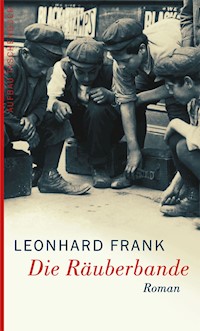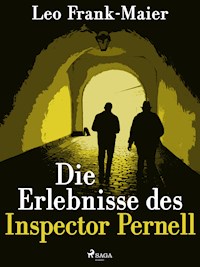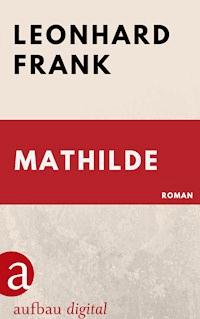4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen, zwei Schicksale: In diesem 1936 erstmals erschienenen Roman erzählt Leonhard Frank die Liebeserlebnisse zweier Frauen. Maria und Eve sind jede für sich in schwierigen Lebenslagen und Beziehungen gefangen. Während die Situation für die eine fatal endet, gelingt der anderen ein Neuanfang mit einem starken Partner an ihrer Seite, mit ihrem "Traumgefährten".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Leonhard Frank
Leonhard Frank wurde am 4. September 1882 in Würzburg geboren. Sein Vater war Schreiner, er selbst ging zu einem Schlosser in die Lehre, arbeitete als Chauffeur, Anstreicher, Klinikdiener. Talentiert, aber mittellos, begann er 1904 ein Kunststudium in München. 1910 zog er nach Berlin, entdeckte seine erzählerische Begabung und verfaßte seinen ersten Roman, »Die Räuberbande«, für den er den Fontane-Preis erhielt. Im Kriegsjahr 1915 mußte er in die Schweiz fliehen: Er hatte Zivilcourage gezeigt und handgreiflich seine pazifistische Gesinnung kundgetan. Hier schrieb er Erzählungen gegen den Krieg, die 1918 unter dem berühmt gewordenen Titel »Der Mensch ist gut« erschienen. Von 1918 bis 1933 lebte er wieder in Berlin, nun schon als bekannter Autor. 1933 mußte er Deutschland erneut verlassen, diesmal für siebzehn Jahre. Die Stationen seines Exils waren die Schweiz, England, Frankreich, Portugal und zuletzt Hollywood und New York. 1952, zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus den USA, veröffentlichte er den autobiographischen Roman »Links wo das Herz ist«. Leonhard Frank, »ein Gentleman, elastisch, mit weißen Haaren, der in seinem langen Leben alles gehabt hat: Hunger, Entbehrung, Erfolg, Geld, Luxus, Frauen, Autos und immer wieder Arbeit« (Fritz Kortner), starb am 18. August 1961 in München.
Informationen zum Buch
Zwei Frauen, zwei Schicksale: In diesem 1936 erstmals erschienenen Roman erzählt Leonhard Frank die Liebeserlebnisse zweier Frauen. Maria und Eve sind jede für sich in schwierigen Lebenslagen und Beziehungen gefangen. Während die Situation für die eine fatal endet, gelingt der anderen ein Neuanfang mit einem straken Partner an ihrer Seite, mit ihrem »Traumgefährten«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Leonhard Frank
Traumgefährten
Roman
Inhaltsübersicht
Über Leonhard Frank
Informationen zum Buch
Newsletter
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Impressum
Zuerst 1936 veröffentlicht
I
Auf einer kleinen Station stieg eine junge Frau aus. Der Schaffner reichte ihr den Koffer hinunter und eine Hutschachtel aus schwarzem Lackleder. Der Zug fuhr sofort weiter.
Sie hatte die telegrafische Mitteilung über den plötzlichen Tod eines Verwandten verspätet erhalten und den Schnellzug nicht mehr erreicht, war die Nacht durch mit Personenzügen gefahren und nach einer viel längeren Reisedauer erst um vier Uhr früh angekommen.
Die zwei noch brennenden Lampen auf dem Bahnsteig, große Milchglaskugeln, hingen fahl in der Morgendämmerung. Dicht über den Wiesen stand der Nebel. Sie blickte suchend über die Gleise hinweg zur dunklen Bahnhofshalle. Kein Mensch. Kein Laut. Das Städtchen schlief.
Den schweren Koffer konnte sie nicht über die Gleise tragen. Sie schlug den schwarzen Mantel enger um sich und blickte auf die Nebelwiese: eine hohe, dünne Gestalt, die leicht auf schlanken Beinen stand.
Sie vernahm ein Geräusch und sah, wie in der Nähe ein Signalarm mit rotem Licht durch einen mit grünem Licht abgelöst wurde. Irgendwo, in einem Wärterhäuschen an der Strecke, mußte also doch noch jemand sein, der diese tote Station betreute.
Der Mann, der von der dunklen Bahnhofshalle aus zugesehen hatte, wie der Zug eingelaufen war, stand jetzt vor einem Plakat für ein Winzerfest und las das rotgedruckte Gedicht, daß der Wein ein Geschenk der Götter sei. Er schrieb mit dem Bleistift ein paar Notenzeichen zu diesem Vers auf das Plakat und summte seine Komposition.
Er wollte gehen, da sah er drüben auf dem Bahnsteig die reglose Gestalt, die mit dem Rücken zu ihm dünn und schwarz gegen die Nebelwiese und den schon heller werdenden Himmel stand. Er schritt aus dem Dunkel heraus, auf die Gestalt zu, die sich erst umwandte, als er das letzte Gleis schon überquert hatte.
Sie sah zwischen dunklen Augen eine scharfe, schmale Nase. Sein unregelmäßig geschwungener Mund, der auch beim Lächeln und beim Sprechen etwas schief blieb, öffnete sich nur wenig. »Hier, jedenfalls, können Sie nicht bleiben.« Er nahm den Koffer, sie die Hutschachtel.
Nach den ersten Schritten, auf dem Wege zum Hotel, wechselte er die Seite und ging rechts von ihr. Woher er das wußte, daß es ihr angenehmer war, wenn ein Mann rechts von ihr ging! Ihr Mann hatte nie etwas Derartiges gefühlt.
Sie spürte ein Rieseln in den Gliedern. Körperliches Verlangen hatte sie bisher nicht gekannt – sie war überrascht und verwirrt und wollte sich innerlich wieder zumachen.
Mit festem Griff umfaßte er ihren Oberarm, drängte sie leicht von der unebenen Straße gegen den Bürgersteig, der asphaltiert war, und ließ den Arm wieder los. Ihr war, als hätte er unterjochend in ihr Gefühl hineingegriffen.
Zunächst versuchte sie nicht mehr, sich zu wehren. Sie sah zu, wie er den Meldezettel ausfüllte, stieg vor ihm die Treppe empor und setzte sich, mit Hut und Mantel, auf das Doppelbett. In sich wußte und fühlte sie, hinter hundert Schutzwänden, den Punkt, bis zu dem er ja doch nicht gelangen würde. Er nicht und leider niemand auf der Welt! Aber seine äußere Erscheinung gefiel ihr.
»Jedenfalls besser als auf dem Bahnsteig, nicht wahr?« Er lehnte an der Wand.
»Aber Sie haben vergessen, für sich ein Zimmer zu nehmen.«
»Das wäre das wenigste. Ich könnte auch wieder gehen.«
Sie fragte lächelnd: »Wer sind Sie eigentlich? Wie heißen Sie?«
»Frimar. Baron Frimar.«
»Sind Sie verheiratet?«
»Meine Frau hat sich das Leben genommen.«
›Seinetwegen!‹ dachte sie sofort und fragte ihn.
Er hob kaum merklich die Schulter. »Selbstmord hat selten nur einen Grund ... Mit meiner zweiten Frau befinde ich mich in Scheidung.«
›Sein Mund ist nicht schön, zu dünn‹, dachte sie. »Und werden Sie noch ein drittes Mal heiraten?«
»Ich besitze nichts mehr.« Ganz ruhig gesagt und wieder mit diesem schmalen Lächeln.
Der deutsche Zweig seiner Familie war verarmt. Frimar hatte viel gelesen und behalten und versuchte sich als Komponist. Begabt war er als Klavierspieler. Die Beziehungen zu den Kreisen, denen er der Geburt nach angehörte, pflegte er sorgsam und aus Neigung.
»Und Sie? Verheiratet?«
Sie nannte den Namen eines millionenreichen Offiziers und Gutsbesitzers. Er hatte ihren Mann vor Jahren flüchtig kennengelernt.
»Ich gebe zur Zeit Klavierunterricht. Drei Mark, manchmal fünf die Stunde!«
›Dennoch ein überlegener Mann? Vielleicht! Er müßte es erst beweisen.‹ Sie puderte Wangen und Nase. Und während sie, das längliche Gesicht verziehend, sich im winzigen Spiegelchen betrachtete: »Waren Ihre Frauen schwierig?«
»Nur die schwierigen sind Frauen und wert, gewählt zu werden.«
»Und dann bringen sie sich um!«
»Wenn das Glück nicht glückt! Und das wieder kann tausend und zehn Gründe haben.«
»Oder auch nur einen, der beim Manne gelegen sein könnte.«
»Natürlich auch denkbar ...! In einer so schlechten Ehe leben Sie?«
Sein schneller Rückschluß gefiel ihr. Sie sah kurz auf und gleich wieder ins Spiegelchen. ›Ihm könnte ich manches sagen von mir. Wenigstens versteht er schnell.‹ Nachdenklich schraubte sie am Lippenstift.
»Lieben Sie Ihren Mann?«
»Nein, ich bin ganz ehrlich, wenn ich ihn auffordere, andere Frauen zu haben«, sagte sie und setzte erklärend hinzu: »Mein Vater war maßlos streng zu mir, und nicht nur streng. Ich wollte endlich fort von zu Hause. Ein schwerer Fehler und eine Versündigung ...! Mein Mann ist Soldat, ein Kriegsheld mit allen Tapferkeitsmedaillen – und vor mir heult er, weil er mich nicht hat. Heult und bettelt! Er tut mir leid. Aber das nützt ihm ja nichts. Im Gegenteil!«
»Sie sind allerdings schwerer zu nehmen als ein Fort ... Heulen müßten Sie. Sie!«
»Das kann nie geschehen.«
»Und auch wenn es Ihnen geschähe, bei einem Mann und in seinen Armen, hätte er sie noch nicht ... Sie müssen nachgiebiger sein beim Nächsten, sonst gelingt Ihnen und ihm die Liebe nicht. Das schafft keiner.«
Er betrachtete ihre Hände, die Stift und Spiegel hielten, die langen, sehr dünnen Finger. Als sie den Stift weglegte, faßte er nach dieser dünnen Hand und spürte, daß sie überraschend hart war. ›Sie lebt mit dem Willen. Nur mit dem Willen! Wer diese Frau einmal weich machen könnte, der hätte sie. Aber wer vermöchte das! Auch wenn sie sich hingibt, gibt sie sich nicht hin.‹ – »Sie sind eine großartige Frau.«
»Das wissen Sie schon jetzt?«
»Und wenn Sie dazu noch den Mut hätten, eine Frau zu sein und nichts als das, wäre auf der Welt nicht leicht eine Ihresgleichen zu finden.«
Sie strich zwischendurch mit dem Stift über die Lippen. »Man soll nicht alles wollen. Wenn man sich auf jemand stützt, wird alles unsicher und gefährdet, auch das, was man vorher war und hatte.«
»Aber das Glück ist nicht zu gewinnen ohne den letzten Einsatz.«
Sein schmales Lächeln machte sie unsicher. ›Zweifellos, der wäre imstand, zu gehen, selbst wenn ich wollte, daß er bliebe.‹ Sie erhob sich und zog den Mantel aus. Da muß sie also ein paar Schritte tun, damit er ihre Gestalt, jetzt ohne Mantel, auch von rückwärts sehen kann.
»Sie sind gewachsen!«
Sie lachte. Es klang zustimmend.
»Aber zu wie eine Faust!«
»Wie könnte eine Frau anders sein! Was würde aus ihr werden! Jeder Mann, auch wenn er glücklich verheiratet ist oder sich gerade bis über den Kopf neu verliebt hat – ausnahmslos jeder will uns haben. Manche erzählen uns stundenlang, daß sie krank sind vor Sehnsucht nach einer bestimmten Frau, ziehen sie aus vor uns, schildern sie und das mit allen Einzelheiten, und zum Schluß wollen sie mit uns schlafen. Dann muß es plötzlich nicht die Ersehnte sein. Alle sind sie so.«
»Das allerdings muß eine Frau wissen und sich danach richten. Wenn sie es erst praktizieren muß, um es zu wissen, ist sie als Frau schon kaputt, bevor sie es gelernt hat.«
»Dann sind wir ja einig ... Und die wirkliche Liebe, auf die ich schon als Zwölfjährige gewartet habe, muß das Allerfurchtbarste sein. Übel wird mir, wenn ich daran nur denke, richtig übel, im Kopf und im Magen. Sicher bricht die ganze mühsam aufgebaute eigene Welt zusammen, wenn man liebt.«
»Und im Vertrauen zum Geliebten baut sie sich dann wieder auf. Aber Sie sprechen da ja von etwas, das Sie noch nicht kennen.« Er ließ eine Pause verstreichen und sagte dann auf ihre gesenkte Stirn hinab: »In der echten Liebe wird die Hingabe zu einer ungeheuren Intimität.«
Ihr Gesicht verwandelte sich, die Härte verschwand, wie weggewischt, sie konnte nicht schnell genug verheimlichen, daß dieses Wort sie stark berührt und einige Schutzwände in ihr durchbrochen hatte. Das war ihr bisher noch nicht geschehen. Ihr war, als hätte sie durch dieses Wort sich selbst erkannt.
Sie saß ganz gerade auf dem Bettrand, Beine und Füße genau geschlossen, sah ihre dünnen Hände an, die ausgestreckt und symmetrisch auf den langen Schenkeln lagen, und lächelte klein – sie fühlte sich von ihm betrachtet. Ihr Haar, flacher, runder Knoten im Nacken, war so schwarz wie ein Steinkohlenstück an der glänzenden, geschieferten Bruchstelle.
Er sah lange nur ihren exakt geschminkten Mund an. Die Oberlippe war klar modelliert, die Unterlippe weich und schmal. »Ein Maskenmund! Man sieht unwillkürlich eine schwarze Halbmaske in Ihr Gesicht hinein, wenn man Ihren Mund erblickt.«
Sie sah nicht auf und rührte sich nicht. Die schmale Unterlippe bewegte sich ein wenig, und das war nicht nur ein Lächeln.
»Und zwei Paar Augen! Du hast zwei Paar Augen – hinter denen, die du zeigst, noch ein Paar, das du nie und niemand zeigst, und mit diesem siehst du die Welt und das Leben. Du bist allein, das kann man sagen.«
›Und die Nase? Gefällt ihm nicht?‹ (Spitze etwas nach oben und zusammen mit den Nasenflügeln fein durchmodelliert und geschliffen und dann erst auf den Nasenrücken sorgsam aufgesetzt.)
Er legte die ganze Handfläche auf ihre Stirn und drückte ihren Kopf in den Nacken, blickte in die dunklen Doppelaugen und wieder lange auf die bebende dünne Unterlippe, bevor er den Mund nahm. Erst Sekunden später gab sie die Hände um seinen Nacken.
»Geh hinunter und laß dir ein zweites Zimmer geben, es ist besser. Wenn möglich nebenan ...! Hoffentlich ist das Wasser im Bad noch warm.« Sie ging hinein und schloß die Tür hinter sich ab.
Kritisch prüfte sie ihr Gesicht im Spiegel – sie war fünfundzwanzig, gelebt hatte sie noch nicht –, verteilte schnell zwei Dutzend Toilettengegenstände an die passenden Plätze, in wenigen Sekunden das fremde Badezimmer in ihr eigenes verwandelnd, und drehte den dicken Warmwasserhahn auf.
Da stand sie wieder vor dem Spiegel, hoch, dünn, fremd in jedem Zuge und als Frau mit sich noch nicht bekannt.
Sie zog sich aus. Die fingerfertigen Hände arbeiteten selbsttätig, der Blick wich dabei nicht vom Spiegel, auch dann nicht, als sie aus dem hinabgesunkenen Kleide herausstieg. Hemd herunter und wieder ein Blick in den Spiegel. ›Es ist in jedem Falle eine ungeheure Intimität‹, dachte sie.
Mit ihrem Körper schien sie ein für allemal zufrieden zu sein, der wurde nicht geprüft, da war alles vollendet: die dünnen, gezogenen Arme und lebendig bewegten Schultern, der zwischen zart geschwungene Hüft- und Beckenlinien delikat hineinmodellierte kleine Leib und die langen Schenkel einer Frau, die seit Jahren täglich viele Stunden im Herrensattel saß. ›Auch das macht hart, innerlich hart‹, hatte sie früher oft gedacht.
»Proportion ist eben alles«, sagte sie trocken, nach einem letzten Blick in den Spiegel. »Aber am meisten liebe ich doch euch, meine zwei zärtlichen Freundinnen. Manchmal seid ihr größer, dann wieder kleiner. Launisch wie Frauen!« Sie legte beide Handflächen an. »Und auch die Konsistenz ist wichtig. Nicht zu fest, nicht zu weich! Sehr wichtig!«
Die dünnen Fingerspitzen beider Hände auf den Wannenrand gestützt, wartete sie, bis die Temperatur richtig war, und holte dann aus dieser Stellung heraus, schön das Gleichgewicht behaltend, indem sie ein Bein nach rückwärts hochsteigen ließ, mit langem Griff die Flasche mit dem grünen Badesalz.
Sie benutzte runde Bürsten, die so hart und auch fast so groß wie Pferdebürsten waren. Obwohl es ihr schon oft geschehen war, hatte sie noch nie darüber nachgedacht, warum ihr nach dem rücksichtslosen Abbürsten die Tränen kamen, wenn sie dann wieder zurückgelehnt in der Wanne lag, die Wange an die Schulterkugel geschmiegt, und auf ihren dünnen Körper hinunterblickte.
Die Lippen waren weich geöffnet, sie wußte nicht, ob der salzige Geschmack vom Badewasser kam oder von den Tränen, die den Mundwinkel erreicht hatten. Sie war doch eine süße Frau! War sie nicht? Ein bißchen muß sie die Beine bewegen.
Als er bei ihr eintrat, erkannte er das Zimmer nicht wieder. Das Deckenlicht war aus, die Nachtlampe mit einem rostroten Seidentuch verhangen, auch über den Spiegeltisch, auf dem die Toilettensachen standen, spielerisch geordnet, hatte sie ein farbiges Tuch gebreitet, das Licht dieser kleinen Tischlampe konnte den grünen Schal kaum durchdringen. In dem Halbdunkel waren nur die Umrisse der alten Möbel zu sehen, die polierten Flächen und Kanten schimmerten. Parfüm hatte sie nicht gespart.
Die Damastpantöffelchen, geschmückt mit rosa Straußenfedern, standen ordentlich nebeneinander auf dem Vorleger. Sie lag schon in dem schweren Bett, die Hände unter dem Kopf, und blickte. Ein Hemd hatte sie wieder an. »Wie bei einer Kokotte sieht’s jetzt hier aus, nicht wahr?«
Aber auch dieses Wort und die ganze Verwandlung des Schlafzimmers nützten nichts – unversehens war er ihr wieder ganz fremd, dieser elegante Herr da mit dem dünnlippigen, schmalen Gesicht. Ein fremder Mann! Und sie lag vor ihm im Bett. Unmöglich! Höchstens komisch! Zu was das Ganze! Er kam ihr vor wie ein Arzt. Aber sie war doch gar nicht krank. Nur zu! Vollständig zu!
Die Turmuhr schlug fünf. Sie zählte mit, beginnend mit dem Daumen – da konnte er sehen, wie ihre dünnen Finger, die einzeln hochschnellten, klar voneinander abgesetzt waren.
»In drei Stunden wird die Totenmesse für meinen Verwandten gelesen, wahrscheinlich in dieser Kirche. Da muß ich hin. Zwei Stunden kann ich noch ruhen. Zweieinviertel!«
Frimar erhob sich sofort und gab ihr die Hand. »Hoffentlich schlafen Sie schnell ein. Das grüne Licht dort drehe ich ab, dann brauchen Sie nicht noch einmal aufzustehen.« Er tat es, ging unter ihrem Blick zur Zwischentür, grüßte zurück, lächelnd, und verschwand in sein Zimmer.
›Der bettelt nicht.‹ Ganz plötzlich war sie nicht mehr zu. Empfindung konnte fließen. Sie hat das bisher nicht gekannt. Da war kein Widerstand mehr und gar kein Druck. Alles strömte. Weil er nicht gebettelt hat? Ging einfach hinaus ... Wenn er jetzt da wäre!
Sie hörte, wie er sich wusch, wie er zu Bett ging. Es war so still, daß sie ihn manchmal atmen hörte. Sie sah die helle Ritze unter der Zwischentür und verlöschte die Nachtlampe, um die Lichtritze deutlicher sehen zu können. Das war schon etwas, diese Lichtritze – allein war sie jetzt nicht mehr. Aufstehen müßte sie und zu ihm hinübergehen. Könnte sie das? O ja, sie möchte sogar. Aber natürlich wird sie es nicht tun. Gewiß nicht!
Sie roch den Duft seiner Zigarette, der durch die Tür drang. Wenn sie den Kopf ein wenig wegdrehte, roch sie wieder nur das Parfüm. Jedenfalls war er anders als alle, die sie bisher im Leben gesehen hat, und verglichen mit ihrem Manne war er die Erlösung. Sie wünschte, daß ihr Verlangen Liebe wäre.
Wie an seiner Stelle ihr Mann sie gequält und schließlich brutalisiert haben würde! Und dann wieder neue schweinische Witze, die er im Kasino gehört hat! Dagegen war diese Lichtritze dort unten das Edelste auf der Welt. Süß war sie. Er raucht also. (Die Beine hoben sich von selbst aus dem Bett. Erst als ihre Füße die Pantöffelchen im Dunkeln gefunden hatten, wurde es ihr bewußt, daß sie aufgestanden war, um zu ihm zu gehen.) Natürlich tut sie’s!
»Darf ich?« Sie stand in seinem Zimmer – ein überaus nüchternes Hotelzimmer, modern möbliert und grell beleuchtet.
Mit spontaner Höflichkeit, wie im Salon, machte er eiligst Platz für sie, rückte zur Wand und blickte nur.
Sie huschelte sich an ihn hin, enger an ihn hin, Scheitel unter seinem Kinn. »Da habe ich drüben alles hergerichtet, und jetzt liege ich hier.«
Sie zog das Hemd aus. »Das stört nur.« Sie saß dabei aufrecht und mußte nun doch ein bißchen zu ihm hinunterlächeln, um das Schamgefühl zu überspielen. Er blickte und empfing sie in die Arme.
Die Turmuhr schlug sechs, schlug wieder und schlug acht.
»Jetzt wird die Totenmesse gelesen«, sagte sie und bot ihm verzaubert den Mund.
Er stützte sich auf und erklärte ihr die Totenkulte fremder Volksstämme – wie verschieden voneinander und wie merkwürdig für den Europäer sie alle seien. Er hielt einen richtigen Vortrag.
Sie ließ die Lider flattern, sie lächelte heimlich über ihren gebildeten Geliebten und beobachtete nur, wie seine Rippen mit dem Atem gingen. Wenn er Luft schöpfte, um von neuem beginnen zu können, traten die Rippen stärker hervor, sie gab ihre Lippen leicht an sie hin, und er bemerkte es gar nicht.
Da mußte sie nun endlich doch ihre Brüste mit seinen atmenden Rippen weich verschwistern und den gescheiten Mund dort oben reden lassen.
Das kleine nachsichtige Lächeln zierte noch ihre Lippen, als sie schon schlief und in den Schlaf hinein ihn fernher sprechen hörte von dem Totenkulte des fremden Volksstammes, dessen Häuptling ihr Mann war, sitzend bei seinen Kameraden im Offizierskasino an der langen Tafel. Darauf stand in der Mitte ein hoher Silberpokal, und darüber hing eine ihrer rosaseidenen Kombinationen. Das war peinlich.
Auf eine Stunde, am Nachmittag, mußte sie ins Trauerhaus. Dieses Alibi brauche sie.
Nachdem sie von der Beisetzung zurückgekommen war, verließen sie das Hotel nicht mehr. Tagsüber blieben die Fensterläden geschlossen. In den Nächten, warmen Sommernächten, wenn alle schliefen und kein Laut mehr zu hören war, durften die Sterne hereinsehen.
Am fünften Morgen trennten sie sich. Eve fuhr allein zurück.
Erst im Zuge kam sie zur Besinnung. Sie sah den jungen Herrn an, der lesend ihr gegenübersaß, das braungebrannte, sympathische Gesicht, und fragte sich: ›Da ich es mit Frimar tun konnte, ohne ihn zu lieben, warum nicht auch mit dem?‹ Wieder wünschte sie sehnlich, daß ihre Neigung für Frimar das große Gefühl wäre, das sie sich als junges Mädchen und schon als Kind unter Liebe vorgestellt hatte, ohne ein Objekt dafür gekannt zu haben. Aber als es ihr gelang, auf ein paar Sekunden ihre Vorstellung von verklärter Liebe mit Frimars Person zu verbinden, schauderte sie zurück vor der körperlichen Hingabe an ihn, durch die das große Gefühl beschmutzt und zerstört worden wäre.
Sie konnte vor Schläfrigkeit jetzt nicht über den Zwiespalt nachdenken, warum diese Liebe das eine und körperliche Hingabe das andere für sie war. Sie nickte ein und träumte, ihr Oberkörper und ihr Kopf seien eine von Blüten prangende Pflanze, die ganz und gar unbeteiligt blieb an dem Verlangen nach Frimar, dem sie sich überließ, obwohl aus der Herzgegend ein Warnruf kam, der wie Schluchzen klang.
II
Ställe, Scheunen, das niedrige Kraftwerk und die Molkerei bildeten ein riesiges Hufeisen, dessen Schenkel – zwei Parallelalleen gestutzter Akazien – an der Rückseite des dreigliederigen Barockschlosses endeten.
Die Vorderfront stand gegen den Park, der sich bis zu den handhohen Wäldern am Horizont fortzusetzen schien. Von der oberen Terrasse aus waren an klaren Tagen die Kirchtürme der Landeshauptstadt zu sehen, blau in blauer Ferne.
Bei einem Rundgang durch das Gebäude hatte Eve kürzlich noch zwei Zimmer entdeckt, die bis dahin niemand bekannt gewesen waren. In diesem großen Hause wohnte sie seit einem Jahr mit ihrem Manne und dessen sechzehnjähriger Nichte, die durch einen Unglücksfall beide Eltern verloren hatte.
Von den Leuten auf dem Gute interessierte sie sich nur für den Stallmeister, der täglich mit ihr ausritt. Er sprach nie mit ihr. Was tat der schweigsame, glatzköpfige kleine Ungar hier auf diesem Schloß in Deutschland? Und sie? In welche Art Leben gehörte sie?
Vor der Ehe hatte Eve, die streng erzogene Tochter vermögender Eltern, als freiwillige Pflegerin im Armenspital viel Unglück gesehen, nach der Verheiratung auf Bällen Aufsehen erregt durch Toiletten, wie sie nach Ansicht der Leute nur in Paris getragen werden durften, und als Schulmädchen war sie lange Zeit von dem Wunsche erfüllt gewesen, Magd zu sein bei einem jungen Bauern. Der Bauer ist immer hinter seiner frischen Frau her, und sie, Eve, liebt den Bauern. Aber er weiß es nicht. Sie tut alles für den verliebten Bauern, der nicht ahnt, daß seine Magd ihn demütig und hoffnungslos liebt.
Der Rittmeister holte Eve von der Bahn ab. Zur Begrüßung klopfte er seiner Frau hinten drauf.
›Ja, klopf du nur, klopf du nur‹, dachte sie und stieg in den Wagen.
»Du siehst aber glänzend aus.«
Das fand sie auch, und ein prickelndes Gefühl befriedigter Rache belebte sie außerdem. ›Weil er nicht bettelte, konnte ich plötzlich zu ihm hinüber, ja zu ihm ins Bett, und sie mit ihm haben – diese »ungeheure Intimität«.‹
»Fährt zu einer Beerdigung und kommt zurück wie aus einem Kurort.« Die Gelegenheit schien dem Rittmeister günstig zu sein. Bewundernd sagte er: »Wenn Doktor Moll dich so sieht, erlaubt er es jetzt vielleicht, daß du ein Kind bekommst.«
Der Rittmeister war ein bekannter Rennreiter gewesen und erst als Fünfunddreißigjähriger, dann aber fast übergangslos, zu schwer geworden für diesen Sport. Den Rennstall hielt er weiter. Er hatte einen sehr starken, roten Hals, großporig wie Gänsehaut. Den betrachtete jeder zuerst. Das Gesicht dann noch anzusehen, war kaum nötig, um zu wissen, wie der Rittmeister aussah – ebenso wie ein Mann mit diesem starken, roten, großporigen Hals aussehen mußte.
Die Meinung der anderen über das Leben und über das, was der Mensch tun darf und nicht tun darf, war auch seine Meinung. Von sich selbst hielt er nicht viel. Seine Kameraden wußten, daß sie zu ihm kommen konnten, wenn sie in Schwierigkeiten gerieten, und die Leute auf dem Gute mochten ihn. Um Eve hatte er sich beworben, weil sie alles besaß, was ihm fehlte. Er kämpfte hartnäckig weiter um die Unerreichbare, als brauchte er diesen quälenden Stachel. Wenn er ihr zur Begrüßung hinten draufklopfte, war auch das bei ihm nur hilflose Werbung, denn die Angstfrage, ob er wieder etwas falsch gemacht habe, entstand dabei sofort in seinem Blick. Da hielt er sie dann zwischendurch auch einmal für eine bösartige Natter, mit Ansprüchen, die eben keiner erfüllen könne.
Seine Geliebten hatte er während der Ehe schon mehrmals gewechselt und immer nebenher auch leichtere Mädchen nach Bedarf genommen.
Der Tee wurde auf der unteren Terrasse gereicht. Auch Maria, die Nichte des Rittmeisters, erschien, wie immer in ihrer wesenlosen Art, als wäre sie mit Seele und Leib noch im Parke. Sie war dünn und so schwarzhaarig wie Eve. Aber sie hatte tiefblaue Augen und ein Elfenbeingesicht von formal untadeliger Schönheit.
Da saß er zwischen den zwei weiblichen Wesen, die aussahen wie zwei fremde Blüten am selben Stengel, und versuchte erst gar nicht, Zugang zu ihnen zu finden. Denn auch die dünne Sechzehnjährige lebte ihr eigenes Leben. Maria liebte auf der Welt nur Eve, ohne es jemals auch nur durch einen Blick geäußert zu haben. Seit sie hier war, verbrachte sie ihre Tage in der Gärtnerei, sie fühlte sich angezogen von gewissen im Treibhause gezüchteten Blumen, die ihr zugleich Grauen erregten. Nachts träumte sie von diesen Blumen, drückte sie ans Herz wie das Gesicht eines Geliebten und hatte dabei Empfindungen, die sie im wachen Zustande noch nicht kannte.
Sie schien Eve in noch unerkennbarer, aber unheilvoller Weise gefährdet zu sein. Nicht vorstellbar, daß dieses immer wie in einen Traum entrückte und dabei seelisch schon viel zu weit entwickelte Mädchen einstens dem Leben standhalten werde.
Der Rittmeister aß viele belegte Brote zum Tee – es war schon ganz gleich, da war ja doch nichts mehr zu retten. Auch Eve, die in den fünf Tagen fast nichts genossen hatte, aß mit Appetit, zur Freude ihres Mannes, da sie damit endlich einmal etwas tat, was auch er tat, und dadurch näher bei ihm zu sein schien.
Maria, die unaufgefordert selten sprach und dann fast immer etwas sagte, das den Onkel verblüffte, sah hinunter auf die gepflegten Rasenflächen und Blumenbosketts und erklärte streng: »Hier sollte ein Nachtfest sein. Alle Damen haben weiße Kleider an, und da die Herren ganz schwarz angezogen sind, sieht man nur die Damen.«
»Warum soll man denn die Herren nicht sehen?«
»Nein, Onkel, die Herren dürfen nicht zu sehen sein, sie sollen nicht da sein und doch da sein.«
Der Rittmeister sagte nur noch: »Verrückt!« Und ging.
Sie hatten ein gemeinsames Schlafzimmer. So ein besonders schönes französisches Bett auf einem Absatz, zu dem eine Stufe hinaufführte – viele Kissen auf der Stufe –, hatte Eve sich als Braut gewünscht. Es war nicht nötig gewesen, eines zu kaufen, im Schlosse standen nur erlesene Möbel aus der Zeit.
Das Schlafzimmer sah genauso aus, wie sie sich es gedacht hatte – kein Deckenlicht, mattes Gelb die Wände und die Seidenvorhänge an den hohen Fenstern, viele Kissen auf der Stufe und das schönste niedrige Bett. Aber der Rittmeister hatte hartnäckig darauf bestanden, weiter bei ihr in diesem Zimmer und in diesem Bett zu schlafen.
Er lag schon und wartete. In diesem Schlafzimmer hatte es furchtbare Szenen gegeben. An die dachte er jetzt nicht. Sie war ja fünf Tage verreist gewesen – das Wunder konnte geschehen sein. Sie kommt aus dem Badezimmer, legt sich neben ihn, nimmt seine Hand und blickt ihn an, stumm und zärtlich. Ganz sanft wird er sein. Oder will sie vielleicht gerade das Gegenteil? Daß er einfach zugreift, liebevoll zwar, aber eben doch herzhaft wie ein Mann? Leider weiß er auch jetzt noch nicht, trotz seiner großen Erfahrung mit anderen Frauen, wie Eve darin ist. Er hat ja alles versucht, manchmal brutal, manchmal mit zärtlichen Bitten, ja sogar mit Tränen. Aber nichts war das Richtige gewesen.
Als sie eintrat, im Schlafrock, sah sie schon an seinem Blick, wie er heute beginnen würde. Da zog sie sogar noch den brutalen Anfang vor. Dann brauchte er ihr nicht leid zu tun, sie begegnete ihm abweisend, und nach einigen Minuten jagten sein Angriff und ihr Zorn sie zurück ins Badezimmer, wo sie die Nacht auf dem Ruhebett verbringen konnte. Viel schlimmer war es, wenn dieser Riesenkerl umflorte Bettelaugen bekam wie der alte Ortsarme vor der Dorfkirche, und es dauerte dann auch meistens viel länger.
Es war auch in den ersten Wochen nach der Hochzeit noch einige Male vorgekommen, daß sie nachgegeben hatte, aus Mitleid und auch, um nicht immer unnahbar hier im Hause umherzustehen wie eine Lilie, die gebrochen werden soll. Diese edle Trauergeste widerstrebte ihrer im Grunde einfachen und eher resoluten Natürlichkeit. Und gehabt hat er sie ja doch nie, nichts von ihr, nicht einmal ihren Körper. Immer und unwillkürlich hatte Eve sich ihren Körper dabei tot und aufgebahrt vorgestellt. Er hatte eine Leiche umarmt.
Aber jetzt war auch das nicht mehr möglich, jetzt war ja alles anders und nichts mehr möglich.
Sie legte sich neben ihn, den Schlafrock hatte sie anbehalten. Ganz und gar anders! Mitleid kann sie jetzt zu nichts mehr bewegen.
Sie wandte sich ihm zu und blickte ihn an, freundlich lächelnd und dennoch tausend Kilometer entfernt, und sah sofort, daß er ihr Lächeln mißverstand. ›Schon hängen die Willkommenkränze, und die Blechmusikkapelle seines Herzens spielt!‹
»Nein, nein! Ach, laß mich doch!« Unwillig wandte sie sich ab von ihm und legte sich zum Schlafen zurecht.
»Was ist denn los?«
Sie sagte nach der anderen Seite, so, wie sie lag: »Ich will keine Auseinandersetzung. Hörst du! Wenn du mich nicht in Ruhe läßt, fahre ich in die Stadt und übernachte im Hotel. Aber lieber möchte ich hier schlafen, ich bin müde.«
Er vernahm und spürte den neuen Ton und fragte erstaunt: »Was ist denn geschehen mit dir ...? Ist etwas geschehen?«
»Gar nichts!« Aber daß er etwas fühlte, war versöhnend.
Minutenlang hörte sie nichts, nicht einmal seinen Atem. Dabei wußte sie, daß er hinter ihrem Rücken aufrecht im Bette saß. Dann sah sie zwischen den Wimpern durch, daß er das tat, was sonst immer sie hatte tun müssen – mit seiner Decke ins Badezimmer ging, um die Nacht auf dem Ruhebett zu verbringen.
Ein unerwarteter, ein Riesenerfolg! Und wem hat sie den zu verdanken! In Frimars Armen schlief sie ein, eng an ihn hingeschmiegt, den Scheitel unter seinem Kinn.
Aber am Morgen fand das Stubenmädchen den Schlafanzug des Herrn zerfetzt im Doppelbett. Einige Knopflöcher waren ausgerissen. Die Knöpfe fand sie auch im Bett. Eine Nachttischlampe lag zertrümmert auf dem Teppich. Die gnädige Frau schlief auf dem Ruhebett im Badezimmer, und der Herr war in die Stadt gefahren.
Er kam eine Woche nicht zurück.