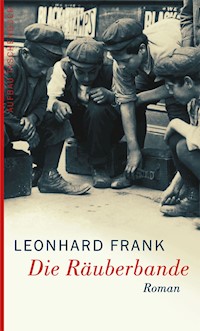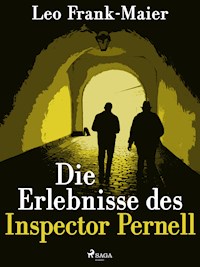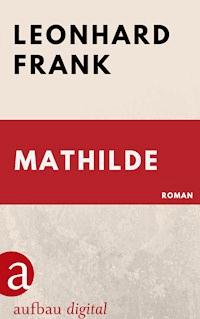9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Leonhard Franks Biographie ist voller Höhen und Tiefen, auf die Entfaltung schöpferischer Produktivität folgen Phasen des Scheiterns und Misslingens. Ob in der Münchner Kunstboheme oder der Weltstadt Berlin, ob in Zürich als Zuflucht des verfolgten Pazifisten oder in Hollywood als letztem Ort des Ausgebürgerten, immer strebt Leonhard Frank alias Michael Vierkant nach künstlerischem Selbstausdruck und politischem Engagement, ersehnt Liebe und Erfolg, erleidet Niederlagen und Zurückweisungen.
Der Roman vermittelt ein anschauliches Bild vom Denken und Empfinden des Autors wie von den Antrieben seines literarischen Schaffens. Leonhard Frank (1882-1961), der bedeutende deutsche Erzähler und Romancier, hat mit der romanhaften Autobiographie "Links wo das Herz ist" die Geschichte seines abenteuerlichen Lebens vor dem Hintergrund der alles verändernden Zeitereignisse geschrieben. In einer meisterhaften Mischung aus Pointiertheit und Überschwang gestaltet er die Schicksale seines Doubles Michael Vierkant. Dieser Lebensbericht gehört zu den bleibenden literarischen Selbstzeugnissen und ist eines der großen Bekenntnisbücher des Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Leonhard Frank
Links wo das Herz ist
Roman
Impressum
Mit einem Nachwort von Armin Strohmeyr
ISBN 978-3-8412-0793-7
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Februar 2014
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Bei Aufbau erstmals 1955 erschienen; Aufbau ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Preuße & Hülpüsch Grafik
Design unter Verwendung eines Fotos aus dem Schiller-Nationalmuseum – Deutsches Literaturarchiv Leonhard Frank mit Lucie Mannheim (l.) und Käthe Dorsch
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Nachwort
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Meiner Frau
Charlotte
gewidmet
I
Michael war das Sorgen vermehrende unerwünschte vierte Kind gewesen. Sein Vater, ein Schreinergeselle, der Parkettböden legte und glatthobelte – zehn Stunden im Tag auf den Knien, die Stirn nahe dem Boden, den er hobelte, hartes Buchenholz –, verdiente achtzehn Mark in der Woche. Am Eßtisch gab es große Augen und kleine Bissen. Acht Monate im Jahr liefen die vier Kinder, zwei Buben und zwei Mädchen, keine Schuhsohlen durch. Aber im Winter, wenn Schnee lag und der Main zugefroren war, konnten sie nicht mehr barfüßig in die Schule gehen.
Daß die Mutter es vollbrachte, Geld für Holz und Kohlen abzuzwacken, dem schwer arbeitenden Vater jeden Morgen Vespergeld mitzugeben, Schuhe und Winterkleider für zwei Erwachsene und vier Kinder beizuschaffen und dennoch die Miete zu bezahlen und täglich zweimal Essen für sechs auf den Tisch zu stellen, alles von achtzehn Mark in der Woche, war ein Wunder, vergleichbar mit dem des Wundertäters Jesus, der mit fünf Broten und zwei Fischen fünftausend Hungrige speiste.
Eine nicht vorauszuberechnende und unvermeidliche Geldausgabe hatte diese schlaue, kampfgewohnte und siegreiche Mutter, die aus Resten, die von anderen in den Müllkübel geworfen werden, ein schmackhaftes Essen machte und aus Lumpen etwas, das kleidsam war, während der ganzen Kindheit Michaels nicht wieder einzusparen vermocht. Er war an Diphtheritis erkrankt, und sie hatte, um den Doktor und die Medizin bezahlen zu können, den Sonntagsanzug des Vaters im Leihhaus für fünf Mark versetzt, an einem Mittwoch, und ihn am Samstag mit fünf Mark von des Vaters Wochenlohn wieder ausgelöst. Infolgedessen waren am nächsten Mittwoch kein Pfennig und kein Bissen Brot mehr im Haus gewesen. Sie hatte den Sonntagsanzug wieder versetzt. Und so war es weitergegangen, diese fünf Mark hatte die Mutter trotz ihrer Schwarzkunst nie wieder einzusparen vermocht. Jeden Mittwoch war kein Brot mehr im Haus gewesen – Jahre und Jahre hindurch den Anzug ins Pfandhaus und Samstag wieder heraus und am Mittwoch kein Brot im Haus. Der Längsbalken des Kreuzes, das die tapfere Mutter während ihres ganzen Lebens auf dem Rücken schleppte, war lang.
Aber für Michael gab es in den Jahren, bevor er in die Schule kam, trotz allem auch Minuten reinen Glücks. Die Mutter kommt mit dem großen Henkelkorb voll Kartoffeln und Gemüse vom Markt zurück. Er fragt erwartungsvoll gespannt nur mit den Augen, und sie schüttelt betrübt den Kopf. ›Nichts! Dazu hat’s nicht gereicht!‹ Der Fünfjährige kann die Hoffnung nicht aufgeben, er sucht mit der Hand in den Bohnen und Kartoffeln, den Blick über den Marktkorb hinweg ins Hoffnungsland gerichtet, findet plötzlich die fünf Zwetschgen, eingewickelt in ein Salatblatt, und sie lacht Tränen, weil es ihr gelungen ist, ihn so zu überraschen, daß seine Augen noch größer werden und die Lippen sich öffnen.
Michaels Mutter, eine schöne Frau, dünn, mit großen Feueraugen, liebte ihren Mann und war ihm so himmelhoch überlegen, daß er es in seinem ganzen Leben niemals bemerkte.
Die große Not, herzabdrückend und die Seele verwundend, begann für Michael erst in der Schule.
Der Schlag ins Gesicht, dem ein viele Sekunden währender Wutblick des Lehrers in die Augen des hypnotisierten Schülers voranging, und die mit vollster Wucht verabreichten Hiebe mit dem Rohrstock, daß Fingerspitzen und Handballen blau anliefen, auf den Hintern, daß die Striemen schwollen, rot-violett und dick wie Würmer, waren nicht das Ärgste, das der Volksschullehrer Dürr seinen vierzig Prügelknaben zufügte. Das Ärgste war die Angst. Seine Erziehungsmethode war, die Knaben in Angstbesessene zu verwandeln. Das Schulzimmer war mit Angst geheizt. Angst war nachts der Trauminhalt seiner Schüler. Frühere Schüler fuhren seinetwegen noch als verheiratete Männer aus Angstträumen hoch und wichen auf der Straße zur Seite, wenn er unverhofft ihres Weges kam.
Auch während des Religionsunterrichts, wenn Adam und Eva im Paradies und das ewige Himmelreich das Thema war, ging er, fanatisch lächelnd in Erwartung der falschen Antwort, wie ein Tierbändiger hin und her, in der Hand den Rohrstock, als hätte er nicht vierzig Kinder für den Weg ins Leben vorzubereiten, sondern vierzig Bestien zu dressieren. Er benutzte seine überwältigende Autorität dazu, die Persönlichkeit des Schülers auszurotten, und beging den Seelenmord gründlich. Nach kurzer Zeit bestand die Mehrzahl aus Kreaturen mit allen Eigenschaften des Untertanen, fertiges Material für die nächste Autorität, den Feldwebel im Kasernenhof, und die Empfindsameren trugen den Stempel des Irrenhauskandidaten auf der Stirn.
Sein Lächeln war besonders gefürchtet. Wenn er morgens, bei Schulbeginn, »Kopfrechnen!« gerufen hatte, lächelte er vom Katheder aus zuerst eine Weile hinab in die Totenstille, bis die vierzig Knaben vor Angst gehirntaub waren und die sinnverwirrende Furcht, aufgerufen zu werden, selbst einen zehnjährigen Immanuel Kant unfähig gemacht haben würde, auszurechnen, daß acht mal sieben sechsundfünfzig ist.
Michael, ein empfindsamer Knabe, der vor der Schulzeit fließend gesprochen und unter dem Hammer des Lehrers plötzlich gestottert hatte, ein Leiden, das er erst nach Jahrzehnten wieder überwand, wurde nicht mehr aufgerufen, da er so dumm sei, daß nichts von ihm kommen könne und sowieso nie im Leben etwas aus ihm würde. Der Lehrer hatte den Stotterer in die letzte Bank gesetzt, ihn allein. Nur zur Belustigung der Klasse rief er ihn noch manchmal auf, und sie durften zusammen mit dem Lehrer über Michael lachen, wenn er seine falsche Antwort stotternd herauspreßte.
Als Michael nach sieben Jahren die Schule verließ, war er ein schwerverwundeter Junge, der nur deshalb nicht Selbstmord beging, weil er im Gefühl noch nicht wußte, daß der Mensch, wenn er nicht mehr weiterkann, Selbstmord begeht. Unbewußt unternahm er mehrere Selbstmordversuche. Seine Überzeugung, daß er zu nichts fähig und von allen der Dümmste sei, wich hin und wieder plötzlichen Anfällen ungezügelter Wildheit. In diesem Zustand raste er, um sich und seinen Freunden von der Straße zu beweisen, daß er zu allem fähig sei, auf dem schmalen Steingeländer im Galopp über die Mainbrücke, haushoch über dem Wasserspiegel im Wettlauf mit dem Tod, oder kletterte von Mauervorsprung zu Mauervorsprung zwanzig Meter außen am Kirchturm empor. Zweimal wurde Michael, der nicht schwimmen konnte und seinen Freunden hatte beweisen wollen, daß er unter einem Floß durchschwimmen könne, der Mutter bewußtlos ins Haus gebracht, also schon tot.
Erst als er siebzehn war und seine Lehrzeit bei einem Schlossermeister schon hinter sich hatte, endeten die unbewußten Selbstmordversuche. In dieser Zeit entstand die Sehnsucht nach etwas, dem er keinen Inhalt geben konnte. Er sehnte sich danach, »etwas« zu werden, und wußte nicht, was. Ein Doktor oder Rechtsanwalt könne er selbstverständlich nicht werden, er, der allein in der letzten Bank gesessen hat. Er fragte fortgesetzt ins Nichts, zerquält von ziellos unbestimmter Sehnsucht, und fand die Antwort nicht. Sein Zustand war der einer jungen Pflanze, die mit einer so dicken Schicht Asche bedeckt wurde, daß sie nicht durchwachsen kann. Jahre hindurch grübelte er am Schraubstock immer wieder und wieder darüber nach, was er werden könnte, und erreichte damit nur, daß er ein schlechter Schlosser wurde. Der Druck unter dem Brustbein wich nicht.
An einem Sonntagnachmittag zeichnete Michael vor dem Spiegel auf ein Blatt Papier sein linkes Auge, in natürlicher Größe, und darüber die Braue, jedes Härchen, jede Wimper. Das linke Auge, mit äußerster Genauigkeit gezeichnet, wie der Hase von Albrecht Dürer, nur nicht so gut, blickte ihn an. Noch ahnungslos, was sich ereignen würde, begann er, auch das rechte Auge zu zeichnen, zufällig in der richtigen Entfernung vom linken. Erst als das zweite Auge fertig war, fragte er sich: ›Und warum eigentlich jetzt nicht auch die Nase dazwischen und darunter den Mund?‹
Nach zehn Stunden starrte Michael, der anfangs nur ein Auge hatte zeichnen wollen, sein Selbstporträt an, plötzlich glühend in unbegreiflicher Begeisterung, als der Gedanke einschlug, daß er vielleicht Kunstmaler werden könnte. Die innere Befreiung riß ihn in die Wolken.
Den folgenden Samstagabend räumte Michael wie gewöhnlich seine Werkbank auf, wischte mit einem Klumpen alter Putzwolle die Feilspäne herunter, auch vom Schraubstock, an dem er Jahre hindurch vergebens darüber nachgegrübelt hatte, was er werden könnte, und sagte zu seinem Meister, daß er am Montag nicht mehr komme. Auf die Frage des erstaunten Meisters nach dem Grund antwortete er nur, er müsse fort aus Würzburg. Die Begründung leuchtete dem Meister nicht ein. Da er aber seit jeher der Meinung gewesen war, daß Michael eigensinniger sei als der bockigste Esel, versuchte er nicht, ihn zu halten.
Am Montag nahm Michael Abschied. Die Mutter weinte. Unschlüssig, in welche Richtung er wandern solle, stand er vor dem Haus auf der Straße und fragte sich, wo er besser Kunstmaler werden könne – flußaufwärts oder flußabwärts, und da gerade ein Fuhrmann, der seinen Gaul am Zügel in die Schmiede führte, vorüberging, flußaufwärts, ging auch er flußaufwärts.
Michael hatte die Absicht, bei einem Zimmermaler als Anstreicher zu arbeiten, da die Anstreicher in den Wintermonaten keine Arbeit haben und dafür in den Sommermonaten besser bezahlt werden. Im Winter wollte er mit dem ersparten Geld Kunstmaler werden. Er war dreiundzwanzig.
Das neu erbaute Schlachthäuschen von Rothenburg ob der Tauber stand zwei Kilometer vom Städtchen entfernt inmitten blumenübersäter Wiesen auf einem Grundstück, das von einem Lattenzaun umgeben und beträchtlich größer war als die Höfe sämtlicher Schlachthäuser Chikagos.
Den Zaun, der ein unübersehbar großes Oval bildete und aus mehr als fünfhunderttausend Latten bestand, sollte Michael zweimal mit Ölfarbe streichen, zweimal von außen herum, zweimal von innen.
Nur mit einem guten Fernglas hätte jemand vom südlichen Bogen des Zaun-Ovales aus das Figürchen zu sehen vermocht, das am nördlichen Bogen Streichbewegungen machte, auf und ab, auf und ab.
Beständig nichts als Latten vor den Augen, von früh sechs bis abends sechs, hatte Michael im Laufe der drei schönen Sommermonate des Jahres 1905 schließlich und endlich den Lattenzaun einmal gestrichen, einmal von außen herum, einmal von innen herum. Er hatte auch nachts im Schlaf und Traum Latten gestrichen. Es gab nur noch Latten und Zwischenräume zwischen Latten.
Als er am Montagmorgen um sechs Uhr wieder vor dem Zaun erschien, um den zweiten Anstrich zu beginnen, starrte er voller Grauen auf die grasgrün gestrichenen Latten und durch die Zwischenräume auf die gegenüberstehende ferne Lattenreihe, bei der er erst nach Monaten angelangt sein würde. Er konnte nicht beginnen. Er zog sein Skizzenbuch heraus und zeichnete den Büschel Löwenzahn, der am Rande der Wiese blühte. Er zeichnete jeden Zacken der gezackten Blätter und mit größter Sorgfalt jedes Blättchen der schwellenden trompetengelben Blüten.
»Wenn so etwas noch einmal vorkommt, können Sie zum Teufel gehen«, sagte der Meister, der lautlos hinter Michael getreten war und schon eine Weile seinen zeichnenden Anstreicher erzürnt beobachtet hatte.
Michael sagte sich, als der Meister gegangen war, für seine Kunst müsse der Künstler jedes Opfer bringen. Aber das Opfer dürfe nicht so groß sein, daß der Künstler dabei draufgehe und blödsinnig werde. Er stieß den Pinsel zurück in den Topf, daß die Farbe hochspritzte, und ging quer über die Wiesen davon, diesmal flußabwärts.
Nachdem Michael in Frankfurt am Main zusammen mit vier Kollegen im Laufe eines Monats die eiserne Flußbrücke mit stahlgrauer Ölfarbe gestrichen hatte, fuhr er nach München, im Brustbeutel die ersparten sechzig Mark, mehr als genug, um Kunstmaler zu werden, und zweifellos der berühmteste von allen.
II
Das Bohemecafé Stefanie bestand aus einem Nebenraum, an dessen Fenstertischen Münchener Berühmtheiten jeden Nachmittag Schach spielten vor zuschauenden Straßenpassanten, und dem größeren Hauptraum mit einem glühenden Kohlenofen, versessenen, stark nach Moder riechenden Polsterbänken, roter Plüsch, und dem Kellner Arthur, der in ein zerschlissenes Büchlein, notdürftig zusammengehalten von einem Gummiband, die Pfennigsummen notierte, die seine Gäste ihm schuldig blieben. Der überfüllte Hauptraum hatte seinen eigenen warmen Geruch, eine spezielle Mischung aus Kaffee- und dumpfem Moderduft und dickstem Zigarettenrauch. Wer hier eintrat, war daheim.
Irgendwo im Haus oder im Himmel mußte ein Elektrizitätswerk sein. Die Gäste, angeschlossen an den Starkstrom, zuckten unter elektrischen Schlägen gestikulierend nach links und nach rechts und vor und von den Polsterbänken hoch, fielen ermattet zurück und schnellten mitten im Satz wieder hoch, die Augen aufgerissen im Kampf der Meinungen über Kunst. Hier und dort saß ein Jüngling, reglos grübelnd über das täglich wiederkehrende Problem, wie er Arthur diesmal überzeugen solle, daß er seine Zeche morgen ganz bestimmt bezahlen werde.
Im Café Stefanie gab es Kreise. Der Magnet eines Kreises war Johannes Wohl, ein innerlich wohlig ausgeglichener Oscar Wilde mit blauen Plüschaugen, der immer einen Strichjungen und einen Band Stefan George bei sich hatte und um seiner kantenlos warmen Liebenswürdigkeit und weichen Schönheit willen von wohlhabenden älteren Damen verehrt und hin und wieder auch gepflegt wurde, wenn er es sich gönnte, ein wenig krank zu sein und schön im Bett zu sitzen. Er war eine pfenniglose Lilie auf dem Felde, die nicht säte und dennoch erntete und gerne gut aß.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!