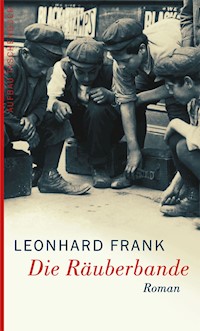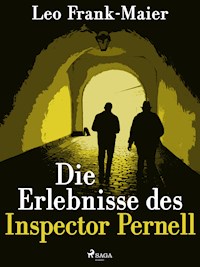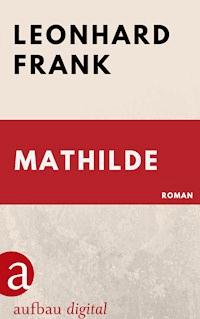4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leonhard Frank erzählt die Geschichte der verbotenen Liebe zwischen Lydia und Konstantin, die zunächst nicht wissen, dass sie Bruder und Schwester sind. Damit lotet der Schrftsteller einmal mehr die Beständigkeit gesellschaftlicher Konventionen aus. Der Roman wurde bei Erscheinen 1929 viel diskutiert und von Heinrich Mann hochgelobt. »›Bruder und Schwester‹ ist die glücklich endende Geschichte einer inzestuösen Liebe.« Main Post
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Leonhard Frank
Leonhard Frank wurde am 4. September 1882 in Würzburg geboren. Sein Vater war Schreiner, er selbst ging zu einem Schlosser in die Lehre, arbeitete als Chauffeur, Anstreicher, Klinikdiener. Talentiert, aber mittellos, begann er 1904 ein Kunststudium in München. 1910 zog er nach Berlin, entdeckte seine erzählerische Begabung und verfaßte seinen ersten Roman, »Die Räuberbande«, für den er den Fontane-Preis erhielt. Im Kriegsjahr 1915 mußte er in die Schweiz fliehen: Er hatte Zivilcourage gezeigt und handgreiflich seine pazifistische Gesinnung kundgetan. Hier schrieb er Erzählungen gegen den Krieg, die 1918 unter dem berühmt gewordenen Titel »Der Mensch ist gut« erschienen. Von 1918 bis 1933 lebte er wieder in Berlin, nun schon als bekannter Autor. 1933 mußte er Deutschland erneut verlassen, diesmal für siebzehn Jahre. Die Stationen seines Exils waren die Schweiz, England, Frankreich, Portugal und zuletzt Hollywood und New York. 1952, zwei Jahre nach seiner Rückkehr aus den USA, veröffentlichte er den autobiographischen Roman »Links wo das Herz ist«. Leonhard Frank, »ein Gentleman, elastisch, mit weißen Haaren, der in seinem langen Leben alles gehabt hat: Hunger, Entbehrung, Erfolg, Geld, Luxus, Frauen, Autos und immer wieder Arbeit« (Fritz Kortner), starb am 18. August 1961 in München.
Informationen zum Buch
Leonhard Frank erzählt die Geschichte der verbotenen Liebe zwischen Lydia und Konstantin, die zunächst nicht wissen, dass sie Bruder und Schwester sind. Damit lotet der Schrftsteller einmal mehr die Beständigkeit gesellschaftlicher Konventionen aus. Der Roman wurde bei Erscheinen 1929 viel diskutiert und von Heinrich Mann hochgelobt.
»›Bruder und Schwester‹ ist die glücklich endende Geschichte einer inzestuösen Liebe.« Main Post
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Leonhard Frank
Bruder und Schwester
Roman
Inhaltsübersicht
Über Leonhard Frank
Informationen zum Buch
Newsletter
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Impressum
Seht die Lilien an: entspringt nicht Gatte und Gattin auf einem Stengel? Verbindet beide nicht die Blume, die beide gebar, und ist die Lilie nicht das Bild der Unschuld, und ist ihre geschwisterliche Vereinigung nicht fruchtbar? Wenn die Natur verabscheut, so spricht sie es laut aus.
GOETHE
Zuerst 1929 veröffentlicht
I
An einem regnerischen Nachmittag im Herbst des Jahres 1906 saßen Herr und Frau Schmitt, deren Ehe tags vorher geschieden worden war, beim Rechtsanwalt, um die materiellen Dinge zu ordnen. Auch Frau Schmitts Vertreter war da.
Die beiden Anwälte brauchten nicht zu kämpfen und nicht zu vermitteln, sondern nur die rechtsgültigen Formulierungen für das Maschinendiktat gemeinsam zu notieren. Denn die Geschiedenen, denen schon bald nach der Hochzeit fast jedes Wort und oft nur die vermeintlich unzulässige Betonung eines Wortes, ein Blick, eine offene oder geschlossene Zimmertür, irgendwelche Winzigkeiten, wie sie jeder Tag bringt, Anlaß zu heftigem Streit geworden waren, machten in den materiellen Dingen keinerlei Schwierigkeiten, obgleich in dieser Stunde endgültige Vereinbarungen über große Vermögenswerte getroffen wurden.
Herr Schmitt, Mitdirektor und europäischer Generalagent der größten amerikanischen Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen, war ein reicher Mann. Er war Deutschamerikaner, Frau Schmitt Russin.
Die Anwälte, die bei Punkten von besonders weittragender Bedeutung jeweils Herrn oder Frau Schmitt erst noch einmal fragten, ob sie denn auch wirklich einverstanden seien, und stets die Antwort erhielten, sich nur ganz nach den Vorschlägen des Herrn Schmitt oder nach den Wünschen der gnädigen Frau zu richten, konnten ihr Staunen über diese nie erlebte Einigkeit in einer Sache, die sonst in der Regel zu den wildesten Orgien der Habsucht führte, nicht ganz verbergen.
Angesichts dieses Staunens wechselten die Geschiedenen hin und wieder einen Blick, bei beiden begleitet von einem kleinen resignierten Lächeln, in dem das gegenseitige Zugeständnis enthalten war, wenigstens von einem Menschen untadeliger Gesinnung neun Jahre lang bis aufs Blut gepeinigt worden zu sein.
Während die Anwälte, die nicht begriffen, weshalb dieses so großzügig einige Paar sich überhaupt getrennt hatte, ihre gemeinsame Arbeit in die Maschine diktierten, blickten die Geschiedenen, beide reglos in die Sessel zurückgelehnt, hinaus auf die nassen, schon herbstgelben Bäume und den trüben Spreekanal. Es schien, als wollten dieses Gelb und dieser Regen, die drückende Leblosigkeit da draußen, der ganze machtvoll trostlose Nachmittag nie mehr enden.
»Aber eigentlich doch sehr vernünftig! Trotz dieser .. Generosität schließlich nur vernünftig!« flüsterte erstaunt der Anwalt seinem beistimmenden Kollegen zu, nachdem er den fertigen Vertrag durchgelesen hatte, und reichte ihn gewichtig Frau Schmitt, deren Blick an Herrn Schmitt vorüberstreifte, fragend, ob sie das lesen müsse. Frau Schmitt konnte mit drei Zahlen charakterisiert werden: Sie war dreißig, sah aus wie zwanzig und hatte die Schuhnummer 34. Immer und in jeder Lebenslage war jemand dagewesen, der ihr alle Sorge und Verantwortung abgenommen hatte. Herr Schmitt unterschrieb das zweite Vertragsexemplar und bat gleichzeitig, noch eine Vereinbarung über die Kinder beizufügen. Sie hatten sich, auch vor dem Scheidungsgericht, dahin geeinigt, daß der achtjährige Konstantin beim Vater und die dreijährige Lydia bei der Mutter bleiben solle, und nun wünschte Herr Schmitt noch, daß die Mutter sich bereit erklärte, in gar keiner Weise mehr in die Erziehung des Knaben einzugreifen, da ein Kind nur Schaden nehmen könne, wenn es von zwei gleichberechtigten Personen beraten werde, die einander so sehr ablehnend gegenüberstünden und vor allem auch in den Fragen der Erziehung ganz entgegengesetzter Ansicht seien.
»Also, Lydia kann Ihretwegen falsch erzogen werden! Das ist Ihnen gleichgültig ... Unerhört!«
»Nein. Aber Sie werden sich doch gewiß nicht auch noch von Lydia trennen wollen.«
»Das muten Sie mir zu?«
Darauf antwortete er nicht. Er sagte: »Außerdem sind Sie ja überzeugt, daß Ihre Erziehungsmethode gut und richtig ist.«
»Aber Sie sind entgegengesetzter Meinung.«
Alte, tausendfach übereinander gelagerte Erbitterung ließ ihn resigniert lächeln bei dem Gedanken, daß sie ja niemals und in keiner Sache seine Meinung habe gelten lassen.
Sie mußte die Hand auf das tobende Herz pressen. »Ich liebe meine Kinder über alles.«
»Das habe ich nie bezweifelt.«
»Aber Sie tun es ja!«
»Wieso?« Nun war er doch wieder verblüfft.
»Jawohl! Denn Sie behaupten immer wieder, ich schade den Kindern.«
›Soll ich ihr nun zum zehntausendstenmal sagen, daß sie ihre Kinder über alles lieben und ihnen dennoch Schaden zufügen kann; daß ein Kind Schaden nehmen muß, wenn alles, aber auch alles, was es tut oder nicht tut, kritisiert wird‹, dachte er und schwieg. Er hatte gelernt, daß Schweigen für ihn noch die beste Verteidigung war.
Erbittert starrten sie aneinander vorbei.
Die Anwälte, die jetzt schon mehr begriffen, formulierten rasch den Nachsatz über die Kinder, und Frau Schmitt, die noch nie selbständig etwas ausgeführt hatte, richtete ihren hilflosen Kinderblick fragend auf Herrn Schmitt. »Hier?« – »Nein, hier!«
Und unterschrieb dann doch an der falschen Stelle.
Mit vollendeter Aufmerksamkeit half er ihr in den Mantel und betrachtete dabei gleichgültig den zarten, weißen Nacken, der ihn vor neun Jahren bezaubert hatte.
Zur selben Zeit brachte die alte Kinderfrau, eine Ostpreußin mit wuchtiger Kartoffelnase und winzigen, klugen Augen, die schon Frau Schmitts Kindheit betreut hatte, die kleine Lydia zu Bett. Das lange Nachthemd, das in der Taille mit einem Goldfaden abgebunden war, hatte Lydia schon an. Ohne diesen Goldfaden schlief sie nicht ein.
Ihr Haar war so schwarz wie die Seidenfransen eines schwarzen Schals, und die länglichen Riesenaugen, tiefblau, hatten einen flaschengrünen Schimmer. Das Mündchen dachte.
Sie streckte die winzige Hand vor, die von der Knienden gewaschen wurde, und blickte dabei still und dennoch äußerst interessiert hinüber zu Konstantin, der mit Buntstiften ein Gesicht zeichnete.
Die Kinderfrau holte das Handtuch, sah im Vorbeigehen dem Maler über die Schulter und erkannte in der gewaltigen Nase mit den winzigen zwei Punkten links und rechts sich selbst. »Du Teufel, du frecher!«
Der Achtjährige, den, gleich der kleinen Lydia, die Natur schon durch Schädelbau und Gesichtsbildung und wie die Augen denkend blickten, als ernstes Menschenkind gezeichnet hatte, fühlte aus der Tiefe seines Wesens unwiderstehlich den Übermut aufsteigen und konnte den Triumph darüber, daß sie selbst sich erkannt hatte, nicht unterdrücken.
Lydia blickte unverwandt zu ihm hinüber und hielt dabei immer noch das schon gewaschene Händchen vorgestreckt. Triumph und Übermut des Bruders sprangen so unvermittelt auf sie über, daß dem fest zusammengepreßten lächelnden Mündchen plötzlich ein leiser Jubelton entschlüpfte. Sofort wurde das ganz weiße, von den schwarzen Seidenfransen umrahmte, vollwangige Gesicht wieder ernst.
Als sie im Bett lag, ganz unbeachtet vom Bruder, verhielt sie sich vollkommen still und blickte nur groß hinüber, bis er aufsah. Da ließ sie lockend und kokett die Augenlider flattern. Die Kinderfrau war in der Küche.
Nach einer Weile hob Konstantin triumphierend das Papier über den Kopf und zeigte Lydia sein Gemälde. Ohne das geringste Interesse bezeugt zu haben, schloß sie befriedigt die Augen zum Schlafe. Es war, als verheimlichte sie die Genugtuung darüber, daß sie seine Beachtung erreicht hatte.
Da trat die Mutter ein, blickte tadelnd ringsum, als ob im Kinderzimmer alles auf dem Kopfe stünde, und rief schließlich: »Tut ein braves Kindchen das?«
Die Kinderfrau stand unterm Türrahmen und schüttelte mißbilligend den Kopf. »Was hat sie denn schon wieder getan? Liegt ja mäuschenstill.«
Die Mutter stürzte vor dem Bett ins Knie, in die entgegengestreckten Ärmchen, und riß im Taumel der Liebe ihr Töchterchen an sich.
Am nächsten Morgen reiste Herr Schmitt mit seinem Sohne ab, zuerst nach England, wo er Konstantin in das Eton College gab, dann auf acht Tage nach New York zur Bilanzsitzung und von dort nach Rußland, wo er die nächsten zehn Jahre zu bleiben gedachte. Herr Schmitt hatte zur Erschließung des russischen und ostasiatischen Marktes die Generalagentur nach Petersburg verlegt.
Getreu der Abmachung bei dem Berliner Rechtsanwalt schrieb Frau Schmitt ihrem Söhnchen jährlich nur einen Brief, einen Glückwunsch zum Geburtstag, den Konstantin in den ersten Jahren mit kurzen Berichten über seine Fortschritte im Boxen und Fußballspiel beantwortete, in Fachausdrücken, die auch die Kinderfrau, die zu Rate gezogen wurde, nicht verstand; später antwortete er überhaupt nicht mehr.
Frau Schmitt, in der das Bild des Achtjährigen, wie sie ihn zuletzt gesehen hatte, weiterlebte, bat noch nach acht Jahren, in ihrem Geburtstagsbrief, als Konstantin schon ein sportgestählter ernster Jüngling und eben dabei war, die Philosophie Nietzsches mit der Humes zu vergleichen, er solle nur ja gut aufpassen, daß er seine Taschentücher nicht immer mit den dummen Farbstiften bekleckse und beim Kirschenessen die Kerne nicht verschlucke.
Auf diesen Brief antwortete der Direktor des Eton College, Mr. Schmitt habe das Institut verlassen, er sei von seinem Vater nach Rußland gerufen worden.
Das war im Jahre 1914. Herr Schmitt hatte seinen Sohn zwischen zwei Operationen zu sich kommen lassen. Er benutzte diese Zwischenzeit dazu, Konstantin bei einem bewährten Jugendfreunde einzuführen, der sich bereit erklärt hatte, den Jüngling zu adoptieren, falls die zweite Operation unglücklich enden würde.
Konstantins Vater starb kurz vor Kriegsausbruch. Und der Sechzehnjährige, der entscheidende acht Jahre der Entwicklung völlig losgelöst von seiner ersten Kindheit verbracht, die Existenz der Mutter schon fast vergessen und auch für den fernen Vater nicht die Gefühle eines Sohnes erworben hatte, konnte an diesem strahlenden Tage keine Trauer empfinden um den Mann im Sarg, hinter dem er in den Friedhof schritt.
Bei der Adoption wurden die alten Papiere von der Behörde eingezogen. Konstantin hieß von nun an Berant. Und schon im Laufe weniger Wochen, verbracht in der lebendigen, heiteren Atmosphäre seiner Adoptiveltern, gewann Konstantin mehr Zugehörigkeits- und Verwandtschaftsgefühl, als er jemals in seinem Leben gekannt hatte.
Im Laufe der acht Jahre war in Konstantin eine neue Welt entstanden, die eines gesunden, unbelasteten Jünglings, der die Gegenwart erlebt und dabei in die Zukunft blickt. Die alte, ferne Welt seiner frühen Kindheit war verblaßt und allmählich versunken und verschwunden.
Konstantin war reich. Vom Krankenbett aus hatte Herr Schmitt den Effektenbesitz, seine Geschäftsanteile und sämtliche immobilen Werte in Amerika, deren Verwaltung für Konstantins Adoptivvater zu schwierig gewesen wäre, abgestoßen. Das riesige Barvermögen war in amerikanischen Banken deponiert.
Frau Schmitt hatte seit jenem Nachmittag beim Rechtsanwalt nichts mehr von ihrem früheren Mann gehört. Die Trennung war vollkommen. Daß Herr Schmitt gestorben war, erfuhr sie nicht und hätte sie auch nicht ermitteln können – der Krieg war ausgebrochen, das Leben hatte sich an jenem Tage plötzlich auf die andere Seite gewälzt: und die Schicksale von Hunderten Millionen Menschen gestalteten sich anders.
Infolge der russischen Revolution würde auch nach Kriegsende jedes Nachforschen vergebens gewesen sein. Aber Frau Schmitt hatte auch gar nicht den Mut, an ihre tiefe Lebenswunde zu rühren. Nur ein einziges Mal hatte Lydia nach Vater und Bruder gefragt und war dann fassungslos vor der fassungslos in sich zusammenbrechenden Mutter gestanden. Nie wieder hatte das frühreife Kind an die Vergangenheit gerührt.
Im steten Wechsel der Tage und Jahre war für die Mutter allmählich eine neue Welt erstanden, und mit dem Versinken ihres früheren Lebens war auch die Erinnerung an Konstantin verblaßt. Ihre Welt war Lydia.
Bei Kriegsausbruch befand sich Frau Schmitt zur Kur in der Schweiz. Sie kehrte nicht nach Berlin zurück. Des Hotellebens überdrüssig, beauftragte sie im zweiten Kriegsjahre ihren Vermögensverwalter, ein Besitztum bei Zürich zu kaufen.
Der Garten reichte bis zum Seeufer. Morgens Punkt sieben Uhr öffnete sich die Tür zur Glasterrasse, eine schmale Gestalt in weißem Badecape, ein senkrechter weißer Strich mit einem seidenschwarzen Köpfchen, stand im Rahmen, den Blick auf den sonnüberblendeten See gerichtet.
Lydia hielt mit der Linken das Cape vorne zusammen, straff, daß die zarten Formen, die dennoch schon den Bau der Frau verrieten, sich zeichneten, und ließ im Gehen die Rechte noch wie im Traum über die blütenstrotzenden, taunassen Sträucher gleiten. Es schien, als gewänne ihr Traum der Nacht noch eine Fortsetzung in diesem Gehen durch den morgenstillen Garten.
Schon jetzt hatte der leicht ziehende Gang der Zwölfjährigen, deren Knie beim Schreiten stets etwas gebeugt zu bleiben schienen, sein ureigenstes Gepräge, das später jeden Mann und jede Frau zwingen sollte, den Blick zu heben, um zu sehen, welches Gesicht die Frau habe, die so ging, als sei bei ihr der Sitz der Seele in den Beinen, in den Kniekehlen.
Das wiederholte sich jeden Morgen: Sowie das Badehäuschen, von dem das Sprungbrett weit hinaus in den See ragte, zwischen den Bäumen sichtbar wurde, ließ Lydia das Cape fallen. Im Garten und auch weiterhin war niemand. Das dünne nackte Kind zwischen den hohen Blumenstengeln, das im Blick den tiefen, ruhigen Ernst der wahren Schönheit trug, gewann, beflügelt von der Morgenfrische, die äußerste Spitze des Sprungbretts: gereckt – und war verschwunden.
Möwen, einzeln und in Scharen, schwebten, flatterten, zogen Kreise und schrien, begleiteten schreiend die Schwimmerin, glitten in ruhelosem Fluge hernieder, daß die Flügelspitzen das Wasser und Lydias bewegten Körper berührten.
Als sie wieder auf dem Sprungbrett stand, auf der äußersten Spitze, und die Möwen im Kreise flogen, immer knapp an ihr vorüber, ein weißer Kreis flatternder Flügel und schreiender Schnäbel, das tägliche Futter von Lydias Hand erwartend, brach sich das Sonnenlicht in den perlenden Tropfen auf ihrem Körper zu den Farben des Regenbogens.
Sie setzte sich nieder, die Knie angezogen, und begann mit der täglichen Fütterung. Der Wind der flatternden Flügel streifte ihre Wangen. Sooft sie ein Brotstückchen hinausschleuderte, schrien die Möwen auf und haschten es im Fluge. Die mutigsten schnappten im Kreisfluge das Brot aus Lydias vorgestreckter Hand.
Immer im Kreise fliegend und schwebend, rückten die Möwen, nun lautlos, allmählich hinaus in die Seemitte, die Fütterung war zu Ende. Lydia stand auf dem Sprungbrett, reglos, den Blick dem Garten zugewendet.
Noch war die Brust knabenhaft, und den zarten Leib zierte noch nicht der Schmuck des Frauentums. Sie trug den Traum des Lebens im Auge.
»Niesen muß doch jeder Mensch manchmal«, sagte Lydia. Aber die überängstliche Mutter ließ gleich den Arzt holen.
Das war für den alten Herrn immer ein Genuß ganz besonderer Art, wenn dieses ernste, schöne Kind mit der Sicherheit und Ruhe einer jungen Dame und zugleich mit dem unwiderstehlichen Charme ihrer zwölf Jahre die ärztliche Untersuchung für nicht nötig erklärte und die sorgsam gewählten Beruhigungsworte, die er der zitternden Mutter sagen sollte, selbst bestimmte. »Aber Sie können ja einmal horchen.«
Folgsam legte er das Ohr nur flüchtig an Lydias gesunde, zarte Brust, und sie blickte gelassen über den schlohweißen Kopf hinweg.
An ihrer echten Selbstsicherheit, die der Mensch nur durch mitgeborene Kraft der Seele und makellose Schönheit des Körpers gewinnen kann, war die krankhafte Kritiksucht der Mutter schon seit Jahren wirkungslos abgeprallt.
Schon waren die Rollen vertauscht. Die Dame des Hauses war Lydia, die mit leichter Hand Atmosphäre und Ablauf des Tages bestimmte, und die Mutter war das Kind, das mit Takt und Feingefühl und einer ins Maßlose gesteigerten Liebe von Lydia geleitet und behütet wurde.
Auf einem Spaziergang am See war die Mutter einst in Entzücken geraten beim Erblicken eines jungen Dackels und hatte den Wunsch geäußert, so ein Dackelchen zu besitzen; das Tier würde außerdem gewiß auch ein sehr guter Schutz für Haus und Garten sein.
Lydia hatte sofort für den Kauf eines Dackels gestimmt, und ihre Spekulation war richtig gewesen. Denn von nun an mußte das junge braune Dackelchen, das schon davonlief, wenn ein Junge nur die Nase durch den Gartenzaun steckte, den Hauptanteil der Kritiksucht aushalten.
Anfangs zog er den Schwanz ein, kauerte sich ängstlich zusammen und traute sich nicht heraus aus seiner Ecke, wenn er etwas angestellt haben sollte; später verdrehte er nur noch die Augen und machte Stirnfalten, und seit einiger Zeit, seitdem er wußte, daß er überhaupt nichts recht machen konnte, war auch sein Augenverdrehen nicht mehr ganz echt, wenn die Herrin völlig grundlos rief: »Tut ein braves Hündchen das?«
Lydias Mutter hatte ihren Mädchennamen, Leskow, wieder angenommen. Sie lebten zurückgezogen. Zürich, die geruhsame Stadt der alteingesessenen Handwerker, Hoteliers und Möwen, war im zweiten Kriegsjahr Sammelpunkt der Hochstapler, politischen Emigranten, Deserteure, Spitzel und Spione aller Länder Europas. Geschäftemacher dunkelster Art, Gaunergesindel jeglicher Prägung, politische Fanatiker und internationale Artisten füllten die Straßen und Kaffeehäuser.
An windstillen Abenden, wenn das Leben in der Stadt schon abgeklungen war, wenn die Möwen schon schliefen und das weiße Gebirge in großer Stille in Erscheinung trat, hörte Lydia den fernher dringenden Donner der Geschütze: kaum vernehmbar schwach und ungeheuer grauenvoll.
Konstantin Berant, dessen Adoptivvater im Kriege gefallen war, studierte in Petrograd Nationalökonomie und setzte das Studium auch in den Jahren der Revolution fort. Als er 1920 Rußland verließ, trug er im Blick das unbestechliche, erlittene Wissen eines Mannes, der gesehen und miterlebt hat, wie ein Volk unter ungeheueren Zuckungen, Kämpfen und Krämpfen in Finsternis und Raserei mit einem Übermaß an Opferbereitschaft ein neues Stockwerk der Menschheitsgeschichte aufrichtete.
1921 kehrte Konstantin aus Amerika zurück. Das ererbte Vermögen hatte sich seither noch so vergrößert, daß es ihm nicht möglich gewesen wäre, auch bei einem verschwenderischen Leben nur einen beträchtlichen Bruchteil der Zinsen zu verbrauchen.
Der Fremde von Distinktion, der in Le Havre an Land stieg, stand seit seiner frühen Jugend zum erstenmal vor der Möglichkeit, die andere und schöne Seite des Daseins zu erleben, als ein äußerlich und innerlich vollkommen unabhängiger, an Seele und Körper unangetasteter Mann, dessen Wesen durch die miterlebten großen geschichtlichen Ereignisse tief geläutert war.
Konstantin Berant hatte zu niemand persönliche Beziehungen. Die Frau seines im Kriege gefallenen Adoptivvaters war an Flecktyphus gestorben. Er war allein. Er reiste. Er war dreiundzwanzig und hatte keine Pläne, folgte plötzlichen Einfällen, fuhr zunächst nach Paris, dann nach Wien, von Wien in die Schweiz und entschloß sich erst in Zürich, eine planvoll zusammengestellte, auf drei Jahre berechnete Weltreise zu unternehmen.
Das internationale Getriebe in Zürich war wie weggeblasen. Verschwunden die Hochstapler und Fanatiker aus aller Welt, wieder in der Welt zerstreut! Zürich war wieder die geruhsame Stadt der alteingesessenen Handwerker, Hoteliers und Möwen.
Konstantin Berant verließ das Reisebüro. Schreiende Möwen schwebten über ihn hinweg, hinaus über den glatten, besonnten See, das Wasser roch frisch, und das ferne, weiß-ruhende Gebirge schien näher gerückt zu sein, so klar und schön war dieser Tag.
Er bog in die Bahnhofstraße ein, wo die eleganten Läden sind und diesen Morgen wie in einer Kleinstadt Gemüsemarkt war. Die ganze Straße hinunter stand Korb an Korb, dicht umgeben von prüfenden, feilschenden, kaufenden Hausfrauen.
Frau Leskow, die Spinat in rohem Zustand von Salat nicht unterscheiden konnte und dennoch zeitlebens darum kämpfte, als tüchtige Hausfrau zu gelten, unterließ es nie, selbst auf den Markt zu gehen. Die Köchin war mit dem gefüllten Gemüsenetz schon heimgegangen. Frau Leskow und Lydia betrachteten die Schaufenster im langsamen Vorübergehen.
1906 hatte die Dreißigjährige wie ein junges Mädchen ausgesehen, jetzt sah die Fünfundvierzigjährige zehn Jahre älter aus, als sie war: eine überzarte, durch schwere Krankheit vorzeitig gealterte Frau.
Wenn Lydia heimlich die Mutter betrachtete, hielt sie stets ein sorgloses Lächeln bereit, das ihre tiefe Besorgnis verdeckte. Sie war achtzehn und trug im Gesicht die Züge der unberührten Jugend und großen Schönheit und den mitgeborenen Lebensernst in ergreifender Vermischung.
Das war die Zeit, da die Gäste eines Restaurants in Paris, London, Berlin erleben konnten, daß an zwei Tischen zwei Menschen sich plötzlich erhoben, fragend, zögernd und erblaßt wie Gespenster aufeinander zugingen und mit einem Begrüßungsschrei einander in die Arme fielen: alte Freunde, Leidensgenossen, durch Krieg und Revolution versprengt, die den anderen tot geglaubt und nun in ganz und gar veränderten Lebensumständen wiedergefunden hatten.
Mutter und Tochter und der Bruder waren, getrennt noch durch Gemüse kaufende Frauen, einander bis auf wenige Schritte nahe gekommen, da rief auf der anderen Seite der Straße ein eiliger Zeitungsverkäufer das neue Mittagsblatt aus, Konstantin wandte den Kopf, überquerte die Straße und schritt, lesend in der gekauften Zeitung, auf dieser Seite langsam weiter.
Wäre der Zeitungsverkäufer nur zwei Sekunden später gekommen, dann hätte Konstantin die Mutter erblickt. Dies wäre für ihn ohne jede Bedeutung gewesen – er wäre nur einer distinguierten alten Dame begegnet.
Aber er hätte Lydia gesehen.
Am Abend desselben Tages begann er die Weltreise, die ihn drei Jahre von Mitteleuropa fernhielt.
II
»Schwerer Nebel über London!« meldete das Schiffsradio. Konstantin Berant, der aus den Tropen kam und nun, nach beendeter Weltreise, in London eine große nationalökonomische Arbeit schreiben wollte, entschloß sich von einer Minute zur anderen, schon in Triest an Land zu gehen und erst einige Tage in Berlin zu verbringen, wo er den Klimawechsel weniger empfinden würde.
An diesem selben Tage wurde auch Lydia Leskow, deren Koffer schon gepackt waren, durch eine Nachricht veranlaßt, ihren Reiseplan umzustoßen: Sie blieb in Berlin. Die Mutter, die, um Lydia nicht zu beunruhigen, noch auf dem Sterbebett geschrieben haben würde, es gehe ihr gerade jetzt besonders gut, war erkrankt und hatte, damit Lydia es nicht erfahre, dringend gebeten, die Heimreise zu verschieben; der Tapezier arbeite noch in Lydias Zimmern.
Konstantin verließ sein Hotel mit der Absicht, im Wagen aus der Stadt hinauszufahren, und entschloß sich erst am Wagenschlag, nach einem Blick auf den wolkenverhängten Himmel, zum Tee in ein Hotel Unter den Linden zu fahren.
Während Lydia den Hut aufsetzte und mit dem Stift die glatten Lippen berührte, deren Rot so tief und leuchtend zum blendenden Weiß der Wangen stand, daß das hingewischte künstliche Rot kaum erkennbar war, ging Konstantin durch die Hotelhalle in den Lichthof, der in einen offenen Raum überging, wo die Jazzkapelle vor dem glänzenden Parkettquadrat saß.
Wie Konstantin, der seinen trainierten, wohlproportionierten Körper in jeder Bewegung beherrschte, durch den Lichthof schritt und mit kaum bemerkbarer Geste wortlos den Kellner fragte, ob das Tischchen frei sei, machte er den Eindruck eines Mannes, der für jede Annäherung unzugänglich ist. Aus seinem tropenbraunen Gesicht, scharf, faltenlos und etwas mager, kam ein Blick, der ihn von den Menschen wegzurücken schien. Sein Haar, dunkelblond, war auf dem Scheitel von der Sonne etwas heller gebleicht. Konstantin war sechsundzwanzig Jahre alt; der Ernst seines Wesens ließ ihn älter erscheinen.
Lydia stieg die Hoteltreppe herunter, in der Mitte. Bei ihr kam jede Gemütsregung sofort in ihrem Gang zum Ausdruck. An der Art, wie sie beim Herabsteigen die Knie hob und den Fuß stellte, in lässigem Tempo, war erkennbar, daß sie nichts Besonderes vorhatte; daß dieser Nachmittag, der für die Abreise bestimmt gewesen war, dem Zufall gehörte.
Sie trug ein schwarzes Seidenkleid. Der Saum des Unterkleides, das erst in der Mitte der Brust begann, war sichtbar, und oberhalb des Saumes schimmerte das blendende Weiß der Brüste durch den dünnen Flor.
Eine Sekunde blieb sie in der Hotelhalle stehen, horchend auf die Jazz, deren hackende Töne von weit rückwärts aus dem Lichthof kamen. Sie hatte noch niemals den Tee im Lichthof genommen. Heute war alles anders. Sie schritt den Tönen entgegen.
Nicht die untadelige Schönheit ihrer Beine, deren Linien wie in Weißglut vollendet vom Knie abwärts flossen zum schmal modellierten Fuß, war das Bedeutsame, sondern daß in diesen Beinen, wenn sie in Bewegung waren, das innerste Wesen Lydias ergreifend zum Ausdruck kam. Die Beine flossen so gerade herab, daß beim Schreiten nicht zwei Millimeter Luft zwischen den Knien war, und innen zog von der Wade empor zur Kniekehle diese Linie ihres Frauentums.
Es schien nur so, als bliebe beim Schreiten das beseelte Knie stets etwas gebeugt.
Konstantin, der an seine Arbeit dachte und vor sich hin zu Boden blickte, sah zuerst nur diesen erregenden Fluß der Beine, vom Knie abwärts.
»Die fortschreitende Vergesellschaftung der Produktionsmittel innerhalb des kapitalistischen Systems«, dieser Titel seines künftigen Werkes, eben erst erdacht, entschwand ihm, sein Blick ging von den geschliffenen Beinen über die Knie empor zu den Schenkeln, die sich rund unter der schwarzen Seide zeigten, und zu der in ihrer Straffheit unbewegten Brust unter dem dünnen Flor; er sah noch die hohe Säule des Halses und dann diesen Kopf, dieses Gesicht, erregend beseelt wie Gang und Knie, mattweiß, das vom schwarzen Flügel der Tragik allen Menschendaseins noch den letzten inneren Glanz seiner ergreifenden Schönheit zu empfangen schien.
Nur unter dem überraschenden Blau des Auges war ein leiser brauner Schimmer. Die Braue war seidenschwarz.
Die allererste Empfindung Konstantins war die eines heftigen Schmerzes in der Herzgegend, dann durchschoß ihn ein heißer Strom, Nacken und Rücken herunter, durch Schultern und Arme, bis in die Fingerspitzen. Er sah weg, langsam, senkte den Blick wieder zu Boden, sah zunächst nicht wieder hin. Die Welle der Ungeduld, dieser Frau noch fremd zu sein, versank wieder in sich selbst.
In dieser lebensentscheidenden ersten Minute, da er abgewandten Kopfes wieder vor sich hin sah, formte sich in seiner Seele das Bild ihres Wesens, unverrückbar und für immer.
Braucht ja nur den Kopf zu heben, dann kann er das brennende Bild in seinem Innern vergleichen mit ihr.
Er tat es nicht.
Sie hatte sich abseits niedergelassen, an einem der kleinen Tische, die für Hotelgäste reserviert waren; war unauffällig gekommen, unbemerkt von den anderen, saß plötzlich da und fiel auf. Beim Kommen hatte sie nur Konstantins äußere Erscheinung erfaßt, die Haltung, das etwas strenge Profil.
Sie saßen nur einen Meter voneinander entfernt an der Mauer, Lydia mit dem Gesicht zurück zur Hotelhalle, er mit dem Blick zu ihr, wenn er ihn hob. Kein Tisch war zwischen ihnen.
Ganz selbsttätig bestrichen Konstantins Hände den Toast auf beiden Seiten mit Butter. In dem gefühlstiefen und dabei hellen, scharfen Bewußtsein, daß durch Lydia der Sinn des Lebens sich an ihm erfüllen werde, hob er ganz unabsichtlich, wie aus einem Traum in den Tag zurückgekehrt, langsam den Kopf.
Diesen Blick, in dem Grundriß und Art seines Wesens, die ganze Legitimation Konstantins, seine Hingabe und sein Begehren lebensstark enthalten waren, empfing Lydia wie eine Saat ins unbewachte Herz.
Er war es, der zuerst die Lider senkte, jetzt, da er den Schuß in ihre Seele abgegeben hatte.
Unter dem glatten Spiegel ihres Lebens war erregende Unruhe entstanden, verwandelnd schon die Züge ihres Lebens, ihres Gesichtes, wie ein beginnendes Seebeben den glatten Wasserspiegel schon verwandelt, noch bevor seine Gewalt emporgestoßen ist.
Sie konnte ihn ansehen, er saß mit abgewandtem Kopfe. Sie konnte nicht widerstehen, die Einheit der männlichen Linien seines Gesichtes mit dem Blick, den sie empfangen hatte, zu vergleichen. Sie fühlte, so, wie er dasaß, daß sie in ihm war, sie fühlte triumphierend ihre Macht und zugleich die unwiderstehliche, tief beunruhigende, beseligende Ohnmacht der Frau, die getroffen ist.
Konstantin wußte, daß sie nun sofort aufstehen und gehen werde, und er hob den Blick nicht mehr zu ihr empor. Er sah nur den schmal modellierten Fuß, das enge Spiel der Beine. Erst als sie den ganzen Lichthof schon durchschritten und die Hotelhalle erreicht hatte, blickte er auf und sah, daß sie gesenkten Kopfes ging.
Dieser Anblick riß ihn empor. Ihn überkam die Herzensangst, sie aus den Augen zu verlieren. Berlin war groß.
In einer Minute wußte er, daß sie in diesem Hotel wohnte, kannte die Zimmernummer. Konstantin kannte Lydias Blume. Erst im vierten Geschäft fand er die Maréchal-Nil-Rosen. Er schickte den Strauß ohne Karte. Dann fuhr er in sein Hotel, packte, und Minuten später standen seine Koffer in den Zimmern neben ihrem Appartement.
Lydia war durch die dämmerige Hotelhalle gegangen bis zum Ausgang, hatte hinaus in die Sonne geblickt und war umgekehrt und mit der blitzenden Unruhe im Herzen treppauf gestiegen, langsam, Hand am Geländer. In den Kniekehlen fühlte sie, was geschehen war. Im Spiegel auf der Treppe sah sie plötzlich ihr weißes Gesicht und in ihm das Leuchten des Triumphes und der Ohnmacht einer Frau: das Glück. Unter ihrem eigenen Blick versuchte sie, sich zu fassen.
Hinein ins Zimmer, auf den nächsten Stuhl. Jetzt erst glaubte sie die Klänge der Jazz zu vernehmen, die sie vorhin überhört hatte, sah den Lichthof mit dem dünnen Springbrunnen, die Tanzenden und klar das Bild Konstantins, das eins war mit dem in ihrem Herzen.
Sie sah ihn lange an, die männliche Stirn im Profil, die über die Augen vorgebaut war, das festsitzende Ohr und die haarfreie Stelle hinter dem Ohr, die sie zuerst mit den Lippen berührt haben würde. »Mir ist etwas geschehen. Es ist mir geschehen.« Dort, hinter dem Ohr oben begann die Linie, zog im Schwung herum und wurde beim klar gebauten Hinterkopf zur starken und jungen Nackenlinie.
Daß er nach diesem einen Blick so abgewandt gesessen hat! Daß er dies getan hat! In scheuer Zärtlichkeit sah sie ihn an.
An die Vorzimmertür wurde geklopft. Sie hörte noch die Stimme ihrer Zofe. Alles war selbstverständlich: daß er Blumen schickte und daß er ihre Blume kannte. Sie nahm den Strauß entgegen, als hätte sie ihn bestellt.