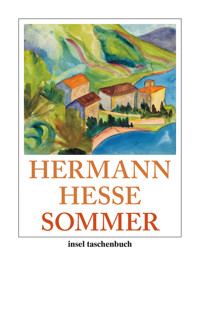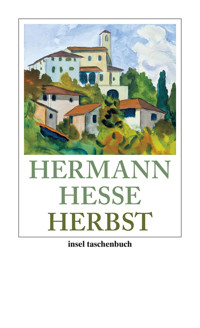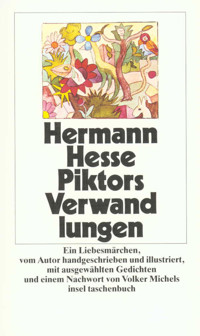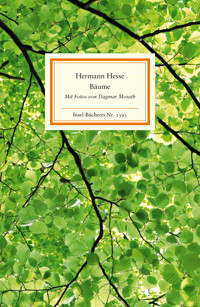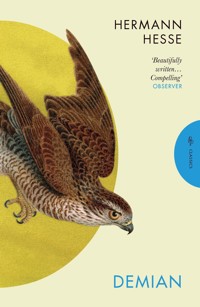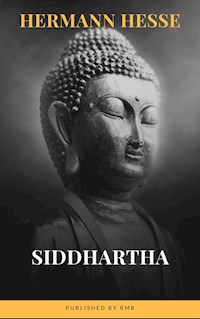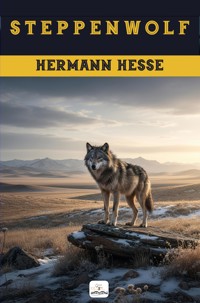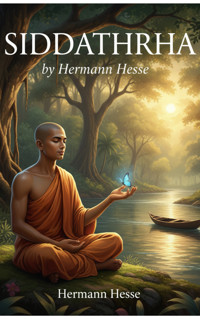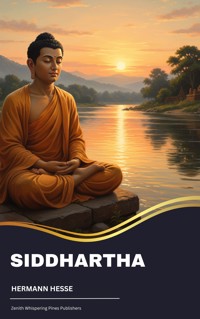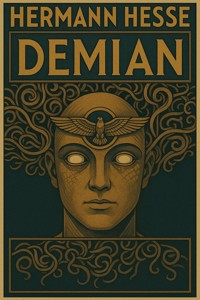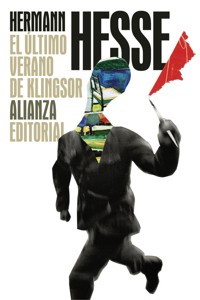22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Den Träumen hat Herman Hesse zeitlebens eine besondere Aufmerksamkeit zugewandt und ihre »nächtlichen Spiele« von seinem ersten Prosabuch Eine Stunde hinter Mitternacht (1899) bis zu seinen späten Betrachtungen sowohl mit artistischem wie auch psychologischem Interesse verfolgt. Als Dichter fand er im Traum »jene von der Logik entbundene Welt der Assoziationen und Symbole, aus welchen einst Sagen und Märchen entstanden sind«. Nirgendwo sonst als an der verborgenen Quelle des Traumbrunnens schien ihm die Sprache der Seele deutlicher vernehmbar. Deshalb ließ er sich immer wieder auf das Abenteuer ein, sie in das Wachbewußtsein zu übersetzen. Nicht von ungefähr hat Hesse auch Traumtagebücher geführt, deren umfangreichstes und interessantestes hier erstmals veröffentlicht wird. Es stammt aus dem Ersten Weltkrieg, einer folgenreichen Lebenskrise, die ihn dazu nötigte, als erster deutscher Dichter die Psychoanalyse zu erproben. Der vorliegende Band setzt ein mit grundsätzlichen Betrachtungen über das Träumen, gefolgt von authentischen Träumen aus Hesses Notiz- und Tagebüchern sowie einigen fiktionalen Traumdichtungen aus seinen Märchen und Erzählungen. Eine Auswahl von Gedichten schließt diesen Themenband ab, der somit aus den verschiedensten Blickwinkeln zeigt, was der Traum – über seine psychohygienische Funktion hinaus – für einen Künstler an kreativen Impulsen enthalten kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hermann Hesse Traumgeschenk
Betrachtungen, Tagebücher, Erzählungen und Gedichte über das Träumen
Herausgegeben von Volker Michels
Suhrkamp
Inhalt
Betrachtungen
Traumtheater
Traumgeschenk
Des Deutenwollens müde ...
Schreiben und Schriften
Tagebücher
Aus meinem Traumbuch
Singapur-Traum
Der Traum von den Göttern
»Möglichst vorurteilslos nur die Erlebnisse der Seele notieren«
Traum am Feierabend
Ein Stück Tagebuch
Ein Traum
Ein Tagebuchblatt
Traumdichtungen
Der Inseltraum
Der schöne Traum
Der Traum des Missionars
Flötentraum
Der schwere Weg
Eine Traumfolge
Pistorius antwortet Sinclair
Traum von einer Audienz bei Goethe
Mit Mozart im magischen Theater
Gedichte
Eine Stunde hinter Mitternacht
Elisabeth
Mon rêve familier
Traum
Landstreicherherberge
Venezianisches Gondelgespräch
Inspiration
Traum von der Mutter
Mittag im September
Wohl lieb ich die finstre Nacht
Wir leben hin…
Nacht
Traum
Schlaflosigkeit
Vergiß es nicht
Beim Schlafengehen
Adagio
Jeden Abend
Zusammenhang
Frühlingsnacht
Neues Erleben
Die Nacht
Verlorenheit
Erwachen in der Nacht
Die Welt unser Traum
Verzückung
Traum von dir
Paradies-Traum
Doch heimlich dürsten wir…
Ein Traum
Wache Nacht
Träumerei am Abend
Ein Traum
Einst vor tausend Jahren
Volker Michels:Die Stimmen der Seele im Traum. Traumbilder und Traumbewußtsein bei Hermann Hesse
Quellennachweise
Betrachtungen
Traumtheater
Jahrzehnte schon sind vergangen, seit ich eine gewisse Übung in der Kunst besaß, meiner nächtlichen Träume mich zu erinnern, sie nachdenklich zu reproduzieren, zuzeiten sogar aufzuschreiben, und sie nach den damals erlernten Methoden um ihren Sinn zu befragen oder doch ihnen so weit nachzuspüren und zu lauschen, daß etwas wie Mahnung und Instinktschärfung sich daraus ergab, Warnung oder Ermutigung je nachdem, jedenfalls aber eine größere Vertrautheit mit den Traumbezirken, ein besserer Austausch zwischen Bewußtsein und Unbewußtem, als man durchschnittlich besitzt. Das Kennenlernen einiger psychoanalytischer Bücher und der praktischen Psychoanalyse selbst, das ich erlebt hatte, war mehr als nur eine Sensation gewesen, es war eine Begegnung mit wirklichen Mächten.
Aber wie es auch der intensivsten Bemühung um Wissen, der genialsten und packendsten Belehrung durch Mensch oder durch Bücher ergeht, so erging es mit den Jahren auch dieser Begegnung mit der Welt des Traumes und des Unbewußten: das Leben ging weiter, es stellte neue und immer neue Forderungen und Fragen, das Erschütternde und Sensationelle jener ersten Begegnung verlor an Neuheit und an Anspruch auf Hingabe, das Ganze des analytischen Erlebnisses konnte nicht als Selbstzweck weiter und weiter gepflegt werden, es wurde eingereiht, wurde teilweise vergessen oder doch durch neue Ansprüche des Lebens übertönt, ohne doch seine stille Wirksamkeit und Kraft je ganz zu verlieren, so wie etwa im Leben eines jungen Menschen die erste Lektüre von Hölderlin, Goethe, Nietzsche, das erste Kennenlernen des anderen Geschlechtes, das erste Bewegtwerden durch soziale und politische Mahnungen und Ansprüche einmal Vergangenheit wird und mit anderem Gut an Erlebnis koordiniert werden muß.
Seither bin ich alt geworden, ohne daß die Fähigkeit, mich durch Träume ansprechen und zuweilen sanft belehren oder führen zu lassen, mich je wieder völlig verlassen hätte, aber auch ohne daß das Traumleben je wieder jene aktuelle Dringlichkeit und Wichtigkeit gewann, die es einst eine Weile gehabt hatte. Seither wechseln bei mir Zeiten, in denen ich mich meiner Träume erinnere, mit solchen, in denen ich sie am Morgen spurlos vergessen habe. Immer wieder aber überraschen mich die Träume, und zwar die Träume anderer nicht weniger als meine eigenen, durch die Unermüdlichkeit und Unerschöpflichkeit ihrer schöpferischen Spielphantasie, durch ihre so kindliche wie geistreiche Kombinatorik, durch ihren oft hinreißenden Humor.
Ein gewisses Vertrautsein mit der Traumwelt und vieles Nachdenken über die künstlerische Seite der Traumkunst (die bisher von der Psychoanalyse, wie die Kunst überhaupt, noch nicht annähernd verstanden oder auch nur bemerkt worden ist) hat mich auch als Künstler beeinflußt. Ich habe das Spielerische in der Kunst immer gern gehabt und habe schon als Knabe und Jüngling häufig und mit großem Vergnügen, meistens nur für mich allein, eine Art von surrealistischer Dichtung betrieben, tue das auch heute noch, zum Beispiel in schlaflosen Morgenstunden, freilich ohne diese seifenblasenartigen Gebilde aufzuschreiben. Und bei diesen Spielen, und beim Nachdenken über die naiven Kunstgriffe des Traumes und die unnaiven der surrealistischen Kunst, deren Genuß und deren Ausübung so viel Vergnügen macht und so wenig Anstrengung fordert, ist mir auch klar geworden, warum ich als Dichter auf die Ausübung dieser Art von Kunst verzichten müsse. Ich erlaube sie mir mit gutem Gewissen in der privaten Sphäre, ich habe Tausende von surrealistischen Versen und Sprüchen in meinem Leben gemacht und tue das noch immer, aber die Art von künstlerischer Moral und Verantwortlichkeit, zu der ich mit den Jahren gekommen bin, würde mir heute nicht mehr erlauben, diese Produktionsweise aus dem Privaten und Unverantwortlichen auf meine ernstgemeinte Produktion anzuwenden.
Nun, diese Raisonnements können hier nicht ausgesponnen werden. Wenn ich mich heut einmal wieder mit der Traumwelt befasse, so geschieht es nicht mit Absichten und gedanklichen Zielen, sondern wurde einfach dadurch angeregt, daß mir innerhalb ganz weniger Tage mehrere eigentümliche Träume begegnet sind.
Den ersten Traum hatte ich nachts nach einem schlechten Tag mit Schmerzen und großer Müdigkeit. Mit stark bedrücktem und entwertetem Lebensgefühl und von Gliederschmerzen im Liegen behindert, lag ich und schlief, und in diesem schlechten, unfrohen Schlaf träumte ich genau das, was ich in der Wirklichkeit tat, ich träumte, daß ich im Bett liege und schwer und schlecht schlafe, nur war es an einem unbekannten Ort in einem fremden Zimmer und Bett. Ich träumte weiter, daß ich in dem fremden Zimmer aus meinem Schlaf erwache, langsam, widerwillig und müde erwache, und daß ich lange brauche, um durch die Schleier der Müdigkeit und des Schwindelgefühls hindurch mir der Situation bewußt zu werden. Langsam rang und wälzte sich mein Bewußtsein empor, langsam und ungern gab ich zu, daß ich nun wach sei, leider, nach einem unechten, mühsamen, wertlosen Schlaf, der mich mehr angestrengt als gestärkt habe.
Nun also war ich (im Traum) wachgeworden, öffnete langsam die Augen, stützte mich langsam auf meinem eingeschlafenen und gefühllos gewordenen Arm ein wenig in die Höhe, sah durch das fremde Fenster graues Tageslicht fallen, und plötzlich gab es mir einen Ruck, es durchfuhr mich ein Unbehagen und etwas wie Angst oder schlechtes Gewissen, und ich griff hastig nach der Taschenuhr, um nach der Zeit zu sehen. Richtig, hole es der Teufel, es war zehn Uhr vorbei, schon beinah halb elf, und ich war ja doch seit Monaten Schüler oder Gast in einem Gymnasium, wo ich fleißig und heldenhaft ein altes Versäumnis gutmachen und die letzten Klassen nachholen wollte. Mein Gott, und nun war es halb elf, und seit acht Uhr hätte ich in der Schule sitzen sollen, und wenn ich auch dem Rektor, wie schon neulich einmal, mein Versagen mit den zunehmenden Altersbehinderungen erklären konnte, ja seines Verstehens im voraus gewiß war, so hatte ich eben doch diesen Vormittag versäumt und war nicht einmal sicher, ob ich nachmittags wohl genug sein werde, in die Schule zu gehen, und inzwischen ging dort der Unterricht weiter, und mein Mitkommen in der Klasse wurde zweifelhafter und zweifelhafter, und jetzt würde sich ja wohl auch plötzlich einmal irgendeine erschreckende Erklärung für die Tatsache einstellen, daß ich zu meiner Beunruhigung in diesen paar Monaten seit meinem Wiedereintritt ins Gymnasium noch keine einzige griechische Lektion gehabt und in meiner schweren Schulmappe, die oft so mühsam zu tragen war, noch nie eine griechische Grammatik hatte finden können. Ach, vielleicht war es nichts mit meinem edlen Entschluß, meine versäumten Pflichten gegen die Welt und die Schule nachzuholen und doch noch etwas Rechtes zu werden, und vielleicht war der Rektor, der mich dort immer so verständnisvoll behandelte, längst und schon von Anfang an von der Verstiegenheit meines Unternehmens überzeugt, auch kannte er mich ja einigermaßen aus einigen meiner Bücher. Sollte ich am Ende lieber die Uhr wieder hinlegen, die Augen wieder zumachen und den Vormittag vollends im Bett bleiben, und vielleicht auch gleich den Nachmittag, und damit zugeben, daß ich mich auf etwas Unmögliches eingelassen hatte? Auf jeden Fall: für den Vormittag hatte es keinen Sinn mehr, sich aufzuraffen; er war vertan. Und kaum hatte ich in der fremden Stube im fremden Bett diese Gedanken gedacht, so erwachte ich wirklich, sah einen dünnen Strahl Licht vom Fenster kommen, und fand mich im eigenen Zimmer und eigenen Bett, wußte unten das Frühstück und die viele Briefpost warten, und erhob mich unlustig, von diesem Schlaf und diesem Traum in keiner Weise gestärkt, aber doch erstaunt und ein klein wenig zum Mitlachen geneigt über diesen Künstler von Traum, der mich so vor den Spiegel gestellt und dabei von den Tricks der Surrealistik so sparsamen Gebrauch gemacht hatte.
Kaum hatte ich, einen Tag später, diesen so realistischen und so wenig dichterischen, so wenig märchenhaften Traum wieder untersinken lassen und beinah vergessen, da sprach schon wieder ein Traum mich an, diesmal ein poetischer und lustiger, und nicht ich selbst hatte ihn geträumt, sondern eine unbekannte Frau, eine Leserin meiner Bücher irgendwo in einem norddeutschen Städtchen, teilte ihn mir mit. Schon vor etwa zwölf Jahren habe sie diesen Traum gehabt, ihn aber nie vergessen, und jetzt erst sei ihr der Einfall gekommen, mir ihn mitzuteilen. Ich zitiere nun den Brief selbst wörtlich:
»Ich fand mich in Däumlingsgröße auf einem großen Gartenhut, den Sie trugen. Sie pflanzten Sträucher, und ich wußte, daß Sie Erde mit Wasser rührten und kneteten. Sehen konnte ich es nicht, die breite Hutkrempe verhinderte das. Vor meinen Augen lag eine wunderbare Terrassenlandschaft. Ich lief ein wenig ängstlich wie auf einer schwankenden Kettenbrücke nach hinten, um nicht abzurutschen, wenn Sie sich bückten. Auch mußte ich von Zeit zu Zeit mich unter der seitlichen Bandschlaufe bergen, wenn eine Ihrer Hände bedrohlich zugriff, um den Hut auf dem Kopf festzupressen. Es machte mir großen Spaß, daß Sie von meiner Gegenwart nichts ahnten. Die Freude erhöhte sich, als herrlicher Vogelsang ertönte. Ich sah den Feuervogel im dunklen Laub eines Baumes aufglühen und sagte leise zu mir: ›Wenn H. Hesse wüßte, daß der Feuervogel es ist, der singt! Er denkt, es sei der Papageno.‹ Irgendwie tröstete mich das Ganze: die Landschaft, mein Zwergendasein auf dem großen Hut, der Vogelgesang, Ihre Gartenarbeit und auch Ihr Irrtum über den Feuervogel.« Das war nun wirklich ein hübscher, ein schöner und auch spaßiger Traum. Und da es ein fremder war, spürte ich keinen Trieb, ihn zu verstehen und zu deuten. Ich hatte nur mein Vergnügen an ihm, dachte aber immerhin: Weiß Gott, ob es nicht doch der Papageno war!
Als hätte dieser Traum einer Unbekannten, der, von mir aus gesehen, so viel hübscher und harmloser war als meine eigenen, mein Traumvermögen angeregt oder ehrgeizig gemacht, brachte ich gleich darauf selbst wieder einen Traum zustande, diesmal einen zwar nicht eigentlich schönen oder witzigen, aber einen recht phantastischen.
Ich befand mich mit anderen Leuten in einem der oberen Stockwerke eines großen Hauses und wußte, daß es ein Theater sei und daß darin der »Steppenwolf« aufgeführt werde, aus dem irgend jemand ein Theaterstück oder eine Oper gemacht habe. Offenbar war es die Erstaufführung, und ich war dazu eingeladen; auch waren die Vorgänge auf der Bühne mir teilweise bekannt, sehen und hören aber konnte ich nichts von ihnen, ich saß in einer Art Nische, ähnlich etwa, als säße ich auf der Empore einer Kirche hinter der Orgel verborgen. Es waren noch manche solche Nischen da, der eigentliche Theatersaal schien von ihnen wie von einer Laube umgeben, und hie und da stand ich auf und ging auf die Suche nach einem Platz, von dem aus man das Theater sehen könnte, aber ein solcher Ort war nicht zu finden, wir saßen so herum etwa wie Leute, die zu einer Aufführung zu spät gekommen sind und nur wissen, daß hinter der Wand das Theater stattfindet. Ich wußte aber, daß jetzt jene Szenen des Stückes kamen, aus denen die Bearbeiter und Regisseure mit großem Aufwand von Musik sowohl wie von Dekoration und Beleuchtung etwas gemacht hatten, was ich mit Ekel »großes Theater« nannte und gern verhindert hätte. Ich fing an unruhig zu werden. Da kam Dr. Korrodi lächelnd auf mich zu und sagte: »Sie können ruhig sein, da braucht man keine leeren Häuser zu fürchten.« Ich sagte: »Schon recht, aber dieses große Theatergetue versaut mir den ganzen dritten Akt.«
Weiter wurde nichts gesprochen. Ich hatte allmählich entdeckt, daß die unübersichtliche und rätselhafte Architektur, die mich vom eigentlichen Theater trennte, eine Orgel war, und setzte mich wieder in Bewegung, um sie zu umgehen und vielleicht doch noch einen Zugang zum Zuschauerraum zu entdecken. Das gelang nun nicht, aber auf der andern Seite des Orgelbaues, der aber auch sehr an eine Bibliothek erinnerte, kam ich zu einem Gerüste, einer Maschine, einem Apparat, der einigermaßen einem Fahrrad glich, wenigstens hatte er zwei gleich große Räder und über ihnen etwas wie einen Sattel, und sofort war die Sache mir klar: Wenn man da oben auf dem Sattel saß und die Räder in Schwung brachte, dann konnte man durch eine Art von Röhre die Vorgänge auf der Bühne sowohl sehen wie hören.
Das war eine Lösung, und es wurde mir wohler. Mehr an Lösung und Befriedigung aber brachte der Traum nicht zustande, es genügte ihm, diese geniale Maschine erfunden zu haben, und es machte ihm Spaß, mich vor ihr stehen zu lassen. Denn diesen ziemlich hochgelegenen Sattel, über die Räder hinweg, zu erreichen, schien gar nicht einfach, höchstens für junge Leute, die ohnehin Radfahrer waren. Auch war der Sattel niemals leer, es saß immer, wenn ich mich zum Ersteigen anschicken wollte, schon irgendein anderer droben. Und so stand ich, starrte auf den Sattel und auf die wunderbare Röhre, durch deren engen Schacht man sowohl sehen wie hören konnte, was im Theater vor sichging,wo die Fachleute inzwischen den dritten Akt versauten. Ich war nicht aufgeregt und auch nicht eigentlich traurig, aber ich kam mir doch gefoppt und um irgend etwas betrogen vor, und hätte, obgleich die Dramatisierung des Steppenwolfes durchaus gegen meinen Geschmack war, etwas darum gegeben, ins Theater selbst zu gelangen oder doch wenigstens auf den Sattel über der wundertätigen Röhre. Es ist jedoch nicht dazu gekommen.
(1948)
Traumgeschenk
In einer Zeit und Zivilisation, welche zwar für jede medizinische, psychologische oder soziologische Sondererscheinung eine spezielle Wissenschaft, Sprache und Literatur ausgebildet hat, eine Anthropologie aber, eine Kunde vom Menschen, überhaupt nicht mehr besitzt, können einem gelegentlich alle menschlichen Erlebnisse und Fähigkeiten zu unlösbaren Problemen und erstaunlichen Merkwürdigkeiten werden, manchmal zu faszinierenden, entzückenden, begeisternden, manchmal zu erschreckenden, bedrohenden und düsteren. Das zersplitterte, nicht mehr ganze und heile, sondern in tausend Spezialitäten und willkürlich gewonnene Ausschnitte zerlegte Menschenwesen kann uns dann, wie mikrotomische Präparate im Mikroskop, in eine Welt von Bildern zerfallen, deren viele an Menschliches, Tierisches, Pflanzliches, Mineralogisches erinnern, deren Formen- und Farbensprache scheinbar unbegrenzt über alle Elemente und Möglichkeiten verfügt, welchen ein gemeinsamer, zusammenhaltender Sinn fehlt, deren einzelne Bildsplitterchen aber absichtslose, zauberhafte, urweltlich schöpferische Schönheit haben können. Es ist ja auch diese Schönheit, dieser Zauber des Zerstückelten und aus dem Ganzen und Wirklichen Erlösten, welche die Maler seit einigen Jahrzehnten so heftig anzieht und vielen ihrer des Sinnes entbehrenden Bildern eine so reizvolle Traurigkeit des Nichtseienden, eine so flüchtige und seelenbetörende Schönheit verleihen kann, daß man zuweilen in ihnen wieder ein Ganzes und Echtes dargestellt zu finden meint: nicht mehr die Einheit und Beständigkeit der Welt nämlich, sondern die Einheit und Ewigkeit des Todes, des Hinwelkens, der Vergänglichkeit.
So wie diese Maler arbeiten, die das Ganze zerstückeln, das Feste auflösen, die Formelemente durcheinander schütteln und zu neuen, verantwortungslosen, aber oft wunderbar reizvollen Kombinationen umbauen, so arbeitet unsre Seele im Traum, und es ist kein Zufall, daß zu den neuen Menschentypen unserer Zeit, die es vordem nicht gab, auch der Typus des Menschen hinzugekommen ist, der nicht mehr lebt, nicht mehr tut, nicht mehr verantwortet, handelt und verfügt, sondern träumt. Er träumt des Nachts, und oft auch bei Tage, und hat sich angewöhnt, seine Träume aufzuschreiben, und da das Aufschreiben eines Traumes das Vielfache an Zeit erfordert als das Träumen selbst, sind diese Traumliteraten nun ihr ganzes Leben lang überbeschäftigt; niemals kommen sie zu Rande, niemals können sie auch nur halb soviel aufschreiben, wie sie träumen, und wie sie zwischen Träumen und Aufschreiben doch immer einmal wieder dazu kommen, eine Mahlzeit einzunehmen oder sich einen Knopf anzunähen, ist beinah ein Wunder. Diese Traumliteraten oder Berufsträumer haben einen Teil, einen in gesunden Zeiten kleinen Teil des Lebens, eine Nebenfunktion des Schlafens, zur Hauptsache, zum Mittelpunkt und Beruf ihres Lebens gemacht. Wir wollen sie darin weder stören noch verlachen, obwohl wir gelegentlich lächeln oder die Achseln zucken, wir finden zwar das Tun dieser Menschen unfruchtbar, aber wir finden es auch harmlos und unschuldig, egoistisch zwar, aber auf eine kindliche Art, ein klein wenig verrückt zwar, so wie auch jene wirklichkeitslosen Maler, so wie auch wir selber und die gesamte heutige Welt ein wenig verrückt sind, aber nicht auf böse und gefährliche Art. Der Mann, der einmal entdeckt hat, wie gut ein Glas Wein schmeckt, kann unter Umständen zum Trinker werden, indem er das Glas Wein zum Sinn und Mittelpunkt seines Lebens macht, oder der Mann, der einmal entdeckt hat, wie gesund und erfrischend rohe Gemüse schmecken können, kann unter Umständen darüber zum Berufs-Rohkostler und Gesundheitsfanatiker werden; auch dies sind verhältnismäßig harmlose Spezialitäten der Verrücktheit, und sie beweisen nichts gegen die Güte des Weines und gegen die Bekömmlichkeit der Salate. Das Richtige, so scheint uns, wäre, sowohl dem Glase Wein wie dem rohen Gemüse je und je seine Anerkennung darzubringen, sie aber nicht zur Achse werden zu lassen, um die sich unser Leben dreht.
So ist es auch mit dem Träumen und Traumbetrachten. Wir glauben nicht, daß es sich nach Gottes Willen wirklich zum Beruf und zur beherrschenden Hauptsache im Menschenleben eigne, aber wir konnten des öfteren entdecken, daß ein Zuwenig an Träumen und an Aufmerksamkeit für unsre Träume auch nicht das richtige sei. Nein, je und je müssen und wollen wir uns über diesen holden Abgrund beugen und ein wenig in seine Geheimnisse staunen, in seinen zerstückten Bilderfolgen Hinweise auf das Ganze und Wirkliche entdecken und uns beschenken lassen von den oft unsäglichen Schönheiten seiner Phantome.
Dieser Tage war ich im Traum im Tessin, in einem etwas fremden, überhöhten, übersteigerten Tessin, und ich ging mit einem Begleiter durch eine unbekannte Vorstadt, wo zwischen Mauern, Zäunen und Neubauten die Berge hereinsahen. Unter den Gebäuden war eines, das »Neue Mühle« hieß, es war sehr viele Stockwerke hoch und hellrot bemalt, und hatte trotz dem Unproportionierten und allzu Kolossalischen einen eigentümlichen Reiz, ich mußte es immer wieder ansehen. Doch waren wir nicht müßig, sondern gingen recht eifrig, ich glaube, wir mußten auf einen Zug, trugen Gepäck und waren, des Weges unkundig, in einer gewissen Hast und Unruhe. Wer mein Begleiter war, ist ungewiß, aber auf jeden Fall war es ein sehr naher Freund und Vertrauter, einer der zu mir und meinem Leben gehörte. Wir kamen an ein Mäuerchen, hinter dem in kleinem Abstande alte verwahrloste Häuser standen, und ich verließ die Straße, stieg über das ganze niedrige Mäuerchen mit einem großen Schritt hinweg und ging dort weiter, obwohl ich genau zu wissen glaubte, daß hier kein Weg sei, daß wir hier sehr bald in Höfen, Gärtchen und andern privaten Räumen steckenbleiben und als Eindringlinge Verdruß haben würden. Es kam indessen nichts dergleichen, wir kamen ungehemmt vorwärts, immer in dieser etwas gehetzten Unruhe, neben und hinter uns gingen auch andre Leute, und von ferne sah ich auf dieser Straße, die keine war, unter andern Gestalten auch einen alten Freund von mir kommen, er war ganz unverändert und in den vielen Jahren, die wir uns nicht mehr gesehen hatten, scheinbar um nichts älter geworden. Es war mir aber, weil wir Eile hatten und auch aus anderen, unklaren Gründen, nicht lieb, ihn zu begrüßen, ich blickte beiseite und tat fremd, und siehe, er ging an uns vorbei, oder vielmehr er verschwand schon, ehe er uns erreicht hatte, als errate er meinen Wunsch und komme ihm entgegen.
Nun tat sich zwischen den Häusern zu unsrer Rechten ein Ausblick auf, und seinetwegen habe ich diesen Traum nicht vergessen und Lust bekommen, eine Erinnerung an ihn aufzuzeichnen. Es eröffnete sich ein Ausblick auf eine weite, von uns weg sachte bis zu großer Höhe ansteigende Landschaft. »Siehst du’s denn nicht?« rief ich meinem Kameraden zu, ohne aber stehenzubleiben, »so sieh doch, sieh, das ist ja unerhört schön!« Der Freund blickte hinüber, blieb aber gelassen und gab keine Antwort. Mir jedoch sprach diese Landschaft zu allen Sinnen und zur ganzen Seele, sie drang in mich ein, ich trank sie und nahm sie mit mir wie ein großes Geschenk, eine seltsame Wunscherfüllung. Und zwar war es das Eigentümliche dieser schönen Landschaft, daß sie zugleich Wirklichkeit und Kunst, zugleich Landschaft und gemaltes Bild war. Sie stieg bergan, in ihrer Mitte auf einem Vorberg stand eine Kirche, Dörfer hier und dort, hinten rosig leuchtende Berggrate, am Hang unterhalb der Kirche zwei kleine Kornfelder, und diese Kornfelder vor allem waren es, an denen ich das Ganze als nicht nur schön, sondern auch als gemalt und gewollt empfand und erkannte, sie waren teils mit Neapelgelb, teils mit einer Mischung von Englischrot und viel Weiß gemalt. Es fehlten alle kalten und kühlen Farben, alles blieb innerhalb der Skala von Rot und Gelb.
Neben uns auf der Straße ging ein junger Mann, ein Franzose oder Welschschweizer, mit seiner Frau. Als ich meinen Begleiter so entzückt und eifrig auf den Durchblick aufmerksam machte, lächelte der Welsche mir freundlich-listig zu und sagte: »Ja, nicht wahr, nichts Kühles, lauter warme Farben; so etwa würde Cézanne sagen.« Ich nickte ihm glücklich zu, und es lag mir schon auf der Zunge, ihm die Farben des Bildes wie einem Kollegen aufzuzählen: Ocker, Neapelgelb, Englischrot, Weiß, ganz heller Krapplack und so weiter, doch schien mir das dann doch allzu intim oder kollegial, und ich unterließ es, aber ich lachte ihn an und freute mich, daß da noch einer war, der genau das gleiche sehe und das gleiche dabei empfinde und denke wie ich.
Aus dem Traume, der noch weiterging und völlig neue Szenen brachte, habe ich das Bild dieser warmen Zauberlandschaft aufbewahrt und trage es als Geschenk des Traumgottes in mir. Ihre Farben waren die Lieblingsfarben meiner Palette gewesen, als ich noch zuweilen mich als Maler-Dilettanten betätigte, sie hatten auch auf der Palette meines Freundes, des Malers Louis, eine Zeitlang dominiert. Und nun ist es wunderlich und ein wenig schade: wenn ich die im Traum gesehene ideale Landschaft, die so erregend schön, so wunderbar beglückend strahlte, mir nun im Wachen wieder aufbaue, ihre neapelgelben Kornfeldchen, die rötlich ragende Bergkirche, das ganze Spiel von warmen, gelben und rötlichen Tönen, die ganze märchenhafte und festliche Musik ihrer Palette: dann ist diese Landschaft zwar noch immer leuchtend, warm und schön, aber ein klein wenig allzu schön, ein klein wenig allzu rosig, ein klein wenig allzu harmonisch, ein klein wenig allzu nah am Süßen, ja am Kitschigen.
Und nun habe ich Mühe, mir das Geschenk unverdorben zu bewahren, es vor Skepsis und Kritik zu schützen, mich seiner Schönheit, die mich eine Traumsekunde lang so innig beglückte, auch weiterhin in der Erinnerung rein zu freuen. Sie ist mir nach dem Erwachen und beim Versuch, sie mir wieder genau vorzustellen, ein wenig zu schön, ein bißchen zu hübsch, ein bißchen zu ideal erschienen, und diese heimliche Kritik will sich nicht wieder zum Schweigen bringen lassen, oder doch nur für Augenblicke. Und war nicht in dem so sehr verständnisvollen Lächeln des welschen Kollegen, in seinem Wort über die Landschaft, das er unnötigerweise dem alten Cézanne in den Mund legte – war nicht in diesem sympathischen und kollegialen Lächeln des Künstlers oder Kenners, des Eingeweihten, auch etwas Listiges und Augurenhaftes gewesen?
(1946)
Des Deutenwollens müde...
... Du weißt, daß ich auch das Träumen unter Umständen zu den Dingen zähle, die ich Erlebnisse nenne. Ohne daß ich mit Freud und Jung gebrochen hätte, bin ich doch – Ausnahmen zugegeben – des Verstehen- und Deutenwollens müde geworden und zu der naiven und kindlichen Weise zurückgekehrt, mit der die Künstler die Welt und also auch die Traumwelt betrachten, als Erscheinung, als Bild, als Augen- und Sinnenerlebnis oder dann als groteskes Gedankenspiel. Ob ein Traum mich auf Trübungen meines Verhältnisses zu Freunden, auf Störungen in meinem seelischen Haushalt, auf baldigen Tod oder andre drohende Gefahren aufmerksam machen wolle, lasse ich gern ununtersucht; er muß schon stark anklopfen, wenn ich mich darauf einlassen soll. Aber wenn er mich zum Staunen über die Buntheit und Pracht seiner Kulissen und Kostüme, zum Entzücken über ideale Landschaften und Phantasiegärten, zur frohen Rührung über die Wiederkehr geliebter, lang verstorbener Menschen, zum Lachen über ein ausgelassenes Spielen mit gedanklichen, sprachlichen oder visuellen Kombinationen und Verrenkungen bringt, dann gehört ihm meine Aufmerksamkeit, meine Hingabe und Dankbarkeit.
Zwei kleine aparte Traumbruchstücke aus den letzten Tagen (nein, Nächten) will ich Dir ihrer Kuriosität wegen mitteilen.
Ich bin etwa zwanzigjährig und Buchhändler in Tübingen. Es ist, glaube ich, das erstemal, daß ich im Traum mit meinem damaligen Prinzipal, dem Herrn Sonnewald, zu tun habe. Er war ein noch junger, etwas lungenkranker, ein wenig ängstlich oder schüchtern wirkender Mann mit hellblondem Vollbart, verheiratet mit einer Engländerin, die während der dreieinhalb Jahre meiner dortigen Tätigkeit nicht ein einziges Mal unsre Räume im Erdgeschoß, den Buchladen, das Kontor und das Antiquariat, betreten hat, sondern unsichtbar mit drei hübschen kleinen Kindern eine Treppe höher in Räumen wohnte, die uns Unteren ebenso unbekannt und unbetretbar blieben wie ihr das Kontor. Im Traum nun war ich wieder der junge Untergebene und er der nicht gerade gefürchtete, aber doch in hohem Respekt stehende Herr Prinzipal, Herr sowohl unten im Laden wie oben in der Wohnung. Im Traum aber hatte er überdies ein privates Büro für sich allein, vor dessen Tür ich stand und anklopfte. Ich trat ein und sah ihn in einem erstaunlich großen, höchst komfortabel ausgestatteten Raume sitzen. Er hieß mich näher treten, er saß hinter einem riesigen Tisch, der voll großer Blätter lag, neben sich hatte er eine Staffelei stehen und auf ihr eines dieser Blätter aufgestellt, es war ein Aquarell, ein wenig an die meinen erinnernd, aber weit größern Formats, auch gekonnter und mit tief glühenden Farben. Ich stand und staunte bald das große Aquarell, bald den auf so ungewöhnliche Art beschäftigten Herrn Sonnewald an. Er schien zu merken, wie erstaunt und neugierig ich war, wußte auch sehr wohl, daß es mir nicht zustand, dieser Neugierde mit einer Frage Ausdruck zu geben, und verharrte eine gute Weile schweigend. Dann erbarmte er sich meiner, wies mit großer Gebärde erst auf den papierbedeckten Tisch, dann auf das schöne leuchtende Staffeleiblatt und sagte mit einiger Feierlichkeit: »Ich muß da ein Inselbändchen zusammenstellen.« Ob es hier um eine Auswahl meiner eigenen, durch Zauber verschönerten Malereien, ob um Werke eines mir unbekannten Malers ging oder gar er selbst der Urheber dieser Werke war und wie er dazu kam, im Auftrag des Inselverlags tätig zu sein, diese Fragen blieben offen.
Die andere Traumszene spielte in einem völlig veränderten Montagnola. Überraschend war hoher Besuch erschienen: André Gide stand da, wollte mich noch einmal sehen, war aber wortkarg und schlechter Laune und zog sich bald ins Gastzimmer zurück. Als er sich wieder zeigte, trat er mit mir vor die Haustür, vermutlich zu einem Spaziergang entschlossen, blieb aber dicht vor dem Haus stehen, zögerte wie im Nachdenken versunken und vollführte dann eine tiefe Kniebeuge. Aus dieser ohnehin schon mühsamen Stellung streckte er ein Bein nach vorn in die Luft, etwa wie slawische Tänze es verlangen, nur viel langsamer und feierlicher, es war ein unverkennbar religiöser, sakraler Akt, dessen Bedeutung ich nicht erraten konnte. Als er sich wieder aufgerichtet hatte, gab er mir eine Erklärung mit den Worten. »Alles ist. Alles ist nicht. Es ist indisch.« »Ah«, sagte ich, »also die coincidentia oppositorum.« Er starrte mich verloren an, offensichtlich überlegend, ob er mir zustimmen solle oder nicht, sagte aber nichts. Und plötzlich stand noch ein dritter Mann bei uns, ein sehr französisch aussehender Herr, brünett mit Schnurrbart, und alsbald war ich für Gide nicht mehr vorhanden, er begann mit seinem Landsmann zu plaudern und ging in lebhaftem Gespräch mit ihm fort. So ließ er mich stehen, ohne Erklärung, ohne Abschied, dem Pariser zuliebe. Es war nicht hübsch.
(1962)
Schreiben und Schriften
Mir träumte: ich saß auf einer stark tätowierten Schulbank, und ein mir unbekannter Lehrer diktierte mir das Thema zu einem Aufsatz, den ich schreiben sollte. Es lautete:
Schreiben und Schriften
Ich saß und dachte nach, ich besann mich auf einige der Regeln, nach denen ein Schüler sich beim Abfassen solcher Kunstwerkchen zu richten angewiesen war: Exposition, Aufbau, Gliederung, und habe dann, glaube ich, recht lange Zeit mit einem hölzernen Federhalter in ein Schulheft geschrieben, doch war mir beim Erwachen die Erinnerung an das Geschriebene unfaßbar gewesen und ließ sich auch seither nicht wieder erwecken. Übrig geblieben war von meinem Traume nur die Schulbank mit ihren Runen und ihrem splittrigen Rand, das linierte Heft und der Befehl des Lehrers, und ihm zu gehorchen spürte ich auch jetzt im Wachsein noch Lust. Ich schrieb also:
Schreiben und Schriften
Da der Traumlehrer nicht mehr da und seine Kritik nicht mehr zu fürchten ist, lege ich meiner Fleißarbeit keinen Plan zu Grunde, teile sie nicht in gleichmäßige Abschnitte und überlasse es dem Zufall, welche Form sie annehmen wird. Ich warte einfach auf die Bilder, Gedanken und Vorstellungen, lasse sie kommen, wie sie mögen, und unterhalte damit, Homo Ludens, mich und ein paar Freunde, so gut es gehen will.
Bei dem Wort »schreiben« denke ich zunächst nur an eine menschliche und mehr oder weniger geistige Tätigkeit, an das Malen oder Zeichnen oder Kritzeln von Buchstaben oder Hieroglyphen, an Literatur, an Briefe, Tagebücher, Rechnungen, an indogermanisch rationale oder ostasiatisch bildhafte Sprachen; der junge Josef Knecht hat einst ein Gedicht darüber gemacht. Anders ist es bei dem Wort »Schriften«. Das erinnert mich nicht nur an Feder, Stift, Tinte, Papier, Pergament, an Briefe oder Bücher, sondern ebensosehr an Spuren und Zeichen anderer Art, an »Schriften« der Natur vor allem, an Bilder und Formen also, die fern vom Menschlichen, ohne Geist, ohne Willen entstehen, die aber unsrem Geist Kunde geben vom Dasein großer und kleiner Mächte, die wir »lesen« können und die immer neu zum Gegenstand sowohl der Wissenschaft wie der Künste werden. Wenn ein kleiner Knabe in der Schule Buchstaben und Wörter schreibt, tut er es nicht freiwillig, will auch mit seinem Schreiben niemandem etwas sagen, und ist überdies bestrebt, seine Gebilde einem unerreichbaren aber mächtigen Ideal anzunähern: den schönen, makellosen, korrekten, vorbildlichen Buchstaben, die der Lehrer mit unbegreiflicher, schrecklicher und doch tief bewunderter Vollkommenheit an die Wandtafel gezaubert hat. »Vorschrift« nennt sich das, und gehört zu den vielen anderen Vorschriften moralischer, ästhetischer, denkerischer, politischer Art, zwischen deren Befolgung und Mißachtung unser Leben und Gewissen spielt und kämpft, deren Mißachtung uns oft sehr froh machen und Erfolg bedeuten kann, deren Befolgung aber, man plage sich, wie man wolle, immer nur eine mühsame und schüchterne Annäherung an das ideale Vorbild auf der Wandtafel sein kann. Die Schrift des Knaben wird ihn selbst enttäuschen und den Lehrer auch im besten Fall nie ganz befriedigen.
Wenn derselbe Schüler, solang er sich nicht beobachtet weiß, mit seinem kleinen, schlecht geschliffenen Taschenmesser seinen Namen in das alte spröde Holz der Schulbank zu schnitzen oder kratzen sucht – eine langwierige aber schöne Arbeit, mit der er schon seit Wochen in günstigen Augenblicken beschäftigt ist –, dann ist das ein ganz anderes Tun. Es ist freiwillig, es ist lustvoll, ist heimlich und verboten, hat keine Regeln einzuhalten und keine Kritik von oben zu befürchten, es hat auch etwas zu sagen, etwas Wahres und Wichtiges zu sagen, nämlich die Existenz und den Willen des Knaben kundzugeben und für immer festzuhalten. Überdies ist es ein Kampf und, wenn es gelingt, ein Sieg und Triumph, das Holz ist hart und hat noch härtere Fasern, es setzt dem Messer lauter Widerstände und Schwierigkeiten entgegen, und das Messer ist kein ideales Werkzeug, die Klinge schon etwas wacklig, die Spitze splittrig, die Schneide nicht mehr scharf. Eine große Erschwerung liegt auch darin, daß dies so geduldige wie kühne Arbeiten nicht nur vor den Augen des Lehrers verborgen, daß die Geräusche des Schneidens, Stechens und Kratzens auch seinen Ohren verheimlicht werden müssen. Das schließliche Ergebnis dieses zähen Kampfes wird etwas völlig anderes sein als die mit unlustigen Buchstaben bedeckten Zeilen im papiernen Heft. Es wird hundertmal wieder betrachtet, wird Quelle der Freude, der Genugtuung, des Stolzes sein. Es wird dauern und kommenden Geschlechtern von Friedrich und Emil künden, ihnen Anlaß zum Raten und Nachdenken geben und ihnen Lust machen, Ähnliches zu unternehmen.
Viele Handschriften habe ich mit den Jahren kennengelernt. Ich bin kein Schriftkundiger, doch hat mir das graphische Bild von Briefen und Manuskripten meistens etwas gesagt und bedeutet. Es gibt da Typen und Kategorien, die man nach einiger Erfahrung sofort erkennt, oft sogar schon an der Adresse auf dem Briefumschlag. Ähnlich wie die Handschriften von Schulkindern haben zum Beispiel die von Bettelbriefen eine unverkennbare Verwandtschaft und Gleichförmigkeit. Die Leute, die nur einmal und in dringender Not etwas erbitten, schreiben ganz anders als jene, denen das Schreiben von Bettelbriefen eine ständige Gewohnheit, ja ein Beruf geworden ist. Nur selten habe ich mich da getäuscht. Ach, und die wackligen Zeilen der schwer Behinderten, der Halbblinden, der Gelähmten, der im Spitalbett Liegenden mit bedenklicher Fieberkurve überm Kopfkissen! In ihren Briefen spricht das Zittern oder Schaukeln oder Hintaumeln der Wörter und Zeilen manchmal stärker, deutlicher und herzbeklemmender als der berichtende Inhalt. Und umgekehrt: wie beruhigend und freundlich sprechen Briefe mich an, in denen ganz alte Menschen noch einer heilen, festen, kräftigen und frohen Handschrift fähig sind! Sie kommen sehr selten, die Briefe dieser Art, aber es gibt sie, auch noch von Neunzigjährigen.
Von den vielen Schriften, die mir wichtig oder lieb wurden, war die merkwürdigste, keiner andern auf Erden ähnliche die von Alfred Kubin. Sie war ebenso unleserlich wie schön. Solch ein Briefblatt war bedeckt mit einem dichten, anregenden, graphisch höchst interessanten Netz von Strichen, dem vielversprechenden Gekritzel eines genialen Zeichners. Ich glaube nicht, daß ich jemals in einem Kubin-Brief jede Zeile habe entziffern können, auch meiner Frau ist das nie gelungen. Wir waren zufrieden, wenn uns zwei Drittel oder gar drei Viertel des Inhalts lesbar wurden. Und jedesmal mußte ich beim Anblick solcher Blätter an Stellen in Streichquartetten denken, wo durch manche Takte alle viere kräftig und wie berauscht drauflos und durcheinander kratzen, bis wieder die Linie, der rote Faden deutlich wird.
Viele schöne und wohltuende Handschriften sind mir vertraut und teuer geworden, ich notiere nur die goethisch-klassische von Carossa, die kleine, flüssige und kluge von Thomas Mann, die schöne, sorgfältige, schlanke von Freund Suhrkamp, die nicht ganz leicht lesbare, aber charaktervolle von Richard Benz. Wichtiger freilich und teurer wurden mir die Schriften meiner Eltern. So vogelfluggleich, so mühelos, so völlig gelöst und flüssig dahineilend und dabei so gleichmäßig und deutlich habe ich niemanden schreiben sehen wie meine Mutter, es fiel ihr leicht, die Feder lief von selber, es machte ihr und machte jedem Leser Vergnügen. Der Vater bediente sich nicht der deutschen Schrift wie die Mutter, er schrieb römisch, war auch ein Latein-Liebhaber, seine Schrift war ernst, sie flog und hüpfte nicht, floß nicht wie ein Bach oder Brunnen, die Worte waren genau von einander getrennt, man spürte die Pausen des Nachdenkens und der Wortwahl. Die Art, wie er seinen Namen schrieb, nahm ich mir schon in früher Jugend zum Vorbild.
Die Graphologen haben eine wunderbare Technik der Schriftdeutung erfunden und beinah bis zur Exaktheit vervollkommnet. Ich habe diese Technik nicht studiert oder gar erlernt, sah sie aber in vielen, oft schwierigen Fällen sich bewähren, und entdeckte nebenbei, daß zuweilen die Charaktere von Graphologen nicht auf der Höhe ihrer Verdienste um die Einsicht in menschliche Seelen standen. Es gibt übrigens auch gedruckte, auf Holz, Pappe oder Metall schablonierte oder in Emailschildern zur Dauer verurteilte Buchstaben und Zahlzeichen, die zu deuten wenig Mühe macht. Auf amtlichen Kundgebungen, auf Verbottafeln, auf Email-Nummernschildern in Eisenbahnwagen habe ich zuweilen Buchstaben und Zahlen bestaunt so blutlos, so schlecht, so ohne Liebe, ohne Leben, ohne Spiel, ohne Phantasie und Verantwortung erfunden und erquält, daß sie noch in der Vervielfältigung, im Blech oder Porzellan schamlos die Psychologie ihrer Erfinder verrieten.
Ich nannte sie blutlos, denn beim Anblick solcher Miß-Schriften fiel mir immer der Spruch aus einem berühmten Buche ein, den ich in meiner Jugend gelesen und der mich damals sehr gepackt und bezaubert hatte. Des Wortlauts bin ich nicht mehr ganz sicher, meine aber, es sei dieser gewesen: »Von allem Geschriebenen liebe ich am meisten, was einer mit seinem Blute schreibt.« Jenen amtlichen Buchstabengespenstern gegenüber war ich dann immer ein wenig geneigt, dem schönen Spruch eines Einsamen und Leidenden wieder zuzustimmen. Doch tat ich das nur für Augenblicke. Der Spruch, und ebenso meine jugendliche Bewunderung für ihn, stammte aus einer unblutigen und unheroischen Zeit, über deren Schönheit und Adel die in ihr Lebenden weit weniger im klaren waren als einige Jahrzehnte später. Wir haben dann lernen müssen, daß die Preisung des Blutes auch eine Schmähung des Geistes sein kann und daß die Leute mit der rhetorischen Begeisterung für das Blut meistens nicht ihr eigenes, sondern das Blut anderer Leute meinen.
Es schreibt aber nicht nur der Mensch. Es kann auch ohne Hände, ohne Feder, Pinsel, Papier und Pergament geschrieben werden. Es schreibt der Wind, das Meer, der Fluß und Bach, es schreiben die Tiere, es schreibt die Erde, wenn sie irgendwo die Stirn runzelt und damit einem Strom den Weg sperrt, ein Stück Gebirge oder eine Stadt wegfegt. Doch ist es freilich nur der Menschengeist, der alles von scheinbar blinden Kräften Gewirkte als Schrift, als objektivierten Geist also, anzusehen geneigt und fähig ist. Vom zierlichen Vogeltritt Mörikes bis zum Lauf des Nils oder Amazonas und des starren, unendlich langsam seine Formen verändernden Gletschers mag jeder Vorgang in der Natur von uns als Geschriebenes, als Ausdruck, als Gedicht, Epos, Drama empfunden werden. Es ist dies die Art der Frommen, der Kinder und Dichter, auch der echten Gelehrten, aller Diener des »sanften Gesetzes«, wie Stifter es genannt hat. Sie suchen nicht wie die Gewalt- und Herrenmenschen die Natur auszubeuten und zu vergewaltigen, sie beten auch nicht angstvoll deren Riesenkräfte an, sie möchten schauen, erkennen, staunen, verstehen, lieben. Ob ein Dichter dem Ozean oder den Alpen in Hymnen huldigt, ob ein Insektenforscher im Mikroskop das Netz kristallener Linien auf dem Flügel des winzigsten Glasflüglers beobachtet, es ist stets der gleiche Trieb und der gleiche Versuch, Natur und Geist als Brüder zusammenzubringen. Dahinter steht immer, ob bewußt oder nicht, etwas wie ein Glaube, etwas wie eine Gottesvorstellung, nämlich die Annahme, es werde das Ganze der Welt von einem Geist, einem Gott, einem Gehirn, dem unsern ähnlich, getragen und gesteuert. Die Diener des sanften Gesetzes machen sich die Erscheinungswelt dadurch verwandt und lieb, daß sie sie als Schrift, als Kundgebung des Geistes betrachten, einerlei, ob sie sich diesen Weltgeist als nach ihrem Bilde geschaffen denken oder umgekehrt.
Seid gepriesen, wunderbare Schriften der Natur, unbeschreiblich schön in der Unschuld eurer Kinderspiele, unbeschreiblich und unbegreiflich schön und groß auch in der Unschuld des Vernichtens und Tötens! Kein Pinsel keines Malers hat je so spielerisch, so liebevoll, so gefühlig und zärtlich die Leinwand gestreichelt wie der Sommerwind, wenn er das hohe wallende Gras oder das Haberfeld zu liebkosen, zu kämmen und zu zausen gelaunt ist oder mit taubenfederfarbenen Wölkchen spielt, daß sie wie in Reigen schweben und das Licht ihre zu Hauch verdünnten Ränder in winzigen Regenbögen von Sekundendauer entzündet. Wie spricht Vergänglichkeit und Flüchtigkeit allen Glückes, aller Schönheit in diesen Zeichen uns mit ihrem Zauber, ihrer sanften Trauer an, Schleier der Maya, wesenlos und zugleich Bestätigung allen Wesens!
Und wie der Graphologe die Schrift eines Humanisten, eines Geizkragens, eines Verschwenders, eines Draufgängers, eines Behinderten liest und deutet, so liest und versteht der Hirt und Jäger die Spuren des Fuchses, des Marders, des Hasen, erkennt seine Art und Familie, stellt fest, ob er sich wohl befinde und alle vier Pfoten unbehindert spielen, ob Wunden oder Alter ihm den Lauf erschweren, ob er müßig schlendert oder es eilig hatte.
Auf Grabsteinen, Denkmälern und Ehrentafeln schrieb Menschenhand mit sorgfältigem Meißel Namen, Preisungen und Zahlen der Jahrhunderte und Jahre. Ihre Botschaft reicht zu Kindern, Enkeln und Urenkeln, zuweilen noch viel weiter. Langsam wäscht am harten Stein der Regen, langsam ziehen die Spuren und Hinterlassenschaften von Vögeln, von Schnecken, von weither gewehtem Staub ihre Schicht als stumpfe Trübung über die Flächen, haften in den vertieften Runen, mildern ihre glatten klaren Formen und rüsten den Übergang des Menschenwerks in Werke der Natur, bis Algen und Moose sie überziehen und der schönen Unsterblichkeit den sanften langsamen Tod bereiten. In Japan, das einst ein vorbildlich frommes Land war, modern in tausend Wäldern und Schluchten unzählige Bildwerke, von Künstlern geschaffen, schöne heiterstille Buddhas, schöne gütige Kwannons, schöne ehrfürchtige Zen-Mönche in allen Zuständen des Verwitterns, des Hinüberschlummerns ins Gestaltlose, tausendjährige Steingesichter mit hundertjährigen Bärten und Locken aus Moos, aus Gras, aus Blumen und struppigem Gesträuch. Ein fromm gesinnter Nachkomme derer, die hier einst gebetet und Blumenopfer dargebracht haben, hat in unsern Tagen viele von ihnen in einem wunderbaren Bilderbuch gesammelt; nie habe ich aus seinem Lande, mit dem ich vielen Austausch pflege, ein schöneres Geschenk bekommen.
Alles Geschriebene erlischt in kurzer oder langer Zeit, in Jahrtausenden oder Minuten. Alle Schriften und aller Schriften Erlöschen liest der Weltgeist und lacht. Für uns ist es gut, einige von ihnen gelesen zu haben und ihren Sinn zu ahnen. Der Sinn, der sich aller Schrift entzieht und ihr dennoch innewohnt, ist immer einer und derselbe. Ich habe in meiner Aufzeichnung mit ihm gespielt, ich habe ihn um ein weniges verdeutlicht oder auch verschleiert, ich habe nichts Neues gesagt, wollte auch nichts Neues sagen. Viele Ahnende und Dichter haben es schon viele Male gesagt, jedesmal ein wenig anders, jedesmal ein wenig heiterer oder klagender, ein wenig bitterer oder süßer. Man kann die Vokabeln anders wählen und die Satzgefüge anders anlegen und verschränken, die Farben auf der Palette anders ordnen und verwenden, den harten Stift nehmen oder den weichen – zu sagen gibt es immer nur eines, das Alte, das Oftgesagte, Oftversuchte, das Ewige. Interessant ist jede Neuerung, spannend jede Revolution in Sprachen und Künsten, entzückend alle die Spiele der Artisten. Was sie damit sagen wollen, was sagenswert doch nie ganz sagbar ist, bleibt ewig eins.
(1961)
Tagebücher
Aus meinem Traumbuch
I
Ich schlug einen wenig gepflegten Waldweg ein, der mehr und mehr verwilderte. Ein voller Wind fuhr über die Kronen alter Eichen, die mit vielfach gekrümmten Ästen, obwohl einer weitab vom andern stehend, einander umarmten und nach Raum und Licht rangen. Oft fand ich auf dem schwarzen Waldboden scharfe Spuren kleiner Hufe, den Pfad der Quere schneidend, und einmal meinte ich im Halbdunkel eines nahen Dickichts den feinen Kopf eines Hirsches über die Laubwand erhoben zu sehen. Ich spähte und lauschte und stand manchmal lange still mit verhaltenem Atem, bis meinen oft getäuschten und immer neu erregten Sinnen der Wald voll von Wundern und schweigsamen Geheimnissen war. Ein breiter Bach ging brausend und über Stein und Moos talab. In seinen Rändern, wo er stiller floß, spiegelte sich unterhöhltes Wurzelwerk in krausen, zitternden Linien. In den Tiefen des Bettes, die oft von Wasserstürzen überwölbt waren, schwammen lautlos und dunkel die scheuen Forellen und verschwanden mit jäher Bewegung, sobald nur mein Schatten über ihren Schlupfwinkel hinwegstrich.
Dem fröhlichen Stürmer folgend, gelangte ich in ein wohlbekanntes Tai. An dessen Mündung bog ich um die vortretende Höhe und verließ den Bach, der zur andern Seite strebte und bald nur leise noch zu hören war. Ein junger Buchenstand, langsam sich lichtend, trat endlich ganz zurück und gab ein heimlich anmutendes Bild meinen Blicken frei. Mehrere Hügel streckten in ein breites Wiesental bewaldete Ausläufer vor. Vor mir lag in hohen Buchen ein dunkler Weiher, an dem ich als Knabe viele Mittagstunden verweilt hatte. Einzelne Laubbäume, schlank mit astlosen Stämmen und hohen, schmalen Kronen, spiegelten sich voll in der bräunlichen Fläche. Meine ersten Lebensträume waren an diesem Schilfufer über die Tiefe meiner Kinderseele gegangen, sich in der unbewegten Fläche spiegelnd. Die ersten wunderlichen Dichtergedanken hatte diese freundlich ernste Einsamkeit in mir erregt.
Ich beschattete meine Augen mit der Rechten und sog die milden Farben in mich, und die Stille und den Frieden, von dem mir schien, als hätte ich ihn dort bei den Lieblingsplätzen einer anderen Zeit zurückgelassen. Die trockenen Spitzen der Halme und Schilfblätter bewegten sich unregelmäßig mit einem feinen Geräusch, welches die Stille noch fühlbarer machte. Am jenseitigen Ufer entstieg dem warmen, feuchten Boden ein dünner Dampf, der die weiter liegenden Hügel mit dem hellen Himmel zu einer sanften Ferne verband. Und über den nächsten Hügelrücken ragte schlank und spitz der Turm der Klosterkirche. Dort begann auch bald ein reines, schönes Geläut.
Die langen Töne gingen in milden Wellen über mich hin.
Hinter dem Hügel wußte ich das Kloster stehen, wo ich zum erstenmal über Heute und Morgen denken lernte, wo ich zum erstenmal die herbe Süßigkeit des Wissens kostete und die süßeren Ahnungen verborgener Schönheit. Zum erstenmal vernahm dort mein empfindlicher Sinn die großen Namen, die wie Türme über meinen Träumen standen, die großen Namen des Themistokles und des Perikles und den größeren des Homer. Mein Geist sah die Wölbungen der Säle und die gotischen Fenster der Kreuzgänge deutlich vor sich, und es zog mich hinüber, die wehe Lust des Wiedersehens in vollen Zügen zu trinken. Aber ich blieb; ich fürchtete, mir das innere Bild zu zerstören; ich fürchtete, andere dort gehen zu sehen, wo ich in Träumen heimisch war. Die Sonne glänzte auf der Spitze des Turmes. Der Hügelrücken stand scharf und ernst zwischen hier und dort, zwischen mir und jenen glücklichen Dämmerungen.
Ich streckte grüßend die Hand aus und war im Innern bewegt. Dort lag ein Stück von mir verloren. Ich dachte an verlassene Tempel, an einen verflogenen Vogel, an Sterne, die gefallen sind.
Ein schmaler Brettersteg ragte in den Weiher. Ich beschritt das zitternde Gerüst und beugte mich, wie ich früher oft getan, über die Brüstung vor. Mein Spiegelbild lag ruhig im blanken Wasser und ich suchte an ihm die Züge, welche mich an das Gesicht erinnerten, das damals aus der Tiefe mich ansah.
Als mein Spiegelbild den fragenden Blick verschleierte, als ein schwerer Tropfen ins Wasser fiel und die klaren Umrisse des Bildes zitterten und zerrannen, merkte ich erst, daß ich weinte.
II
An einer schmalen Straße stehn
In langen Reihen die Zypressen
Und legen breite Schatten vor sich nieder.
In Tempeldämmerungen liegt
Der schmale Weg, darauf die Schatten
Sich überkreuz in strenger Wölbung bündeln.
Mein Traum wird bang und zwingt den Schritt
Beklommen wie ein Dieb und schweigend
In scheuem Takt den rätselvollen Weg hin.
Da schwimmt ein schwacher Veilchenduft
Mir lockend nach und weckt verwehend
Nach Licht und Tag und Menschenlaut mein Heimweh.
Es kennt mein Herz den weichen Duft,
Der einer andern Zeit ist eigen,
Da meine Träume andre Wege gingen.
Mein Traum kehrt um – und stockt – und sieht
Ein Weib in seinen Spuren wandeln,
Das mit erhobner Hand die Rückkehr weigert.
Er schweigt und neigt das Haupt und zwingt
Den Schritt die lange Straße weiter,
Darauf sich überkreuz die Schatten bündeln...
III
Die Nacht zog ihren Kreis enger um die Gärten; sie kam rasch und herrisch wie die Nächte des Südens. Nacheinander versanken Hügel, Gebüsch und Hain, bis auch die nahe stehenden Bäume sich vor meinen Blicken verhüllten und ein fremdes Ansehen gewannen.
Ich saß zu Füßen der Königin in dem weiten Halbrund einer offenen Halle. Die schweren Säulen hoben sich fest und ruhig, Wächtern gleich, von der matten Ferne ab; die Kapitäle standen rein und edel gegen den lichteren Himmel. Zwei rote Feuer brannten am Eingang in steinernen Becken, über uns hing eine runde silberne Ampel mit vier Flammen. Von drei Seiten hatte die schwere Nachtluft Zutritt und führte den Duft des wohlriechenden Öles in langsamen Wogen davon. Das Meer, dessen Geräusch am Tage nicht bis an Palast und Gärten reichte, sang gedämpft in gleichmäßigen Intervallen.
Der Gesang der Frauen war kaum verstummt, in der Luft lag noch ein Nachhall festlicher Melodien. Mir wurde eine fünfsaitige Laute gebracht; die Augen der Wartenden hingen an meinem Munde. Ich schloß die Augen und sog den Duft der Nacht und fühlte ihren Atem in meinem Haar. Mein Herz war voll wehen Glückes und meine Stimme zitterte, als ich zu singen begann. Mein Finger rührte an die feinen Saiten – ich hatte lange nimmer gesungen. Takt und Tonfall der Verse stieg mir neu und berückend zu Häupten.
Ich sang von einem vergangenen Sommer, da zum erstenmal mein Knabenauge an der Gestalt und dem Gange eines jungen Weibes hing. Und sang von den späten Abenden, da der Lindenduft schwoll und da ich mein wehes Verlangen mit wildem Ruderschlag über den schwarzen Weiher ruderte, da ich die Bänke und Wege und Treppen besuchte und alle Stätten, an denen ich die schlanke Wohlgestalt am Tage aus banger Ferne erblickt hatte. Ich gedachte der voll erblühten Rosenhecken und pries die schattigen Gänge, welche der Duft des Jasmin erfüllte.
Von den Frauen lächelten manche, und manche sahen mich mit ernsthaft großen Augen an. Als ich aber den Blick nach der Schönsten wandte, sah ich breite, bläuliche Lider über ihren Augen geschlossen und sah ihren Mund und die zarte Färbung der Wangen und die kurz gelockten Haare über der Stirn. Ich erblickte das Bild meiner ersten Liebe, schön und rein und verzaubert von Erinnerung und Heimweh, wie ich’s in Lieblingsträumen oft erschaute. Mir war das Herz erregt und schwer von Liedern und Sehnsüchten einer andern Zeit.
«Ich berührte die Hand der Königin« –
- »Erinnerst Du dich noch?«
Sie schlug die Augen auf-
»Bist Du nicht glücklicher als andre gewesen?«
Ich nickte mit dem Haupt und konnte das Auge nicht von den Lippen wenden, die Elisens Lippen waren.
»Bist Du nicht undankbar gewesen?«
Ich war traurig und mußte wieder das Haupt neigen...
IV
Ein Knabe mit schmalen Händen führte mich durch einen Garten. Seine nackten Füße traten weich in den Sand.
Ich hörte den Wind, und ich trank den lauen Duft, der in Wellen über die Erde ging.
Ich fühlte die Sonne auf meinen Schultern und Händen und schritt langsam die Terrasse empor.
Auf der erreichten Höhe stieß meine vorgestreckte Hand an die niedrige Mauer. Dort setzte ich mich und hörte tief mit dunklen Stimmen das Meer singen und den heimatlich einfachen Refrain der Brandung.
Ich wußte kleine Schiffe mit farbigen Segeln und schlanken Schnäbeln in der Ferne und das Meer am Horizonte silbern, und wenig aufragend in violetten Tönen das bewaldete Ufer der weit entfernten Insel. Dort mußten jetzt die rötlichen Mittagslichter glänzen und die hellen Felswände.
Und ich war blind.
(1898)
Singapur-Traum
Den Vormittag hatte ich zwischen den Gärten der Europäer auf den grasbewachsenen, laubig umrahmten Wegen Schmetterlinge gefangen, war in der weißen Mittagsglut zu Fuß in die Stadt zurückgegangen und hatte den Nachmittag mit Spazierengehen, Lädenbesuchen und Einkaufen in den schönen, lebendig wimmelnden Straßen von Singapur hingebracht. Nun saß ich im hohen Säulensaal des Hotels mit meinen Reisegefährten beim Abendessen, die großen Flügel der Fächer surrten fleißig in der Höhe, die weißleinenen Chinesenboys schlichen still und gelassen durch den Saal und trugen das schlechte englisch-indische Essen auf, das elektrische Licht blitzte in den kleinen schwimmenden Eisstückchen der Whiskygläser. Müde und ohne Hunger saß ich meinen Freunden gegenüber, schlürfte kaltes Getränk, schälte kleine goldgelbe Bananen und rief frühzeitig nach Kaffee und Zigarren.
Die andern hatten beschlossen, in einen Kinematographen zu gehen, wozu meine von der Arbeit in voller Sonne überangestrengten Augen keine Lust hatten. Dennoch ging ich schließlich mit, nur um für den Abend versorgt zu sein. Wir traten barhaupt und in leichten Abendschuhen vor das Hotel und schlenderten durch die wimmelnden Straßen in gekühlter blauer Nachtluft; in ruhigem Seitengassen hockten bei Windlichtern an langen rohen Brettertischen hunderte von chinesischen Kulis und aßen vergnügt und sittsam ihre vielerlei geheimnisvollen und komplizierten Speisen, die fast nichts kosten und voll unbekannter Gewürze stecken. Getrocknete Fische und warmes Kokosöl dufteten intensiv durch die von tausend Kerzen flimmernde Nacht, Rufe und Schreie in dunkeln östlichen Sprachen hallten in den blauen Bogengängen wider, geschminkte hübsche Chinesinnen saßen vor leichten Gittertüren, hinter denen reiche goldene Hausaltäre düster funkelten.
Von der dunkeln Brettertribüne des Kinotheaters blickten wir über unzählige langzopfige Chinesenköpfe hinweg auf das grelle Lichtviereck, wo eine Pariser Spielergeschichte, der Raub der Mona Lisa und Szenen aus Schillers Kabale und Liebe, alle in derselben seelenlosen Anschaulichkeit, vorübergeisterten, doppelt gespensterhaft in der Atmosphäre von Unwirklichkeit oder peinlicher Zweifelhaftigkeit, welche diese westlichen Angelegenheiten hier zwischen Chinesen und Malayen annehmen.
Meine Aufmerksamkeit war bald erlahmt, mein Blick ruhte zerstreut in der Dämmerung des hohen Saales aus, und meine Gedanken fielen auseinander und blieben leblos liegen wie die Glieder einer Marionette, die man im Augenblick nicht braucht und weggelegt hat. Ich senkte den Kopf in die aufgestützten Hände und war alsbald allen Launen meines denkmüden und mit Bildern gesättigten Gehirns preisgegeben.
Es umgab mich zunächst eine schwach murmelnde Dämmerung, in der ich mich wohl fühlte und über welche nachzusinnen ich kein Verlangen trug. Allmählich begann ich zu merken, daß ich auf dem Deck eines Schiffes lag, es war Nacht, und nur wenige Öllaternen brannten, neben mir lagen viele andere Schläfer Mann an Mann, jeder am Boden auf seiner Reisedecke oder Bastmatte hingestreckt.
Ein Mann, der mir zur Seite lag, schien nicht zu schlafen. Sein Gesicht war mir bekannt, ohne daß ich seinen Namen wußte. Er bewegte sich, stützte die Ellbogen auf, nahm eine goldene Brille ohne Ränder von den Augen und begann sie mit einem weichen, flanellenen Tüchlein sorgfältig zu reinigen. Da erkannte ich ihn; es war mein Vater.
»Wohin fahren wir?« fragte ich schläfrig.
Er putzte, ohne aufzublicken, an seiner Brille weiter und sagte ruhig: »Wir fahren nach Asien.«
Wir redeten Malayisch, mit Englisch vermischt, und dieses Englisch erinnerte mich daran, daß meine Kindheit lang vorüber sei, denn damals besprachen meine Eltern ihre Geheimnisse alle englisch, und ich verstand nichts davon.
»Wir fahren nach Asien«, wiederholte mein Vater, und plötzlich wußte ich alles wieder. Jawohl, wir fuhren nach Asien, und Asien war nicht ein Weltteil, sondern ein ganz bestimmter, doch geheimnisvoller Ort, irgendwo zwischen Indien und China. Von dort waren die Völker und ihre Lehren und Religionen ausgegangen, dort waren die Wurzeln alles Menschenwesens und die dunkle Quelle alles Lebens, dort standen die Bilder der Götter und die Tafeln der Gesetze. Oh, wie hatte ich das nur einen Augenblick vergessen können! Ich war ja schon so lange Zeit unterwegs nach jenem Asien, ich und viele Männer und Frauen, Freunde und Fremde.
Leise sang ich unser Reiselied vor mich hin: »Wir fahren nach Asien!« und ich gedachte des goldenen Drachens, des ehrwürdigen Bobaumes und der heiligen Schlange.
Freundlich sah mich mein Vater an und sagte: »Ich lehre dich nicht, ich erinnere dich nur.« Und indem er es sagte, war er nicht mein Vater mehr, sein Gesicht lächelte eine Sekunde lang genau so wie das Gesicht, mit welchem in den Träumen unser Führer, der Guru, zu lächeln pflegt, und im selben Augenblick erlosch das Lächeln, und das Gesicht war rund und still wie die Lotosblüte und glich genau dem goldenen Bildnis Buddhas, des Vollendeten, und wieder lächelte es, und es war das reife, schmerzliche Lächeln des Heilands.
Der neben mir lag und gelächelt hatte, war nicht mehr da. Es war Tag, und alle Schläfer hatten sich erhoben. Bestürzt raffte auch ich mich empor und irrte auf dem ungeheuren Schiff umher, zwischen fremden Menschen, und sah auf dem schwarz-blauen Meere Inseln mit wilden, gleißenden Kalkfelsen und Inseln mit wehenden hohen Palmen und tiefblauen Vulkanbergen. Kluge, braune Araber und Malayen standen mit vor der Brust gekreuzten mageren Händen, verneigten sich bis zum Boden und verrichteten die vorgeschriebenen Gebete.
»Ich habe meinen Vater gesehen«, rief ich laut, »mein Vater ist auf dem Schiff!«
Ein alter englischer Offizier in einem geblümten japanischen Morgenkleide sah mich aus hellblauen Augen glänzend an und sagte: »Ihr Vater ist hier und ist dort, er ist in Ihnen und außer Ihnen, Ihr Vater ist überall.«
Ich gab ihm die Hand und erzählte ihm, daß ich nach Asien fahre, um den heiligen Baum und die Schlange zu sehen und um in die Quelle des Lebens zurückzugehen, in welcher alles seinen Anfang nahm und welche die ewige Einheit der Erscheinung bedeutet. Aber ein Händler hielt mich eifrig an und nahm mich in Anspruch. Es war ein Englisch redender Singhalese, er zog aus einem Körbchen kleine Lappenbündel hervor, die er auseinanderwickelte und aus denen kleine und große Mondsteine zum Vorschein kamen.
»Nice moonstones, Sir«, flüsterte er beschwörend, und da ich mich heftig abwenden wollte, legte jemand eine leichte Hand auf meinen Arm und sagte: »Schenken Sie mir ein paar Steinchen, sie sind wirklich hübsch.« Die Stimme fing mein Herz alsbald ein wie eine Mutter ihr entlaufenes Kind, ich wandte mich glühend um und begrüßte Miß Wells aus Amerika. Unbegreiflich, daß ich sie so ganz hatte vergessen können!
»O Miß Wells«, rief ich erfreut, »Miß Anni Wells, sind Sie denn auch hier?«
»Wollen Sie mir einen Mondstein schenken, Deutscher?«
Ich griff schnell in die Tasche und zog den langen gestrickten Geldbeutel hervor, den ich als Knabe von meinem Großvater bekommen und als Jüngling auf meiner ersten Italienreise verloren hatte. Es war mir lieb, ihn wiederzuhaben, und ich schüttete eine Menge silberner Ceyloner Rupien heraus; aber mein Reisekamerad, der Maler, von dem ich nicht gewußt hatte, daß er noch da sei und neben mir stehe, sagte lächelnd: »Die können Sie als Hosenknöpfe tragen, sie gelten hier keinen Cent.«
Verwundert fragte ich ihn, wo er herkomme und ob er die Malaria wirklich überwunden habe. Er zuckte die Achseln und sagte: »Man sollte die modernen europäischen Maler alle einmal in die Tropen schicken, da könnten sie sich ihre Orangepalette wieder abgewöhnen. Gerade hier kommt man mit einer dunkleren Palette der Natur viel näher.«
Es war klar, und ich stimmte lebhaft bei. Aber die schöne Miß Anni hatte sich inzwischen im Gedränge verloren. Beklommen ging ich auf dem riesigen Schiffe weiter, wagte jedoch nicht, mich an einer Gruppe von Missionsleuten vorbeizudrängen, die im Kreise sitzend die ganze Deckbreite versperrten. Sie sangen ein frommes Lied, in das ich bald einstimmte, da ich es von Hause her kannte:
Darunter das Herze sich naget und plaget
Und dennoch kein wahres Vergnügen erjaget...
Ich war damit einverstanden, und die schwermütig pathetische Melodie stimmte mich traurig, ich dachte an die schöne Amerikanerin und an unser Reiseziel Asien und fand so viel Ursache zur Ungewißheit und Kümmernis, daß ich einen der Missionare fragte, wie denn das nun sei, ob sein Glauben denn wirklich gut und auch für einen Mann wie mich zu brauchen sei. »Sehen Sie«, sagte ich trostbegierig, »ich bin Schriftsteller und Schmetterlingssammler...«
»Sie irren sich«, sagte der Missionar.
Ich wiederholte meine Erklärung. Aber auf alles, was ich sagen mochte, gab er mit einem hellen, kindlichen, bescheiden triumphierenden Lächeln dieselbe Antwort: »Sie irren sich.«
Verwirrt floh ich davon. Ich sah, daß ich hier nicht zurecht kam, und ich beschloß, auf alles zu verzichten und meinen Vater zu suchen, der würde mir gewiß helfen. Wieder sah ich das Gesicht des ernsten englischen Offiziers und glaubte seine Worte zu hören: »Ihr Vater ist hier und ist dort, er ist in Ihnen und außer Ihnen.« Ich begriff, daß dies eine Mahnung war, und ich kauerte mich nieder, um mich zu versenken und meinen Vater in mir selbst zu suchen.
So saß ich still und versuchte zu denken. Allein es ging schwer, die ganze Welt schien auf diesem Schiffe versammelt, um mich zu stören. Auch war es furchtbar heiß, und ich hätte gerne meines Großvaters gestrickten Geldbeutel für einen frischen Whisky Soda hingegeben.
Von diesem Augenblick an, wo sie mir zum Bewußtsein gekommen war, schien diese satanische Hitze beständig anzuschwellen wie ein furchtbarer, unerträglich gellender Klang. Die Menschen verloren alle Haltung, sie soffen aus Korbflaschen gierig wie Wölfe, sie machten es sich auf die seltsamsten Arten bequem, und es geschahen rings um mich her unbeherrschte und sinnlose Taten; das ganze Schiff war offenbar im Begriff, wahnsinnig zu werden.
Der freundliche Missionar, mit dem ich mich nicht hatte verständigen können, war zwei riesengroßen chinesischen Kulis zum Opfer gefallen und wurde von ihnen auf das schamloseste als Spielzeug benützt. Sie wußten ihn durch einen heillosen Kunstgriff echt chinesischer Mechanik dazu zu bringen, daß er auf einen Druck hin seine gestiefelten Füße zu seinem eigenen Mund herausstreckte. Auf einen anderen Druck hin hing er beide Augen lang wie Würste aus den Höhlen, und als er sie wieder zurückziehen wollte, sah er sich dadurch verhindert, daß sie ihm Knoten darein geschlungen hatten.