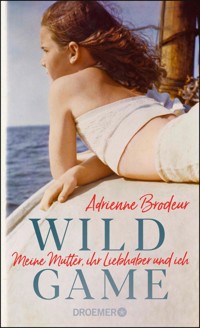19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Roman über eine komplizierte Familie und lang gehütete Geheimnisse Sommer auf Cape Cod. Alle Mitglieder der Familie Gardner verheimlichen etwas. Ken, ein erfolgreicher Geschäftsmann mit Vorzeigefamilie und politischen Ambitionen, versucht mit aller Macht, seine Ehekrise zu verbergen. Abby ist Künstlerin und schämt sich dafür, immer noch auf das Wohlwollen ihres Bruders angewiesen zu sein. Adam, der Vater der zwei, sieht unterdessen seinem 70. Geburtstag entgegen. Um ein letztes Mal als Forscher zu glänzen, setzt der brillante Meeresbiologe heimlich seine Medikamente ab - mit fatalen Konsequenzen. Während Adams Festtag unaufhaltsam näher rückt, verschärfen sich die Konflikte zwischen den Geschwistern. Dann erscheint eine Unbekannte auf der Bildfläche, und bringt alles, woran Abby und Ken geglaubt haben, zum Einsturz. «Ein mitreißender und geschickt erzählter Roman.» New York Times «Eine perfekte Sommerlektüre.» Washington Post «Wunderschön, poetisch und ehrlich.» Miranda Cowley Heller, Autorin von Der Papierpalast
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Adrienne Brodeur
Treibgut
Roman
Über dieses Buch
Keramikscherben im Sand, einsame Trampelpfade und der Gesang der Wale: Die Landschaft Cape Cods und die einsamen Nachmittage am Strand haben Abby Gardner und ihre Kunst tief geprägt. Kurz vor ihrem großen Durchbruch entdeckt sie, dass sie schwanger ist. Abby muss sich entscheiden: Wer will sie sein – als Künstlerin, als Frau, als Mutter? Und auf wen kann sie zählen?
Ken, Abbys Bruder, scheint sie stets übertrumpfen zu wollen – als erfolgreicher Immobilienunternehmer und als Sohn. Was Abby nicht weiß: Ken steckt in einer tiefen Identitätskrise. Seine Ehe hängt am seidenen Faden, den frühen Tod der Mutter hat er nie verwunden. Ihr Vater Adam wiederum ist Ozeanograf und hat sich schon immer mehr für Buckelwale interessiert als für seine Kinder.
Je dichter Adams 70. Geburtstag rückt, desto mehr spitzen sich die Konflikte zwischen Abby und ihrem Bruder zu – bis zwei lang gehütete Geheimnisse die Familie Gardner für immer zu entzweien drohen.
«Ein mitreißender und geschickt erzählter Roman.» New York Times
«Eine perfekte Sommerlektüre.» Washington Post
Vita
Adrienne Brodeur ist Geschäftsführerin von Aspen Words, einer literarischen Non-Profit-Organisation, und Mitbegründerin der Literaturzeitschrift «Zoetrope», zusammen mit Francis Ford Coppola. Sie war Lektorin in einem großen Verlag, Jurorin des National Book Award und hat Essays in u. a. «Vogue» und «The New York Times» veröffentlicht. Ihr Memoir «Wild Game» war ein New York Times Best Seller und ist als Netflix-Film in Vorbereitung. Adrienne Brodeur pendelt zwischen Cambridge und Cape Cod, wo sie mit ihrer Familie lebt.
Karen Witthuhn übersetzt nach einem ersten Leben im Theater seit 2000 Theatertexte und Romane, u. a. von Simon Beckett, D.B. John, Ken Bruen, Sam Hawken, Percival Everett, Anita Nair, Alan Carter und George Pelecanos. 2015 und 2018 erhielt sie Arbeitsstipendien des Deutschen Übersetzerfonds.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel «Little Monsters» bei Avid Reader Press/Simon & Schuster, US.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg «Little Monsters» Copyright © 2023 by Adrienne Brodeur
Redaktion Anne Nordmann
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg, nach dem Original von Simon & Schuster UK
Coverabbildung Strand bei Ebbe (Ausschnitt). Gemälde von Frederick Milner 1890. Private Collection Photo © The Maas Gallery; Kinder am Strand (Ausschnitt). Gemälde von Charles Garabed Atamian. Private Collection/Bridgeman Images
ISBN 978-3-644-01849-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Lauren Wein
Wenn du das Familienskelett nicht loswirst,
kannst du es auch tanzen lassen.
George Bernard Shaw
Ken
Als das Telefonat mit seinem Anwalt beendet war, senkte Ken Gardner den Kopf, faltete die Hände zum Gebet, drückte die Daumen gegen die Stirn und ließ die Bedeutung dessen, was gerade geschehen war, auf sich wirken: Der Deal war unterzeichnet.
«Danke», flüsterte er. «Danke, Brian.» (Sein Geschäftspartner.) «Danke, Phil.» (Sein Anwalt.) «Danke, Stefan.» (Sein Geldgeber.) «Danke, Gott.» Er sah, dass heute der 7. April war, und prägte sich das Datum ein. Ken würde 2016 mehr Geld verdienen, als er es für sein gesamtes Leben erwartet hatte. Der Gedanke an das Finanzamt machte ihn nervös, aber Phil würde die Schlupflöcher schon finden. Dafür wurde er bezahlt. Und er war genial darin.
Erst einmal würde Ken sich auf das Positive konzentrieren. Genau in diesem Moment floss elektronisches Geld von einem Konto auf ein anderes. Genauer gesagt auf das Konto einer Strohfirma, die Phil zu diesem Zweck gegründet hatte. Ken konnte das herrlich rhythmische Geräusch von raschelnden Geldscheinen geradezu hören, als würde ein Bankautomat sie auswerfen. Er saß allein hinter seinem großen, aufgeräumten Schreibtisch in dem, was seine Zwillingstöchter «Kommandozentrale» getauft hatten, ein Hightech-Arbeitsraum auf seinem Grundstück mit Blick über den Stage Harbor in Chatham.
«Danke», sagte er wieder.
Durch das Einheiraten in eine der alten Bostoner Brahmin-Familien – die stolz darauf waren, ihre Vorfahren bis zum puritanischen Klerus der alten kolonialen Herrscherklasse im siebzehnten Jahrhundert zurückverfolgen zu können – verfügte Ken ohnehin schon über Status und Geld, jede Menge sogar. Aber dieser Deal schuf ein neues Gleichgewicht. Er würde sich seiner Frau nicht mehr verpflichtet fühlen. Er stand nun auf eigenen Beinen, dieses Geld gehörte ganz allein ihm. Na ja, nicht ganz ihm. Sein Schwiegervater war der Privatinvestor, der die Kohle überhaupt zur Verfügung gestellt hatte, aber genau das war Theodore Lowells Geschäftsmodell: das Familienvermögen investieren. Es würde Ken großes Vergnügen bereiten, dem alten Herrn alles zurückzuzahlen. Die Familie Lowell würde an diesem Deal viel Geld verdienen, vielleicht genug, um zur Abwechslung einmal ihm, Ken, dankbar zu sein. Wahrscheinlich nicht. Aber das war letztlich egal: Der Gewinn gehörte allein ihm.
Sein Körper kribbelte, als würde er unter Strom stehen, sein Geist schien zu schweben, er hatte das Gefühl, er würde sich selbst von oben betrachten: Er war Quarterback und Zuschauer zugleich. Eben noch stand er auf dem Spielfeld, im nächsten Moment saß er auf der Tribüne. Auf dem Feld. Auf der Tribüne. Feld. Tribüne. Obwohl Ken seit Monaten wusste, dass alle Zeichen auf Grün standen und der Deal durchgehen würde, war der Unterschied zwischen seinen Erwartungen und der Realität größer als gedacht. So fühlte sich Macht an. Vermischt mit etwas anderem: Erleichterung. Verdammte. Riesen. Erleichterung. All die Jahre der Planung, Arbeit und Disziplin waren nicht umsonst gewesen. Jetzt lachte niemand mehr über ihn.
Ken sprach ein schnelles Gebet. Bevor er und Jenny geheiratet hatten, war er zum Episkopalismus konvertiert – wenn man den Wechsel von nichts zu etwas als Konvertieren bezeichnen konnte. Sein Schwiegervater hatte ihm dies nahegelegt und die Vorteile betont: Mitgliedschaften in verschiedenen Countryclubs, ein finanzkräftiges Netzwerk, politische Verbindungen. «Falls du es noch nicht weißt, mein Junge, Gott ist ein Episkopaler aus Boston», hatte Theo gescherzt.
Aber zu Theos Überraschung hatte Ken das Gelübde ernst genommen und im Lauf der Jahre eine solide persönliche Beziehung zu Gott entwickelt. Er betete jeden Abend, ging sonntags zum Gottesdienst und erlegte sich Regeln auf, die dafür sorgten, dass er bestimmte Grenzen einhielt. Gucken war erlaubt, Anfassen nicht, war so ein Beispiel. Ken war sicher, dass Gott Verständnis für niedere männliche Bedürfnisse hatte, schließlich hatte Gott den Mann nach seinem Ebenbild geschaffen. Also hatte Ken einen Deal ausgehandelt, einen Deal, mit dem er leben konnte und mit dem er seine Frau seiner Meinung nach nicht betrog. Er gestand sich den regelmäßigen Konsum von Pornos zu – welcher echte Amerikaner tat das nicht? –, aber Besuche in Stripclubs waren nur auf überregionalen Geschäftsreisen erlaubt und Lapdance lediglich zu besonderen Anlässen.
Ken boxte in die Luft. «Yes. Yes. Yes», wiederholte er so lange, bis sich die Worte zu einem schlangenähnlichen Zischen verbanden, ein Geräusch, das ihn in den Biologieunterricht der sechsten Klasse und einen Raum voller Reptilien und Amphibien zurückversetzte. Er stand mit einem Skalpell in der Hand über einen Frosch gebeugt, aber während die anderen Kinder lossäbelten, spürte er, wie ihm kotzübel wurde. Schon nach ein, zwei Sekunden hatte er sich gefasst, atmete tief durch und legte die Klinge an den Frosch. Aber in diesen beiden Sekunden war alles verloren. Danny McCormick, der beliebteste Junge in der Klasse, hatte sein Zögern bemerkt, und damit war Kens Ruf als Versager in der Mittelstufe besiegelt, wie zuvor schon auf der Grundschule, wo er gehänselt worden war, weil er keine Mutter hatte und schnell weinte, aber vor allem, weil er fett war.
Tja, wer heult jetzt, Danny McCormick?
Ken hatte die Einkommensverhältnisse des Arschlochs immer im Blick behalten, ab jetzt würde er sie nur noch im Rückspiegel sehen. Das Adrenalin rauschte durch seine Adern, er sprang auf. Er spürte die Situation physisch, als würde sich zusammen mit seinem Bankkonto auch sein Körper ausdehnen. Soeben war er dem Club von Männern beigetreten, denen die Welt gehörte und die sich kaufen konnten, was ihr Herz begehrte: eine zweitausend Dollar teure Flasche Wein, einen Ferrari, eine Loge in Fenway Park.
Ken hatte schon immer reich sein wollen, aber wie die meisten Menschen nicht gewusst, wie er das anstellen sollte, außer immer schneller im Hamsterrad zu rennen. Nach dem College hatte er ein mehr als durchschnittliches Einkommen durch den Verkauf von Immobilien verdient, aber das große Geld war es nicht. Erst als Jenny in sein Leben getreten war und ihr Vater ihn ermutigt hatte, größer zu denken, hatte er begonnen, in einer anderen Liga zu spielen.
«Um es mit Yogi Berra zu sagen, mein Junge», hatte Theo geraunt, «ein Nickel ist auch keinen Dime mehr wert.» Auf Kens verständnislosen Blick hin fügte er hinzu: «Wenn du zur Familie gehören willst, musst du anfangen, wie ein Lowell zu denken. Und das bedeutet groß. Vergiss Häuser, Ken, bau Siedlungen. Wie sieht der nächste Wohntrend aus? Das ist die Frage, die du dir stellen musst.»
Bei diesen Worten hatte es klick gemacht. Der nächste Trend war offensichtlich. Ken hatte die Demografiestatistik analysiert und wusste, dass fast fünfzig Millionen Menschen im Land älter als fünfundsechzig waren. Eine Zahl, die sich in den nächsten zwanzig Jahren noch einmal um die Hälfte erhöhen würde. Ka-tsching. Also hatte er mit nur einunddreißig Jahren ein Stück Land gekauft – siebenstellig unterstützt von seinem Schwiegervater und mit einer einmaligen Vision: einen hochmodernen Seniorenwohnsitz für anspruchsvolle und steinreiche Rentner zu bauen. Ein Platz, der rein gar nichts mit gewöhnlichen Altenheimen für Normalo-Omas gemein haben würde.
Von Anfang an hatte Ken sich auf dieses eine Prozent der pensionierten Bevölkerung konzentriert und war überzeugt gewesen: Wenn er bei der Entwicklung beeindruckender Prototypen für Häuser und Siedlungen keine Kosten scheute – Anlagen, die nicht nur Nachhaltigkeit versprachen, sondern auch die allerneuste Technologie boten und die Planung von Außenflächen mit gesundheitsorientierten und ergonomisch durchdachten Innenbereichen verbanden –, dann würden wohlhabende Senioren Schlange stehen, um ihr Geld hinzublättern. Kens Mutter war Architektin gewesen, und Ken redete sich gern ein, dass er ihren Sinn für Proportionen, Raum und Licht geerbt hatte.
Zehn lange Jahre des Verhandelns, Finanzierens, Entwerfens und Marketings später hatte sich sein Einsatz gelohnt. Seine Designs hatten nicht nur jeden Architekturpreis am Markt gewonnen, sie waren auch in tonangebenden Architekturzeitschriften für ihre «innovative und sinnvolle Ästhetik» und ihr «perfektes Augenmaß für Form und Funktion» gelobt worden. Ja, seine Mutter wäre stolz gewesen. Vor allem – wie sein Anwalt gerade bestätigt hatte – war es Ken gelungen, seine ursprüngliche Vision für eine elitäre Seniorenresidenz auf Cape Cod in ein praktikables Geschäftsmodell zu übertragen, das sich in allen finanzstarken Postleitzahlen des Landes beliebig duplizieren ließ. Was Melvin Simon in den 1980ern für die Einkaufszentren getan hatte, würde Ken Gardner jetzt mit Seniorenwohnanlagen wiederholen. Und mit dem Gewinn würde er seine politische Karriere in Gang bringen. 2018 würde er sich für das Repräsentantenhaus aufstellen lassen, so der Plan. Danach für den Senat. Und dann … Nun, das behielt er lieber noch für sich.
«Alexa, ruf Jenny an», sagte Ken.
Die Mailbox seiner Frau sprang an.
«Babe, wo bist du? Ruf mich an, wenn du das hier hörst. Ich habe gerade abgeschlossen. Jetzt ist es real. Ich will feiern.» Unverhofft verspürte er Erregung, das alte Zusammenspiel von Adrenalin, Aufregung und Blutgefäßen. Schon jetzt verschob sich das Machtgefälle in seiner Ehe. «Ich will mich in Boston mit dir treffen. Sag der Babysitterin, sie muss über Nacht bei den Mädchen bleiben. Und akzeptier kein Nein. Zahl ihr das Dreifache oder was auch immer. Reservier uns ein Zimmer im Ritz, wir sehen uns um sieben an der Bar.» Ein tolles Gefühl, so mit Jenny zu reden.
«Alexa, ruf Abby an.»
Wieder die Mailbox. Ken legte auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Wahrscheinlich besser so, dachte er. Abby würde nicht wirklich verstehen, wie bedeutsam das Ganze war, vermutlich würde sie irgendeine blöde Bemerkung von sich geben. Irgendwas Scheinheiliges wie: «Oh, wie schön, Ken. Das Wichtigste ist, dass es dich glücklich macht.» Und Ken würde sie dafür umbringen wollen. Abby konkurrierte mit ihm, indem sie Gleichgültigkeit vortäuschte. Was, wie er zugeben musste, eine verdammt brillante Strategie war. Er konnte nicht gewinnen. Sie war genau wie ihr Vater mit ihrer moralischen Überlegenheit und dem Gerede von sinnhafter Arbeit. Natürlich drückten die beiden es nie so aus, taten aber so, als wäre Geldverdienen irgendwie vulgär und unter ihrer Würde. Aber zu wem rannten sie, wenn sie Hilfe brauchten? Ken finanzierte seine Schwester seit Jahren, indem er ihr das Studio seiner Mutter mietfrei überließ (das eigentlich ihm gehörte), und seinem Vater lieh er gelegentlich Geld.
Ken beschloss, die Neuigkeit so lange für sich zu behalten, bis er entschieden hatte, wie er sie am besten verkünden sollte. Nur, wie konnte das aussehen? Er könnte beim nächsten Familiendinner im Lamborghini vorfahren (nicht wirklich sein Stil). Oder die ganze Sippschaft auf eine Luxusreise nach Tahiti einladen. Oder – das war jetzt wirklich eine gute Idee – er konnte seinem Vater zu dessen bevorstehendem siebzigsten Geburtstag ein extravagantes Geschenk machen, so übertrieben, dass sich die alte linke Socke die Tiraden gegen Kapitalismus, Religion und Freiheit vielleicht verkneifen würde.
Ken griff in seine Hosentasche, zog seinen Glücksgolfball heraus und platzierte ihn sorgfältig auf seiner Putting-Matte, einem langen, schmalen grünen Rechteck, das fast die ganze Länge der Kommandozentrale einnahm. Er wackelte mit dem Schläger, dessen Sweetspot höchstens so groß war wie ein Nickel, und machte sich bereit. Konzentrier dich, ermahnte er sich. «Hör zu, du kleiner Scheißer», sagte er zu dem Ball. «Du bist nur zu einem Zweck auf dieser Erde: um in das Loch da zu rollen.» Ken fokussierte, zog den Golfschläger ein Stück zurück und versetzte dem Ball einen kontrollierten Schlag, der ihn in einer geraden Linie über den leichten Anstieg und in das Loch rollen ließ. Yes!
«Alexa, stell den Computer ab. Mach das Licht aus. Jalousien hoch.»
Während die Jalousien nach oben surrten, blinzelte Ken in das morgendliche Sonnenlicht, das auf den Wellen in der Bucht glitzerte. Dann fiel sein Blick auf die offen daliegenden Wurzeln eines Strauchs auf der Uferböschung. Trotz des Vermögens, das er auf eine stabile Grundstücksbegrenzung verwandt hatte, schien die Natur zu gewinnen.
«Alexa, spiel ‹Like a Rolling Stone› von Bob Dylan.»
Das Lieblingslied seiner Mutter. Er dachte zurück an seine Kindheit, daran, wie er auf ihren Füßen mitgetanzt hatte, und verspürte Sehnsucht.
«Alexa, lauter», sagte er. Seine Mutter war seit achtunddreißig Jahren tot – seit er dreieinhalb gewesen war. Warum er plötzlich ständig an sie dachte, war ihm ein Rätsel. Er musste seinen verdammten Seelenklempner feuern. Verletzlichkeit wurde überbewertet. Aber dann spürte Ken die Nähe seiner Mutter, und sein Herz schwoll an, was er als ihre Zustimmung zu seinem Erfolg deutete. Emily Gardner freute sich für ihn. Sie war stolz auf seine Leistungen, das konnte er fühlen. Ken erinnerte sich noch, wie sie ihn immer auf den Kopf geküsst und gesagt hatte: «Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt.» Das hatte sie auch in sein Exemplar von Wo die wilden Kerle wohnen geschrieben, das er versteckt in der linken unteren Schublade seines Schreibtischs aufbewahrte, um es von Zeit zu Zeit hervorzuholen und mit den Fingern über die Worte zu streichen, die sie nur für ihn geschrieben hatte. Manchmal fühlte es sich so an, als wäre die Gewissheit, dass seine Mutter ihn mehr als alle anderen geliebt hatte, alles, was er hatte.
Als das Lied zu Ende war, öffnete Ken die Tür der Kommandozentrale und atmete die Gerüche des Hafens ein – das Salzwasser, die Algen, die Abgase eines Fischerboots. Gerade kam die Flut, erst langsam, eine täuschend dünne Wasserschicht, die über den Strand strich. Schon bald würde sie stärker werden und vor nichts haltmachen, bis der Hafen randvoll gelaufen war. Dann, nach einem Moment des Stillstands, würde sie umkehren, durch den Kanal ablaufen und Teile von Kens kostbarem Küstenabschnitt mit sich reißen. Er beschloss, sich von dem Gedanken an die Erosion nicht die Laune verderben zu lassen.
Am Himmel schob der Wind elfenbeinfarbene Wolken auf silberumrandete Berge zu, und bei dem Anblick fühlte sich Ken erhaben, als würde er in diesem einen Augenblick verstehen, was im Leben wichtig war. Als er aber versuchte, das Gefühl zu fassen, verflüchtigte es sich wie ein Traum. Egal. Er schmiss eine zusammengeknüllte To-do-Liste in den Papierkorb – Treffer! – und wandte seine Gedanken den greifbaren Dingen zu: weitere Pflanzungen, um die Uferböschung zu stabilisieren, die Suche nach Standorten für die nächsten drei Gardner-Seniorensiedlungen und die Kapitalbeschaffung für seine Wahlkampagne. Mit diesem Deal standen Ken alle Türen offen. Er boxte in die Luft. Er war unerreichbar.
Abby
Fünfzehn Minuten zu spät und deshalb sauer auf sich selbst, bog Abby auf den kleinen Parkplatz oberhalb von Coast Guard Beach in North Truro ab. Das war ein Interview, Herrgott noch mal. Sie selbst hatte vorgeschlagen, sich hier zu einem Strandspaziergang zu treffen, und dann schaffte sie es nicht mal, pünktlich zu sein. Das Porträt von ihr, das landesweit in einer namhaften Kunstzeitschrift erscheinen würde, war eine große Sache. Wie auch ihre Teilnahme an der Gruppenausstellung im Institute of Contemporary Art im kommenden Oktober, wo ihre Arbeit im Rahmen einer Schau mit dem Titel «Identität und Selbstporträt» gezeigt werden würde.
Die Welt der zeitgenössischen Kunst war viel zentrierter, als vielen Leuten bewusst war, und wer nicht in einer der großen Kunststädte lebte – New York, Los Angeles, Miami –, hatte selten Erfolg. Wer zur Kunstszene gehörte, wusste das. Aber wer außen stand – wie Abbys Vater und Bruder –, fand es lächerlich. Farbe. Pinsel. Leinwand. Konnte man damit nicht überall rumwerkeln? Wie sollte man zwei Männern, denen Zuhören nicht gegeben war, erklären, dass man für Händler, Kritiker, Käufer und andere Künstler vor allem gut erreichbar sein musste, um sich in der Kunstwelt durchzusetzen? Atelier und Kunstwerke mussten der Öffentlichkeit zugänglich sein, was auf diesem Streifen Sand mit einer einzigen größeren Straße nicht ganz einfach war. Aber auch wenn Abby weit ab vom Schuss lebte, genoss sie einen Vorteil, den viele andere Künstlerinnen nicht hatten: das Arcadia, ihr wunderbares Atelier in den Dünen, entworfen und erbaut von ihrer Mutter. Sie wohnte dort auch, es gab ein kleines Schlafzimmer mit Bad im hinteren Teil des Hauses. Mehr brauchte sie nicht.
Abby betrachtete sich rasch im Rückspiegel, setzte eine Strickmütze auf und zog ein paar Haarsträhnen glatt. Besser.
Fridas Schwanz klopfte laut gegen Beifahrersitz und Tür. «Warte kurz», sagte Abby und tastete unter dem Sitz nach der Leine, bis ihr einfiel, dass sie sie am Haken neben der Eingangstür hatte hängen lassen. Stattdessen bekam sie einen Kotbeutel zu fassen, der inmitten von Müll im Fußraum vor dem Beifahrersitz lag. Die Reporterin vom Art Observer-Magazin würde hoffentlich nicht merken, wie durcheinander sie war.
Rachel Draper war leicht zu erkennen, sie stand gegen das einzige Auto mit New Yorker Kennzeichen gelehnt, starrte aufs Meer und war modischer gekleidet als jede Einheimische. Sie trug dunkle Jeans, einen grauen Rollkragenpullover und war in eine leichte, taillierte Daunenjacke eingemummelt. Ihr feiner Schal, rot wie Blut, flatterte in der Brise, als wäre er lebendig.
Als Abby die Autotür öffnete, schlug ihr frischer Wind entgegen. Frida sprang über ihren Schoß hinweg und rannte die Düne hinab ans Wasser, wo sich ein Möwenschwarm ohne Eile in die Lüfte schwang. Abby zog den Reißverschluss ihrer Jacke zu und stieg aus dem Wagen.
Rachels Blick wanderte vom Hund zu Abby, und sie schob sich die Sonnenbrille ins Haar. «Abigail?»
«Ja. Hi, Rachel.» Abby ergriff die ausgestreckte Hand. «Tut mir sehr leid, dass ich zu spät komme. Und bitte nennen Sie mich Abby.»
«Freut mich, Sie endlich kennenzulernen, Abby. Ich bin ein großer Fan. Und wer ist das?» Sie deutete auf Frida, die am Ufer entlangpreschte.
«Das ist Frida», sagte Abby.
«Frida», wiederholte Rachel lächelnd. «Ein toller Name. Ich liebe Golden Retriever. Ich habe selbst zwei.»
Ein Hundemensch. Rachel war vermutlich Ende fünfzig, hatte blaugraue Augen und ein freundliches, offenes Gesicht. Abby mochte sie sofort.
Von dort, wo sie standen, erstreckte der Strand sich schier endlos in beide Richtungen. Der Atlantik war für die Jahreszeit ungewöhnlich ruhig, die Wellen brachen nicht, sondern schienen sich am Strand aufzulösen und hinterließen eine feine Borte aus Schaum. Die Sandbänke waren überspült und nur als grüne Flecken im dunklen Wasser zu erkennen. Die Flut lief immer noch ab – ideale Bedingungen für einen langen Spaziergang.
Am Rand des Parkplatzes stand eine Malerin in Kittel und mit fingerlosen Handschuhen hinter einer Staffelei, die auf die Dünen im Norden hin ausgerichtet war. Genau gegen dieses Klischee hatte Abby anzukämpfen: dass alle Cape-Cod-Kunst das bildliche Äquivalent zu Liebesromanen wäre – Sonnenuntergänge über der Marsch, am Strand entlanghuschende Regenpfeifer, Hummerboote, denen Möwenschwärme folgten. Hübsche Landschaftsbilder für den Kaminsims. Die Malerin setzte letzte Pinselstriche an ein paar Kumuluswolken, und Abby sah mit Grauen, dass sie jegliche Einzigartigkeit daran verfehlt hatte: die Helligkeitsabstufungen, die versteckten Farben und die Wölbungen, die dem Bild Tiefe gegeben hätten. Abby malte seit der Highschool keine Meeresbilder mehr.
«Meine Güte, das ist wirklich atemberaubend», sagte Rachel und schützte mit der Hand die Augen vor der spätmorgendlichen Sonne. «Gehen Sie hier jeden Tag spazieren?»
«Oh, nein, nicht jeden Tag. Ich bin für Gleichberechtigung unter den Stränden», sagte Abby lächelnd. «Race Point und Cahoon Hollow liebe ich genauso, aber ich gehe auch auf der Buchtseite spazieren. Das hängt immer von den Gezeiten, dem Wind und meiner Stimmung ab.»
Rachel befestigte ihr iPhone an ihrem Oberarm und erklärte, dass sie das Interview aufnehmen würde.
Altbekannte Nervosität regte sich in Abby. Es fiel ihr immer schwer, über sich und ihre Kunst zu sprechen, und ihre neuen Bilder waren sehr persönlich, etwas ganz anderes als die Skulpturen, mit denen sie bekannt geworden war: lebensgroße Nachbildungen von Meeresgeschöpfen aus Müll, den sie an den Stränden von Cape Cod gesammelt hatte, darunter ein Buckelwalskelett aus weggeworfenen Bleichmittelflaschen; ein weißer Hai aus Flipflops, zusammengebunden mit schlaffen Heliumballons; riesige Seesterne aus Bierflaschen, Tamponapplikatoren, Golfbällen und dergleichen. Sie erzählten eine einfache Geschichte und lenkten den Blick auf die Vermüllung der Meere. Aus der Ferne wirkten sie reizvoll und interessant, aus der Nähe waren sie ein Schlag ins Gesicht. Abbys Durchbruch kam, als Jeff Koons – der ihre Arbeiten während eines Urlaubs in Provincetown gesehen hatte – in einem Interview nach interessanten Nachwuchskünstlern gefragt wurde und ihre riesige Unechte Karettschildkröte erwähnte. Quasi über Nacht hatte Abby auf einmal Fans und eine Ausstellung in einer örtlichen Galerie. Die Schildkröte verkaufte sich für zwölftausend Dollar, zu jener Zeit eine für sie lebensverändernde Summe. Aber das war zehn Jahre her, und der Hype hatte sich als kurzlebig herausgestellt. Die nachfolgende Ausstellung war finanziell erfolglos geblieben, und die Galerie hatte sie fallen lassen.
Abbys aktuelle Arbeiten waren viel intimer. Sie wusste nicht genau, wie sie darüber sprechen sollte, schon gar nicht in das Aufnahmegerät einer Reporterin. Bisschen spät, um es sich anders zu überlegen, dachte sie, steckte sich ein Zimtkaugummi in den Mund und kaute, bis ihr Gaumen kribbelte. Ein Porträt im Art Observer war eine wirklich gute Sache, ermahnte sie sich. Eine großartige Sache. Hart erarbeitet.
Es bestand sogar die – wenn auch kleine – Chance, dass ihre Arbeit auf dem Titelblatt abgebildet sein würde. Ein Fototermin in ihrem Atelier war bereits geplant. Und selbst wenn sie es nicht aufs Cover schaffte, ein Bericht im Art Observer war immer noch die Art Publicity, die den Schalter umlegen könnte. Vielleicht konnte sie dann ihren Job als Lehrerin an der Nauset High School an den Nagel hängen und von ihrer Kunst leben. Nicht dass sie nicht gern unterrichtete – sie liebte ihre Schüler, und die Schüler liebten sie. Aber der Job bedeutete, weniger Zeit zum Malen zu haben, und sie zählte die Tage bis zum Beginn der Sommerferien. Die Zeitschrift würde im Oktober in die Läden kommen.
«Alles bereit», sagte Rachel. «Können wir anfangen?»
Sie spazierten entspannt plaudernd am Wasser entlang, Frida rannte voraus und jagte Strandläufer, die nach Würmern und Sandflöhen pickten. Abby spulte die üblichen biografischen Informationen herunter: geboren und aufgewachsen auf Cape Cod; der Vater ein hoch angesehener Meeresbiologe; die Mutter Architektin, jung gestorben; der Bruder ein erfolgreicher Bauunternehmer; sie selbst Absolventin der RSID – Rhode Island School of Design, 1999, seitdem als Künstlerin auf Cape Cod lebend und arbeitend.
«Ich habe in der Cape Cod Times einen Artikel über Ihren Vater gelesen. Das muss eine Herausforderung für ihn gewesen sein – nach dem Tod Ihrer Mutter alles allein hinzukriegen, beruflich voranzukommen, während er Sie beide mehr oder weniger ohne Hilfe aufgezogen hat. Das hätte nicht jeder Mann geschafft. Und Sie beide sind in Ihren jeweiligen Berufen so erfolgreich. Erstaunlich», sagte Rachel.
Abby lächelte. Ja, das war die offizielle Version ihrer Familie.
«Sprechen wir über Ihre Kunst. Haben Sie beim Malen ein Ziel?», fragte Rachel.
«Ich will Geschichten erzählen», sagte Abby. «Mein Ziel ist es, eine Geschichte zu erzählen, die einen Nerv trifft. Wenn ich die Wahrheit male, egal, wie seltsam sie sein mag, erkennen die Menschen sich darin wieder. Das Leben liegt in den Details.»
«Wie wissen Sie, dass Sie auf dem richtigen Weg sind?», fragte Rachel.
Abby kickte mit der Turnschuhspitze Sand hoch. Kunst zu machen, fühlte sich gefährlich und aufregend an. «Das ist so, als würde man über einem dunklen Teich schwingen und das Seil loslassen.»
Beim Gehen sammelte Abby allerlei Dinge ein, die ihr ins Auge fielen: elegante spiralförmige Wellhornschnecken, glatte Treibholzstücke, das brüchige schwarze Ei eines Rochens mit spitzen Zacken an beiden Enden. In all diesen Fundstücken sah sie Schatten, Kurven und Muster, die den meisten Menschen verborgen blieben. Dank der Winterstürme und weil noch wenig Touristen kamen, war der April ein guter Monat, um Treibgut zu sammeln. Nicht alles, was sie aufhob, war natürlichen Ursprungs, sie sammelte auch angespülten Müll oder Hinterlassenschaften der Strandurlauber aus den letzten Jahren: ein ausgefranstes verknotetes Seil, einen verrosteten Köder, den Kopf einer Barbiepuppe. Für diese Schätze trug sie immer einen Beutel über der Schulter.
Nach etwa einer Meile entdeckte Abby über dem Meer einen Sprühnebel, vermutlich der Blas eines Wals. Auf weitere hoffend, setzten sie und Rachel sich in den Sand und blinzelten in die Helligkeit über dem Wasser. Rachel saß kerzengerade im Schneidersitz, die Schultern nach hinten und unten gezogen wie ein Yogi. Abby hockte nach vorne gebeugt und hatte die Arme um die Knie gelegt.
«Um diese Jahreszeit kehren die Wale ans Cape zurück, um Nahrung zu suchen», sagte Abby. Sie richtete sich auf und streckte den Rücken durch, ihr Körper schien zu erblühen.
Sie starrten die Linie am Horizont an, an der Himmel und Meer ineinander verschmolzen, sahen aber nichts. Frida spielte währenddessen ein artenübergreifendes Versteckspiel mit einer Robbe und bellte jedes Mal wie wild, wenn diese kurz abtauchte, um woanders wieder aufzutauchen.
«Also, wollen wir über Ihre neue Arbeit sprechen?», schlug Rachel vor. «Ich würde gern erfahren, warum Sie Ihren Skulpturen den Rücken gekehrt haben.»
Plötzlich konnte Abby es nicht erwarten, Rachel ins Arcadia zu bringen. «Fahren wir in mein Atelier.» Sie hoffte, ihre Kunst würde für sich sprechen.
Der Wind trieb sie auf dem Rückweg nach Coast Guard Beach vor sich her. Eine halbe Meile vor dem Parkplatz fiel Abbys Blick auf eine blau-violette Keramikscherbe mit einem auffälligen orangen Schlangenmuster, die Ränder vom Meer abgeschliffen. Gänsehaut breitete sich auf ihren Unterarmen aus wie Sterne am Nachthimmel. So eine hatte sie seit über einem Jahr nicht mehr gefunden. Das Muster war selten – keine Massenware, wie sie aus ihren Nachforschungen wusste –, trotzdem hatte sie bereits eine ganze Schale voller solcher Scherben in ihrem Atelier stehen, die sie im Lauf der Jahre an so unterschiedlichen Orten wie den Turks- und Caicosinseln, Korsika, Montauk und hier auf Cape Cod gesammelt hatte.
«Was für ein ungewöhnliches Muster», bemerkte Rachel.
«Nicht wahr?» Abby strich mit dem Finger über die leicht erhobene Glasur der Schlange, als würde sie Brailleschrift lesen. Es mochte albern klingen, aber sie glaubte fest daran, dass diese Keramikscherben Geschenke, eigentlich kleine Botschaften, von ihrer Mutter waren. Das hatte sie nur einmal jemandem verraten: ihrem Bruder, als sie acht gewesen war und er elf. Keine gute Idee. Kenny hatte sich furchtbar aufgeregt, ihr vorgeworfen, sie würde lügen, und ihr klargemacht, dass sie sich keine besondere Verbindung zu ihrer Mutter einreden solle. «Die hast du nicht. Und wirst du auch nie haben», hatte er gesagt. Als sie widersprechen wollte, fauchte er: «Du weißt, dass du schuld bist an ihrem Tod, oder, Abby?» Das hatte sie zum Schweigen gebracht.
Später an jenem Abend war Kenny zu ihr ins Bett geschlüpft, um sich zu entschuldigen. «Ich hab’s nicht so gemeint», sagte er, zutiefst unglücklich. Aber Abby wusste, dass das nicht stimmte. «Tut mir leid», sagte er. «Ich vermisse sie einfach.» Verwirrt und von Schuldgefühlen überwältigt tröstete Abby ihn, gleichzeitig ihrerseits untröstlich, für den Tod ihrer Mutter und Kennys Verlust verantwortlich zu sein. Sie schwor, alles zu tun, um es wiedergutzumachen, umarmte ihn fest, als er weinte, bis sein verkrampfter Körper sich entspannte und er vom Schlaf überwältigt wurde. Von da an behielt sie ihre Gespräche mit ihrer Mutter für sich.
Abby war schon immer eine Sammlerin gewesen. Als kleines Kind hatte ihr Vater sie oft und lange allein am Strand gelassen, während er mit Kenny segeln ging. Im Rückblick waren diese einsamen Tage prägend gewesen für ihren Weg als Künstlerin. Stundenlang hatte sie ganze Dörfer aus Seetang, Treibholz, Muscheln und anderen Fundstücken gebaut. Aber sie war nie wirklich allein gewesen. Ihre Mutter war immer bei ihr und legte ihr Schätze in den Sand. Sie überlegte dann, woher die Gegenstände stammen mochten, und Geschichten tauchten in ihrem Kopf auf: Ein Eisennagel hatte einst zu einem Wikingerschiff gehört; ein von Seepocken besiedelter Kieselstein hatte das Meer im Magen eines Felsenbarschs überquert; ein Stück Seeglas – der Rand einer Parfümflasche – war von einer eifersüchtigen Schwester in den Ozean geworfen worden. Andere würden in diesen Tagträumen Kindheitsfantasien sehen, für Abby waren es Erinnerungen.
Sie steckte die Keramikscherbe ein und pfiff Frida zu sich. Kaum zu glauben, ein Interview mit dem Art Observer und eine Nachricht von ihrer Mutter am selben Tag.
Die Fahrt zu Abbys Atelier war kurz, Rachel folgte ihr in ihrem Mietwagen. Ein steiler Schotterweg führte zu einem einfachen rechteckigen Gebäude aus Schlackenbetonblöcken, Holzbohlen und Glas, das in der Sonne glitzerte. Abby warnte Rachel vor einer losen Treppenstufe und hoffte, sie würde die abgeblätterte Farbe an der Tür nicht bemerken. Das Arcadia war renovierungsbedürftig. Aber dafür müsste sie Kenny fragen, ob sie seine Instandhaltungsrücklagen anzapfen durfte, und dieses Gespräch vermied sie.
Rachel Draper trat ein und brachte kein Wort heraus. Abby versuchte sich vorzustellen, wie es war, das Atelier zum ersten Mal zu betreten. Der Mief nach Ölfarben und nassem Hund, der Sand, der auf dem Boden knirschte, am anderen Ende des Raums Wandschränke, deren Farbe abblätterte, uralte Küchengeräte – ein Kühlschrank mit abgerundeten Ecken, über dessen Griff in Chrombuchstaben das Wort PHILCO angebracht war, ein schwerer beiger Gasherd, ein gusseisernes Spülbecken mit gelblicher Emaillierung. Überall Kram: ausgetrocknete Farbtuben, alte Taschenbücher, halb bemalte Leinwände, gräuliche Tropftücher, ein vertrockneter Wildblumenstrauß. Ich hätte wirklich ein bisschen aufräumen können, dachte sie. Zumindest verhinderte die hohe Decke, dass Platzangst aufkam.
«Das ist ein Paradies», flüsterte Rachel.
Abby atmete auf und versuchte, das Atelier durch Rachels Augen zu sehen. Die ließ ihren Blick über die Wände gleiten, die bedeckt waren mit Bildern aus Pornozeitschriften aus den Dreißigern, anatomischen Illustrationen, Fotos von Operationen. Über die Fensterbretter, auf denen Seesterne, Seeglas, Strandschneckenhäuser und Glückssteine aus übervollen Einweckgläsern quollen. Dann über die drei Bilder an der hinteren Wand, denen Abby die Titel Es, Ich und Über-Ich gegeben hatte. Sie hatte sich für Begriffe aus der Psychoanalyse entschieden, einerseits, weil sie es lustig fand, andererseits, weil sie poetisch und passend waren. Dann kam der Moment, auf den Abby gewartet hatte: Rachels Blick folgte einem schräg hereinfallenden Sonnenstrahl und landete auf dem Bild, an dem sie gerade arbeitete.
Rachel eilte darauf zu, beugte sich nach vorn und betrachtete es eingehend. Sie sah die lebendigen, fließenden Linien, Ergebnis von Abbys energischem Pinselstrich und ihrer Schichtenmaltechnik. «Mein Gott», flüsterte sie, die Augen halb zusammengekniffen, «das ist unglaublich.» Dann stand sie auf, trat zurück, um das Bild als Ganzes zu betrachten, und zog mit dem Zeigefinger eine Kurve durch die Luft. «Die impliziten Linien sind kinetisch, sie ziehen das Auge von Szene zu Szene weiter.» Ihr Mund zuckte, und sie schwieg eine Weile. «Da ist viel zu verarbeiten, aber ich verstehe, was Sie mit dem Geschichtenerzählen meinen. Unruhe vermischt sich mit Hoffnung.» Sie zückte ihr iPhone. «Darf ich?»
«Gern», sagte Abby und drückte Frida mit rotem Gesicht einen Kuss auf den Kopf.
«Hat es einen Titel?» Rachel knipste mehrere Fotos.
«Noch nicht», sagte Abby. Sie hatte mehrere Titel im Sinn, die aber alle noch nicht treffend waren.
Während die Dünen draußen unter der wandernden Sonne langsam von Grün zu Gold wechselten, betrachtete Rachel ausführlich die Bilder an den Wänden, sah sich die ungeordnet in einem großen Gestell stehenden Leinwände an und kehrte immer wieder zu dem noch unfertigen Gemälde zurück. Dabei sprach sie einen stakkatoartigen Monolog in ihr iPhone, bei dem Abby ganz schwummrig wurde. «Vergleich: Lucian Freud, nicht idealisierte weibliche Form. Vergleich: Chaïm Soutine, Darstellungen von Kadavern, zerfetztem Fleisch. Vergleich: Tracey Emin, autobiografisch, bekennend. Vergleich: Twombly, energische Verwendung von Linien, Farbe.»
Als Rachel ihr iPhone schließlich wegsteckte, schlug Abby vor, auf die Dachterrasse zu gehen. Sie legte eine Dose mit Mandeln, einen Granny-Smith-Apfel und ein Gemüsemesser in eine Stofftasche und füllte zwei große Gläser mit Wasser. Da sie die Hände voll hatte, trat sie die hintere Ateliertür mit dem Fuß auf und führte Rachel eine zierliche Wendeltreppe hinauf – die für Frida zu steil war. Die Metallspirale war von Glyzinien überwuchert, deren knorrige Sprossachsen in alle Richtungen wuchsen, das Geländer umrankten, sich unter das Hausdach schlängelten und die Regenrinnen anhoben.
In einem Monat, Mitte Mai, würde das Ungetüm blühen, dann würden Tausende von duftenden blauvioletten Blumen die Hauswand überziehen und flatternde Monarchfalter anlocken, die auf ihrer kräftezehrenden Reise aus Mittelamerika eine Pause einlegen mussten. Ken lag ihr ständig in den Ohren, das Ding zurückzuschneiden, er mochte es sauber und ordentlich. Die Glyzinie war ein Geschenk seiner Frau Jenny gewesen, die Abby gewarnt hatte, sie müsse das Biest zähmen, sonst würde sie Chaos ernten. Glyzinien erforderten Planung und Erziehung, hatte Jenny erklärt. Abby hatte den Ratschlag ignoriert, die jungen Triebe nicht wie angewiesen umeinandergewickelt und nach jedem Sommer vergessen, die Ranken zurückzuschneiden. Jetzt war sie dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen. Die Glyzinie war ein wunderschönes Kuddelmuddel.
Von der Dachterrasse aus hatte man einen Rundumblick: Geradeaus lag Pilgrim Lake, im Osten waren Dünen, die in den Atlantik übergingen, im Nordwesten der geschwungene Ausläufer von Provincetown, der zuletzt entstandene Teil des Cape, vor zehntausend Jahren durch Strandversetzung aufgeschüttet, was geologisch betrachtet einem Wimpernschlag gleichkam.
«Wow!», rief Rachel aus, die am Geländer stand und die Mondlandschaft aus Dünen betrachtete, die in den Ozean hineinliefen, die Horizontlinie in der Ferne, verwobene Blautöne.
«Ich weiß, ich habe wirklich Glück. Das Atelier hat früher meiner Mutter gehört.» Abby stellte die Wassergläser auf den Tisch, packte die aufs Geratewohl zusammengestellten Snacks aus und begann, den Apfel klein zu schneiden. «Sie war Architektin, das hatte ich erwähnt, oder? Sie hat alles selbst gebaut.»
«Das hatten Sie gesagt. Was für ein wunderbares Vermächtnis. Ihre Mutter muss gewusst haben, dass Sie ähnlich künstlerisch veranlagt sein würden, wie sie es war.»
«Oh, nein, na ja, nicht wirklich.» Abby ging zu Rachel. «Meine Mutter starb, als …» Sie hielt inne, suchte nach Worten. Es fiel ihr immer schwer, es auszusprechen. «Na ja, es geschah sehr plötzlich. Sie starb Stunden nach meiner Geburt.»
«Oh, das tut mir so leid.» Rachel legte Abby eine Hand auf den Arm. «Wie furchtbar für Ihre Familie.»
«Das war es. Schrecklich. Meine Eltern haben sich sehr geliebt und eine perfekte Ehe geführt. Und mein Bruder Kenny war damals noch ein kleiner Junge», sagte Abby. Der Gedanke an Kennys Trauer schmerzte sie jedes Mal. «Jedenfalls ist es kompliziert. Meine Mutter hatte ihr Testament nicht aktualisiert, Sie wissen schon, Treuhandkonten und so. Um es kurz zu machen, die beiden Dinge, die ihr am meisten bedeuteten, dieses Atelier und ihr Segelboot, wurden beide meinem Bruder vermacht, an seinem achtzehnten Geburtstag. Mein Vater hat versucht, das Richtige zu tun und alles so fair aufzuteilen, wie es seiner Überzeugung nach in ihrem Sinn gewesen wäre – mir das Arcadia zu geben und Ken die Francesca. Aber rein rechtlich gesehen gehört beides immer noch meinem Bruder.»
«Was ist mit Ihrer Stiefmutter?», fragte Rachel. «Ich habe einen Artikel über ihre Biolumineszenz-Forschung gelesen. Standen Sie sich nah?»
Die Frau hatte ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, Abby hatte ihre Stiefmutter vergöttert. An dem Tag, als Gretchen endlich die Nase voll hatte und Abbys Vater nach einem Streit epischen Ausmaßes – in dem sowohl Vorwürfe als auch Teller geflogen waren – verließ, war Abby am Boden zerstört gewesen. Gretchen war ihre Verbündete gewesen und die einzige Mutter, die sie je gekannt hatte. Und da es für Stiefeltern kein Umgangsrecht gab, hatte Abby keine Möglichkeit gehabt, mit ihr in Kontakt zu bleiben. Gretchen war als Feindin abgestempelt worden. Verrückt. Durchgeknallt. Ende der Diskussion. Ohne dass ihr Vater oder Bruder etwas ahnten, hatte Abby Gretchen mithilfe des Internets wiedergefunden. Seitdem hielten die beiden sich ein paarmal im Jahr gegenseitig auf dem Laufenden – an Geburts- und Feiertagen.
«Das ist ewig lange her.» Abby fragte sich, wie viel Rachel über ihre Stiefmutter wusste. «Aber, ja, Gretchen war wunderbar. Es war nicht ihre Schuld. Meine Mutter hatte ziemlich große Fußstapfen hinterlassen …» Abby deutete auf die Stühle. «Setzen wir uns doch.»
Rachel verstand den Hinweis und kehrte zum ursprünglichen Thema zurück. «Und warum überschreibt Ihr Bruder Ihnen das Arcadia nicht einfach?»
Noch ein wunder Punkt. Aber Abby hatte ihn erwähnt, war also selbst schuld. Sie dachte einfach nicht nach – warum wusch sie ihre dreckige Wäsche vor den Augen und Ohren einer Reporterin? Sie biss in ein Apfelstück, die Säure ließ den Speichel fließen. «Kann der Teil mit meinem Bruder bitte unter uns bleiben?», fragte sie. «Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Tut mir leid. Sie sind so … na ja, Sie machen es einem leicht, mit Ihnen zu reden.»
«Natürlich», sagte Rachel. «Selbstverständlich. Aber jetzt bin ich neugierig.»
«Ich glaube, es geht um Kontrolle. So sorgt er dafür, dass ich ihm verpflichtet bleibe, nehme ich an.» Abby zuckte die Achseln. «Er würde Ihnen sagen, dass er aus reiner Nächstenliebe handelt – und sich um die Steuern und die Instandhaltung und all diese Sachen kümmert. Dass er mir hilft. Aber es steckt mehr dahinter. Haben Sie Geschwister?»
«Ah! Ich verstehe. Alles klar.»
Rachel und Abby machten es sich auf den Korbstühlen bequem, knabberten die Snacks und schauten auf die Dünen hinab, die in der Nachmittagssonne schimmerten. Unten winselte Frida.
«Ruhig!», rief Abby, und ausnahmsweise gehorchte der Hund. «Gutes Mädchen», sagte sie. «Tut mir leid. Sie ist nicht daran gewöhnt, dass Besuch da ist und sie mich teilen muss.»
«Nur noch ein paar Fragen, dann lasse ich Sie in Ruhe, versprochen.» Rachel scrollte durch ihre Handynotizen und murmelte gedankenverloren – «Arcadia, familiärer Hintergrund, monatlich Tag der offenen Tür, RISD» –, bis sie ein Thema fand, das sie noch nicht angeschnitten hatte. «Unterrichten Sie gern an der Nauset High?»
«Oh, ja. Ich bin gern mit Kindern zusammen und finde es toll, ihre künstlerische Entwicklung mitzuerleben. Natürlich findet die nicht bei jedem Schüler statt. Viele starren die ganze Zeit auf ihre Handys. Aber wenn es klappt, gibt es nichts Besseres.» Abby zuckte die Schultern. «Außerdem kann ich so meine Rechnungen bezahlen.»
«Wem zeigen Sie Ihre Arbeiten als Erstes?»
«Meiner besten Freundin, Jenny. Immer Jenny. Im ersten Jahr an der RISD war sie meine Zimmergenossin», sagte Abby. «Jetzt ist sie mit meinem Bruder verheiratet. Sie haben sich durch mich kennengelernt.»
«Interessant», sagte Rachel. «Ihre Schwägerin ist also ebenfalls Künstlerin?»
«War», sagte Abby. «Keramikerin. Aber Jenny hat vor langer Zeit einen anderen Weg eingeschlagen.»
Die Untertreibung des Jahrhunderts, dachte Abby. Jenny Lowell stammte aus völlig anderen Verhältnissen und war eine Freundin, wie Abby sie sich nie zu erhoffen gewagt hatte. Schon am ersten Abend im College hatten sie Freundschaft geschlossen: Wenige Minuten nachdem Jennys Eltern, Theodore und Isabel, abgefahren waren, hatte Jenny Abby eine Schere hingehalten und sie aufgefordert, die teure Bettwäsche zu zerschneiden, die ihre Eltern als «Einzugsgeschenk» zurückgelassen hatten.
«Werden sie nicht sauer sein?», hatte Abby zu bedenken gegeben und sich gefragt, ob sie Jenny von ihrem Plan abhalten sollte, um nicht als schlechter Einfluss auf sie abgestempelt zu werden.
Jennys Lächeln hatte klargestellt, dass der Zorn ihrer Eltern – insbesondere der ihrer Mutter – Teil des Vergnügens war. «Kunst ist meine Rebellion», sagte sie und brachte Abby bei, wie sich aus Bettwäschestreifen ein Flickenteppich knüpfen ließ, den sie später auf den Boden zwischen ihren Betten legten.
Bald hatte Abby verstanden, dass das Zerstören und Neuzusammensetzen teurer Geschenke ihrer Eltern Jennys Lieblingsbeschäftigung war. Sie schlug geerbte Teetassen kaputt und bastelte daraus Mosaike, arbeitete die Ärmel von Kaschmirpullovern in fingerlose Handschuhe um und schmolz Schmuck ein, um damit ihre Keramiken zu lackieren. Sie erzählten einander alles.
Auch jetzt noch machte es Abby traurig, dass Jenny ihren Traum, Künstlerin zu werden, aufgegeben hatte, aber ihre Freundin hatte sich anders entschieden. «Obwohl sie an einer der besten Kunstschulen des Landes aufgenommen wurde und irrsinnig talentiert war, haben ihre Eltern ihre Arbeit nie ernst genommen. Sie sahen es als Hobby, nicht als richtigen Beruf», sagte Abby. «Und die Zweifel haben sich festgebohrt.»
«Wie denn?», fragte Rachel.
«Das ist schwer zu erklären. Bei allem Draufgängertum war Jenny nicht sehr selbstsicher. Ihre Eltern wollten, dass sie sich einen passenden Ehemann sucht, mit den, Sie wissen schon, richtigen Beziehungen, wofür eine Kunstschule ihrer Meinung nach nicht der geeignete Ort war. Als ihre Mutter dann krank wurde – Brustkrebs –, hat Jenny die Schule verlassen und kam nie zurück. Aber wir sind eng befreundet geblieben. Mit Anfang zwanzig hat sie hier bei mir den Sommer verbracht und sich in Ken verliebt.» Abby merkte, dass sie ihre Freundin schützte – die wilden Jahre, die Aufenthalte in Entzugskliniken ließ sie aus. Als dann klar wurde, dass Isabel Lowell den Krebs nicht überleben würde, hatte sich etwas verändert. Jenny wollte ihrer Mutter zeigen, dass sie endlich auf dem richtigen Weg war.
«Also hat sie durch die Kunstschule doch den passenden Ehemann gefunden – dank Ihnen», sagte Rachel. «Ihre beste Freundin und Ihr Bruder. Sie müssen zugeben, das ist richtig süß.»
«Ja, schon.» Abby dachte an die Kompromisse, die Jennys Ehe ihrer Freundschaft abgerungen hatte. Sie wollte nicht länger über ihre Familie reden. «Können wir über etwas anderes sprechen?»
«Okay», stimmte Rachel zu. «Erzählen Sie mir von Ihren literarischen Einflüssen.»
«Wie viel Zeit haben Sie?» Abby grinste. «Zuerst fällt mir Frankenstein ein. Da ist alles drin: Ehrgeiz, Rache, Verlust, die Vergänglichkeit des Körpers …»
Abby hatte Frankenstein zum ersten Mal als Teenager gelesen, das Buch hatte ihre lebenslange Faszination für körperliche Veränderungen geweckt. Jahrelang hatte sie jeden Tag mit Wasserfarben Skizzen solcher Veränderungen angefertigt – gerinnendes Blut, ein anschwellender Penis, Wangen, die sich rot färbten –, schnelle, freihändige Zeichnungen, in denen sie die der Veränderung eigene kinetische Energie einzufangen versuchte.
«Außerdem ist Mary Shelleys Mutter bei der Geburt gestorben, wir haben also etwas gemeinsam.»