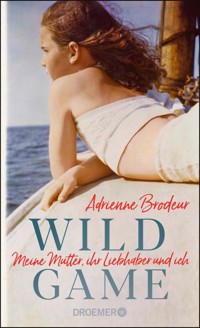
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sprachgewaltig, mitreißend, erschütternd: "Wild Game" der amerikanischen Schriftstellerin Adrienne Brodeur ist ein fesselndes Buch zum Thema Mutter-Tochter-Verhältnis. Adrienne hat eine umwerfende, strahlende Mutter, die der Mittelpunkt einer jeden Gesellschaft ist. Schon ihr Name Malabar strömt reine Exotik aus. Doch Malabar ist auch eine große Egozentrikerin, und als sie sich in den besten Freund ihres Mannes verliebt, macht sie ihre Tochter zu ihrer engsten Vertrauten und stellt auf diese Weise das Mutter-Tochter-Verhältnis auf den Kopf. Bald schon lebt Adrienne ganz für die aufregende Liebesgeschichte ihrer Mutter, statt ihre eigene Jugend auszukosten. Erst als erwachsene Frau ist sie in der Lage, die Mechanismen zu erkennen, die ihr Leben geprägt haben. Und es gelingt ihr, sich mit ihrer Mutter auszusöhnen, die ihr die Jugend gestohlen hat. "Das Buch ließ mich atemlos zurück." Richard Russo "Dieses atemberaubende Memoir über eine auf besondere Weise befrachtete Mutter-Tochter-Beziehung kann man nicht mehr aus der Hand legen." - Publishers Weekly "Seit Jeannette Walls 'Schloss aus Glas' ist es keinem Memoir mehr gelungen, eine solch komplexe Familienbeziehung zu schildern, in der Liebe, Hingabe und zerstörende Geheimnisse so untrennbar miteinander verbunden sind." Ruth Ozeki "Wild Game erzählt eine außergewöhnliche Familiengeschichte. Dieses Memoir wird alle Mütter und Töchter berühren. Adrienne Brodeur erkundet so mitfühlend wie klarsichtig die emotionalen Bande, die eine Familie ausmachen – und was es bedeutet, wenn sie zerstört sind. Ein beeindruckendes Buch." Claire Messud
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Adrienne Brodeur
Wild Game
Meine Mutter, ihr Liebhaber und ich
Aus dem amerikanischen Englisch von Nicole Seifert
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Adrienne hat eine umwerfende, strahlende Mutter, die der Mittelpunkt einer jeden Gesellschaft ist. Schon ihr Name Malabar strömt reine Exotik aus. Doch Malabar ist auch eine große Egozentrikerin, und als sie sich in den besten Freund ihres Mannes verliebt, macht sie ihre Tochter zu ihrer engsten Vertrauten und stellt auf diese Weise das Mutter-Tochter-Verhältnis auf den Kopf. Bald schon lebt Adrienne ganz für die aufregende Liebesgeschichte ihrer Mutter, statt ihre eigene Jugend auszukosten. Erst als erwachsene Frau ist sie in der Lage, die Mechanismen zu erkennen, die ihr Leben geprägt haben. Und es gelingt ihr, sich mit ihrer Mutter auszusöhnen, die ihr die Jugend gestohlen hat.
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorbemerkung
Motto
Prolog
Teil I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Teil II
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Teil III
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Epilog
Danksagung
Für Tim, Madeleine und Liam
und im Gedenken an Alan
Vorbemerkung
»Das Leben besteht nicht aus dem Gelebten, sondern aus dem, woran man sich erinnert und wie man sich daran erinnert, um davon erzählen zu können.« Gabriel García Márquez
Beim Schreiben dieses Buches habe ich versucht, mich so weit wie möglich an die Fakten zu halten, habe Tagebücher zurate gezogen, Briefe, Sammel- und Fotoalben, Karteikarten, Rezepte, Zeitungsartikel und andere Zeugnisse der Geschichte meiner Familie. Wenn sich ein physisches oder emotionales Detail nicht nachweisen ließ, habe ich mein Gedächtnis befragt, wohl wissend, dass es unzuverlässig ist und wir das Erinnerte mit jedem Erinnern leicht verändern, unsere Perspektive beschönigen und mit neuen Sichtweisen anreichern, um ihm in der Gegenwart Sinn zu verleihen.
Wild Game gibt nicht vor, die ganze Geschichte zu erzählen – Jahre wurden zu Sätzen gestaucht, Freunde und Geliebte außen vor gelassen, Details ausgeblendet. Die Zeit hat die Einzelheiten zerstreut. Was auf den folgenden Seiten steht, sind Erinnerungen, Interpretationen und Nachbildungen von Momenten, die mein Leben geprägt haben, alle gefärbt durch meinen Blickwinkel, meine Überzeugungen und Sehnsüchte. Mir ist bewusst, dass andere sich womöglich anders erinnern und ihre eigene Sicht auf die Ereignisse haben. Ich habe versucht, eine Geschichte, die nicht mir allein gehört, mit Bedacht zu erzählen.
Die Namen aller im Buch vorkommenden Personen habe ich geändert, bis auf die meiner Eltern, Malabar und Paul. Und meinen eigenen.
DER NUTZEN VON LEID
von Mary Oliver
(Im Schlaf träumte ich dies Gedicht)
Jemand, den ich liebte, gab mir einst
ein Kästchen voller Dunkelheit.
Ich brauchte Jahre, um zu verstehen,
dass auch das ein Geschenk war.
Prolog
Eine verborgene Wahrheit, mehr ist eine Lüge nicht.
Cape Cod ist ein Ort, an dem Verborgenes an die Oberfläche kommt und wieder verschwindet: Hummerfangkörbe aus Holz, Wirbel von Buckelwalen, vom Meer polierte Glasscherben. An einem Tag ist da nichts; am nächsten fördern die Naturgewalten – Erosion, Wind und Gezeiten – etwas zutage, das die ganze Zeit über da war. Einen Tag später ist es wieder weg.
Vor ein paar Jahren entdeckte mein Bruder den Bug eines Schiffswracks, der aus einer Sandbank ragte. Es gelang ihm, einen Großteil des Schiffsrumpfes freizulegen, bevor die Flut kam und seine Bemühungen zunichtemachen konnte. Am nächsten Tag kehrte er beim selben Wasserstand an die Stelle zurück, aber von dem Schiff war nichts mehr zu sehen. Hätte er nicht ein mit Wasser vollgesogenes Stück Holz mitgenommen, wunderschön verdreht und knorrig, um es auf dem Rasen trocknen zu lassen, hätte er vielleicht geglaubt, alles nur geträumt zu haben.
Blinzele, und dir entgeht ein Schatz.
Blinzele noch einmal, und dir wird klar, dass die Wahrheit, die du für gut verborgen gehalten hattest, ans Licht gekommen ist, dass sich unter veränderten Bedingungen irgendein unansehnlicher Teil davon offenbart hat. Wir alle wissen, dass eine Lüge oft weitere Lügen nach sich zieht. Täuschung erfordert Einsatz, Wachsamkeit und ein sehr gutes Gedächtnis. Man muss sich anstrengen, wenn man will, dass die Wahrheit verborgen bleibt.
Viele Jahre lang war es meine Aufgabe, Sand aufzuschütten – mit Händen, Schaufeln, Eimern, was immer gerade erforderlich war –, damit das Geheimnis meiner Mutter verborgen blieb.
Teil I
Oh, welch verworren Netz wir weben.
Sir Walter Scott
1
Ben Souther schob sich durch die Eingangstür unseres Strandhauses auf Cape Cod und begrüßte meine Familie mit seinem üblichen enthusiastischen: »Wie geht’s!« Er war damals Anfang sechzig, hatte dichtes, weißes Haar und schwielige Hände, die von seiner Liebe zur Arbeit im Freien zeugten. Ich beobachtete vom Flur aus, wie er mit der einen Hand meinem Stiefvater Charles Greenwood auf den Rücken schlug und mit der anderen eine braune Lebensmitteltüte hochhielt, in deren Ecken sich feuchte, dunkle Flecken gebildet hatten.
»Bin gespannt, was du aus denen hier machst, Malabar«, sagte Ben zu meiner Mutter, die neben ihrem Mann in der Tür stand. Er präsentierte ihr das nässende Päckchen und küsste sie flüchtig auf die Wange.
Meine Mutter nahm die Tüte mit in die Küche, stellte sie auf die Holzarbeitsplatte und sah hinein.
»Täubchen«, sagte Ben stolz und rieb sich die Hände. »Ein Dutzend. Gerupft und ausgenommen, ich habe sogar die Köpfe für dich abgetrennt.«
Aha. Das Nasse war also Blut.
Ich sah meine Mutter an, deren Gesichtsausdruck nicht die geringste Abscheu zeigte, nur Entzücken. Zweifellos kalkulierte sie bereits, wie viel Zeit bei welcher Temperatur nötig wäre, damit die Haut knusprig, das Fleisch aber nicht trocken wurde, und womit sie die Aromen am besten zur Geltung brächte. In der Küche erwachte meine Mutter zum Leben – sie war ihre Bühne und sie selbst der Star.
»Also, ich muss schon sagen, Ben, das ist ja mal ein Gastgeschenk«, sagte sie lachend und sah ihn mit erhobenem Kinn abschätzend an. Sie sah ihn lange an. Malabar war eine harte Kritikerin. Man musste sich ihre Achtung verdienen, und das konnte Jahre dauern, wenn es überhaupt dazu kam. Ben Souther, das konnte ich sehen, war in ihrem Ansehen etwas gestiegen.
Bens Frau Lily folgte dicht hinter ihm, in den Armen einen Strauß Blumen aus ihrem Garten in Plymouth und eine Tüte mit Brunnenkresse, die sie an ihrem Bachufer frisch gepflückt hatte, scharf, wie Malabar es liebte. Lily war ungefähr zehn Jahre älter als meine Mutter, zierlich und auf schlichte Weise hübsch, mit ergrauendem braunem Haar und Falten im Gesicht, die von ihrer sachlichen neuenglischen Art und dem völligen Fehlen von Eitelkeit zeugten.
Charles stand mit einem breiten Lächeln am Rand. Er liebte Gesellschaft, köstliche Mahlzeiten und Geschichten von früher, und dieses Wochenende mit seinem alten Freund Ben und dessen Frau Lily versprach all das im Überfluss. Ich kannte die Southers, seit ich acht war und meine Mutter Charles geheiratet hatte. Ich kannte sie so, wie ein Kind die Freunde seiner Eltern kennt, also nicht gut, sie interessierten mich nicht weiter.
Ich war vierzehn.
Sofort wurde die Cocktailstunde ausgerufen, bei uns zu Hause ein geheiligtes Ritual. Meine Mutter und Charles begannen mit dem Üblichen, einem Bourbon on the Rocks, tranken gleich noch einen und gingen dann über zu ihrem Lieblingsaperitif, den sie »Powerpack« nannten: ein trockener Manhattan mit einer Zitronenspirale. Die Southers taten es meinen Eltern gleich, Drink für Drink. Die vier plauderten und mäanderten dabei mit ihren Cocktails vom Wohnzimmer auf die Terrasse und später über den Rasen zu der Holztreppe, die zum Strand hinunterführte. Dort konnten sie am besten die ozeanische Fülle genießen, die sich ihnen bot: salzige Luft, ein von der untergehenden Sonne rosa gefärbter Himmel, die Geräusche der in der Nähe vertäuten Schiffe, der Möwen und fernen Wellen.
Dann kam mein älterer Bruder Peter dazu, der einen langen Arbeitstag als Steuermann auf einem gecharterten Fischkutter vor Wellfleet hinter sich hatte. Er war sechzehn, blond, seine Haut gebräunt, die Lippen von zu viel Salz und Sonne rissig. Er und Ben unterhielten sich über Felsenbarsche: was sie fraßen (Sandaale), wo sie anbissen (hinter den Sandbänken, aber noch ziemlich nah am Ufer). Die beiden waren sich einig, dass diese Art des Sportfischens mit der anspruchslosen Kumpanei und den Hightech-Angelschnüren eigentlich nicht ernst zu nehmen war. Ben war ein passionierter Angler. Er band seine Fliegen selbst und reiste alljährlich nach Island und Russland, um in den unberührtesten Flüssen der Welt zu fischen. Er hatte in seinem Leben bereits über siebenhundert Lachse gefangen und wieder freigelassen und wollte es noch auf tausend bringen. Trotzdem, ein Tag auf dem Wasser war ein Tag auf dem Wasser, auch wenn Bier saufende Touristen dabei waren.
»Wann gibt’s Essen, Mom?«, fragte Peter. Mein Bruder hatte ständig Heißhunger, war immer ungeduldig.
Mehr brauchte es nicht, damit alle wieder ins Haus gingen. Wir wussten, was nun kommen würde.
Meine Mutter knipste das Küchenlicht an, wusch sich die Hände und begann, die kopflosen Vögel auszupacken, auf der Arbeitsplatte aufzureihen und die Wunden mit einem frischen Küchentuch abzutupfen. Wir anderen ließen uns auf massiven Barhockern mit hohen Rückenlehnen nieder, die Ellbogen auf der grünen Marmorplatte, sodass wir Richtung Küche guckten, mit freier Sicht auf Malabars Tun. Auf der gigantischen Kücheninsel sprossen direkt vor uns duftende Kräuter aus einer Vase, wie ein Strauß Blumen – Basilikum, Koriander, Thymian, Oregano, Minze. Ein rechteckiges Stück Butter war zu einem glänzenden Hügel geschmolzen. Eine riesige Knoblauchknolle erwartete das Messer meiner Mutter. Hinter uns erstreckte sich das Wohnzimmer, auf allen Seiten von gläsernen Schiebetüren umgeben, die einen Panoramablick auf Nauset Harbor boten, sodass man bei Ebbe Sumpfgras und Sandbänke sehen konnte. Jenseits des Hafens lag der äußere Strand, ein khakifarbener Sandstreifen, unterbrochen von Dünen, die uns Schutz vor dem Atlantik boten. Ab und zu unterbrach meine Mutter das Hacken, Rühren und Reiben, schaute hoch, nahm den Anblick in sich auf und lächelte zufrieden.
Schon als kleines Mädchen war sie regelmäßig in diesem Städtchen auf Cape Cod gewesen. Orleans liegt am Ellbogen dessen, was aus der Vogelperspektive aussieht wie ein riesiger Arm, der fünfundsechzig Meilen in den Atlantik reicht, dann wieder Richtung Festland deutet, sich verjüngt und bei Provincetown eine Faust bildet. Als Kind kam Malabar immer nach Pochet; als sie mit meinem Vater verheiratet war, gehörte ihr ein winziges Häuschen in Nauset Heights, und vor ein paar Jahren hatte sie, zweifellos mit Charles’ Unterstützung, ein paar Morgen am Wasser gekauft. Sie hatte grundlegend renovieren lassen, nachdem sie das Haus erworben hatte, und es war kein Zufall, dass die Küche den besten Ausblick bot.
Wer bei einer Frau in der Küche an eine niedliche Hausfrau mit Rüschenschürze denkt, oder an eine dieses Lebens überdrüssige Mutter, die pflichtschuldig ihre junge Familie verköstigt, der stellt sich die falsche Frau in der falschen Küche vor. Hier, im allerletzten Haus an einer kurvigen Strandstraße, war die Küche die Kommandozentrale und Malabar ein hochdekorierter General. Lange bevor offene Küchen in Mode kamen, vertrat sie die Ansicht, dass man Köchinnen feiern sollte, statt sie in zu heiße Räume zu verbannen, wo sie allein schuften mussten, hinter geschlossenen Türen. In dieser Küche wurde Baiser auf ein Meer aus Crème anglaise gesetzt, perfekt sautierte Scheiben von Foie gras mit Feigenreduktion beträufelt und Salate aus Brunnenkresse und Endivie sachkundig in Olivenöl und Meersalz geschwenkt.
Meine Mutter hielt sich selten an Rezepte. Sie brauchte sie nicht. Ihr ging es darum, die Chemie des Essens zu verstehen, und dazu benötigte sie nur ihren Gaumen, ihren Instinkt und ihre Fingerspitzen. Ein einziger Tropfen Soße auf ihrer Zunge reichte, um eine Idee Kardamom aufzuspüren, eine einzelne Zitronenzeste, den noch so winzigen Hauch einer geheimen Zutat. Sie hatte ein angeborenes Gefühl für Komposition und Beschaffenheit und dafür, wie sich beides durch Hitze veränderte. Vor allem hatte sie ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Macht, die ihr diese Gabe verlieh, insbesondere im Hinblick auf das andere Geschlecht. Bewaffnet mit scharfen Messern, duftenden Gewürzen und Feuer konnte meine Mutter ein Festmahl kreieren, dessen Aromen allein Schiffe voller Männer auf Felsen hätten locken können, von denen sie sie mit Vergnügen in den Abgrund hätte stürzen sehen. Ich kannte die Sirenen, denn ich hatte die griechischen Sagen gelesen, und staunte über die Kräfte meiner Mutter.
Es wurden Kerzen angezündet, die den Raum leuchten ließen, und das fröhliche Quietschen der Korken verkündete, dass das Essen fertig war. Wir versammelten uns um den Tisch und widmeten uns dem ersten Gang: dampfenden Sandklaffmuscheln, die meine Mutter und ich früher am Tag bei Ebbe auf einer der Sandbänke gesammelt hatten. Wir hebelten die Schalen auf, entfernten die Haut von den langen Hälsen und tauchten die Körper in heiße Brühe und geschmolzene Butter. Dann steckten wir sie uns in den Mund, wo das Meer explodierte.
Als Nächstes kam die Hauptattraktion: Bens Täubchen, ganz familiär auf einem riesigen Schneidebrett serviert, in dessen Rillen sich die überschüssige Flüssigkeit sammelte. Mit einer langen Zange legte Malabar auf jeden Teller eine winzige Taube. Medium rare gebraten, war das Fleisch seidig, zart und feinporig und aromatischer, als ich erwartet hatte. Die Haut war fett wie die von Enten und knusprig wie Schinkenspeck. Als Beilage hatte meine Mutter ein pikantes Maispüree gemacht, eine Karambolage aus Maiskörnern, Eiern und Sahne, von der sie jedem einen Klacks gab. Es schmeckte süß und salzig, Aromen, die sich ergänzten, und war sehr saftig, mit einer Ahnung von Vergorenem.
Beim ersten Bissen seufzte meine Mutter zufrieden. Sie scheute sich nie, die Früchte ihrer Arbeit zu genießen.
»Das«, sagte Ben und schloss die Augen, »ist Perfektion.« Er saß neben Malabar und legte einen Arm auf ihre Rückenlehne, dann hob er sein Glas. »Auf die Köchin!«
»Auf Malabar«, stimmte Lily ein.
Wir stießen an. Mein Stiefvater strahlte und sagte: »Auf meinen Liebling.« Charles betete meine Mutter an, seine zweite Frau, die fast fünfzehn Jahre jünger war als er. Sie waren beide mit anderen Menschen verheiratet gewesen, als sie sich über Freunde kennengelernt und ineinander verliebt hatten. Charles war meiner Mutter sehr dankbar, dass sie trotz seiner langwierigen Scheidung und mehrerer folgenschwerer Schlaganfälle unmittelbar vor ihrer Hochzeit bei ihm geblieben war. Seine rechte Körperhälfte war teilweise gelähmt, sein Gang schlurfend, und er hatte lernen müssen, mit links zu schreiben und zu essen.
Charles und Ben waren seit ihrer Kindheit befreundet, verbunden durch ihre Liebe zu Plymouth, wo Ben lebte, ein direkter Nachfahre der Mayflower-Pilgerväter, und wo Charles als Kind die Sommer verbracht hatte. Sie waren ein ungewöhnliches Paar – Charles so verkopft, Ben so körperlich –, aber die Freundschaft hatte seit Jahrzehnten Bestand. Sie waren nur sechs Monate auseinander, wobei der lebhafte, unwiderstehliche Ben Jahre jünger wirkte. Als Jäger, Angler und Umweltschützer – außerdem war er ein erfolgreicher Geschäftsmann – besaß Ben ein enzyklopädisches Wissen über die Natur und ließ andere begeistert daran teilhaben. Beim Abendessen bombardierte ich ihn mit Fragen: Wie paaren sich Pfeilschwanzkrebse? Was löst die jährliche Wanderung der Heringe aus? Wie legen Perlboote Eier? Ich versuchte, ihn in Verlegenheit zu bringen, aber es gelang mir nicht. Fragen zum Thema Umwelt und Natur waren sein Partytrick.
Während wir aßen, schulte Ben uns zum Thema Tauben, die er seit mehr als dreißig Jahren züchtete.
»Wusstet ihr, dass die Jungen von beiden Elternteilen bebrütet und gefüttert werden?«, fragte er und deutete mit einer winzigen Keule auf mich.
»Sind das hier denn Stadttauben?«, fragte ich, neugierig, ob es sich um dieselben schmuddeligen Wesen handelte, die ich aus New York kannte, wo ich geboren war und wo mein Vater noch immer lebte.
»Ja und nein. Taubenvögel gehören alle zur Familie der Columbidae«, sagte Ben und berührte dabei meinen Arm. »Was wir züchten, sind weiße Tauben.«
»Ach, es ist eine so wunderbare Schar, Rennie«, sagte Lily. »Du musst mal zu Besuch kommen und sie dir ansehen.«
»Das würde ich gern«, sagte ich und sah meine Mutter an, die zustimmend nickte.
»Und wie genau tötet ihr sie nun eigentlich?«, fragte Peter.
Ben drehte in der Luft einen winzigen, unsichtbaren Hals um.
Der Abend nahm seinen Lauf, anregend und voll kleiner Überraschungen. Ben war ein lebhafter Mann, der viel gestikulierte und Dinge ausführlich erklärte, anderen aber auch aufmerksam zuhörte. Mir fiel auf, dass sein Blick während des Essens immer wieder zu meiner Mutter wanderte. Die schien ihr Vergnügen daran zu haben, warf den Kopf hin und her wie ein Pferd und lachte viel. Einmal beobachtete ich sie dabei, wie sie die Gabel über ihr Maispüree zog. Wir blickten beide auf, um zu sehen, ob Ben hersah. Tat er. Sie lächelte mir kurz verschwörerisch zu und goss mir Rotwein in ein Glas. Dann goss sie Peter auch etwas ein.
»Der Pinot passt perfekt zu den Täubchen«, sagte sie zu uns, als bekämen wir ständig Wein zum Essen.
Als ich sie überrascht ansah, zuckte sie amüsiert mit den Schultern. »Wenn wir in Frankreich leben würden, hättet ihr schon mit acht Jahren zum Abendessen Wein bekommen!«
Ben nickte schmunzelnd, und meine Mutter folgte seinem Beispiel mit einem kehligen Lachen.
Charles und Lily, unbeeindruckt davon, dass ich Wein trank, unbeirrt davon, dass ihre Ehepartner miteinander flirteten, brachen ebenfalls in Lachen aus.
An diesem Abend war alles so verdammt lustig.
Gegen neun Uhr wurde ich unruhig. Obwohl die Ventilatoren liefen, war es im Esszimmer unangenehm warm, und meine Oberschenkel klebten am Stuhl. Immer wieder sah ich unauffällig auf die Standuhr. Wo bleibt er? Als es schließlich an der Tür klopfte, warf ich Peter einen flehenden Blick zu. Er rührte sich nicht vom Fleck.
Bitte, bat ich mit hochgezogenen Augenbrauen. Komm schon. Tu es einfach.
Peter verdrehte die Augen und zuckte halbherzig mit den Schultern, gab dann aber nach und ging zur Tür.
»Darf ich aufstehen?«, fragte ich meine Mutter. »Ich brauch frische Luft.«
Sie nickte, bekam meine Frage aber kaum mit.
Als ich meinen Teller wegräumte, fühlte ich mich vom Wein etwas beschwipst. Ich rannte nach oben, putzte mir die Zähne, bürstete mir die Haare und raste hinunter zur Tür. Kurz davor wurde ich langsamer, um gelassen zu wirken.
Mein Bruder und unser Nachbar Ted standen auf der Veranda und quatschten. Wir machten es immer so: Peter sagte Gute Nacht und ging wieder rein, während Ted und ich ums Haus herum- und dann die Holztreppe zum Wasser hinunterliefen. Viel zu sagen hatten wir uns nicht, dieser Junge und ich, also redeten wir nicht. Wir gingen an unsere gewohnte Stelle, legten uns auf den grobkörnigen Sand und fingen an rumzumachen, wie wir es seit einer Woche fast jeden Abend taten.
Ein Paar ging Hand in Hand an uns vorbei, ohne uns zu bemerken, lehnte sich an den Findling nah am Ufer und bewunderte das Mondlicht, das sich in der Bucht spiegelte. Statt auseinanderzurücken, wie wir es normalerweise taten, wenn uns jemand störte, legte Ted mir eine salzige Hand auf den Mund und zog mit einem Ruck mein Trägerhemd hoch, bis über meine Brüste. Ich lag flach auf dem Sand, verblüfft über dieses unerwartete Manöver. Teds grinsendes Gesicht, das vom Mond erleuchtet wurde, war voll jugendlicher Lust und Gier. Seine Augen weideten sich an meinem Anblick. Aus seinen Achseln lugten dunkelblonde Haare, und die Muskeln an seinen Schultern zuckten. Dann fing er an – drückte erst eine Brust, dann die andere, und ließ sie wieder los, sodass in meinem Inneren Funken stoben und mir zwischen den Beinen warm wurde.
Als ich schließlich nach Hause kam, ging die Dinnerparty meiner Mutter dem Ende entgegen. Lily räumte die Dessertteller ab, und mein Stiefvater wirkte erschöpft. Sogar Ben und meine Mutter machten einen gedämpften Eindruck. Ich glitt unbemerkt an ihnen vorbei und ging nach oben.
Als ich ins Bett kroch, begann mein Erlebnis mit Ted Schleifen in meinem Kopf zu drehen. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken, was er getan hatte. Die Regeln bei sexuellen Begegnungen unter Teenagern waren unmissverständlich: Es gab kein Zurück. Ich wusste, dass eine neue Startlinie gezogen worden war. Wenn wir uns das nächste Mal gemeinsam davonschlichen, würden meine entblößten Brüste wie selbstverständlich vorausgesetzt werden.
Die Vorhänge in meinem Zimmer waren offen, die Fenster so weit aufgerissen wie möglich, und trotzdem war es drückend heiß. Mein Haar, das von der salzigen Luft feucht war, klebte mir am Hals, und an den Beinen spürte ich das abgenutzte, sandige Baumwolllaken. Nur der Mond wirkte kühl, wie ein kaltes Metallstück, das ich mir gern ans Gesicht gehalten hätte. Nicht einmal die kleinste Brise zerrte an der Vertäuung der Fischerboote oder brachte das Windspiel meiner Mutter zum Klingen. Auch im Haus war es still. Meine Eltern und ihre Gäste mussten ebenfalls schlafen gegangen sein.
Mein Körper hatte sich im Laufe des letzten Jahres sehr verändert. Davor hatte ich Jungs nachlaufen müssen, um sie auf mich aufmerksam zu machen. Jetzt brauchte ich mich nur am Geländer unserer Veranda festhalten, mich nach hinten beugen, meine Zehen im weichen Sand vergraben oder nach oben blinzeln, als würde ich in die Sonne gucken, und schon waren sie hin und weg. Nach einer langen Ruhephase war mein Körper explodiert – ich hatte Brüste bekommen, breitere Hüften, meine Haut straffte sich über neuen Rundungen. Auch mein Inneres spielte verrückt.
Jeden Monat blutete ich und hatte Krämpfe, aber vom Rest hatte mir niemand erzählt: wie feucht und lehmig es da drinnen war, wie glatt, wenn ich nicht meine Tage hatte, ständig passierte etwas, veränderte sich, wurde weich und hinterließ schlüpfrige Spuren. Beim Wegdämmern ließ ich die abendlichen Ereignisse immer wieder vor meinem inneren Auge ablaufen – Top hochgezogen, Hände auf Brüsten –, bis in meinem Inneren eine vollkommen neue Art von Aufruhr entfesselt wurde. Tief in mir drin rollte eine unbekannte Welle heran, tanzte durch mich hindurch und leckte dabei an jedem Nerv und jeder Zelle.
Was war das denn?
Ich war wieder vollkommen wach, versuchte mich zu erinnern, was genau ich gemacht hatte, wollte mir den Weg zu diesem außergewöhnlichen Ort merken, aber er entglitt mir bereits. Ich sank in einen unruhigen Schlaf.
»Wach auf, Rennie.«
Ich spürte eine Hand auf meiner Schulter und zog mir die Decke über den Kopf.
»Rennie, bitte.«
Noch ehe ich mich umdrehte und das Gesicht meiner Mutter sah, nahm ich ein seltsames Beben in ihrer Stimme wahr und roch den Pinot noir. Sie klang zögerlich und irgendwie verzweifelt. Die Matratze sank ein, als sie sich neben mich setzte, und mein Körper versteifte sich, um die Vertiefung auszugleichen. Ich hielt die Augen geschlossen und atmete bewusst gleichmäßig.
»Rennie!« Das Flüstern war jetzt dringlicher und immer noch ungewohnt zittrig. Sie zog mir die Decke weg. »Bitte, wach auf.«
Obwohl sie neben mir saß und sich über mich beugte, ich ihren Atem warm an meinem Ohr spürte, wollte ich die Gedanken an Ted nicht loslassen. Warum kam meine Mutter mitten in der Nacht in mein Zimmer? Einen Moment lang verspürte ich Panik: Hatte sie einen sechsten Sinn dafür, dass ich heute zum ersten Mal so etwas wie Sex gehabt hatte? Oder hatte Peter mich verraten und ihr erzählt, dass ich weg gewesen war und Mist gebaut hatte? Ich drehte mich von ihr weg, im Halbschlaf, nicht in der Stimmung für eine Standpauke. Was ich gerade erlebt hatte, ließ mich immer noch schweben, und ich wollte es nicht aus den Augen verlieren.
»Rennie, wach auf. Bitte, wach auf.«
Geh weg, dachte ich.
»Süße. Bitte. Ich brauche dich.«
Da öffnete ich die Augen. Malabar war im Nachthemd, ihr Haar zerzaust. Ich setzte mich auf.
»Was ist, Mom? Alles in Ordnung?«
»Ben Souther hat mich eben geküsst.«
Ich versuchte, diese Information zu verarbeiten. Versuchte, mir einen Reim darauf zu machen. Konnte es nicht. Ich rieb mir die Augen. Meine Mutter saß immer noch neben mir.
»Ben hat mich geküsst«, wiederholte sie.
Ein Nomen, ein Verb, ein Objekt – eigentlich ein ganz simpler Satz, und doch begriff ich ihn nicht. Warum sollte Ben Souther meine Mutter küssen? Es lag nicht daran, dass ich naiv gewesen wäre – ich wusste, dass sich auch Menschen küssten, die sich nicht küssen sollten. Meine Eltern hatten mich mit den Geschichten ihrer jeweiligen Seitensprünge nicht verschont, und ich wusste mehr über Untreue als die meisten anderen Kinder. Ich war vier, als sich meine Eltern trennten, sechs, als mein Vater wieder heiratete, sieben, als diese neue Ehe zu zerbrechen begann, und acht, als meine Mutter schließlich Charles heiraten konnte, der, als sie sich kennenlernten, von seiner ersten Frau zwar längst getrennt, aber noch nicht geschieden war.
Auch Ben war natürlich verheiratet, mit Lily. Die Southers waren seit fünfunddreißig Jahren verheiratet.
Mom und Charles. Ben und Lily.
Die beiden Paare verband eine Freundschaft, seit meine Mutter und mein Stiefvater sich kannten, inzwischen seit fast einem Jahrzehnt.
Das war es, was mich an dem Kuss am meisten verwirrte – die Freundschaft zwischen Ben und Charles. Die Männer liebten sich heiß und innig. Sie waren seit fünfzig Jahren befreundet, vielleicht sogar länger – seit sie als kleine Jungs Steine über das glatte, graue Wasser der Bucht von Plymouth springen ließen und so taten, als wären sie Pilgerväter, die in den Dünen Festungen bauten und imaginäre Feinde mit Musketen aus Stöcken abwehrten. In all den Jahren hatten sie zusammen gejagt und geangelt, waren mit der Schwester des jeweils anderen ausgegangen, hatten einander als Trauzeugen gewählt und waren Paten für den Sohn des anderen geworden.
»Was soll das heißen, Ben hat dich geküsst?« Plötzlich war ich hellwach. Ich stellte mir vor, wie sie ihm daraufhin eine Ohrfeige verpasst hatte. So etwas traute ich meiner Mutter zu. »Was ist passiert?«
»Wir sind nach dem Abendessen spazieren gegangen, nur wir zwei, und er hat mich an sich gezogen, so.« Meine Mutter legte die Arme um ihren Körper, zeigte mir Bens Umarmung und durchlebte zugleich noch einmal die Erinnerung. Dann ließ sie die Arme sinken und streckte sich lächelnd neben mir auf dem Bett aus.
Eine Ohrfeige hatte es offenbar nicht gegeben.
»Ich kann es immer noch nicht glauben. Ben Souther hat mich geküsst«, sagte sie.
Was war heute Abend nur mit ihrer Stimme los?
»Er hat mich geküsst, Rennie.«
Da war es wieder: Glück. Ein Tonfall, den ich seit Charles’ Schlaganfällen nicht mehr an ihr gehört hatte. Glück war vom Nachthimmel gefallen und in der Stimme meiner Mutter gelandet. Ein Kuss – sein Glanz und Schimmer und das, was er womöglich bedeutete – hatte alles verändert.
»Er will, dass wir uns nächste Woche in New York treffen. Er hat da eine Vorstandssitzung – irgendwas mit Lachsen –, und Lily will in Plymouth bleiben. Ich weiß nicht, was ich machen soll.«
Wir lagen auf dem Rücken und sahen an die Decke, unsere Körper strahlten Wärme aus. »Was meinst du, was soll ich tun?«
Wir wussten beide, dass das eine rhetorische Frage war. Malabar plante immer voraus. Sie hatte sich schon entschieden.
»Ich werde deine Hilfe brauchen, Süße«, fuhr sie fort. »Ich muss mir überlegen, wie ich das mache. Wie ich es möglich mache.«
Ich lag still wie eine Leiche, unsicher, was ich sagen sollte.
»Natürlich möchte ich Charles nicht wehtun. Ich würde lieber sterben, als ihm noch mehr Kummer zu bereiten. Das ist für mich das Allerwichtigste. Charles darf es nie erfahren. Er wäre am Boden zerstört.« Sie hielt inne, als dächte sie ein letztes Mal über ihn nach, dann drehte sie sich auf die Seite und sah mich an. »Du musst mir helfen, Rennie.«
Meine Mutter brauchte mich. Mir war klar, dass ich die Lücken im Gespräch füllen sollte, aber mir fehlten die Worte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Freust du dich nicht für mich, Rennie?«, fragte sie und stützte sich auf einen Ellbogen.
Ich sah ihr ins Gesicht, in die dunklen, hoffnungsvoll schimmernden Augen, und plötzlich freute ich mich für sie. Und für mich. Malabar hatte sich verliebt, und sie hatte mich als ihre Vertraute gewählt, eine Rolle, nach der ich mich immer gesehnt hatte, ohne es zu wissen. Vielleicht hatte es ja etwas Gutes. Vielleicht konnte jemand, der so vital war wie Ben, meine Mutter aus der Missstimmung befreien, in der sie sich seit Charles’ Schlaganfällen befand und die manchmal auch schon in den Jahren davor aufgetreten war. Vielleicht würde sich meine Mutter im Herbst, wenn die Schule wieder losging, anziehen, bevor sie mich und die Nachbarskinder morgens zur Schule fuhr. Kein Mantel überm Nachthemd mehr, kein Kopfkissenabdruck in ihrem aufgedunsenen Morgengesicht. Vielleicht würde sie sich die Haare bürsten, Lipgloss auftragen und die anderen Kinder mit einem gut gelaunten »Hallo« begrüßen, so wie die anderen Mütter.
»Natürlich freue ich mich«, sagte ich. »Ich freu mich sehr für dich.«
Ihre Reaktion – dankbare Tränen – machte mich mutig.
»Du hast es verdient, nach allem, was du durchgemacht hast«, sagte ich zu ihr.
»Süße, du darfst es niemandem erzählen. Keiner Menschenseele. Deinem Bruder nicht, deinem Vater nicht, und deinen Freundinnen auch nicht. Niemandem. Es ist eine ernste Angelegenheit. Versprich es mir, Rennie. Dieses Geheimnis musst du mit ins Grab nehmen.«
Ich versprach es sofort, ganz begeistert, eine Hauptrolle im Drama meiner Mutter bekommen zu haben, und merkte nicht, dass ich zum zweiten Mal an diesem Abend überrumpelt worden war.
Die Menschen in den Schlafzimmern um uns herum – mein Bruder Peter, mein Stiefvater Charles, Ben und seine Frau Lily – schliefen alle friedlich in ihren Betten. Sie hatten keine Ahnung, dass der Boden unter ihnen in Bewegung geraten war. Meine Mutter hatte ihren Blick verengt und sich für das Glück entschieden, und ich machte bereitwillig mit, wobei wir beide die Gefahren des neuen Terrains ignorierten.
Als die Morgendämmerung durch mein offenes Fenster strömte und die Sonne über dem äußeren Strand aufging, der langen Landzunge aus Sand und Dünen, die unsere Bucht vom Atlantik trennt, war der Himmel pink mit roten Streifen. Ich wachte hoffnungsfroh auf und dachte nicht mehr an Ted. Ich wusste bereits, wenn er am Abend auf unserer Veranda auftauchen würde, würde ich mich nicht mit ihm zum Strand stehlen, um zu spüren, wie er sein Becken gegen meines drückte. Ich würde zu Hause bleiben, um die Verführung meiner Mutter mitzuerleben.
2
Wenn ein Schmetterling, der in Südamerika mit den Flügeln schlägt, angeblich einen Sturm in Texas auslösen kann, welche unvorhersehbaren Folgen kann dann ein verbotener Kuss auf einer Landstraße haben? Dieser markierte den Beginn vom Rest meines Lebens. Nachdem ich einmal beschlossen hatte, zu meiner Mutter zu halten, gab es kein Zurück mehr. Ich wurde ihre Beschützerin, ihr Wachposten, immer darauf lauernd, was sie womöglich verraten könnte.
Ich wachte mit einem prickelnden Hochgefühl auf, getragen vom Glück in der Stimme meiner Mutter, noch ganz trunken von der Vertrautheit unseres Gesprächs. Malabar hatte mich erwählt, und mein Körper vibrierte förmlich vor Erwartung, was nun kommen würde.
Mein Bruder saß schon über eine Schüssel Cornflakes gebeugt in der Küche, als ich nach unten geschwebt kam. Die halb leeren Gläser, die auf der Theke standen, verströmten den schalen Geruch des Weins vom Vorabend. Peter war im Juni sechzehn geworden, hatte über der Garage ein eigenes Apartment (eine Quelle des Neids), sein eigenes Boot (noch eine) und bereits eine Vorstellung davon, wer er mal sein wollte.
»Dir ist schon klar, dass Ted ein total widerlicher Typ ist, oder, Ren?«, sagte Peter und schaufelte sich einen Löffel Cornflakes in den Mund. Mit dem Handrücken wischte er sich einen Tropfen Milch aus dem Mundwinkel.
Ich wurde rot, sah wieder vor mir, wie Ted mein Oberteil hochzog. Ja, mir war klar, dass er ein widerlicher Typ war. Vor fünf Jahren hatte er seine Sommerabende noch damit verbracht, Frösche zu fangen, ihnen Knallkörper ins Maul zu stecken und sich dann totzulachen, wenn ihre Beine wegflogen.
»Nein, er ist ein toller Typ«, sagte ich zu meinem Bruder, die Worte glatt wie Murmeln. Ich hatte zwar kein Interesse mehr an Ted; zuzugeben, dass er ein Idiot war, war trotzdem keine Option. In unserer Familie war es immer schon wichtiger, recht zu haben, als ehrlich zu sein. Es gab keinen Raum für Unsicherheiten, also behielt man sein Visier stets unten.
Peter grinste und schob seine Schale in Richtung Spüle.
Seit unsere Eltern sich vor zehn Jahren hatten scheiden lassen, waren wir zu dritt: Mom, Peter, ich. Natürlich war mein Vater im Hintergrund, in unserem Jedes-zweite-Wochenende-und-die-Hälfte-der-Ferien-Haus, und dann war da noch mein Stiefvater Charles mit seinen vier erwachsenen Kindern aus erster Ehe, die nun meine Stiefgeschwister waren. Aber unsere eigentliche Familie bestand seit der Scheidung aus einem robusten Dreieck. An diesem Morgen veränderte sich jedoch unsere Geometrie. Bevor der Tag zu Ende war, würde Peters Ecke abgeschlagen sein, und einmal von ihm befreit, würden meine Mutter und ich uns in einer geraden Linie anordnen, der optimalen Aufstellung für ihr Geheimnis.
»Guten Morgen«, zwitscherte Malabar und wehte in die Küche, einen Morgenrock aus Baumwolle locker über ihrem dünnen Nachthemd, das Haar zerzaust. Es war an diesem Morgen etwas kühler, aber immer noch schwül, und die grauvioletten Wirbel am Himmel versprachen den erlösenden Regen. Meine Mutter erhaschte ihr Spiegelbild im Küchenfenster und schürzte die Lippen. Im kalten Licht des Tages sah man die Altersflecken auf ihren Händen und die schlaffe Haut an ihrem Hals, die an eine leicht überreife Nektarine erinnerte.
Trotzdem: Sie war schön, schlank und stark, mit glänzendem, kastanienbraunem Haar und einem verführerischen Gesicht. Eine Art Grübchen oben auf ihrer linken Wange, das von einer Geburtszange herrührte, erinnerte an ihren schwierigen Start auf dieser Erde. Obwohl sie eine elegante Unnahbarkeit kultivierte, war sie überraschend mutig, jederzeit bereit, Köder auszulegen, und bei starkem Wellengang oft die Erste, die ins Wasser sprang. Inzwischen weiß ich, dass sie einen entscheidenden Teil von sich selbst verloren hatte, als sie ihre Arbeit als Journalistin in New York aufgab und sich für finanzielle Sicherheit und ein einfacheres Leben an der Seite von Charles entschied, der einer reichen Familie entstammte. Mein Vater hat mir mal erzählt, dass meine Großmutter ihrer Tochter immer folgenden Rat gegeben hat: »Man heiratet einen Mann, um mit ihm Kinder zu bekommen, und einen anderen, der sich im Alter um einen kümmert.« Sollte das Malabars Absicht gewesen sein, als sie Charles heiratete, ob bewusst oder unbewusst, lief es anders als geplant. Charles hatte meine Mutter reich gemacht, aber den Löwenanteil des Kümmerns leistete sie. Im Herbst wurde Malabar neunundvierzig, und sie war fraglos verzweifelt über die unerwarteten Wendungen, die ihr Leben genommen hatte.
Trotzig reckte sie ihrem Spiegelbild das Kinn entgegen, dann wandte sie sich mir zu und sah mich mit einem Blick an, der bewies, dass ich unsere Begegnung letzte Nacht nicht geträumt hatte.
»Junge Dame«, sagte sie mit einer hochgezogenen Augenbraue, »du und ich, wir haben nachher noch was zu besprechen.«
Peter schüttelte den Kopf, fragte sich offenbar, was ich jetzt wieder angestellt hatte. Vielleicht dachte er, ich wäre beim Knutschen mit Ted erwischt worden, aber dann tat er, als würde er an einem Joint ziehen. Ist es das? Er zwinkerte.
Meine Mutter fing an, Tee zu kochen, ein aufwändiges Ritual, bei dem der Nebel vom Vorabend – verursacht durch Cocktails, Wein und ein, zwei Schlaftabletten – vertrieben und der neue Tag begonnen wurde. Sie leerte den Kessel, füllte ihn mit frischem Wasser und stellte ihn auf den Herd. Dann öffnete sie eine Blechdose mit Lapsang Souchong, und puff, war der Raum erfüllt von diesem speziellen rauchigen Duft. Mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger nahm sie die perfekte Menge getrockneter Blätter auf und ließ sie nach und nach in die Teekanne fallen. Als der Kessel endlich brodelte und pfiff, traf heißes Wasser auf Blätter, und während der Tee zog, wurde ihm ein absonderlicher, hahnenförmiger Kannenwärmer übergezogen.
Als Nächster kam Charles angeschlurft, frisch geduscht und sehr aristokratisch mit seinem breiten Kiefer, der dicken Hornbrille und dem zurückgegelten grauen Haar. Er wirkte wie immer seit seinen Schlaganfällen vor sechs Jahren: ergeben in sein Schicksal, dass er nicht mehr das Sagen hatte. Er war als Ideengeber der »Plimoth Plantation« verehrt worden, einem Museum für Geschichte zum Anfassen, das er vor Jahren gegründet hatte und für das er nach wie vor brannte, und begeisterte sich für diverse archäologische Projekte. Neuerdings wollte er die lange verschollenen Überreste eines gesunkenen Schiffs namens Whydah Gally finden. Am meisten bewunderte ich an ihm, wie vollkommen anders er war als meine Eltern: Er fluchte nicht, verlor nie die Fassung, und er hatte kein Problem damit, nicht recht zu behalten. Charles hatte Manieren, wahrte gelassen die Form und blieb immer freundlich; er brauchte nicht mehr als ein gutes Buch, vorzugsweise ein historisches, das er überall lesen konnte, außer am Strand. Entsprechend rief er an jedem Sommermorgen den Regengott an. »Bitte, lieber Regengott«, betete er beim Frühstück, »sorg dafür, dass ich nicht im heißen Sand sitzen muss.« Wir mussten jedes Mal darüber lachen.
»Heute bekommst du offenbar deinen Willen, Charles«, sagte Peter, und unser Stiefvater betrachtete lächelnd den seltsamen Himmel.
»Wir könnten nach Wellfleet fahren und gucken, was Barry Clifford so treibt«, schlug er vor. Barry Clifford, auch bekannt als Indiana Jones von Cape Cod, war stets auf der Jagd nach gesunkenen Schätzen und hatte sich, wie Charles, vorgenommen, die Whydah zu finden.
Niemand biss an.
Normalerweise bereitete meine Mutter, während sie ihren Tee trank, den morgendlichen Trunk für Charles zu: ein Löffel Instantkaffee in einem Becher, der Rest von ihrem kochenden Wasser, einmal kurz umgerührt. Ein Überbleibsel aus seinen Junggesellentagen, nannte sie diese Vorliebe. Aber heute braute meine Mutter, da Ben und Lily übers Wochenende zu Besuch waren, eine Kanne Kaffee aus frisch gemahlenen Bohnen, und als ich sah, mit welchem Genuss Charles ihn trank, fragte ich mich, ob er Instantkaffee wirklich vorzog.
Charles, Peter und ich saßen an unseren üblichen Plätzen an der Theke, mit Blick in die Küche, wo meine Mutter, der der Tee Schwung verliehen hatte, zwischen Herd, Kücheninsel, Spüle und Kühlschrank herumwieselte und das Frühstück zubereitete. An diesem Morgen hatte sie beschlossen, Maisplätzchen zu backen, also schlug sie Eiweiß zu steifen Spitzen, schabte Maiskörner von Kolben und rieb Muskatnuss. Auf dem Herd schmolz die Butter, und Ahornsirup wurde auf kleiner Flamme warm.
Ben und Lily waren die Letzten, die erschienen, ebenfalls frisch geduscht, mit gekämmten Haaren, Lilys ergraute Locken wurden von einem leuchtend gelben Haarband zurückgehalten. Sie war keine Frau, die bereitwillig Geld für schicke Frisuren ausgab. Sie trug Bermudashorts und ein Polohemd, und ihre Lesebrille saß gefährlich tief auf ihrer Nase. Unter dem Arm hatte sie einen Ziegelstein von einem Buch über die Geschichte Norwegens, das sie meinem Stiefvater entgegenstreckte. Charles nickte lächelnd.
Ben begrüßte ihn mit seinem energiegeladenen »Wie geht’s!«, dann stiefelte er in die Küche, nahm die Hände meiner Mutter und küsste sie vor den Augen seiner Frau und meines Stiefvaters mitten auf den Mund.
»Malabar«, sagte er, das Gesicht so nah an ihrem, dass er bestimmt sehen konnte, wie ihre Pupillen sich weiteten, »das war verdammt noch mal das beste Dinner meines ganzen Lebens!«
»Ben«, sagte Lily mit spielerischem Tadel. »Lass die arme Frau in Ruhe.« Ihre Stimme war dünn und heiser, die Folge einer Krebsbehandlung mit Mitte zwanzig, bei der radioaktive Implantate in ihren Brustkorb eingesetzt worden waren. Die Strahlung hatte dem Tumorwachstum erfolgreich Einhalt geboten, aber verheerende Auswirkungen auf andere Körperteile gehabt: ihre Eierstöcke, ihr Herz und nun auch ihre Stimmbänder. Sie war zwar nicht mehr krank, aber man brauchte Lily nur anzusehen, um zu wissen, dass es ihr nicht gut ging. Gebrechlich war das Wort, das einem in den Sinn kam.
»Auf keinen Fall«, antwortete Ben, der weder die Hände meiner Mutter losließ, noch den Blick von ihr abwandte. »Wie viele Frauen gibt es, die wissen, was zu tun ist, wenn man ihnen einen Beutel frischer Täubchen mitbringt?« Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Wunderbar. Einfach wunderbar.«
Eine glückliche Wärme überzog das Gesicht meiner Mutter. War da auch Erleichterung? Hatte sie gezweifelt an dem, was letzte Nacht geschehen war? Versucht, sich einzureden, der Kuss sei nicht mehr gewesen als die Tat eines Betrunkenen, im Morgengrauen schon vergessen? Jetzt konnte sie sicher sein, dass es nicht so war. Ben Souther hatte gerade öffentlich erklärt, sie sei wunderbar, und das reichte aus, um das in ihr schlummernde Wunderbare zu wecken.
Meine Mutter entzog ihm die Hände und griff nach einer großen Gabel, wie man sie benutzt, um Fleisch auf dem Grill zu wenden. »Ben Souther, verlass sofort meine Küche!«
Ben lachte und trat mit abwehrend erhobenen Händen den Rückzug an. Er nahm seinen Platz auf der anderen Seite der Küchentheke ein, auf dem Hocker neben meinem Stiefvater. Ben hatte Hände, die Holz hackten, Zäune errichteten und Tiere aller Art geschickt töteten. Charles’ Hände waren zart wie die eines Babys, und die rechte konnte er seit seinen Schlaganfällen nicht mehr richtig bewegen. Mein Stiefvater schien sich in der Bewunderung seines ältesten Freundes für seine Frau zu aalen, und er tätschelte Bens Rücken mit einer lahmen Faust, durch deren papierene Haut die Knochen zu sehen waren. (Meine vier Stiefgeschwister konnten sich nie einigen, ob meine Mutter eine Goldgräberin war, nur auf das Geld der Familie aus, oder ob sie ihr Gewicht in Gold wert war, weil sie nach seinen Schlaganfällen bei Charles geblieben war.)
Draußen hingen Möwen wie Mobiles im Wind, bis sich irgendetwas änderte und sie zwang, auf der Suche nach der nächsten flüchtigen Bö abzudrehen. Stieglitze und Meisen flatterten zum Futterspender und stritten sich um die letzten Samen, bevor der Regen kam, während unter ihnen ein einsames Streifenhörnchen aufsammelte, was bei dem Gerangel zu Boden fiel. Das Licht war wunderschön und dann plötzlich verschwunden, ersetzt durch Elektrizität.
Wie aufs Stichwort stellte meine Mutter zwei herrliche Stapel Maisplätzchen auf die Theke, perfekt goldbraun gebacken und gekrönt mit dicken Baconstreifen. Als die Teller mit einem leisen Klirren die Marmorplatte trafen, beugten Charles und Ben einträchtig ihre Köpfe darüber und inhalierten das perfekte Zusammenspiel von Ahornsirup und Schweinefleisch.
Nach dem Frühstück ging ich hoch, um die überwältigenden Ereignisse der letzten vierundzwanzig Stunden festzuhalten – meinen ersten Orgasmus und den verbotenen Kuss meiner Mutter. Ich schrieb zwar schon lange Tagebuch, aber besonders fesselnd war der Inhalt bis zu diesem Tag nie gewesen. Mein Leben hatte sich über Nacht grundlegend verändert. Ich schrieb stundenlang.
Als ich schließlich wieder nach unten kam, sah ich, dass meine Mutter meinen Rat brauchte. Unschlüssig, wie sie das Spiel mit Ben vorantreiben sollte, suchte sie meine Hilfe. Was mache ich jetzt?, formte sie stumm mit den Lippen. Draußen schüttete es, und drinnen saßen die Erwachsenen faul herum, lasen oder sahen sich ein Tennis-Match an.
Wir huschten von einem ruhigen Eckchen ins nächste, und meine Mutter vertraute mir Geheimnisse an, deren Beichte für sie eine große Erleichterung gewesen sein muss. Auf der Fensterbank in ihrem Schlafzimmer gestand sie mir, seit Jahren unter Depressionen zu leiden. Ob ich das gewusst hätte, fragte sie. Ich wusste, dass sie morgens oft Mühe gehabt hatte, aufzustehen, und dass ich sie hatte bitten müssen, sich die völlig zerzausten und verknoteten Haare am Hinterkopf zu bürsten, bevor sie uns zur Schule fuhr. Aber wie die meisten Kinder war ich mit mir selbst beschäftigt, kreiste um meine Freundschaften und meinen jeweils aktuellen Schwarm und interessierte mich nicht besonders für das Innenleben meiner Mutter. Ich wollte nur sicher sein, dass sie mich am meisten liebte.





























