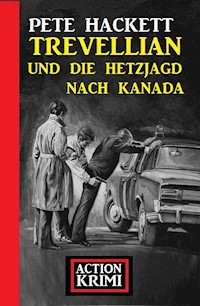
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Krimi von Pete Hackett Der Umfang dieses Buchs entspricht 227 Taschenbuchseiten. Viele Menschen sind bereit zu spenden, wenn andere in Not sind, und das Konto, das McBrady dafür angelegt hat, hat ein beachtliches Guthaben. Alles scheint in Ordnung zu sein, denn die Gelder sind auch für die Bedürftigen verwendet worden. Ein anonymer Anrufer behauptet jedoch, dass McBrady Geld unterschlagen habe. Die Untersuchungen bestätigen diese Aussage nicht. Erst als die FBI Agenten Trevellian und Tucker auf ein zweites Spendenkonto stoßen, bestätigen sich die Aussagen des Anrufers. Doch da ist McBrady schon geflohen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett
Inhaltsverzeichnis
Trevellian und die Hetzjagd nach Kanada: Action Krimi
Copyright
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Trevellian und die Hetzjagd nach Kanada: Action Krimi
Krimi von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 227 Taschenbuchseiten.
Viele Menschen sind bereit zu spenden, wenn andere in Not sind, und das Konto, das McBrady dafür angelegt hat, hat ein beachtliches Guthaben. Alles scheint in Ordnung zu sein, denn die Gelder sind auch für die Bedürftigen verwendet worden. Ein anonymer Anrufer behauptet jedoch, dass McBrady Geld unterschlagen habe. Die Untersuchungen bestätigen diese Aussage nicht. Erst als die FBI Agenten Trevellian und Tucker auf ein zweites Spendenkonto stoßen, bestätigen sich die Aussagen des Anrufers. Doch da ist McBrady schon geflohen.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER FIRUZ ASKIN
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Kapitel 1
»Aus Kolumbien erreichte uns eine erschütternde Nachricht«, sagte der Moderator der Sieben-Uhr-Nachrichten. »Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat in der Nacht die Westküste von Kolumbien erschüttert. Das Zentrum des Erdstoßes am Montag lag nach Angaben der Seismologen siebenundzwanzig Kilometer von der Stadt Jurado entfernt unter dem Meeresgrund des Pazifiks.
Den Behörden liegen noch keine Berichte über Schäden oder Opfer vor. Das Epizentrum des Bebens lag US-Geologen zufolge in der Stadt Jurado in der nördlichen Urwald-Provinz Choco im Grenzgebiet zu Panama. Die Ausläufer des Bebens waren auch in der Metropole Medellin und der Hauptstadt Bogota zu spüren. - 1999 waren bei einem Erdbeben der Stärke 6,2 in der Kaffee-Anbauregion Kolumbiens 1230 Menschen ums Leben gekommen.«
Drei Stunden später wurde in den Zehn-Uhr-Nachrichten bekannt gegeben, dass man mit mehr als 10.000 Toten rechnet und dass mindestens 50.000 Menschen obdachlos geworden sind. Die amerikanische Bevölkerung wurde aufgefordert, zu spenden, um die Menschen der betroffenen Region mit notwendigen Gütern und medizinischen Hilfsmitteln versorgen zu können.
Spendenorganisationen wurden ins Leben gerufen. Unter anderem die Aktion >Hilfe für Erdbebenopfer in Kolumbien<. Präsident dieser Aktion war ein Mann namens James McBrady. McBrady persönlich bat die Bevölkerung Amerikas, für die Erdbebenopfer in Kolumbien zu spenden und versprach, die Gelder dem Internationalen Roten Kreuz und anderen Hilfsorganisationen, die vor Ort tätig waren, um Hilfe zu leisten, unbürokratisch und in voller Höhe zuzuleiten.
*
Es war ein Mittwoch, der Tag war regnerisch, es war kalt, und man jagte – wie man so schön sagt -, keinen Hund vor die Tür. Milo und ich hatten vor einer Viertelstunde den Dienst angetreten. Wir arbeiteten an einer Sache, in der wir nicht so recht weiterkommen wollten. Es ging um Produktpiraterie. Ein Hersteller in Taiwan hatte den amerikanischen Markt mit Handys der Marke Nokia überschüttet, die zu einem Bruchteil des Preises eines echten Nokia-Handys erworben werden konnten und die illegal in die Staaten eingeführt worden waren.
Wir hatten einen Mann namens Tyler Broderick im Auge, den wir verdächtigten, der Verbindungsmann der taiwanesischen Mafia in Amerika zu sein. Aber Broderick bot uns keinen Hebel, um anzusetzen. Er war clever und aalglatt. Er tanzte uns sozusagen auf der Nase herum.
Mein Telefon klingelte. Es war Mr. McKee. »Guten Morgen, Jesse. Kommen Sie und Milo doch gleich mal bei mir vorbei. Ich erhielt soeben einen Anruf...«
Der Chef brach ab. »Wir kommen«, sagte ich, »bis gleich.« Ich legte auf und erhob mich. »Komm, Alter. Der Chef ruft. Ich nehme an, er hat vor, uns einen weiteren Fall aufs Auge zu drücken.«
Milo verzog das Gesicht. »Ich würde lieber an Broderick dranbleiben.«
»Wir arbeiten eben wieder mal zweigleisig«, versetzte ich. »Wäre ja nicht das erste Mal.«
Milo stemmte sich am Tisch in die Höhe. Wir verließen unser Büro, betraten wenig später das Vorzimmer Mr. McKees und Mandy empfing uns mit einem freundlichen Lächeln. »Geht nur hinein. Kaffee habe ich bereitgestellt.«
»Du bist ein Schatz«, sagte Milo und grinste breit. »Wieso bist du eigentlich noch immer unverheiratet? Du könntest doch an jedem Finger zehn Kerle haben. Wie wäre es mit uns beiden?«
Mandy lachte hell auf. »Alles, nur keinen FBI-Agenten, der täglich 24 Stunden im Dienst ist. Wenn ich heirate, will ich auch etwas haben von meinem Mann.«
»Wieder nichts«, murmelte Milo und machte ein zerknirschtes Gesicht. »Ich glaube, ich muss den Job wechseln. Was meinst du, Jesse?«
»Der Chef wartet«, sagte ich und schob Milo mit sanfter Gewalt weiter. Dann betraten wir das Büro Mr. McKees. Er kam uns entgegen, drückte jedem die Hand und bot uns Plätze an seinem kleinen Konferenztisch an, um den einige lederbezogene Stühle herum gruppiert waren. Auf dem Tisch standen Tassen und eine Thermoskanne aus Edelstahl. »Bedienen Sie sich«, lud der Chef uns ein, und wie ließen es uns nicht zweimal sagen. Bald roch es in dem Büro wie in einem türkischen Kaffeehaus.
»Ich erhielt gestern Abend, nachdem Sie schon Ihren Feierabend angetreten hatten, einen anonymen Anruf«, begann Mr. McKee. »Der Anrufer erklärte, dass sich ein Mann namens James McBrady Gelder, die für die Erdbebenopfer in Kolumbien gespendet worden sind, unter den Nagel gerissen hat.«
»Soll dieser McBrady in New York leben?«, fragte ich.
Der Assistant Director nickte. »Ich habe im Telefonbuch nachgeschaut. Es gibt einen James McBrady in New York. Und er hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, der er den Namen Hilfe für Erdbebenopfer in Kolumbien gegeben hat. Er wohnt in der 54th Street, Hausnummer 78. Vielleicht könnten sie sich diesem McBrady ein wenig widmen.«
Ich warf Milo einen schnellen Blick zu und nahm war, dass er wenig begeistert dreinblickte. »Wir arbeiten im Moment an der Sache mit den Nokia-Handys, Sir. Leider treten wir auf der Stelle. Tyler Broderick versteht es, uns keinen Hebel zu bieten, mit dem wir ansetzen könnten.«
»Ja, ich weiß. Aber Broderick läuft Ihnen nicht weg. Außerdem sind Sie in der Lage, an zwei Sachen gleichzeitig zu arbeiten. Ich kenne Ihre Fähigkeiten. Widmen Sie McBrady einen etwas intensiveren Blick. Und wenn sie zu dem Ergebnis kommen, dass er sich an Spendengeldern bereichert hat, dann reißen Sie ihm die Maske des Biedermannes vom Gesicht.«
»Wir werden unser Bestes geben«, sagte ich, dann trank ich einen Schluck Kaffee. Er schmeckte vorzüglich.
»Wie weit sind Sie denn mit Ihren Ermittlungen in der Sache Broderick?«, fragte der Chef und griff damit das Thema, das ich eben angesprochen hatte, noch einmal auf.
»Wir haben 100.000 Handys, die mit einem Hubschrauber nach New York gebracht wurden und von zwei Kerlen übernommen werden sollten, beschlagnahmt. Ihre Namen sind Wes Hollow und Walt Danner. Job der Kerle war es, die Handys auf die Läden zu verteilen, in denen sie zum Verkauf angeboten werden sollten. Hollow und Danner arbeiten als Fahrer in Tyler Brodericks Speditionsbetrieb. Wir haben die beiden verhaftet. Leider schweigen sie. Entweder aus Loyalität, oder sie haben Angst. Ich weiß es nicht. Tatsache ist, dass zwei Fahrer Brodericks mit einem Fahrzeug der Firma Broderick die Handys übernommen haben. Was liegt näher, als anzunehmen, dass sie im Auftrag Tyler Brodericks unterwegs waren.«
»Vielleicht sollte man Brodericks Telefon anzapfen«, meinte Mr. McKee. »Wäre doch interessant, zu erfahren, mit wem er kommuniziert.«
»Daran haben wir auch schon gedacht, Sir. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass er für die illegalen Deals das Telefon benutzt. Dieser Bursche ist verdammt vorsichtig. Wir haben Carnivore auf seinem Computer installiert. Erfolglos. Es gibt keine Dateien, anhand welcher wir ihn überführen könnten. Keine E-Mails – nichts. Wir haben uns von AT&T Wireless einer Liste der im vergangenen halben Jahr geführten Telefonate erstellen lassen. Die Überprüfung ergab keinerlei Kontakte, die sich als verdächtig erwiesen hätten. Keine Auslandsgespräche, keine Häufung von Nummern, die er immer wieder konfrontiert hätte. Wir haben in tagelanger Schreibtischarbeit gecheckt, mit wem Broderick telefoniert hat. Es sind Firmen im ganzen Land, mit denen er wahrscheinlich geschäftliche Beziehungen pflegt. Seine Lastwagen sind überall in den Staaten unterwegs. Natürlich auch im Nahverkehr.«
»Vielleicht sind Sie dem falschen Mann auf der Spur«, gab Mr. McKee zu bedenken.
»Nein, Sir«, sagte Milo. »Broderick ist unser Mann. Und wir werden ihn schnappen. Es ist nur eine Frage der Zeit.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Hollow und Danner in eigener Regie tätig waren. Ihren Andeutungen gemäß aber gibt es einen Hintermann.«
»Vielleicht haben die beiden Sie auf eine falsche Spur gesetzt.«
»Daran glaube ich nicht, Sir. Es handelt sich um ziemlich einfache Gemüter, die angesichts der erdrückenden Beweislage geständig sind, die aber ihren Auftraggeber nicht preisgeben wollen.«
Ich trank meine Tasse leer.
»Sie werden das Kind schon schaukeln«, meinte der AD lächelnd.
»Bist du fertig?«, fragte ich Milo.
Auch er trank seine Tasse leer. Wir erhoben uns, verabschiedeten uns von Mr. McKee und kehrten in unser Büro zurück.
»Fahren wir gleich mal zu McBrady«, schlug ich vor.
Gesagt, getan. Wir fuhren nach Clinton in die 54th Street. Im Haus No. 78 bewohnte McBrady ein teures Apartment. Ich stellte Milo und mich vor und erklärte dem verdutzten Mann, dass wir einige Fragen an ihn hätten. Er bat uns in die Wohnung. Im Wohnzimmer saß eine aufgetakelte Frau um die Vierzig in einem der Sessel und schaute fern. Auf dem Tisch stand ein Cocktail; sicherlich alkoholfrei. Andernfalls hätte es zu denken gegeben, wenn Mrs. McBrady schon am hellen Vormittag Alkohol getrunken hätte.
»Zwei Gentlemen vom FBI«, stellte uns McBrady seiner Frau vor. »Mr. Trevellian und – äh...«
»Mr. Tucker«, half ich ihm auf die Sprünge.
»...und Mr. Tucker«, sagte McBrady. Er schaute mich an. »Meine Frau stört Sie doch nicht.«
In einem der angrenzenden Räume klapperte etwas. Fragend schaute ich McBrady an. »Unsere Haushaltshilfe«, sagte er. »Sie ist zugleich unsere Köchin.« Er lächelte starr. Es wirkte aufgesetzt. »Ohne das Mädchen könnte meine Frau kaum schon am Vormittag fernsehen.«
Ich glaubte, einen zynischen Unterton in der Stimme McBradys wahrgenommen zu haben, und versuchte in seinem Gesicht zu lesen, doch seine Miene war ausdruckslos. Er ließ sich nicht hinter die Fassade blicken.
Mrs. McBrady schenkte uns kaum Beachtung. Sie starrte auf die Mattscheibe. Ich sah Clark Gable auf dem Bildschirm und sagte mir, dass es ein uralter Hollywood-Schinken sein musste, den sich die gute Frau reinzog.
McBrady bot uns Sitzplätze an und wir ließen uns nieder.
»Worum geht es?«, fragte McBrady, als auch er saß. Erwartungsvoll fixierte er uns abwechselnd. Sein Blick mutete mich etwas starr an, als wollte er verhindern, irgendeine Gefühlsregung zu zeigen. Und ich fand einen Vergleich. McBrady verfügte über die Augen eines Reptils. Stechend, glitzernd, glasig…
»Sie sind Präsident der Aktion >Hilfe für Erdbebenopfer in Kolumbien<«. Ich musterte McBrady. Er war ein Mann um die Fünfzig mit beginnender Stirnglatze. Über seinem linken Auge sah ich eine kleine Narbe. Sie teilte die Braue in zwei Hälften. Irgendwie verlieh dies seinem Gesicht etwas Charakteristisches, Einmaliges. Die Wangen waren fleischig, er besaß ein Doppelkinn, die Lippen waren schmal und verliehen seinen Zügen etwas Hartes, Unnachgiebiges.
»Das ist richtig«, erwiderte McBrady. »Ich habe schon des öfteren Hilfsorganisationen ins Leben gerufen, denn ich möchte helfen, wo Hilfe notwendig ist. Diese armen Menschen. Sie haben oftmals alles verloren und stehen vor dem absoluten Nichts. Es wird noch viel zu wenig gespendet auf der Welt. Mit der Nächstenliebe ist es ausgesprochen schlecht bestellt. Die Gebote der Bibel werden nicht beachtet. Wenn die vielen Millionäre, die in unserem Land leben, etwas von ihrem Reichtum abgäben…«
McBrady seufzte. Es hörte sich theatralisch und wie eingeübt an. Sein Gesichtsausdruck passte zu seinen Worten. Er wirkte auf mich wie ein Prediger, dem man kein Gehör schenkt. Ich hielt ihn für einen Heuchler. Ich versuchte das aufkommende Gefühl der Antipathie zu unterdrücken.
»Das mag sein«, murmelte Milo. »Was machen Sie mit den Geldern, die Sie einsammeln?«
»Warum fragen Sie?«
Ich bemerkte im Blick McBradys Unruhe.
»Weil jemand behauptet, dass Sie die Gelder Ihrem eigenen Konto gutschreiben«, antwortete Milo ohne Umschweife. Und sogleich fügte er hinzu: »Was man auch nicht gerade mit Nächstenliebe umschreiben könnte.«
McBrady prallte regelrecht zurück. »Das ist eine Infamie!«, entfuhr es ihm, als er seine Fassungslosigkeit überwunden hatte. »Wer kann so etwas behaupten? Ich kann beweisen, dass die Gelder nach Abzug meiner eigenen Unkosten bei den Hilfsorganisationen gelandet sind, die sich vor Ort um die Menschen kümmern und sie mit allem Notwendigen versorgen. Kommen Sie morgen in mein Büro in der Monroe Street. Dort werde ich Ihnen schwarz auf weiß zeigen, dass ich die Wahrheit spreche.«
»Warum sind Sie heute nicht in Ihrem Büro?«, fragte ich.
»Jeden Tag ist meine Anwesenheit nicht vonnöten. Mein Sekretär, Ben Faithfull, vertritt mich. Ein guter Mann.«
»Was machen Sie beruflich?«, fragte ich.
»Ich handle mit Autoersatzteilen. Fast ein Dutzend Angestellte arbeiten für mich. Im- und Export. Ich beziehe die Teile aus Deutschland und Frankreich und arbeite eng mit den Werkstätten zusammen, die deutsche und französische Fabrikate betreuen.«
»Was exportieren Sie?«, wollte Milo wissen.
»Ersatzteile amerikanischer Fabrikate. Ich habe Kontakte in Saudi Arabien, Russland, sogar nach China. Ein florierendes Geschäft.«
Ich dachte an die gefälschten Nokia-Handys, die den Markt in Amerika überschwemmen sollten. Und ganz beiläufig fragte ich: »Auch Kontakte in Taiwan?«
Irritiert schaute er mich an. »Wie kommen Sie darauf?«
»War nur eine Frage am Rande«, versetzte ich.
»Nein«, sagte McBrady, »nach Taiwan habe ich noch keine geschäftlichen Beziehungen.«
»Warum fahren wir nicht gleich in Ihr Büro?«, fragte Milo.
»Ja, warum nicht?« McBrady erhob sich. »Ich habe nichts zu verbergen.«
Im Erdgeschoss des Hauses, in dem McBrady seinen Betriebssitz hatte, befand sich das Lager des Ersatzteilhandels. In der ersten Etage waren die Büros untergebracht. McBrady geleitete uns in sein Büro, das ziemlich luxuriös ausgestattet war. Es gab eine Ecke mit wuchernden, exotischen Pflanzen, die dem Büro einen Hauch von Wildnis verliehen. McBrady bot uns an dem runden Besuchertisch Plätze an und wir setzten uns. Er verschwand, kam aber schon nach zwei Minuten zurück. Ein Mann begleitete ihn, etwa fünfundvierzig Jahre alt, mittelgroß, schmächtig, gekleidet wie ein typischer Buchhalter. Grauer Anzug, rote Krawatte, weißes Hemd. Er trug einen Ordner unter dem Arm, der prall mit Schriftstücken gefüllt war.
»Mr. Faithfull wird Ihnen die entsprechenden Quittungen und Kontoauszüge vorlegen, meine Herren«, gab McBrady zu verstehen. »Irgendjemand versucht, mir eins auszuwischen. Nur so kann ich mir den anonymen Anruf bei Ihnen erklären.«
»Wir werden sehen«, sagte Milo.
*
Als wir wieder im Wagen saßen, meinte Milo: »Es scheint wirklich alles seine Richtigkeit zu haben. Nach den Unterlagen, die wir gesehen haben, fehlt nicht ein Cent von dem Geld, das auf das Konto der Erdbebenhilfe überwiesen wurde. Ich denke, da will in der Tat McBrady jemand eins auswischen.«
Wir fuhren zurück ins Field Office und meldeten uns bei Mr. McKee an, um ihm Bericht zu erstatten.
Der Chef nahm zur Kenntnis, was wir ihm zu erzählen hatten, und als ich geendet hatte, meinte er: »Fein. Damit wäre Mr. McBrady aus dem Schneider. Es ist für mich immer wieder verwunderlich, welche missgünstigen und hinterhältigen Zeitgenossen es gibt. Da opfert sich ein Mann auf, um Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, und jemand versucht ihn schlecht zu machen. Sie haben sich doch hoffentlich bei McBrady entschuldigt.«
»Natürlich, Sir. Selbstverständlich. McBrady hat nur gelacht und meinte, es sei Job der Polizei, solchen Anrufen nachzugehen. Es habe ihn gefreut, wenn er zur Klärung der Angelegenheit beitragen konnte.«
»Sie können sich wieder auf Tyler Broderick stürzen, Jesse, Milo«, erklärte Mr. McKee und lächelte in der ihm eigenen Manier.
»In der Hoffnung, dass wir bald mit einem positiven Ergebnis aufwarten können, Sir«, sagte ich.
Wir begaben uns in unser Büro. Ich fuhr mein Terminal hoch. Einige E-Mails waren angekommen, unter anderem eines von der Gefängnisverwaltung auf Rikers Island. Wes Hollow möchte Sie sprechen. Ich glaube, er ist bereit, ein Geständnis abzulegen, hieß es in der Nachricht. Darunter stand der Name Salzman. Es war der stellvertretende Direktor im Gefängnis.
Milo und ich vergeudeten keine Zeit. Der Verkehr in New York war wieder einmal katastrophal. Es nieselte leicht. Der Scheibenwischer lief auf Intervall. Menschen mit hochgeschlagenen Mantel- und Jackenkrägen hetzten auf den Bürgersteigen dahin, die meisten trugen aufgespannte Regenschirme. Die Autos fuhren mit Licht. Und wir mussten eine Rotphase erwischt haben, denn bis zur Williamsburg Bridge mussten wir bei jeder Ampel anhalten.
In Queens wurde es ein wenig besser. Wir fuhren auf dem Brooklyn Queens Expressway nach Norden. Einige Flugzeuge befanden sich im Landeanflug auf La Guardia. Es war für mich immer wieder faszinierend, zu sehen, wie die Flugzeuge aus den Wolken stießen und zur Erde schwebten. Für mich immer noch ein Phänomen, wie es diese tonnenschweren Maschinen schafften, die Schwerkraft zu überwinden.
Nach über einer Stunde erreichten wir Rikers Island. Ich stellte den Wagen auf dem großen Parkplatz vor dem Gefängnis ab, dann läuteten wir am großen Tor. Ein Wachposten schaute aus der Luke, die in die Pforte eingelassen war, ich zeigte ihm meine ID-Card und wir wurden eingelassen.
Es dauerte nicht lange, dann saß Wes Hollow im Vernehmungsraum an einem Tisch. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und streckte die Beine von sich. »Ich möchte rauchen«, sagte er.
»Wenn Sie Zigaretten haben - bitte«, antwortete ich. Er griff in die Tasche und holte ein zerknülltes Päckchen Marlboro hervor. Gleich darauf setzte er einen der Glimmstängel in Brand. Tief inhalierte er den Rauch.
»Was habt ihr zu bieten?«, begann er, nachdem er den Rauch durch die Nase ausgestoßen hatte.
»Was meinen Sie?«, fragte Milo.
»Nun, wenn ich rede, will ich auch etwas davon haben. Straffreiheit zum Beispiel. Kronzeugenregelung – ihr wisst schon.«
»Wir werden bei der Staatsanwaltschaft ein gutes Wort für Sie einlegen«, sagte ich. »Ihnen irgendwelche Versprechungen zu machen – dazu sind wir nicht kompetent. Aber der Staatsanwalt wird ihre Kooperationsbereitschaft sicher honorieren. Wahrscheinlich kommen Sie mit einer Bewährungsstrafe davon.«
»Mein Anwalt hat sowieso Haftbeschwerde eingelegt. Wieso der Richter nach der Anhörung Haftbefehl erließ, ist mir ein Rätsel. Ihr habt uns lediglich mit falschen Markenhandys erwischt. Und wir waren geständig.«
»Verdunklungsgefahr«, versetzte Milo. »Was den Richter genau bewegte, wissen wir natürlich auch nicht. Vielleicht wollte er ein Exempel statuieren. Generalprävention nennt man so etwas. Die Produktpiraterie ist auf dem Vormarsch. Was glauben sie, was alles gefälscht und zum Kauf angeboten wird, und was für ein Schaden dadurch entsteht. Das fängt bei T-Shirts an und endet bei – hm, Handys.«
Ein besseres Beispiel war Milo wohl nicht eingefallen. Aber es stimmte. Der Schaden, der der Wirtschaft durch die Produktpiraterie entstand, ging in die Milliarden. Es war in der Tat kein Kavaliersdelikt, vor allem, weil es sich nicht um Einzeltäter handelte, sondern um organisierte Banden.
Hollow zog an seiner Zigarette. »Wir erhielten den Auftrag, die Handys zu übernehmen und zu verteilen, von Slim Osborne. Er ist erster Buchhalter bei Broderick.«
»Was spielt Broderick selbst für eine Rolle?«
»Ich weiß nicht, ob Osborne seine Befehle von ihm erhält. Osborne segnet die Fahrpläne ab und leitet sozusagen den Betrieb. Sein Wort ist in der Firma Gesetz.«
»Zu wem sollten sie die Handys bringen?«, fragte ich.
»Wir sollten die Liste der Läden bei Osborne abholen. Inwieweit diese Leute mit Osborne oder sonst wem zusammenarbeiten, weiß ich nicht. So tief hat uns Osborne nicht in seine Karten blicken lassen.«
»Können Sie uns sonst noch etwas zu der Angelegenheit sagen?«, fragte Milo.
»Nein. Walt und ich waren nur Statisten. Wir bekamen für die Abholung der Handys einen Sonderbonus von zweihundert Dollar. Die Kisten mit den Mobiltelefonen waren als medizinische Geräte ausgewiesen. Wie sie in die USA kamen, weiß ich nicht. Wir haben sie beim Harriman State Park von einem Hubschrauber übernommen. Der Park liegt etwa fünfundzwanzig Meilen nordwestlich von New York.«
»Ich kenne den Park«, versetzte ich.
»Woher wusstet ihr eigentlich, dass wir gefälschte Handys geladen hatten?«
Es berührte mich eigentümlich, dass er uns duzte, ich sagte aber nichts. Um es salopp auszudrücken: In unserem Job wird man mit der Zeit hart im Nehmen.
»Wir bekamen einen Tipp. – Hast du noch Fragen, Milo?«
Mein Kollege verneinte. Ich ließ Hollow wieder abführen und bat, Walt Danner vorzuführen.
Es dauerte keine zehn Minuten, dann betrat Walt Danner den Vernehmungsraum. Seine Brauen waren zusammengeschoben, über seiner Nasenwurzel hatten sich zwei senkrechte Falten gebildet. Trotzig schaute er uns an. »Ich habe euch nichts zu sagen«, knurrte er. »Alles, was es zu sagen gibt, habe ich bereits dem Haftrichter erzählt. Was wollt ihr noch?«
»Hollow hat uns einen Namen genannt«, erklärte Milo.
Ein lauernder Ausdruck trat in die Augen Danners. »Welchen Namen?«
»Slim Osborne.«
Danner senkte den Kopf. »Was verspricht er sich davon?«
»Milde«, antwortete ich. »Auch Sie können Punkte für sich sammeln, Danner.«
»Na schön. Wenn Hollow schon geredet hat, gibt es für mich auch keinen Grund mehr, zu schweigen. Osborne schickte uns mit dem Lastwagen zum Harriman State Park, um die Ladung zu übernehmen. Wir sollten mit den Handys zur Spedition kommen, wo wir eine Liste mit den Empfängern erhalten sollten. Soweit kam es allerdings nicht mehr. Wir wurden vorher hoch genommen.«
Auch Danner wurde befragt, ob ihm die Rolle Brodericks in dieser Inszenierung bekannt war. Er verneinte.
Mit den beiden Aussagen konnten wir aber zumindest Osborne festnageln. Über ihn kamen wir vielleicht an den Hintermann und Drahtzieher heran.
*
»Fahren wir nach Brooklyn zu der Spedition«, schlug Milo vor, nachdem wir das Gefängnis verlassen hatten und zum Parkplatz marschierten. »Bin gespannt, was uns der Oberbuchhalter zu sagen hat.«
»Erster Buchhalter«, verbesserte ich.
»Meinetwegen, dann eben erster Buchhalter, alter I-Tüpfelchenscheißer. Jedenfalls scheint Osborne Dreck am Stecken zu haben. Die Aussagen Hollows und Danners reichen für einen Haftbefehl.«
Die Spedition lag in der Colonial Road in Bay Ridge. Wir wandten uns nach Süden, durchquerten Queens und Brooklyn und erreichten nach mehr als einer Stunde unser Ziel. Im großen Hof, der in Hufeisenform von hohen Gebäuden eingeschlossen war, standen ein halbes Dutzend Lastzüge in Reih und Glied. Auf die Türen der Laster war das Betriebslogo gespritzt. Eine riesige Garage stand offen, ein Tieflader ohne Aufleger stand in der Werkstatt. Ich sah einige Monteure.
Ich parkte den Sportwagen vor dem Gebäude, an dem ein Schild prangte, das deutlich machte, dass in ihm die Verwaltung des Betriebes untergebracht war. Wir stiegen aus. Ich schaute mich um und nahm die Eindrücke auf, die sich mir boten. Dann betraten wir das Gebäude. Es gab eine Rezeption, an der eine junge Frau Dienst versah. Wir fragten Sie nach dem Büro von Slim Osborne. »Was möchten Sie denn von Mr. Osborne?«, fragte die junge Lady.
Ich zeigte ihr meine ID-Card und stellte uns vor. »Wir möchten Mr. Osborne sprechen«, erklärte ich dann. »Es ist wichtig.«
Die junge Frau griff nach dem Telefonhörer. »Ich melde Sie an.«
»Das ist nicht notwendig«, sagte ich schnell. »Sagen Sie uns nur, in welchem Büro wir ihn finden.«
»Hundertsieben, erster Stock. Ich muss Sie anmelden. Darauf legt Mr. Osborne allergrößten Wert. Wenn ich es nicht tue, bekomme ich wahrscheinlich ein Problem mit ihm.«
»Keine Sorge«, besänftigte Milo die junge Frau. »Sie haben nichts zu befürchten.«
Die Lady schaute zweifelnd.
Wir gingen zur Treppe und stiegen sie hinauf. Schließlich standen wir vor dem Raum mit der Nummer hundertsieben. Die Eins stand für die erste Etage. Die Sieben war die Zimmernummer. Das Büro befand sich am Ende des Korridors. Milo klopfte, und ohne die Aufforderung, einzutreten, abzuwarten, öffnete er die Tür. Wir betraten das Büro.
»Was ist denn?«, empfing uns eine ungeduldige Stimme. Der Mann hinter dem Schreibtisch schaute ärgerlich. Er hatte gerade am Computer gearbeitet und seine rechte Hand lag auf der Mouse.
»Mein Name ist Trevellian«, sagte ich. »Mein Kollege Tucker. Wir kommen vom FBI.«
Die Brauen Osbornes – ich ging davon aus, dass er es war -, hoben sich. Sein Gesicht nahm einen arroganten Ausdruck an. Er ließ die Mouse los und setzte sich aufrecht. »FBI?«
»Richtig. Sie können sich denken, weshalb wir hier sind?« Ich hatte meinen Blick auf Osbornes Gesicht geheftet. Es zeigte jähe Verunsicherung.
Osborne begann an seiner Unterlippe zu nagen. »Nein«, erwiderte er schließlich, »das kann ich mir nicht denken. Wenn Sie denken, dass ich etwas mit der Handygeschichte zu tun habe, so ist das ein Irrtum. Hollow und Danner haben in eigener Regie gearbeitet. Ich hatte keine Ahnung, dass sie für ihre verbrecherischen Machenschaften ein Fahrzeug der Firma missbrauchen.«
»Hollow und Danner haben sich nach einigem Hin und Her bereit erklärt, zu sprechen«, gab ich zu verstehen. »Beide haben angegeben, dass sie in Ihrem Auftrag die Handys abholten. Auch sollten sie von Ihnen eine Liste der Abnehmer erhalten. Dazu ist es allerdings nicht mehr gekommen. Wie wäre es, wenn Sie uns diese Liste aushändigen würden?«
Osborne lachte auf. Es war ein unechtes Lachen und klang rasselnd. »Die beiden lügen!«, stieß er dann hervor. »Indem sie mich anschwärzen, versuchen sie, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen.«
»Sie klangen ziemlich glaubwürdig, und haben unabhängig voneinander dasselbe ausgesagt. Darum nehmen wir sie vorläufig fest, Mr. Osborne. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie kommen freiwillig mit uns, oder wir führen Sie in Handschellen ab. Entscheiden Sie sich.«
In seinem Gesicht arbeitete es. Osborne war ein Mann von ungefähr vierzig Jahren. Er war schlank, seine Haare waren dunkel und voll, Gesicht und Hände waren solariengebräunt. Er war ein Frauentyp. Einen Ehering sah ich nicht an seiner Hand.
Er erhob sich langsam. »Ich will kein Aufsehen, darum werde ich freiwillig mit Ihnen kommen. Vorher aber verständige ich meinen Anwalt.«
»Wenn Sie denken, dass Sie ihn nötig haben«, knurrte Milo. »Bitte…«
Osborne pflückte den Telefonhörer vom Apparat, drückte eine Nummer, wahrscheinlich eine Kurzwahl, dann sagte er: »Verständigen Sie Rechtsanwalt Frank Gardner, Mandy. Bestellen Sie ihm von mir, dass ich mich zusammen mit zwei Special Agents zum FBI-Building begebe. Er soll sofort dorthin kommen.«
Er legte auf. »Ich weiß nichts von den illegalen Geschäften Hollows und Danners und werde den Verdacht widerlegen.«
»Dazu bekommen Sie sicher Gelegenheit«, versetzte ich. »Spätestens bei der Anhörung durch den Haftrichter.
Osbornes Züge entgleisten. Er atmete tief durch und stieß die verbrauchte Atemluft scharf durch die Nase aus, kam um den Schreibtisch herum und sagte: »Ich werde selbst fahren. Irgendwie muss ich ja wieder zurückkommen. Ich will Sie nicht über Gebühr in Anspruch nehmen.« Er grinste schief.
Ich wechselte mit Milo einen schnellen Blick. In Milos Augen las ich Zustimmung. »In Ordnung«, sagte ich. »Sie fahren vor uns her. Ob Sie allerdings zurückkommen, ist fraglich. Die Aussagen Hollows und Danners stehen gegen Ihre.«
Er fixierte mich von oben bis unten. Auf mich wirkte dieser Bursche wie ein Brechmittel. Seine Arroganz war durch nichts zu überbieten. Ein überhebliches Grinsen bog seine Mundwinkel nach unten. »Ich habe einen guten Anwalt«, presste er hervor.
»Gehen wir«, sagte ich.
»Lassen Sie mich wenigstens das Terminal herunter fahren«, murmelte Osborne. »Und dann muss ich Mr. Broderick Bescheid sagen.«
»Machen Sie«, sagte Milo, und Osborne schloss die Programme, die er geöffnet hatte, nahm den Telefonhörer und tippte eine Nummer, und dann sagte er: »Ich bin es, Osborne. Ich soll wegen der Handysache vernommen werden und werde die Special Agents Trevellian und Tucker zum FBI-Building begleiten. Hollow und Danner haben mich angeschwärzt, aber ich werde den Verdacht wohl entkräften können.«
Der Gesprächspartner Osbornes schien etwas zu sagen, denn Osborne nickte, dann sagte er: »Ich weiß von nichts. Man wird mich nach der Vernehmung laufen lassen müssen. Gardner habe ich informiert. Er wird der Vernehmung beiwohnen. Ich melde mich wieder, wenn der Zirkus vorbei ist.«
Osborne legte auf, kam um den Schreibtisch herum und ging zur Tür. »Nach Ihnen, Gentlemen«, sagte er und öffnete…
*
»Die Behauptung der beiden U-Häftlinge besagt gar nichts«, stieß der Anwalt Osbornes hervor. »Mein Mandant bestreitet, etwas von der illegalen Ladung gewusst zu haben. Er hat Hollow und Danner niemals den Auftrag gegeben, die Handys abzuholen und in die Spedition zu bringen.«
»Hollow und Danner haben unabhängig voneinander ausgesagt«, erklärte Milo. »Ihre Aussagen stimmen überein. Abgesprochen können Sie sich nicht haben. Wir werden gegen Ihren Mandanten einen Haftbefehl beantragen.«
»Mein Mandant ist ein gesetzestreuer, integrer Mann, der sich noch nie etwas zuschulden kommen ließ. Sie haben nur die beiden Aussagen. Einen Beweis gibt es nicht. Selbst wenn die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eröffnet, das Gericht wird den Antrag abschmettern. Dafür garantiere ich. Sie werden sich blamieren.«
»Wir werden sehen«, erwiderte ich, dann rief ich im Zellentrakt an und bat, zwei Wachtmeister zu schicken, damit sie Osborne arretierten.
Osborne war außer sich. Ich glaube, er stand knapp vor einem Herzinfarkt. »Das ist eine bodenlose Unverschämtheit!«, erregte er sich. »Hollow und Danner wollen mir eins auswischen. Sie haben vor einiger Zeit Abmahnungen erhalten. Das ist nun die Rache. Wenn sie mich inhaftieren ist das ein Gesichtsverlust…«
»Darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen«, unterbrach ihn Milo. »Wenn Sie unschuldig sind, wird sich das herausstellen und man wird sie unverzüglich wieder frei lassen. Die Aussagen Hollows und Danners können jedoch nicht weggedacht werden.«
Am folgenden Vormittag fand die Anhörung statt. Der Staatsanwalt hatte die Aussagen Hollows und Danners in schriftlicher Form vorliegen, wir hatten außerdem ein Festnahmeprotokoll angefertigt. Er trug vor, was wir Osborne zum Vorwurf machten. Milo und ich sagten aus und bestätigten noch einmal, was wir schon in den Vernehmungsprotokollen niedergeschrieben hatten.
Der Richter stellte keine Fragen. Er hörte sich geduldig an, was der Anwalt vorzubringen hatte. Das letzte Wort hatte Osborne. Er beteuerte seine Unschuld.
Es erging der Beschluss, dass kein Haftbefehl erlassen werde. Der Richter begründete dies damit, dass es sich bei den Aussagen Hollows und Danners um nicht bewiesene Behauptungen handelte, bei denen es sich tatsächlich um einen Racheakt handeln könnte.
Osborne verließ als freier Mann den Gerichtssaal. Er feixte. Wir waren frustriert.
Kapitel 2
Bei James McBrady läutete das Telefon. Es war kurz nach 22 Uhr. Mrs. McBrady lag auf der Couch im Wohnzimmer und schaute fern. Auf dem Tisch stand ein Cocktail. James McBrady runzelte die Stirn, dann griff er nach dem Hörer, der auf dem Tisch lag. »McBrady«, meldete er sich.
»Hör zu, McBrady. Ich weiß, dass du auch die Hilfsorganisation >Rettet die Kinder Kolumbiens< ins Leben gerufen hast. Die Spenden in Höhe von mehr als zwei Millionen Dollar hast du dir unter den Nagel gerissen.«
»Worauf möchten Sie hinaus?« McBradys Miene hatte sich verschlossen. Seine Augen waren schmal geworden. Die Worte des Anrufers klangen durch sein Bewusstsein und hallten in ihm nach.
»Ich werde der Polizei einen Tipp geben. Das FBI wird sich gewiss dafür interessieren. Was ist dir mein Schweigen wert, McBrady?«
»Sie reden doch Unsinn.«
Kath McBrady war aufmerksam geworden. Sie beobachtete ihren Mann. »Wer ist das?«, fragte sie.
McBrady winkte ungeduldig ab.
Der Anrufer sagte: »Ich denke, dass es dir eine Million wert sein dürfte, McBrady. Wir teilen uns den Gewinn. Ich denke, damit bist du gut bedient. Dir bleiben immer noch mehr als eine Million.«
»Sie sind verrückt!« McBrady drückte den roten Knopf und warf den Hörer auf den Tisch. In seinem Gesicht zuckte kein Muskel. Aber in seinen Augen wob eine ungezügelte Wut. Er ließ sich in den Sessel fallen.
»Wer hat angerufen?«, fragte Kath McBrady mit schwerer Zunge. »Und was wollte er?«
»Lass mich in Ruhe, verdammt!«, schnaubte McBrady. Seine Nerven lagen blank. Und das machte ihn zornig. »Versuch lieber, deinen Alkoholkonsum in den Griff zu kriegen. Du bist doch schon wieder betrunken.«
Kath griff nach dem Glas und trank es leer. »Anders ist das Leben an deiner Seite nicht zu ertragen«, fauchte sie, schwang die Beine von der Couch und erhob sich. Einen Moment schien sie zu schwanken, dann aber hatte sie sich wieder unter Kontrolle und ging zur Schlafzimmertür. »Ich gehe schlafen«, sagte sie, ohne sich umzudrehen. »Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich dich verlasse.«
»Geh von mir aus zur Hölle!«, blaffte McBrady. Da klingelte wieder das Telefon. Er presste die Lippen zusammen und zog den Kopf zwischen die Schultern. Kath blieb stehen. McBrady machte keine Anstalten, den Hörer zu nehmen.
Plötzlich drehte sich die Frau um und kam zurück. Jetzt kam Leben in die Gestalt McBradys. Er schoss aus seinem Sessel in die Höhe, beugte sich nach vorn und riss den Hörer regelrecht vom Tisch. »Was ist noch?«
Kath war stehen geblieben. Fast verächtlich musterte sie ihren Mann. »Verschwinde!«, zischte dieser. »Leg dich ins Bett und schlaf deinen Rausch aus.«
Das Gesicht der Frau erschlaffte. Müde wandte sie sich ab und ging mit hängenden Schultern ins Schlafzimmer.
»Ich bin nicht gewillt, zu zahlen«, schnappte McBrady, nachdem er das Gespräch angenommen hatte.





























