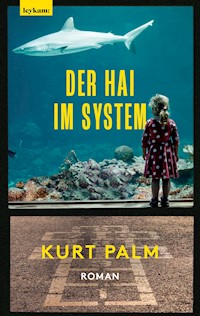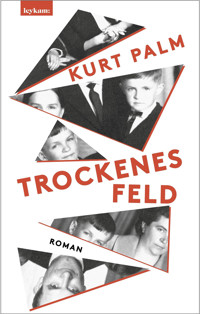
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Welche Zufälle bestimmen unser Leben? Kurt Palm schreibt erstmals über seine Familiengeschichte, über die Macht des Zufalls und die Traumata der Kriegsgeneration. »Meine Eltern wurden aus Jugoslawien vertrieben und wir sind froh, dass wir so eine schöne Wohnstube besitzen«, schreibt Kurt Palm 1964 in sein Schulheft. Seine Mutter musste 1943 auf einem Pferdewagen aus Suhopolje in Kroatien fliehen, Ziel: unbekannt. Sein Vater wurde als 18-Jähriger vom Schweinestall an die Front geschickt, um in einer deutschen Uniform gegen Partisanen in Slowenien und Frankreich zu kämpfen. Trotzdem hatte die Biografie der Eltern für den jugendlichen Sohn kaum eine Bedeutung, sie waren einfach seine Eltern. Erst nach ihrem Tod beginnt er über seine Herkunft, über Fluchterfahrungen, über Täterschaft und Mitläufertum nachzudenken. Kurt Palm schreibt in diesem Buch erstmals über seine Familiengeschichte. Welche Zufälle bestimmen unsere Herkunft und unsere Geschichten? Und welche Traumata sind uns und unseren Leben eingeschrieben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Welche Zufälle bestimmen unser Leben?
»Meine Eltern wurden aus Jugoslawien vertrieben und wir sind froh, dass wir so eine schöne Wohnstube besitzen«, schreibt Kurt Palm 1964 in sein Schulheft. Seine Mutter musste 1943 auf einem Pferdewagen aus Suhopolje in Kroatien fliehen, Ziel: unbekannt. Sein Vater wurde als 18-Jähriger vom Schweinestall an die Front geschickt, um in einer deutschen Uniform gegen Partisanen in Slowenien und Frankreich zu kämpfen. Trotzdem hatte die Biografie der Eltern für den jugendlichen Sohn kaum eine Bedeutung, sie waren einfach seine Eltern. Erst nach ihrem Tod beginnt er über seine Herkunft, über Fluchterfahrungen, über Täterschaft und Mitläufertum nachzudenken.
Kurt Palm schreibt in diesem Buch erstmals über seine Familiengeschichte. Welche Zufälle bestimmen unsere Herkunft und unsere Geschichten? Und welche Traumata sind uns und unseren Leben eingeschrieben?
Über Kurt Palm
Kurt Palm, 1955 in Vöcklabruck geboren, lebt als Autor und Regisseur in Wien. Palm wurde mit der gefeierten TV-Produktion »Phettbergs Nette Leit Show« (1994-96) bekannt. Sein Bestseller »Bad Fucking« (Residenz 2010) wurde 2011 mit dem Friedrich Glauser-Preis für den besten deutschsprachigen Krimi des Jahres ausgezeichnet und war auch als Film erfolgreich. Zuletzt erschien sein Roman »Der Hai im System« (Leykam 2022), der mit dem Leo Perutz-Preis ausgezeichnet wurde.
Newsletter des Leykam Verlags
Bleiben wir im Gespräch! In unserem Newsletter informieren wir euch über aktuelle Veranstaltungen unserer Autor*innen, neue Bücher und aktuelle Angebote. Hier geht es zur Anmeldung:
https://mailchi.mp/leykamverlag/newsletter
leykam:seit 1585
Kurt Palm
TROCKENES FELD
ROMAN
leykam:Belletristik
Für meine Eltern Ana und Stjepan Palm
„Es gibt keine Wahrheit in der Erinnerung.“
Werner Herzog
„Wir kommen der Wahrheit nie näher als in erfundenen Geschichten.“
Louis Begley
Inhalt
Der Tote im Fluss
Tagebucheintrag vom 8. Jänner 2005
Der tote Bruder Johan (mit einem n)
Ich ficke Gott
Die scheißenden Kühe von Neukirchen an der Vöckla
Bohnennudeln versus Schweinsbraten
Tagebucheintrag vom 1. Dezember 2000
Der Fisch in der Unterhose
Ein lustiges Erlebnis
Daheim ist woanders
Treffen der Stalingradkämpfer mit Unterhaltungsmusik und kaltem Büffet
Kriegskameraden
Tagebucheintrag vom 11. Juli 1972
Das Kartoffelkäfer-Mysterium
Als Long John Silver, Hans-Joachim Kulenkampff und Norman Bates Timelkam eroberten
Wie schön unsere Heimat ist
Unser Wohnzimmer
Der Pferdetreck ins Ungewisse
Die Daunendecke kommt mit
17312 Santa Clara Street, Fountain Valley 92708
Ein Schwein wird geschlachtet
Was der Arzt befiehlt
Drei Frauen lachen in die Kamera
Krankenhaus Wels, 22. September 2000, 16 Uhr
Die rote Strumpfhose
Mutter schreibt einen Brief
Zieh deine Schlapfen an
Alle unsichtbaren Dinge sind Hauptwörter
Karl Marx statt MKV
Der Topf am Kopf
Der Genitiv
Die Zeiten ändern sich
Ein Blick in die Unterhose
Selbstbefragung
Olympisches Gold für Žižić und Genossen
Ein unnötiger Streit
Mein Bruder erhängt sich
Wald, Vollmond, Albtraum
Eine Rechnung
Dienstag, 11. Februar 2014
Mittwoch, 26. Februar 2014
Tagebucheintrag vom 14. Jänner 1999
Ein Ort zerfällt
Die bittere Wahrheit lautet: SS-Polizeiregiment 19
Von Tim-El-kam nach Ouargla
Der Krieg schießt ein Loch in deine Existenz
Helden, Vaterland, Dankbarkeit
Die schwarze Kiste
Prisoner of War oder Displaced Person?
Katastrophen ohne Ende
Dunkle Flecken überall
Schwabenball mit temperamentvoller Rock ’n’ Roll-Show
Tagebucheintrag vom 25. April 2004
Luka-Batschi erinnert sich
Der Tote im Fluss
„Er ist ertrunken. Die Strömung hat ihn unter einen Felsen gedrückt, dort ist er mit einem Fuß hängen geblieben. Er trug einen gestreiften Pyjama, der an einigen Stellen zerrissen war. Wahrscheinlich hat er in der Nacht das Altersheim verlassen und ist die Böschung hinuntergestürzt.“
Der das sagt, heißt Christoph. Er hatte in der Vöckla nach Luka-Batschi gesucht. „Die Gendarmerie hat mich darum gebeten, weil ich bei der Feuerwehr immer wieder als Taucher ausgeholfen habe.“
„Bist du dir sicher?“, frage ich. „Oder verwechselst du ihn mit jemand anderem?“
„Nein. Ich bin mir sicher. Ich habe ihn ja eigenhändig aus dem Wasser gezogen. Außerdem kannte ich ihn vom Sehen.“
„War es Selbstmord?“
Christoph zuckt mit den Schultern. „Schwer zu sagen, ist ja schon so lange her.“
„Weißt du noch, wann es war?“
„Ungefähr Mitte der siebziger Jahre, an das genaue Jahr kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber an den Ort. Es war in der Nähe der Schlangengrube.“ Christoph nimmt einen Schluck Bier.
Ich überlege. „Mit 20 hast du bereits als Taucher bei der Feuerwehr ausgeholfen?“
Christoph denkt nach. „Dann war es vielleicht Ende der siebziger Jahre. Oder Anfang der Achtziger. War er verwandt mit dir?“
„Nein. Ich kenne nicht einmal seinen richtigen Namen. Meine Eltern nannten ihn nur Luka-Batschi, weil er aus demselben Ort stammte wie sie. Aus Kapan, in Slawonien.“
Christoph runzelt die Stirn. „Batschi?“
„Ja, das war die Bezeichnung für ältere Männer und bedeutet so viel wie Onkel. In meiner Verwandtschaft gab es viele Batschis: Josef-Batschi, Janosch-Batschi, Stipo-Batschi. Sind alle längst tot, genauso wie die Nenis, die Tanten, die gar keine richtigen Tanten waren, aber als ältere Frauen so genannt wurden.“
Ich hatte Christoph zufällig am Friedhof von Oberthalheim getroffen, wo ich das Grab meiner Eltern besuchte. Später wollte ich zu meiner Tante fahren, um ihr noch ein paar Fragen zu stellen. Sie war eine der letzten Überlebenden aus Kapan und hatte mir vor ein paar Jahren bereitwillig Auskunft über ihre Flucht und den Neubeginn in Österreich gegeben. Ihr Sohn hatte mir allerdings am Telefon gesagt, dass ein Gespräch wegen ihrer fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung schwierig werden würde, aber ich könnte es ja versuchen.
Blickwechsel: In Oberthalheim gab es bis vor kurzem neben dem Friedhof ein Kloster der Salesianer Don Boscos. Heute befindet sich dort ein „Zentrum der Ruhe und persönlichen Weiterentwicklung“, was immer das sein mag. Weil ich ein fleißiger Ministrant war, wurden mir im Kloster einmal an einem Gründonnerstag vom Pfarrer die Füße gewaschen. Gemeinsam mit elf anderen Ministranten und Novizen. Ich repräsentierte einen der zwölf Apostel, denen Jesus am Tag vor seiner Kreuzigung die Füße gewaschen hatte. Welcher Apostel ich war, weiß ich nicht mehr. Hoffentlich nicht Judas Iskariot, der Verräter. Mein Lieblingsapostel war nämlich Johannes, der Verfasser des gleichnamigen Evangeliums:
Im Anfang war das Wort
und das Wort war bei Gott
und das Wort war Gott.
Im Anfang war es bei Gott.
Alles ist durch das Wort geworden
und ohne das Wort wurde nichts,
was geworden ist.
Vielleicht war diese Passage mit ausschlaggebend dafür, dass ich schon früh meine Liebe zur Literatur entdeckte: „Alles ist durch das Wort geworden.“ Was für ein phantastischer Gedanke!
Am Tag nach der Fußwaschung schimpfte mich meine Mutter, weil einer meiner Socken ein Loch hatte. Ich verstand ihr Problem nicht, weil ich den Socken vor der Waschung ja ohnehin ausgezogen hatte. Unabhängig davon fand ich die Zeremonie ziemlich unappetitlich.
Kürzlich habe ich gelesen, dass es bei den Salesianern Don Boscos von allen religiösen Orden weltweit den höchsten Prozentsatz an sexuellen Übergriffen gab. Mit diesem Wissen würde ich heute bestimmte Handlungen kirchlicher Würdenträger während meiner Zeit als Ministrant und Mitglied der Katholischen Jungschar anders einordnen. Und jetzt wird mir auch klar, weshalb ich bei der Beichte die Verstöße gegen das sechste Gebot – „Du sollst nicht Unkeuschheit treiben!“ – immer bis ins kleinste Detail schildern musste. Der jeweilige Beichtvater wollte halt alles ganz genau wissen. Damals waren mir die Fragen des Kaplans oder Pfarrers egal, weil ich nach der Beichte von allen Sünden befreit war und wieder tun und lassen konnte, was ich wollte. Auch Unkeuschheit treiben.
Dass Kinder und Jugendliche aber selbst im Beichtstuhl nicht vor Übergriffen von Kirchenvertretern sicher waren, passt ins Bild jener Institution, die sich in meiner späteren Wahrnehmung vor allem durch Verlogenheit auszeichnete. Obwohl alle im Ort wussten, was innerhalb und außerhalb der Beichtstühle passierte, wurde so getan, als wäre alles in bester Ordnung. Das war auch der Grund, weshalb ich nach dem Erreichen der Volljährigkeit sofort aus der katholischen Kirche austrat. An dieser Entscheidung änderten auch die Hausbesuche des Pfarrers nichts, der meine Eltern – natürlich subtil – moralisch unter Druck setzte.
Da ich Friedhöfen wenig abgewinnen konnte, kam ich nur zwei- oder dreimal im Jahr nach Oberthalheim. Mein Vater lag seit 1997 hier, er war an Lungenkrebs gestorben (der Asbest, die Eisenspäne, der Kohlenstaub), meine Mutter seit 2003, sie hatte einen Herzinfarkt erlitten (die Belastungen, die Aufregungen, der hohe Blutdruck). Oft stellte ich mir die Frage, ob meine Eltern in fremder Erde ruhten oder ob es nicht völlig gleichgültig war, wo man seine letzte Ruhestätte fand. Das Grab meiner Großeltern mütterlicherseits befand sich ebenfalls auf diesem Friedhof, andere Verwandte lagen auf Friedhöfen in Los Angeles, Neukirchen an der Vöckla, Milwaukee, Zipf, Curibata (Brasilien), Pforzheim oder Kapan.
In Oberthalheim standen auf zahlreichen Grabsteinen die Worte: „Hier ruht in Frieden …“ Woher wollten das die Hinterbliebenen eigentlich wissen? Wahrscheinlicher war, dass die meisten Toten in Unfrieden ruhten und der Spruch nur ein frommer Wunsch der Angehörigen war. Sonst müsste auf Begräbnissen nicht so viel gelogen werden. Wenn ich mir vorstellte, wie sich der ganze Hass, die Wut, der Neid, die Missgunst, die Niedertracht und die Trauer der Toten in ihren Särgen entluden, fragte ich mich, weshalb die Friedhöfe in diesem Land nicht schon alle längst explodiert waren.
Ich halte es in dieser Sache eher mit Bertolt Brecht, der in seinem „Lesebuch für Städtebewohner“ schrieb:
Sorge, wenn du zu sterben gedenkst
Dass kein Grabmal steht und verrät, wo du liegst
Mit einer deutlichen Schrift, die dich anzeigt
Und dem Jahr deines Todes, das dich überführt!
Noch einmal:
Verwisch die Spuren!
Ich blieb nie lange am Grab meiner Eltern. Ich goss die Blumen, erzählte ihnen ein paar Neuigkeiten und ging wieder. Als ich noch ein Kind war, hat mir mein Vater einmal einen Witz erzählt.
„Ich kann mit den Toten reden“, sagte er.
„Wirklich?“, fragte ich mit kindlichem Erstaunen.
„Ja, aber sie antworten nicht.“
Ich brauchte lange, bis ich den Witz verstand. Aber vielleicht ging der Witz auch ganz anders, weil mein Vater generell ein schlechter Witzeerzähler war, der es selten bis zur Pointe schaffte. Einmal versuchte er, einen Witz über Stalin und Churchill zu erzählen, der sich über Tage hinzog und nicht und nicht enden wollte. Ich glaube, die Szene spielte im Himmel, und irgendjemand schaute durch ein Schlüsselloch. Wer, wieso und weshalb? Das weiß ich nicht mehr.
Christoph jedenfalls stand am Grab seiner Frau, und erst als ich den Namen auf dem Grabstein las, erkannte ich ihn. Wir waren gemeinsam in die Knaben-Hauptschule in Vöcklabruck gegangen, und da ich noch Zeit hatte, fragte ich ihn, ob er Lust auf einen Kaffee oder ein Bier hätte.
„Ja, gehen wir auf ein Bier, Kaffee vertrage ich nicht, wegen dem Blutdruck, aber in Timelkam haben fast alle Gasthäuser zugesperrt. Fahren wir nach Vöcklabruck.“
„Okay, aber zum Auerhahn gehe ich nicht. Dort habe ich nämlich seit 1971 Lokalverbot.“
„Wieso das denn?“ Christoph strich sich über seinen Schnauzer. Er sah alt aus, älter als ich. Oder bildete ich mir das nur ein?
„Wir hatten damals eine Flugblattaktion gegen den Auerhahn gemacht, weil sein Besitzer die Lehrlinge ausbeutete und uns wegen unserer langen Haare nicht ins Lokal ließ. Außerdem hasste er uns wegen unserer politischen Einstellung.“
Christoph lachte. „Am Stadtplatz gibt es ein paar andere Lokale, in die wir gehen können.“
Während wir im Gastgarten einer Pizzeria bei Bier (Christoph) und gemischtem Eis mit Schlag (ich) saßen, erzählte mir Christoph, dass seine Frau vor einem halben Jahr an Brustkrebs gestorben war. Es war immer dasselbe. Kaum traf ich jemanden in meinem Alter, kamen wir unweigerlich auf Krankheiten oder Todesfälle zu sprechen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass es auf der Rutschbahn des Lebens nach unten ging. Und zwar unaufhaltsam.
Nachdem wir uns über die Toten in unserem Umfeld ausgetauscht hatten, erzählte ich Christoph, dass ich an einem Buch über meine Vorfahren arbeite, das Unterfangen aber kompliziert sei, weil fast alle Zeitzeugen tot waren und es kaum schriftliche Quellen gab. Als ich in einem Nebensatz erwähnte, dass ein Knecht aus Kapan im Altersheim in Timelkam gelebt hatte, wurde er hellhörig und erzählte mir von seinem Taucheinsatz.
Dass ich Christoph getroffen hatte und er mir über Luka-Batschis Tod etwas erzählen konnte, war ein Glücksfall. Eigentlich hatte ich Luka-Batschi längst vergessen, aber jetzt, wo Christoph erzählte, dass er seine Leiche aus der Vöckla geholt hatte, erinnerte ich mich wieder an ihn. Und an die Schlangengrube, um die sich in unserer Kindheit allerhand Geschichten rankten, die dazu führten, dass wir diesen Uferbereich mieden. Nur die Tapfersten wagten sich in seine Nähe, weil es dort angeblich Giftschlangen gab. Trotzdem rauchten wir nicht weit davon entfernt unsere ersten Lianen. „Was ist eigentlich aus der Schlangengrube geworden?“, fragte ich.
„Die gibt es schon lange nicht mehr“, antwortete Christoph nachdenklich. „Mein Vater hat jahrelang darum gekämpft, dass sie zugeschüttet wird. Er gab ja den Schlangen die Schuld am Unfall meines Bruders. Nachdem die Gemeinde aber nichts unternommen hat, hat er sich einen Bagger organisiert und das Gelände dem Erdboden gleichgemacht.“
Jetzt erinnerte ich mich wieder, dass Christophs jüngerem Bruder der Arm amputiert werden musste, nachdem er bei der Schlangengrube von einer Höllenotter gebissen worden war. Die Ärzte entschieden sich zu diesem drastischen Schritt, weil sie Angst hatten, dass das Gift ins Herz gelangen könnte. Das erzählte man sich jedenfalls im Ort. Christophs Bruder hatte sich vom Schock der Amputation nie richtig erholt und soll deshalb noch als Jugendlicher zum Alkoholiker geworden sein. Ob das stimmte, wusste ich nicht, aber nachdem ich das Thema angeschnitten hatte, fragte ich pflichtschuldig: „Wie geht es deinem Bruder?“
Christoph zuckte mit den Schultern und verzog das Gesicht: „Keine Ahnung, ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört.“
So hat jede Familie ihre Leichen im Keller, dachte ich mit einem unangenehmen Gefühl im Bauch. Aber bevor ich zu sentimental wurde, fragte ich Christoph: „Hast du eine Idee, wie Luka-Batschi überhaupt in die Vöckla gekommen ist?“
Er schüttelte den Kopf und sah auf das Display seines Mobiltelefons. „Ich muss jetzt langsam los.“ Er winkte der Kellnerin.
„Ich lade dich ein. Mein gemischtes Eis mit Schlag ist sicher teurer als dein Bier.“ Ich lachte.
„Okay, danke.“ Christoph stand auf und gab mir die Hand. „Hat mich gefreut. Vielleicht sehen wir uns wieder einmal am Friedhof.“
„Ja, mach’s gut. Bis bald.“
Da bis zum Treffen mit meiner Tante noch etwas Zeit war, dachte ich über Luka-Batschi nach. Ich stellte mir vor, wie er in der Nacht das Altersheim verließ, um – ja, was zu tun? Zu rauchen? Dazu hätte er seinen Holzverschlag nicht verlassen müssen, weil damals im Altersheim alle rauchten. Zumindest die Männer. Ich wusste das, weil ich dort ministriert habe.
Oder war er Schlafwandler? Wusste er nicht, was er tat? Haben die Ordensschwestern nichts gehört? Wenn ja, werden sie sich nichts dabei gedacht haben. Viele alte Menschen stehen in der Nacht auf und geistern herum, weil sie nicht schlafen können oder aufs Klo müssen. Oder weil sie etwas suchen, was sie gar nicht verloren haben.
Wenn ich an Luka-Batschi denke, sehe ich einen alten Mann vor mir. Dabei war er, als ich ihm das erste Mal begegnete, sicher nicht älter als fünfzig. Vielleicht lag es am Stock, auf den er sich immer stützte. Oder an der Zigarettenspitze, die ständig in seinem Mund steckte. Oder an seiner dunklen, abgetragenen Kleidung. Oder an seinen Bartstoppeln. Oder an seinem speckigen Hut. Luka-Batschi war ein kleiner, schmächtiger Mann, dessen Erscheinung so gar nicht zu seinem früheren Beruf passte: Knecht. Aber ist Knecht überhaupt ein Beruf? Ist man zum Knechtsein berufen oder wird man zum Knecht gemacht?
Luka-Batschi, Knecht, ertrunken in der Vöckla. Oder doch nicht? Einige Stunden nach meiner Begegnung mit Christoph erzählte mir meine Tante nämlich, dass Luka-Batschi in einem Sanatorium an Lungenkrebs gestorben sei.
„Bist du dir sicher?“, fragte ich.
Sie sah mich an, ihr Blick ging ins Leere. Woran sie dachte, war schwer zu sagen. „Nein“, antwortete sie und holte einen Besen, mit dem sie den sauberen Küchenboden kehrte.
„Also bist du dir nicht sicher?“
„Ja, schon.“ Und nach einer kurzen Pause. „Wie geht es deiner Mama?“
„Gut“, sagte ich, obwohl meine Mutter schon lange tot war.
Ich war irritiert, weil ich nicht wusste, wer recht hatte: Christoph oder meine Tante? Nachdem ich mich von meiner Tante verabschiedet hatte, entschied ich mich für Christophs Version von Luka-Batschis Tod. Erstens klang seine Erzählung spektakulärer, und zweitens litt meine Tante an Alzheimer, weshalb ihrer Erinnerung nicht ganz zu trauen war.
Bis heute weiß ich nicht, ob Luka-Batschi in Kapan am Bauernhof meiner Mutter oder meines Vaters gearbeitet hat. Ich dachte immer, dass es der Bauernhof meiner Mutter war, aber vor ein paar Jahren hat meine Tante behauptet, dass es der Hof meines Vaters gewesen sei. Als seine Halbschwester musste sie es eigentlich wissen, außerdem war sie damals noch einigermaßen klar im Kopf.
Der Bauernhof meines Vaters war ein großer Hof mit Kühen, Schweinen und Pferden sowie Äckern, Feldern und einem Wald mit einer Gesamtfläche von 20 Hektar. Außerdem gehörte ihm ein Weingarten mit 1,7 Hektar in Borova, etwa vier Kilometer außerhalb des Dorfes. Mein Vater hatte den Hof bereits in jungen Jahren geerbt, weil sein Vater mit 24 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben war. Nach heftigen Regenfällen war Wasser in den Weinkeller eingedrungen und mein Großvater wollte einige Fässer in Sicherheit bringen, dabei hatte er sich eine Lungenentzündung zugezogen. So hat es mir jedenfalls mein Vater erzählt. Auf dem Totenschein steht als Todesursache allerdings nicht Lungenentzündung (upala pluća), sondern „plötzlicher Tod“ (nagla smrt). Ein Kaufvertrag (kupoprodajni ugovor), der am 2. Mai 1928, also einen Tag vor seinem Tod, von meinem Großvater unterzeichnet wurde, scheint freilich die Variante vom „plötzlichen Tod“ zu bestätigen, wobei ich mir die Frage stelle, ob nicht jeder Tod „plötzlich“ ist. Wenn ich den auf Kroatisch abgefassten Vertrag richtig interpretiere, hat mein Großvater an diesem Tag von Gjuro und Klara Elias zwei landwirtschaftliche Grundstücke um 2.000 Dinar erworben.
Meine Tante wiederum glaubte sich zu erinnern, dass mein Großvater nach der Feldarbeit verschwitzt nach Hause kam und zu viel kaltes Wasser trank, woraufhin er eine Lungenentzündung bekam. Das wusste sie aber auch nur vom Hörensagen, weil sie zum Zeitpunkt des Todes meines Großvaters noch gar nicht auf der Welt war. Sie war ja die Tochter des zweiten Mannes meiner Großmutter und daher meine Halbtante, falls es dieses Verwandtschaftsverhältnis überhaupt gibt.
Beim Tod seines Vaters war mein Vater gerade einmal vier Jahre alt. Ich habe ihn nie gefragt, wie es war, so früh seinen Vater zu verlieren. Als ich klein war, löste die Vorstellung, dass meine Eltern sterben würden, eine regelrechte Panik in mir aus. Wenn sie einmal am Abend länger fortblieben – was ohnehin selten genug vorkam –, starrte ich beim Fenster hinaus in die dunkle Nacht und zitterte am ganzen Körper. In diesen Nächten war die Bettdecke dann so schwer, dass ich dachte, sie würde mich erdrücken.
Tagebucheintrag vom8. Jänner 2005
Letzte Nacht träumte ich, dass ich meinen Vater mit einer Schnur erdrosseln wollte. Als ich realisierte, was ich gerade vorhatte, war ich geschockt, und ich versuchte, meinen Vater zu umarmen. Später träumte ich von meiner Mutter, die mir auf der Straße entgegenkam. Sie trug einen Mantel und eine Pelzmütze und sah sehr krank aus. Ich hatte Angst, dass sie sterben würde und drückte sie ganz fest an mich. Ihr Herz schlug so heftig, dass ich es sogar durch den Mantel spüren konnte.
Es ist immer dasselbe: Meine Eltern tauchen in meinen Träumen auf und ich wundere mich, dass sie nicht wissen, dass sie längst tot sind. Ich hasse diese Träume und frage mich, was sie mir erzählen wollen.
Der tote Bruder Johan (mit einem n)
Dass mein Vater einen kleinen Bruder hatte, der bereits mit fünf Monaten starb, habe ich erst erfahren, als ich vor ein paar Jahren mit meiner Schwester den Friedhof von Kapan besuchte. Es war ein alter Friedhof, der direkt an ein abgeerntetes Maisfeld angrenzte. In der Nähe des Eingangs stand ein großes Steinkreuz, das von einem riesigen Handymast überragt wurde. Ein merkwürdiger Kontrast zu den Gräbern, von denen einige bereits seit 250 Jahren existierten. Auch die Porzellan-Porträts der verschreckt wirkenden Frauen mit ihren tief ins Gesicht gezogenen Kopftüchern und der Männer mit ihren Schnauzbärten und den selbstbewussten Blicken erinnerten an längst vergangene Zeiten. Und an Hierarchien, die offenbar über den Tod hinaus ihre Gültigkeit hatten. Beim Betrachten der Porträts fragte ich mich, ob diese Menschen glücklich waren. Aber vielleicht war das auch die falsche Frage, weil sie ohnehin niemand mehr beantworten konnte.
Meine bäuerlichen Vorfahren mussten Baden-Württemberg Mitte des 18. Jahrhunderts aus wirtschaftlichen Gründen verlassen. Auf mehrere Missernten folgten Hungersnöte, und ihre einzige Chance zu überleben bestand in der Besiedelung jener Gebiete in Slawonien, die nach der Vertreibung der Türken entvölkert und verwüstet waren. Der ersten Siedler-Generation brachte das neue Land den Tod, der zweiten die Not, der dritten das Brot. Meine Eltern gehörten – im übertragenen Sinn – der dritten Generation an. Meine Vorfahren kamen als Wirtschaftsflüchtlinge, bauten sich eine Existenz auf und standen knapp 200 Jahre später als Kriegsflüchtlinge wieder vor dem Nichts.
Der Ort Kapan gehörte zum Dorf Suhopolje, was auf Deutsch so viel heißt wie: Trockenes Feld. Ein rätselhafter Name, wenn man bedenkt, dass die Gegend um Suhopolje Sumpfgebiet war und erst ab 1760 von deutschen und kroatischen Kolonisten urbar gemacht wurde, zu einer Zeit, als der Landstrich menschenleer war und Wölfe durch die Wälder streiften.
Als der Ustascha-Führer Ante Pavelić 1941 mit Hitlers Unterstützung den Unabhängigen Staat Kroatien ausrief, übernahm der Tod das Kommando und der Krieg führte schließlich dazu, dass die Felder in Suhopolje erneut vertrockneten und den Bewohnerinnen und Bewohnern ihre Existenzgrundlage entzogen wurde.
Anhand der Namen auf den Grabsteinen hätte man wahrscheinlich die Geschichte des Ortes seit seiner Gründung erzählen können. Einige Namen sagten mir etwas, weil ich sie aus Erzählungen meiner Eltern kannte. Andere wie Nemodlin oder Brozović las ich hingegen zum ersten Mal. Eva Nemodlin (1807–1846). Eva Brozović (1850–1912). Lebensgeschichten, reduziert auf Jahreszahlen. Wie immer auf Friedhöfen, begann ich zu rechnen: Eva Nemodlin war nur 39 Jahre alt geworden. Woran ist sie gestorben? Hatte sie einen Unfall? Wurde sie ermordet? Wer hat um sie getrauert? Eva Brozović ist mit 62 gestorben, wahrscheinlich ein normales Alter für die damalige Zeit.
Auf einigen Grabsteinen war auch der Name Palm zu lesen:
Eva Palm (1829–1882) und Johan Palm (1825–1895), ein Ehepaar, bei dem der Mann die Frau um 13 Jahre überlebte.
Konrad Palm (1857–1901) und Josefina Palm, geb. Fett (1861–1902), beide sehr jung gestorben.
Ein treues Elternherz hat aufgehört zu schlagen
Befreit ist all der Schmerz
Verstumt sind seine Klagen
Die müde Seele ist nun
Daheim in Vaterhaus
Die fleissigen Hände ruhen
Im stillen Grabe aus
Ich hatte keine Ahnung, wer diese Palms waren, aber wahrscheinlich war ich über verschlungene Wege mit ihnen verwandt. Eine eigenartige Vorstellung.
Bei einem Grab war ich mir allerdings sicher, dass es sich um das Grab meines Urgroßvaters handelte, weil ich mir notiert hatte, dass er Konrad hieß und 1926 gestorben war:
Hier ruhen
Konrad Palm
2/XI. 1884–25/I. 1926
Was das Leben hat vereint
Hat der bitre Tot getrent
Doch nur auf kurze Zeit
Es gibt ein Wiedersehen in Ewigkeit
Die Orthographie der Bewohnerinnen und Bewohner Kapans war immer schon sehr eigenwillig gewesen, was sicher auch daran lag, dass im Dorf ein ganz spezieller schwäbischer Dialekt mit ungarischem und kroatischem Einschlag gesprochen wurde. Da auch der Unterricht in der sechsklassigen Volksschule vornehmlich auf Kroatisch erfolgte, war Hochdeutsch in Kapan so etwas wie eine Fremdsprache. Im Haus des Lesevereins, das sich neben der Schule befand, konnte man zwar das eine oder andere deutschsprachige Buch oder die Zeitschriften der Genossenschaft Agraria lesen, allerdings diente das Haus in erster Linie den Männern des Dorfs als Treffpunkt für das sonntägliche Kartenspiel. Wenn sie nicht in der Gastwirtschaft saßen, die von Michael und Maria Palm betrieben wurde. Maria Palm war die Mutter der Schwägerin meines Großvaters mütterlicherseits. Ja, Verwandtschaftsverhältnisse können sehr kompliziert sein, vor allem, wenn die Quellenlage dürftig ist und man die Beziehungen der einzelnen Personen zueinander erst mühsam rekonstruieren muss. Außerdem hatten viele Familien in Kapan den gleichen Namen, was die Sache auch nicht einfacher machte.
Es gibt ein Wiedersehen in Ewigkeit. Auf dem Grabstein meines Urgroßvaters befand sich ein ovales Porzellan-Porträt, das einen etwa 40 Jahre alten Mann mit exaktem Seitenscheitel und einem imposanten, gezwirbelten Schnurrbart zeigte. Er trug ein weißes, kragenloses Hemd, das bis oben zugeknöpft war, dazu ein schwarzes Sakko samt Gilet.
Die Grabinschrift und das leere Ovalfeld neben dem Porträt deuteten darauf hin, dass hier auch seine Frau, Anna Palm, liegen sollte. Hier ruhen … Aber Anna Palm lag nicht dort, weil sie nicht in Kapan, sondern in Vinkovci gestorben war, nachdem sie im Frühjahr 1944 auf der Flucht einen Schlaganfall erlitten hatte. So erzählte es jedenfalls meine Tante. Eine andere Version der Geschichte lautet, dass sie während eines Partisanenangriffs auf den Flüchtlingstreck, mit dem sie unterwegs war, spurlos verschwand. So hatte es Hilde K., die als Kind ebenfalls auf einem Pferdewagen aus Kapan flüchten musste, in Erinnerung. In einem Schreiben, das mein Vater 1965 an die Entschädigungsabteilung der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich richtete, hieß es hingegen, dass seine Großmutter schon seit Juli 1943 als vermisst galt: „Sie war krank und wurde mit einem Lazarett-Zug von Virovitica nach Semlin (Franztal) transportiert, wo sie aber nie ankam.“
Wo Anna Palm, meine Urgroßmutter väterlicherseits, tatsächlich abgeblieben ist, ist nicht bekannt. Hätte Anna Palm die Flucht überlebt, wäre sie möglicherweise ein paar Jahre später gemeinsam mit ihrer Tochter (meiner Großmutter) nach Los Angeles ausgewandert. Von Kapan nach Los Angeles, ein größerer Kontrast ist wohl kaum vorstellbar. Ich weiß das, weil ich als Jugendlicher einmal meine aus Kapan stammenden Verwandten in Los Angeles besucht habe.
Von meiner Tante wusste ich, dass sich das Grab meines Großvaters, der ebenfalls Konrad hieß, irgendwo auf dem Friedhof von Kapan befinden musste. Erst nach langem Suchen fanden meine Schwester und ich den Grabstein, der achtlos am Stamm eines Pfirsichbaums lehnte. Ein Pfirsichbaum am Friedhof – das gefiel mir. Das Grab selbst war nicht mehr auffindbar.
Hier ruhet Konrad Palm, 20/VIII. 1904–3/V. 1928
Sein Sohn Johan, 31/X. 1925–31/III. 1926
Johan, mit einem n, hieß also der Bruder meines Vaters, der nur fünf Monate alt wurde und den mein Vater nie erwähnt hat. Erst jetzt, beim Schreiben, wird mir bewusst, dass Johan Palm mein Onkel war.
Ganz unten am Grabstein war in verwitterter Schrift zu lesen:
Tief betribt von seiner Gattin u. Kinder
Aber weshalb stand Kinder auf dem Grabstein? Das einzige Kind, das damals tief betribt sein konnte, war mein Vater. Seine Halbschwester kam ja erst ein paar Jahre später zur Welt und hatte einen anderen Vater. Oder gab es noch ein anderes totes Kind, von dem nicht einmal mein Vater etwas wusste? Da die Kindersterblichkeit damals erheblich höher war als heute, ist anzunehmen, dass über den Tod von Säuglingen oder Kleinkindern, zumindest nach außen hin, nicht allzuviel Aufhebens gemacht wurde.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an einen mysteriösen Vorfall, der sich Mitte der 1960er-Jahre in unserem Haus in Timelkam zugetragen hatte: Meine Eltern hatten den ersten Stock an einen Zahnarzt und dessen Ehefrau vermietet. Eines Tages gab es im Treppenhaus einen ziemlichen Tumult, nachdem wir aus der Wohnung im ersten Stock einen Schrei und lautes Weinen gehört hatten. Obwohl meine Geschwister und ich von unseren Eltern weggescheucht wurden, konnte ich durch den Türspalt sehen, wie ein Schuhkarton die Treppe heruntergetragen wurde. Den Andeutungen meiner Eltern entnahm ich, dass sich in dem Karton eine Babyleiche befunden haben musste. Das sind jedenfalls die Bilder, die in meinem Kopf auftauchen, wenn ich an dieses Ereignis denke. Genauere Auskünfte zum Vorgefallenen gab es keine mehr, und kurze Zeit später ist das Ehepaar ausgezogen.
Das Tabu Totgeburt wurde in unserer Rest-Familie erst gebrochen, als meine Frau 2008 ein totes Baby zur Welt brachte. Valentin hieß unser Sohn, der drei Tage, bevor er zur Welt kam, starb. Ein Paradoxon, das auch die Beamten bei der Ausstellung des Totenscheins vor große Probleme stellte. Dass der Todestag eines Menschen vor dessen Geburtstag liegt, hat nicht einmal das Computerprogramm des Standesamts verstanden. Meine Eltern haben die Totgeburt ihres Enkels zum Glück nicht mehr erlebt. Genauso wenig wie den Suizid meines Bruders. Ich hatte allerdings die Möglichkeit, über den Verlust meines Kindes und den Tod meines Bruders zu trauern. Meine Vorfahren in Kapan, die ähnliche Schicksalsschläge erlitten hatten, haben diese Möglichkeit wahrscheinlich nur in sehr eingeschränktem Maß gehabt.
Einmal habe ich meine Eltern gefragt, weshalb sie mich auf den Namen Kurt getauft haben. „Wegen deinem Großvater“, hat mein Vater gesagt. „Kurt ist ja die Kurzform von Konrad.“ Das war mir neu. Über den Namen gibt es also eine Verbindung zu meinem Großvater, aber sonst? Was hätte Konrad Palm wohl gesagt, wenn er 1973 als 69-Jähriger erfahren hätte, dass sein langhaariger Enkel soeben Mitglied der Kommunistischen Partei geworden war? Wahrscheinlich hätte er die Welt nicht mehr verstanden. Oder vielleicht doch?
Während ich diese Zeilen schreibe, kommt mir der Gedanke, dass ich nicht alleine bin, weil meine Ahnen hinter mir stehen. Auch mein Großvater Konrad Palm, der bereits mit 28 Jahren gestorben ist. Und auch mein Onkel Johan Palm (Johan mit einem n), der nur fünf Monate alt wurde. Und auch jene Vorfahren, die vor mehr als 250 Jahren aus Baden-Württemberg nach Slawonien auswanderten, um dort ein besseres Leben zu führen. Ein beruhigender Gedanke. Aber auch beunruhigend, weil ich weiß, dass viele meiner Vorfahren während des Zweiten Weltkriegs auf Seiten der Nationalsozialisten gekämpft haben.
Ich ficke Gott
Ob Luka-Batschi Serbe oder Kroate war, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass er sich mit meinen Eltern ausschließlich auf Kroatisch unterhielt. Meist kam er um die Mittagszeit, weil er sich da sicher sein konnte, dass meine Mutter zu Hause war. Worüber sie plauderten, kann ich nur vermuten. Wahrscheinlich tauschten sie Erinnerungen an frühere Zeiten aus. Dazwischen holte Luka-Batschi immer wieder sein Stofftaschentuch hervor und spuckte ungeniert hinein. Offenbar hatte er es an der Lunge.
Manchmal, wenn meine Mutter keine Lust hatte, Luka-Batschi zu empfangen, sperrte sie die Haustüre zu und tat so, als wäre sie nicht zu Hause. Nach dem dritten Läuten gab Luka-Batschi auf und wir hörten, wie er sich mit Worten des Bedauerns – so habe ich sie jedenfalls interpretiert – auf den Weg zurück ins Altersheim machte. Aber vielleicht hat er ja auch geflucht. Wir freuten uns dann, dass wir den alten Mann hereingelegt hatten. Heute schäme ich mich für dieses Verhalten, was aber auch niemandem etwas nützt. Auch stellt sich die Frage, ob man sich für ein Verhalten, das 60 Jahre zurückliegt, überhaupt schämen kann oder ob es sich dabei bloß um eine moralische Alibiaktion handelt.
Luka-Batschis Deutschkenntnisse waren so schlecht, dass wir Kinder immer lachten, wenn er versuchte, Deutsch zu sprechen. Meine Mutter erzählte uns einmal, dass er auf die Frage des Gemeindearztes, wie es ihm gehe, geantwortet habe: „Nix scheißat, nix brunzat. Luftdruck nix gut.“ Das wurde für uns zum geflügelten Wort, das wir bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zum Besten gaben.
Kroatisch war bei uns zu Hause eine Art Geheimsprache. Meine Eltern unterhielten sich auf Kroatisch, wenn es Dinge zu besprechen gab, die wir Kinder nicht hören sollten. Auch geflucht wurde auf Kroatisch: Die Flüche hatten eine große Bandbreite und reichten von „Bože moj i isuse dragi“ (Mein Gott und lieber Jesus) bis „Jebem ti Boga“ (Ich ficke Gott). Dabei ging meine Mutter jeden Sonntag in die Kirche.
Mit der Zeit entwickelte ich ein Gespür dafür, ob es sich bei den Gesprächen zwischen meinen Eltern um ernste Angelegenheiten handelte oder ob bloß Belanglosigkeiten ausgetauscht wurden. Wenn mir böse Blicke zugeworfen wurden, wusste ich, dass sie über mich redeten und es Zeit war, die Küche zu verlassen und auf Tauchstation zu gehen.
Weshalb meine Eltern unter keinen Umständen wollten, dass meine Geschwister und ich Kroatisch lernten, habe ich erst viel später verstanden. Sie waren aufgrund ihrer Herkunft und ihres eigenartigen Dialekts eindeutig als Flüchtlinge zu erkennen und taten alles, um ihren Kindern dieses Stigma zu ersparen. Deshalb legte meine Mutter auch so großen Wert darauf, dass wir immer schön angezogen waren. Zumindest äußerlich sollte es keine Unterschiede zu den anderen Kindern im Ort geben. Um ihren Integrationswillen zu unterstreichen, ließen meine Eltern auch ihre kroatischen Taufnamen Ana und Stjepan auf Anna und Stefan ändern. Oder ging es ihnen gar nicht um Integration, sondern um Assimilation?
Die scheißenden Kühe von Neukirchen an der Vöckla
In den letzten Jahren habe ich mich oft gefragt, weshalb ich mit meinen Eltern nie über ihre Herkunft gesprochen habe. Oder weshalb ich meinen Vater nie gefragt habe, was er im Krieg tatsächlich gemacht hat. Dass er bei der SS-Polizei war, habe ich erst im Zuge der Recherchen zu diesem Buch erfahren, obwohl es nicht schwer gewesen wäre, das auch schon früher herauszufinden. Aber vielleicht wollte ich es auch gar nicht wissen.
Natürlich: Seit meiner Hinwendung zum Kommunismus als 18-Jähriger saß der Schock bei meinen Eltern tief, und weil der politische Feind jetzt mithörte, mussten sie aufpassen, was sie sagten. Nicht genug damit, reagierten viele Verwandte und Bekannte auf meine offene Sympathie mit den Kommunisten entsetzt, und auch wenn sie es nicht offen aussprachen, gaben sie zumindest indirekt meinen Eltern die Schuld daran. Zur Ehrenrettung meiner Eltern muss ich allerdings sagen, dass sie zwar nie verstanden haben, weshalb ich mich der Kommunistischen Partei angeschlossen habe, mich aber, wenn es darauf ankam, nie im Stich ließen.