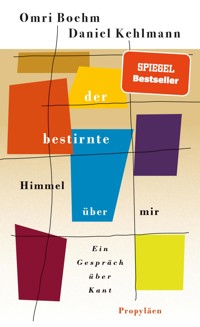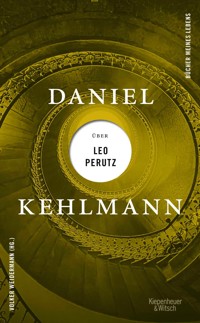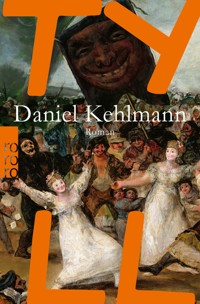
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Tyll», der neue Roman des Erfolgsautors Daniel Kehlmann – er veröffentlichte u.a. «Die Vermessung der Welt», «Ruhm», «F» und «Du hättest gehen sollen» –, ist die Neuerfindung einer legendären Figur: ein großer Roman über die Macht der Kunst und die Verwüstungen des Krieges, über eine aus den Fugen geratene Welt. Tyll Ulenspiegel – Vagant, Schausteller und Provokateur – wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts als Müllerssohn in einem kleinen Dorf geboren. Sein Vater, ein Magier und Welterforscher, gerät schon bald mit der Kirche in Konflikt. Tyll muss fliehen, die Bäckerstochter Nele begleitet ihn. Auf seinen Wegen durch das von den Religionskriegen verheerte Land begegnen sie vielen kleinen Leuten und einigen der sogenannten Großen: dem jungen Gelehrten und Schriftsteller Martin von Wolkenstein, der für sein Leben gern den Krieg kennenlernen möchte, dem melancholischen Henker Tilman und Pirmin, dem Jongleur, dem sprechenden Esel Origenes, dem exilierten Königspaar Elisabeth und Friedrich von Böhmen, deren Ungeschick den Krieg einst ausgelöst hat, dem Arzt Paul Fleming, der den absonderlichen Plan verfolgt, Gedichte auf Deutsch zu schreiben, und nicht zuletzt dem fanatischen Jesuiten Tesimond und dem Weltweisen Athanasius Kircher, dessen größtes Geheimnis darin besteht, dass er seine aufsehenerregenden Versuchsergebnisse erschwindelt und erfunden hat. Ihre Schicksale verbinden sich zu einem Zeitgewebe, zum Epos vom Dreißigjährigen Krieg. Und um wen sollte es sich entfalten, wenn nicht um Tyll, jenen rätselhaften Gaukler, der eines Tages beschlossen hat, niemals zu sterben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Daniel Kehlmann
Tyll
Roman
Über dieses Buch
«Tyll», der neue Roman des Erfolgsautors Daniel Kehlmann – er veröffentlichte u.a. «Die Vermessung der Welt», «Ruhm», «F» und «Du hättest gehen sollen» –, ist die Neuerfindung einer legendären Figur: ein großer Roman über die Macht der Kunst und die Verwüstungen des Krieges, über eine aus den Fugen geratene Welt.
Tyll Ulenspiegel – Vagant, Schausteller und Provokateur – wird zu Beginn des 17. Jahrhunderts als Müllerssohn in einem kleinen Dorf geboren. Sein Vater, ein Magier und Welterforscher, gerät schon bald mit der Kirche in Konflikt. Tyll muss fliehen, die Bäckerstochter Nele begleitet ihn. Auf seinen Wegen durch das von den Religionskriegen verheerte Land begegnen sie vielen kleinen Leuten und einigen der sogenannten Großen: dem jungen Gelehrten und Schriftsteller Martin von Wolkenstein, der für sein Leben gern den Krieg kennenlernen möchte, dem melancholischen Henker Tilman und Pirmin, dem Jongleur, dem sprechenden Esel Origenes, dem exilierten Königspaar Elisabeth und Friedrich von Böhmen, deren Ungeschick den Krieg einst ausgelöst hat, dem Arzt Paul Fleming, der den absonderlichen Plan verfolgt, Gedichte auf Deutsch zu schreiben, und nicht zuletzt dem fanatischen Jesuiten Tesimond und dem Weltweisen Athanasius Kircher, dessen größtes Geheimnis darin besteht, dass er seine aufsehenerregenden Versuchsergebnisse erschwindelt und erfunden hat. Ihre Schicksale verbinden sich zu einem Zeitgewebe, zum Epos vom Dreißigjährigen Krieg. Und um wen sollte es sich entfalten, wenn nicht um Tyll, jenen rätselhaften Gaukler, der eines Tages beschlossen hat, niemals zu sterben.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung FAVORITBUERO, München
Umschlagabbildung Francisco de Goya; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, Spain/Bridgeman Images
ISBN 978-3-644-03501-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Schuhe
Der Krieg war bisher nicht zu uns gekommen. Wir lebten in Furcht und Hoffnung und versuchten, Gottes Zorn nicht auf unsere fest von Mauern umschlossene Stadt zu ziehen, mit ihren hundertfünf Häusern und der Kirche und dem Friedhof, wo unsere Vorfahren auf den Tag der Auferstehung warteten.
Wir beteten viel, um den Krieg fernzuhalten. Zum Allmächtigen beteten wir und zur gütigen Jungfrau, wir beteten zur Herrin des Waldes und zu den kleinen Leuten der Mitternacht, zum heiligen Gerwin, zu Petrus dem Torwächter, zum Evangelisten Johannes, und sicherheitshalber beteten wir auch zur Alten Mela, die in den rauen Nächten, wenn die Dämonen frei wandeln dürfen, vor ihrem Gefolge her durch die Himmel streift. Wir beteten zu den Gehörnten der alten Tage und zum Bischof Martin, der seinen Mantel mit dem Bettler geteilt hatte, als es diesen fror, sodass sie danach beide froren und beide gottgefällig waren, denn was nützt ein halber Mantel im Winter, und natürlich beteten wir zum heiligen Moritz, der mit einer ganzen Legion den Tod gewählt hatte, um nicht seinen Glauben an den einen und gerechten Gott zu verraten.
Zweimal im Jahr kam der Steuereintreiber und schien immer überrascht, dass wir noch da waren. Hin und wieder kamen Händler, aber da wir nicht viel kauften, zogen sie schnell ihrer Wege, und so war es uns recht. Wir brauchten nichts aus der weiten Welt und dachten nicht an sie, bis eines Morgens ein Planwagen, gezogen von einem Esel, über unsere Hauptstraße rollte. Es war ein Samstag und seit kurzem auch Frühling, der Bach schwoll vom Schmelzwasser an, und auf den Feldern, die gerade nicht brachlagen, hatten wir die Saat ausgebracht.
Auf dem Wagen war ein Zelt aus rotem Segeltuch aufgeschlagen. Davor kauerte eine alte Frau. Ihr Körper sah wie ein Beutel aus, ihr Gesicht wie aus Leder, ihr Augenpaar wie winzige schwarze Knöpfe. Eine jüngere Frau mit Sommersprossen und dunklem Haar stand hinter ihr. Auf dem Kutschbock aber saß ein Mann, den wir erkannten, obgleich er noch nie hier gewesen war, und als die Ersten sich erinnerten und seinen Namen riefen, erinnerten sich auch andere, und so rief es bald von überall und mit vielen Stimmen: «Tyll ist hier!», «Tyll ist gekommen!», «Schaut, der Tyll ist da!» Es konnte kein anderer sein.
Sogar zu uns kamen Flugschriften. Sie kamen durch den Wald, der Wind trug sie mit sich, Händler brachten sie – draußen in der Welt wurden mehr davon gedruckt, als irgendwer zählen konnte. Sie handelten vom Schiff der Narren und von der großen Pfaffentorheit und vom bösen Papst in Rom und vom teuflischen Martinus Luther zu Wittenberg und dem Zauberer Horridus und dem Doktor Faust und dem Helden Gawain von der runden Tafel und eben von ihm, Tyll Ulenspiegel, der jetzt selbst zu uns gekommen war. Wir kannten sein geschecktes Wams, wir kannten die zerbeulte Kapuze und den Mantel aus Kalbsfell, wir kannten sein hageres Gesicht, die kleinen Augen, die hohlen Wangen und die Hasenzähne. Seine Hose war aus gutem Stoff, die Schuhe aus feinem Leder, seine Hände aber waren Diebes- oder Schreiberhände, die nie gearbeitet hatten; die rechte hielt die Zügel, die linke die Peitsche. Seine Augen blitzten, er grüßte hierhin und dorthin.
«Und wie heißt du?», fragte er ein Mädchen.
Die Kleine schwieg, denn sie begriff nicht, wie es sein konnte, dass einer, der berühmt war, mit ihr sprach.
«Na sag es!»
Als sie stockend herausgebracht hatte, dass sie Martha hieß, lächelte er nur, als hätte er das immer schon gewusst.
Dann fragte er mit einer Aufmerksamkeit, als wäre es ihm wichtig: «Und wie alt bist du?»
Sie räusperte sich und sagte es ihm. In den zwölf Jahren ihres Lebens hatte sie nicht Augen gesehen wie seine. Augen wie diese mochte es in den freien Städten des Reichs geben und an den Höfen der Großen, aber noch nie war einer, der solche Augen hatte, zu uns gekommen. Martha hatte nicht gewusst, dass solche Kraft, solche Behändigkeit der Seele aus einem Menschengesicht sprechen konnten. Dereinst würde sie ihrem Mann und noch viel später ihren ungläubigen Enkeln, die den Ulenspiegel für eine Figur alter Sagen hielten, erzählen, dass sie ihn selbst gesehen hatte.
Schon war der Wagen vorbeigerollt, schon war sein Blick anderswohin geglitten, zu anderen am Straßenrand. «Tyll ist gekommen!», rief es wieder an der Straße und: «Tyll ist hier!» aus den Fenstern und: «Der Tyll ist da!» vom Kirchplatz, auf den nun sein Wagen rollte. Er ließ die Peitsche knallen und stand auf.
Blitzschnell wurde der Wagen zur Bühne. Die zwei Frauen falteten das Zelt, die junge band ihre Haare zu einem Knoten, setzte ein Krönchen auf, warf sich ein Stück Purpurstoff um, die alte stellte sich vor den Wagen, erhob die Stimme und begann einen Leiergesang. Ihr Dialekt klang nach dem Süden, nach den großen Städten Bayerns, und war nicht leicht zu verstehen, aber wir bekamen doch mit, dass es um eine Frau und einen Mann ging, die einander liebten und nicht zueinanderkonnten, weil ein Gewässer sie trennte. Tyll Ulenspiegel nahm ein blaues Tuch, kniete sich hin, schleuderte es, eine Seite festhaltend, von sich, sodass es sich knatternd entrollte; er zog es zurück und schleuderte es wieder weg, zog es zurück, schleuderte es, und wie er auf der einen und die Frau auf der anderen Seite kniete und das Blau zwischen ihnen wogte, schien da wirklich Wasser zu sein, und die Wellen gingen derart wild auf und nieder, als könnte kein Schiff sie befahren.
Als die Frau sich aufrichtete und mit schreckensstarrem Gesicht auf die Wogen sah, bemerkten wir mit einem Mal, wie schön sie war. Während sie da stand und die Arme zum Himmel streckte, gehörte sie plötzlich nicht mehr hierher, und keiner von uns vermochte den Blick von ihr zu wenden. Nur aus dem Augenwinkel sahen wir ihren Geliebten springen und tanzen und fuhrwerken und sein Schwert schwingen und mit Drachen und Feinden und Hexen und bösen Königen kämpfen, auf dem schweren Weg zu ihr.
Das Stück dauerte bis in den Nachmittag. Aber obgleich wir wussten, dass den Kühen die Euter schmerzten, wurde keiner von uns ungeduldig. Die Alte trug Stunde um Stunde vor. Es schien unmöglich, dass jemand sich so viele Verse merken konnte, und einigen von uns kam der Verdacht, dass sie sie beim Singen erfand. Tyll Ulenspiegels Körper war unterdessen nie in Ruhe, seine Sohlen schienen kaum den Boden zu berühren; wann immer unsere Blicke ihn fanden, war er schon wieder anderswo auf der kleinen Bühne. Am Ende gab es ein Missverständnis: Die schöne Frau hatte sich Gift verschafft, um sich tot zu stellen und nicht den bösen Vormund heiraten zu müssen, aber die alles erklärende Botschaft an ihren Geliebten war auf dem Weg zu ihm verlorengegangen, und als er, der wahre Bräutigam, der Freund ihrer Seele, zu guter Letzt bei ihrem reglosen Leib ankam, traf ihn der Schreck wie ein Blitzschlag. Eine lange Zeit stand er wie erfroren. Die Alte verstummte. Wir hörten den Wind und die nach uns muhenden Kühe. Keiner atmete.
Schließlich zog er das Messer und stach sich in die Brust. Es war erstaunlich, die Klinge verschwand in seinem Fleisch, ein rotes Tuch rollte ihm aus dem Kragen wie ein Blutstrom, und er verröchelte neben ihr, zuckte noch, lag still. War tot. Zuckte doch noch einmal, setzte sich auf, sank wieder zurück. Zuckte wieder, lag wieder still, und nun für immer. Wir warteten. Tatsächlich. Für immer.
Sekunden später wachte die Frau auf und erblickte den toten Leib neben sich. Erst war sie fassungslos, dann schüttelte sie ihn, dann begriff sie und war wieder fassungslos, und dann weinte sie, als würde nichts auf Erden jemals gut. Dann nahm sie sein Messer und tötete sich ebenfalls, und wieder bewunderten wir die schlaue Vorrichtung und wie tief die Klinge in ihrer Brust verschwand. Nun war nur mehr die Alte übrig und sprach noch ein paar Verse, die wir des Dialekts wegen kaum verstanden. Dann war das Stück zu Ende, und viele von uns weinten noch, als die Toten längst aufgestanden waren und sich verbeugten.
Das war aber nicht alles. Die Kühe mussten noch warten, denn nach der Tragödie kam das Lustspiel. Die Alte schlug eine Trommel, und Tyll Ulenspiegel pfiff auf einer Flöte und tanzte mit der Frau, die nun gar nicht mehr besonders schön aussah, nach rechts und nach links und vor und wieder zurück. Die beiden warfen die Arme hoch, und ihre Bewegungen stimmten in einem Maße überein, als wären sie nicht zwei Menschen, sondern Spiegelbilder voneinander. Wir konnten leidlich tanzen, wir feierten oft, aber keiner von uns konnte tanzen wie sie; wenn man ihnen zusah, war es einem, als hätte ein Menschenkörper keine Schwere und als wäre das Leben nicht traurig und hart. So hielt es auch uns nicht auf den Füßen, und wir begannen zu wippen, zu springen, zu hüpfen und uns zu drehen.
Doch plötzlich war der Tanz vorbei. Keuchend blickten wir auf zum Wagen, auf dem Tyll Ulenspiegel jetzt allein stand, die beiden Frauen waren nicht zu sehen. Er sang eine Spottballade über den armen dummen Winterkönig, den Pfälzer Kurfürsten, der gemeint hatte, er könne den Kaiser besiegen und von den Protestanten Prags Krone annehmen, doch sein Königtum war noch vor dem Schnee getaut. Auch vom Kaiser sang er, dem immer kalt war vom Beten, dem Männlein, das in der Hofburg zu Wien vor den Schweden zitterte, und dann sang er vom Schwedenkönig, dem Löwen aus der Mitternacht, stark wie ein Bär, aber was hatte es ihm genützt gegen die Kugel in Lützen, die ihm das Leben nahm wie einem kleinen Söldner, und aus war dein Licht, und fort das Königsseelchen, fort der Löwe! Tyll Ulenspiegel lachte, und wir lachten auch, weil man ihm nicht widerstehen konnte und weil es guttat, daran zu denken, dass die Großen starben und wir noch lebten, und dann sang er vom König in Spanien mit der vollen Unterlippe, der die Welt zu beherrschen glaubte, obgleich er pleite war wie ein Huhn.
Vor Lachen merkten wir erst nach einer Weile, dass die Musik sich verändert hatte, dass plötzlich kein Spott mehr darin klang. Eine Ballade vom Krieg sang er jetzt, vom gemeinsamen Reiten und dem Klirren der Waffen und der Freundschaft der Männer und der Bewährung in Gefahr und dem Jubel der pfeifenden Kugeln. Vom Söldnerleben sang er und von der Schönheit des Sterbens, er sang von der jauchzenden Freude eines jeden, der auf dem Pferd dem Feind entgegenritt, und wir alle spürten unsere Herzen schneller schlagen. Die Männer unter uns lächelten, die Frauen wiegten die Köpfe, die Väter hoben ihre Kinder auf die Schultern, die Mütter blickten stolz auf ihre Söhne hinab.
Nur die alte Luise zischte und ruckte mit dem Kopf und murmelte so laut, dass die, die neben ihr standen, ihr sagten, sie solle doch heimgehen. Worauf sie aber nur lauter wurde und rief, ob denn keiner verstehe, was er hier mache. Er beschwöre es, er rufe es her!
Aber als wir zischten und abwinkten und ihr drohten, trollte sie sich gottlob, und schon spielte er wieder die Flöte, und die Frau stand neben ihm und sah nun majestätisch aus wie eine Person von Stand. Sie sang mit klarer Stimme von der Liebe, die stärker war als der Tod. Von der Liebe der Eltern sang sie und von der Liebe Gottes und der Liebe zwischen Mann und Frau, und da änderte sich wieder etwas, der Taktschlag wurde schneller, die Töne wurden spitzer und schärfer, und auf einmal handelte das Lied von der Liebe der Körper, den warmen Leibern, dem Sich-Wälzen im Gras, dem Duft deiner Nacktheit und deinem großen Hintern. Die Männer unter uns lachten, und dann stimmten die Frauen ins Gelächter ein, und am lautesten lachten die Kinder. Auch die kleine Martha lachte. Sie hatte sich nach vorne geschoben, und sie verstand das Lied ganz gut, denn sie hatte Mutter und Vater oft im Bett gehört und die Knechte im Stroh und ihre Schwester mit dem Tischlersohn voriges Jahr – nachts hatten die beiden sich davongemacht, aber Martha war ihnen nachgeschlichen und hatte alles gesehen.
Auf dem Gesicht des berühmten Mannes zeigte sich ein lüstern breites Grinsen. Eine starke Kraft hatte sich zwischen ihm und der Frau aufgespannt, es drängte ihn hin- und sie herüber, so heftig zog es ihre Leiber aufeinander zu, und es war kaum auszuhalten, dass sie einander nicht endlich anfassten. Doch die Musik, die er spielte, schien es zu verhindern, denn wie aus Versehen war sie eine andere geworden, und der Moment war vorbei, die Töne erlaubten es nicht mehr. Es war das Agnus Dei. Die Frau faltete fromm die Hände, qui tollis peccata mundi, er wich zurück, und die beiden schienen selbst erschrocken über die Wildheit, die sie beinah erfasst hätte, so wie auch wir erschrocken waren und uns bekreuzigten, weil wir uns erinnerten, dass Gott alles sah und wenig billigte. Die beiden sanken in die Knie, wir taten es ihnen nach. Er setzte die Flöte ab, stand auf, breitete die Arme aus und bat um Bezahlung und Essen. Denn jetzt gebe es eine Pause. Und das Beste komme, falls man ihm gutes Geld zustecke, danach.
Benommen griffen wir in die Taschen. Die beiden Frauen gingen mit Bechern umher. Wir gaben so viel, dass die Münzen klirrten und sprangen. Alle gaben wir: Karl Schönknecht gab, und Malte Schopf gab, und seine lispelnde Schwester gab, und die Müllersfamilie, die sonst so geizig war, gab ebenfalls, und der zahnlose Heinrich Matter und Matthias Wohlsegen gaben besonders viel, obwohl sie Handwerker waren und sich für etwas Besseres hielten.
Martha ging langsam um den Planwagen herum.
Da saß, mit dem Rücken ans Wagenrad gelehnt, Tyll Ulenspiegel und trank aus einem großen Humpen. Neben ihm stand der Esel.
«Komm her», sagte er.
Mit klopfendem Herzen trat sie näher.
Er streckte ihr den Humpen hin. «Trink», sagte er.
Sie nahm den Krug. Das Bier schmeckte bitter und schwer.
«Die Leute hier. Sind das gute Leute?»
Sie nickte.
«Friedliche Leute, helfen einander, verstehen einander, mögen einander, solche Leute sind das?»
Sie nahm noch einen Schluck. «Ja.»
«Na dann», sagte er.
«Wir werden sehen», sagte der Esel.
Vor Schreck ließ Martha den Humpen fallen.
«Das schöne Bier», sagte der Esel. «Du saudummes Kind.»
«Man nennt das Reden mit dem Bauch», sagte Tyll Ulenspiegel. «Kannst du auch lernen, wenn du möchtest.»
«Kannst du auch lernen», sagte der Esel.
Martha hob den Humpen auf und trat einen Schritt zurück. Die Bierpfütze wurde größer und wieder kleiner, der trockene Boden saugte die Nässe ein.
«Im Ernst», sagte er. «Komm mit uns. Mich kennst du ja jetzt. Ich bin der Tyll. Meine Schwester da drüben ist die Nele. Sie ist nicht meine Schwester. Wie die Alte heißt, weiß ich nicht. Der Esel ist der Esel.»
Martha starrte ihn an.
«Wir bringen dir alles bei», sagte der Esel. «Ich und die Nele und die Alte und der Tyll. Und du kommst weg von hier. Die Welt ist groß. Du kannst sie sehen. Ich heiß nicht einfach Esel, ich hab auch einen Namen, ich bin Origenes.»
«Warum fragt ihr mich?»
«Weil du nicht wie die bist», sagte Tyll Ulenspiegel. «Du bist wie wir.»
Martha streckte ihm den Humpen hin, aber er nahm ihn nicht, also stellte sie ihn auf den Boden. Ihr Herz klopfte. Sie dachte an ihre Eltern und an die Schwester und an das Haus, in dem sie lebte, und an die Hügel draußen hinterm Wald und an das Geräusch des Windes in den Bäumen, von dem sie sich nicht vorstellen konnte, dass es anderswo genauso klang. Und sie dachte an den Eintopf, den ihre Mutter kochte.
Die Augen des berühmten Mannes blitzten auf, als er lächelnd sagte: «Denk an den alten Spruch. Was Besseres als den Tod findest du überall.»
Martha schüttelte den Kopf.
«Na gut», sagte er.
Sie wartete, aber er sagte nichts mehr, und sie brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass sein Interesse an ihr schon erloschen war.
Also ging sie wieder um den Wagen herum und zu den Leuten, die sie kannte, zu uns. Wir waren jetzt ihr Leben, ein anderes gab es nicht mehr. Sie setzte sich auf den Boden. Sie fühlte sich leer. Aber als wir nach oben blickten, tat sie es auch, denn allen zugleich war uns aufgefallen, dass etwas im Himmel hing.
Eine schwarze Linie durchschnitt das Blau. Wir blinzelten. Es war ein Seil.
Auf der einen Seite war es am Fensterkreuz des Kirchturms festgebunden, auf der anderen an einer Fahnenstange, die neben dem Fenster des Bürgerhauses aus der Mauer ragte, in dem der Stadtvogt arbeitete, was aber nicht oft geschah, denn er war faul. Im Fenster stand die junge Frau, sie musste das Seil gerade erst festgeknotet haben; aber wie, so fragten wir uns, hatte sie es gespannt? Man konnte hier oder dort sein, in diesem Fenster oder im anderen, man konnte leicht ein Seil festknoten und es fallen lassen, aber wie bekam man es wieder hinauf ins andere Fenster, um die andere Seite festzumachen?
Wir sperrten die Münder auf. Für eine Weile schien es uns, als wäre das Seil selbst schon das Kunststück und als bräuchte es nicht mehr. Ein Spatz landete darauf, machte einen kleinen Sprung, breitete die Flügel aus, überlegte es sich anders und blieb sitzen.
Da erschien Tyll Ulenspiegel drüben im Kirchturmfenster. Er winkte, sprang aufs Fensterbrett, trat aufs Seil. Er tat das, als wäre es nichts. Er tat es, als wäre es nur ein Schritt wie jeder. Keiner von uns sprach, keiner rief, keiner bewegte sich, wir hatten aufgehört zu atmen.
Er schwankte nicht und suchte nicht nach Gleichgewicht, er ging einfach. Seine Arme schlenkerten, er ging, wie man auf dem Boden geht, bloß sah es ein bisschen geziert aus, wie er immer einen Fuß genau vor den anderen setzte. Man musste scharf hinsehen, um die kleinen Hüftbewegungen zu bemerken, mit denen er das Schwanken des Seils abfing. Er machte einen Sprung und ging nur einen Moment in die Knie, als er wieder aufkam. Dann spazierte er, die Hände auf dem Rücken gefaltet, zur Mitte. Der Spatz flog auf, aber er machte nur ein paar Flügelschläge und setzte sich wieder und drehte den Kopf; es war so still, dass wir ihn fiepen und piepen hörten. Und natürlich hörten wir unsere Kühe.
Tyll Ulenspiegel über uns drehte sich, langsam und nachlässig – nicht wie einer, der in Gefahr ist, sondern wie einer, der sich neugierig umsieht. Der rechte Fuß stand längs auf dem Seil, der linke quer, die Knie waren ein wenig gebeugt und die Fäuste in die Seiten gestemmt. Und wir alle, die wir hochsahen, begriffen mit einem Mal, was Leichtigkeit war. Wir begriffen, wie das Leben sein kann für einen, der wirklich tut, was er will, und nichts glaubt und keinem gehorcht; wie es wäre, so ein Mensch zu sein, begriffen wir, und wir begriffen, dass wir nie solche Menschen sein würden.
«Zieht eure Schuhe aus!»
Wir wussten nicht, ob wir ihn verstanden hatten.
«Zieht sie aus», rief er. «Jeder den rechten. Fragt nicht, tut es, das wird lustig. Vertraut mir, zieht sie aus. Alt und Jung, Frau und Mann! Jeder. Den rechten Schuh.»
Wir starrten ihn an.
«War es denn nicht lustig bis jetzt? Wollt ihr nicht mehr? Ich zeige euch mehr, zieht die Schuhe aus, jeder den rechten, los!»
Wir brauchten eine Weile, um in Bewegung zu kommen. So ist es immer mit uns, wir sind bedächtige Leute. Als Erstes gehorchte der Bäcker, dann sogleich Malte Schopf und dann Karl Lamm und dann dessen Frau, und dann gehorchten die Handwerker, die sich immer für was Besseres hielten, und dann taten wir es alle, jeder von uns, nur Martha nicht. Tine Krugmann neben ihr stieß sie mit dem Ellenbogen und zeigte auf ihren rechten Fuß, aber Martha schüttelte den Kopf, und Tyll Ulenspiegel auf dem Seil machte von neuem einen Sprung, wobei er in der Luft die Füße zusammenschlug. So hoch sprang er, dass er beim Aufkommen die Arme ausstrecken musste, um sein Gleichgewicht zu finden – ganz kurz nur, aber es reichte, um uns daran zu erinnern, dass auch er Gewicht hatte und nicht fliegen konnte.
«Und jetzt werft», rief er mit hoher, klarer Stimme. «Denkt nicht, fragt nicht, zögert nicht, das wird ein großer Spaß. Tut, was ich sage. Werft!»
Tine Krugmann tat es als Erste. Ihr Schuh flog und stieg höher und verschwand in der Menge. Dann flog der nächste Schuh, es war der von Susanne Schopf, und dann der nächste, und dann flogen Dutzende und dann noch mehr und mehr und mehr. Alle lachten wir und schrien und riefen: «Pass auf!», und: «Duck dich!», und: «Hier kommt was!» Es war ein Heidenspaß, und es machte auch nichts, dass manche der Schuhe Köpfe trafen. Flüche stiegen auf, ein paar Frauen schimpften, ein paar Kinder weinten, aber es war nicht schlimm, und Martha musste sogar lachen, als ein schwerer Lederstiefel sie nur knapp verfehlte, während ein gewebter Pantoffel vor ihre Füße segelte. Er hatte recht gehabt, und einige fanden es sogar so lustig, dass sie auch die linken Schuhe warfen. Und einige warfen noch Hüte und Löffel und Krüge, die irgendwo zerbrachen, und natürlich warfen ein paar auch Steine. Aber als seine Stimme zu uns sprach, ebbte der Lärm ab, und wir horchten.
«Ihr Deppen.»
Wir blinzelten, die Sonne stand niedrig. Die auf der hinteren Seite des Platzes sahen ihn deutlich, für die anderen war er nur ein Umriss.
«Ihr Narren. Ihr Staubköpfe. Ihr Frösche. Ihr Nichtsnutze, ihr Maulwürfe, ihr blöden Ratten. Jetzt holt sie euch wieder.»
Wir starrten.
«Oder seid ihr zu blöd? Könnt sie euch nicht mehr holen, schafft es nicht, seid zu dumm in den Schädeln?» Er lachte meckernd. Der Spatz flog auf, erhob sich über die Dächer, war dahin.
Wir blickten einander an. Was er gesagt hatte, war gemein; aber es war so gemein auch wieder nicht, dass es nicht immer noch ein Scherz sein konnte und ein derbes Frotzeln nach seiner Art. Dafür war er ja berühmt, er konnte es sich erlauben.
«Na was denn?», fragte er. «Braucht ihr sie nicht mehr? Wollt sie nicht mehr? Mögt sie nicht mehr? Ihr Rindviecher, holt eure Schuhe!»
Malte Schopf war der Erste. Ihm war die ganze Zeit nicht wohl gewesen, und so lief er jetzt dorthin, wo er meinte, dass sein Stiefel hingeflogen war. Er schob Leute zur Seite, drängte sich, schob sich, bückte sich und wühlte zwischen den Beinen. Auf der anderen Seite des Platzes tat Karl Schönknecht es ihm nach, und dann folgte Elsbeth, die Witwe des Schmieds, aber ihr kam der alte Lembke dazwischen und rief, sie solle sich trollen, das sei der Schuh seiner Tochter. Elsbeth, der noch die Stirn weh tat, weil ein Stiefel sie getroffen hatte, rief zurück, dass lieber er sich trollen solle, denn sie könne ja wohl noch ihren Schuh erkennen, so schöne bestickte Schuhe wie sie habe die Lembke-Tochter gewiss nicht, worauf der alte Lembke schrie, sie solle ihm aus dem Weg gehen und nicht seine Tochter schimpfen, worauf wiederum sie schrie, dass er ein stinkiger Schuhdieb sei. Da mischte sich Lembkes Sohn ein: «Ich warne dich!», und zur selben Zeit begannen Lise Schoch und die Müllerin zu streiten, denn ihre Schuhe sahen wirklich gleich aus, und ihre Füße waren gleich groß, und auch zwischen Karl Lamm und seinem Schwager setzte es laute Worte, und Martha begriff plötzlich, was hier geschah, und sie hockte sich auf den Boden und kroch los.
Über ihr war schon Geschiebe, Geschimpfe und Gestoße. Ein paar, die ihre Schuhe schnell gefunden hatten, machten sich davon, aber zwischen uns anderen brach eine Wut aus, so heftig, als hätte sie sich lange gestaut. Der Tischler Moritz Blatt und der Hufschmied Simon Kern schlugen mit Fäusten aufeinander ein, dass einer, der gedacht hätte, es ginge nur um Schuhe, das nicht hätte verstehen können, denn dafür hätte er wissen müssen, dass Moritz’ Frau als Kind dem Simon versprochen gewesen war. Beide bluteten aus Nase und Mund, beide keuchten wie Pferde, und keiner traute sich dazwischenzugehen; auch Lore Pilz und Elsa Kohlschmitt waren scheußlich ineinander verbissen, aber schließlich hassten sie einander schon so lange, dass sie die Gründe nicht mehr wussten. Sehr wohl allerdings wusste man, warum die Semmler-Familie und die Leute vom Grünangerhaus aufeinander losgingen; es war wegen des strittigen Ackers und der alten Erbschaftssache, die noch von den Tagen des Schultheiß Peter her rührte, und auch wegen der Semmler-Tochter und ihres Kindes, das nicht von ihrem Ehemann war, sondern vom Karl Schönknecht. Wie ein Fieber griff die Wut um sich – wo man hinsah, wurde geschrien und geschlagen, Leiber wälzten sich, und jetzt drehte Martha den Kopf und sah nach oben.
Da stand er und lachte. Den Leib zurückgebogen, den Mund weit aufgerissen, mit zuckenden Schultern. Nur seine Füße standen ruhig, und seine Hüften schwangen mit dem Schaukeln des Seils. Martha kam es vor, als müsste sie nur besser hinsehen, dann würde sie begreifen, warum er sich so freute – aber da rannte ein Mann auf sie zu und sah sie nicht, und sein Stiefel traf ihre Brust, und ihr Kopf schlug auf den Boden, und als sie einatmete, war es, als ob Nadeln sie stachen. Sie rollte auf den Rücken. Seil und Himmel waren leer. Tyll Ulenspiegel war weg.
Sie raffte sich hoch. Sie humpelte vorbei an den sich prügelnden, sich wälzenden, einander beißenden, weinenden, schlagenden Leibern, an denen sie da und dort noch Gesichter erkannte; sie humpelte die Straße entlang, geduckt und mit gesenktem Kopf, aber gerade als sie ihre Haustür erreicht hatte, hörte sie hinter sich das Rumpeln des Planwagens. Sie drehte sich um. Auf dem Kutschbock saß die junge Frau, die er Nele genannt hatte, daneben kauerte reglos die Alte. Warum hielt sie denn keiner auf, warum folgte ihnen niemand? Der Wagen fuhr an Martha vorbei. Sie starrte ihm nach. Gleich würde er bei der Ulme sein, dann am Stadttor, dann fort.
Und da, als der Wagen schon fast die letzten Häuser erreicht hatte, rannte ihm doch einer hinterher, mit mühelos großen Schritten. Das Kalbsfell des Mantels sträubte sich um seinen Nacken wie etwas Lebendes.
«Ich hätt dich mitgenommen!», rief er, als er an Martha vorbeilief. Kurz bevor die Straße sich krümmte, holte er den Wagen ein und sprang auf. Der Torwächter war mit uns anderen am Hauptplatz, niemand hielt sie zurück.
Langsam ging Martha ins Haus, schloss die Tür hinter sich und legte den Riegel vor. Der Ziegenbock lag neben dem Ofen und sah fragend zu ihr auf. Sie hörte die Kühe brüllen, und vom Hauptplatz her gellte unser Geschrei.
Aber schließlich beruhigten wir uns. Noch vor dem Abend wurden die Kühe gemolken. Marthas Mutter kam zurück, und ihr war außer ein paar Schrammen wenig passiert, ihr Vater hatte einen Zahn verloren, und sein Ohr war eingerissen, ihrer Schwester war jemand so fest auf den Fuß getreten, dass sie noch einige Wochen hinkte. Aber es kamen der nächste Morgen und der nächste Abend, und das Leben ging weiter. In jedem Haus gab es Beulen und Schnitte und Schrammen und verstauchte Arme und fehlende Zähne, aber schon am Tag darauf war der Hauptplatz wieder sauber, und jeder trug seine Schuhe.
Wir sprachen nie über das, was geschehen war. Wir sprachen auch nicht über den Ulenspiegel. Ohne es ausgemacht zu haben, hielten wir uns daran; sogar Hans Semmler, den es so fürchterlich erwischt hatte, dass er von nun an im Bett liegen musste und nichts essen konnte außer dicker Suppe, tat so, als wäre es nie anders gewesen. Und auch die Witwe von Karl Schönknecht, den wir am nächsten Tag auf dem Gottesacker begruben, verhielt sich, als wäre es ein Schicksalsschlag gewesen und als wüsste sie nicht genau, wem das Messer in seinem Rücken gehört hatte. Nur das Seil hing noch tagelang über dem Platz, zitterte im Wind und war Spatzen und Schwalben ein Halt, bis der Priester, dem bei der Schlägerei besonders übel mitgespielt worden war, weil wir sein Großtun und seine Herablassung nicht mochten, wieder auf den Glockenturm steigen konnte, um es abzuschneiden.
Aber wir vergaßen auch nicht. Was geschehen war, blieb zwischen uns. Es war da, während wir die Ernte einholten, und es war da, wenn wir miteinander um das Korn handelten oder uns sonntags zur Messe versammelten, wo der Priester einen neuen Gesichtsausdruck hatte, halb Verwunderung und halb Furcht. Und besonders war es da, wenn wir auf dem Platz Feste begingen und wenn wir einander beim Tanzen ins Gesicht sahen. Dann kam es uns vor, als hätte die Luft mehr Schwere, als schmeckte das Wasser anders und als wäre der Himmel, seitdem das Seil in ihm gehangen hatte, nicht mehr derselbe.
Und ein gutes Jahr später kam der Krieg doch zu uns. Eines Nachts hörten wir es wiehern, und dann lachte es draußen mit vielen Stimmen, und schon hörten wir das Krachen der eingeschlagenen Türen, und bevor wir noch auf der Straße waren, mit nutzlosen Heugabeln oder Messern bewaffnet, züngelten die Flammen.
Die Söldner waren hungriger als üblich, und sie hatten noch mehr getrunken. Lange schon hatten sie keine Stadt betreten, die ihnen so viel bot. Die alte Luise, die tief geschlafen und diesmal keine Vorahnung gehabt hatte, starb in ihrem Bett. Der Pfarrer starb, als er sich schützend vors Kirchenportal stellte. Lise Schoch starb, als sie versuchte, Goldmünzen zu verstecken, der Bäcker und der Schmied und der alte Lembke und Moritz Blatt und die meisten anderen Männer starben, als sie versuchten, ihre Frauen zu schützen, und die Frauen starben, wie Frauen eben sterben im Krieg.
Martha starb auch. Sie sah noch, wie die Zimmerdecke über ihr sich in rote Hitze verwandelte, sie roch den Qualm, bevor er so fest nach ihr griff, dass sie nichts mehr erkannte, und sie hörte ihre Schwester um Hilfe rufen, während die Zukunft, die sie eben noch gehabt hatte, sich in nichts auflöste: der Mann, den sie nie haben, und die Kinder, die sie nicht großziehen, und die Enkel, denen sie niemals von einem berühmten Spaßmacher an einem Vormittag im Frühling erzählen würde, und die Kinder dieser Enkel, all die Menschen, die es nun doch nicht geben sollte. So schnell geht das, dachte sie, als wäre sie hinter ein großes Geheimnis gekommen. Und als sie die Dachbalken splittern hörte, fiel ihr noch ein, dass Tyll Ulenspiegel nun vielleicht der Einzige war, der sich an unsere Gesichter erinnern und wissen würde, dass es uns gegeben hatte.
Tatsächlich überlebten nur der lahme Hans Semmler, dessen Haus nicht Feuer gefangen hatte und der übersehen worden war, weil er sich nicht bewegen konnte, sowie Elsa Ziegler und Paul Grünanger, die heimlich miteinander im Wald gewesen waren. Als sie im Morgengrauen mit zerzausten Kleidern und wirren Haaren zurückkamen und nur Trümmer unter sich kräuselndem Rauch vorfanden, meinten sie für einen Augenblick, Gott der Herr hätte ihnen zur Strafe für ihre Sünde ein Wahngespinst geschickt. Sie zogen miteinander nach Westen, und für eine kurze Zeit waren sie glücklich.
Uns andere aber hört man dort, wo wir einst lebten, manchmal in den Bäumen. Man hört uns im Gras und im Grillenzirpen, man hört uns, wenn man den Kopf gegen das Astloch der alten Ulme legt, und zuweilen kommt es Kindern vor, als könnten sie unsere Gesichter im Wasser des Baches sehen. Unsere Kirche steht nicht mehr, aber die Kiesel, die das Wasser rund und weiß geschliffen hat, sind noch dieselben, wie auch die Bäume dieselben sind. Wir aber erinnern uns, auch wenn keiner sich an uns erinnert, denn wir haben uns noch nicht damit abgefunden, nicht zu sein. Der Tod ist immer noch neu für uns, und die Dinge der Lebenden sind uns nicht gleichgültig. Denn es ist alles nicht lang her.
Herr der Luft
I
Kniehoch hat er das Seil gespannt, von der Linde zur alten Tanne. Dafür musste er Kerben schneiden, bei der Tanne war das leicht, bei der Linde ist das Messer immer wieder abgerutscht, aber schließlich ist es gegangen. Er prüft die Knoten, zieht bedächtig seine Holzschuhe aus, steigt aufs Seil, fällt.
Jetzt steigt er wieder auf, breitet die Arme aus und macht einen Schritt. Er breitet die Arme aus, aber er kann sich nicht halten und fällt. Er steigt wieder auf, versucht es, fällt von neuem.
Er versucht es wieder und fällt.
Man kann auf einem Seil nicht gehen. Das ist offensichtlich. Menschenfüße sind nicht gemacht dafür. Warum es überhaupt probieren?
Aber er probiert weiter. Immer fängt er bei der Linde an, jedes Mal fällt er sofort. Die Stunden vergehen. Am Nachmittag gelingt ein Schritt, ein einziger nur, und bis es dunkel wird, schafft er nicht noch einen. Doch für einen Augenblick hat das Seil ihn gehalten, und er hat darauf gestanden wie auf festem Boden.
Am nächsten Tag regnet es in Strömen. Er hockt im Haus und hilft seiner Mutter. «Halt das Tuch straff, träum nicht, um Christi willen!» Und der Regen trommelt aufs Dach wie Hunderte kleine Finger.
Am nächsten Tag regnet es weiter. Eiskalt ist es, und das Seil ist klamm, man kann keinen Schritt machen.
Am nächsten Tag wieder Regen. Er steigt auf und fällt und steigt wieder auf und fällt, jedes Mal. Eine Weile liegt er auf dem Boden, die Arme ausgebreitet, die Haare nur ein dunkler Fleck vor Nässe.
Am nächsten Tag ist Sonntag, deshalb kann er erst am Nachmittag aufs Seil, der Gottesdienst dauert den ganzen Morgen. Am Abend gelingen drei Schritte, und wäre das Seil nicht nass gewesen, hätten es vier sein können.
Allmählich begreift er, wie man es machen kann. Seine Knie verstehen, die Schultern halten sich anders. Man muss dem Schwanken nachgeben, muss weich werden in Knien und Hüften, muss dem Sturz einen Schritt zuvorkommen. Die Schwere greift nach einem, aber schon ist man weiter. Seiltanz: dem Fallen davonlaufen.
Tags darauf ist es wärmer. Dohlen schreien, Käfer und Bienen brummen, und die Sonne lässt die Wolken zerrinnen. Sein Atem steigt in kleinen Wolken in die Luft. Die Helle des Morgens trägt die Stimmen weiter, er hört seinen Vater im Haus einen Knecht anschreien. Er singt vor sich hin, das Lied vom Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom großen Gott, das hat eine Melodie, zu der es sich gut auf dem Seil gehen lässt, aber offenbar war er zu laut, denn auf einmal steht Agneta, seine Mutter, neben ihm und fragt, warum er nicht arbeitet.
«Ich komme gleich.»
«Wasser muss geholt werden», sagt sie, «der Herd geputzt.»
Er breitet die Arme aus, steigt aufs Seil und versucht, dabei nicht auf ihren gewölbten Bauch zu achten. Steckt wirklich ein Kind in ihr, strampelt und zuckt und hört ihnen zu? Der Gedanke stört ihn. Wenn Gott einen Menschen schaffen möchte, warum tut er das in einem anderen Menschen? Es liegt etwas Hässliches darin, dass alle Wesen im Verborgenen entstehen: Maden im Teig, Fliegen im Kot, Würmer in der braunen Erde. Nur ganz selten, das hat ihm sein Vater erklärt, wachsen Kinder aus Alraunwurzeln, und noch seltener Säuglinge aus faulen Eiern.
«Soll ich den Sepp schicken?», fragt sie. «Willst du, dass ich den Sepp schicke?»
Der Junge fällt vom Seil, schließt die Augen, breitet die Arme aus, steigt erneut auf. Als er wieder hinsieht, ist seine Mutter gegangen.
Er hofft, dass sie die Drohung nicht wahr macht, aber nach einer Weile kommt Sepp wirklich. Der sieht ihm kurz zu, dann tritt er ans Seil und stößt ihn herunter: kein leichter Schubs, sondern ein Stoß, so fest, dass der Junge der Länge nach hinschlägt. Vor Wut nennt er Sepp einen widerlichen Ochsenarsch, der mit seiner eigenen Schwester schläft.
Das ist nicht klug gewesen. Denn erstens weiß er gar nicht, ob Sepp, der wie alle Knechte von irgendwoher gekommen ist und irgendwohin weiterziehen wird, überhaupt eine Schwester hat, zweitens hat der Kerl nur auf so etwas gewartet. Bevor der Junge aufstehen kann, hat Sepp sich auf seinen Hinterkopf gesetzt.
Er kann nicht atmen. Steine schneiden ihm ins Gesicht. Er windet sich, aber das hilft nichts, denn Sepp ist doppelt so alt wie er und dreimal so schwer und fünfmal so stark. Also nimmt er sich zusammen, um nicht zu viel Luft zu verbrauchen. Seine Zunge schmeckt nach Blut. Er atmet Dreck ein, würgt, spuckt. In seinen Ohren summt es und pfeift, und der Boden scheint sich zu heben, zu senken und wieder zu heben.
Plötzlich ist das Gewicht weg. Er wird auf den Rücken gerollt, Erde im Mund, die Augen verklebt, im Kopf ein bohrender Schmerz. Der Knecht zerrt ihn zur Mühle: über Kies und Erde, durch Gras, über noch mehr Erde, über scharfe Steinchen, vorbei an den Bäumen, vorbei an der lachenden Magd, dem Heuschuppen, dem Ziegenstall. Dann reißt er ihn empor, öffnet die Tür und stößt ihn hinein.
«Na wird auch Zeit», sagt Agneta. «Der Herd putzt sich nicht selbst.»
Geht man von der Mühle in Richtung Dorf, so muss man durch ein Stück Wald. Dort, wo sich die Bäume lichten und man die Flur des Dorfes überquert – Wiesen und Weiden und Äcker, davon ein Drittel brachliegend, zwei Drittel bewirtschaftet und geschützt von Bretterzäunen –, sieht man schon die Spitze des Kirchturms. Irgendwer liegt hier immer im Dreck und zimmert an den Zäunen, sie gehen ständig kaputt, aber sie müssen standhalten, sonst entkommt das Vieh, oder die Tiere des Waldes zerstören das Korn. Die meisten Äcker gehören Peter Steger. Die meisten Tiere auch, man kann es leicht erkennen, sie haben sein Brandzeichen am Hals.
Zuerst kommt man am Haus der Hanna Krell vorbei. Sie sitzt, was soll sie sonst tun, auf ihrer Schwelle und flickt Kleidung, so verdient sie ihr Brot. Danach geht man durch die schmale Lücke zwischen dem Steger-Hof und dem Schmiedehaus des Ludwig Stelling, steigt auf den hölzernen Steg, der verhindert, dass man im weichen Kot einsinkt, lässt Jakob Kröhns Stall rechts liegen und befindet sich auf der Hauptstraße, die die einzige Straße ist: Hier wohnt Anselm Melker mit Frau und Kindern, neben ihm sein Schwager Ludwig Koller und daneben Maria Loserin, deren Mann voriges Jahr gestorben ist, weil jemand ihn verwünscht hat; die Tochter ist siebzehn und sehr schön, und sie wird Peter Stegers ältesten Sohn heiraten. Auf der anderen Seite wohnt Martin Holtz, der das Brot bäckt, gemeinsam mit seiner Frau und den Töchtern, und neben ihm sind die kleineren Häuser der Tamms, der Henrichs und der Familie Heinerling, aus deren Fenstern man oft Streiten hört; die Heinerlings sind keine guten Leute, sie haben keine Ehre. Alle außer dem Schmied und dem Bäcker haben draußen ein wenig Land, jeder hat ein paar Ziegen, aber nur Peter Steger, der reich ist, hat Kühe.
Dann ist man auf dem Dorfplatz mit der Kirche, der alten Dorflinde und dem Brunnen. Neben der Kirche steht das Pfarrhaus, neben dem Pfarrhaus das Haus, in dem der Amtmann wohnt, Paul Steger, der Vetter von Peter Steger, der zweimal im Jahr die Felder begeht und jeden dritten Monat die Steuern zum Grundherrn bringt.
Auf der hinteren Seite des Dorfplatzes ist ein Zaun. Öffnet man das Gatter und geht über das große Feld, das auch dem Steger gehört, ist man schon wieder im Wald, und wenn man sich nicht zu sehr vor der Kalten fürchtet und immerfort weiterwandert und im Unterholz den Weg nicht verliert, so ist man in sechs Stunden beim Hof von Martin Reutter. Wenn einen dort der Hund nicht beißt und man weitergeht, ist man in drei Stunden im nächsten Dorf, das auch nicht viel größer ist.
Dort aber ist der Junge nie gewesen. Er war noch nie anderswo. Und obwohl mehrere Leute, die schon anderswo waren, ihm gesagt haben, dass es dort genauso sei wie hier, kann er nicht aufhören, sich zu fragen, wo man wohl hinkäme, wenn man einfach immer weiterginge, nicht bloß zum nächsten Dorf, sondern weiter und weiter.
Am Kopfende des Tisches spricht der Müller über Sterne. Seine Frau und sein Sohn und die Knechte und die Magd tun, als würden sie zuhören. Es gibt Grütze. Grütze gab es auch gestern, und Grütze wird es morgen wieder geben, mal mit mehr und mal mit weniger Wasser gekocht; es gibt jeden Tag Grütze, nur an den schlechteren Tagen gibt es statt Grütze nichts. Im Fenster hält eine dicke Scheibe den Wind ab, unter dem Herd, der zu wenig Wärme abstrahlt, balgen sich zwei Katzen, und in der Ecke der Stube liegt eine Ziege, die eigentlich drüben im Stall sein müsste, aber keiner mag sie hinauswerfen, denn alle sind müde, und ihre Hörner sind spitz. Neben der Tür und um das Fenster sind Pentagramme eingeritzt, der bösen Geister wegen.
Der Müller beschreibt, wie vor genau zehntausendsiebenhundertunddrei Jahren, fünf Monaten und neun Tagen der Mahlstrom im Herzen der Welt Feuer gefangen hat. Und jetzt dreht das Ding, das die Welt ist, sich wie eine Spindel und gebärt Sterne in Ewigkeit, denn da die Zeit keinen Anfang hat, hat sie auch kein Ende.
«Kein Ende», wiederholt er und stockt. Er hat bemerkt, dass er etwas Unklares gesagt hat. «Kein Ende», sagt er leise, «kein Ende.»
Claus Ulenspiegel stammt von droben her, aus Mölln im lutherischen Norden. Schon nicht mehr ganz jung, ist er vor einem Jahrzehnt in die Gegend gekommen, und weil er nicht von hier war, hat er nur Müllersknecht sein können. Der Müllersstand ist nicht ehrlos wie der des Abdeckers, der die verwesten Tiere beseitigt, oder der des Nachtwächters oder gar des Henkers, aber auch nicht besser als jener der Taglöhner und weit schlechter als der Stand der Handwerker in ihren Zünften oder der der Bauern, die einem wie ihm nicht einmal die Hand gegeben hätten. Aber dann hat ihn die Tochter des Müllers geheiratet, und bald ist der Müller gestorben, und jetzt ist er selbst Müller. Nebenbei heilt er die Bauern, die ihm immer noch nicht die Hand reichen, denn was sich nicht gehört, gehört sich nicht; aber wenn sie Schmerzen haben, kommen sie zu ihm.
Kein Ende. Claus kann nicht weitersprechen, es beschäftigt ihn zu sehr. Wie soll Zeit aufhören! Andererseits … Er reibt sich den Kopf. Sie muss ja auch begonnen haben. Denn wenn sie nie begonnen hätte, wie wäre man bis zu diesem Moment gelangt? Er blickt um sich. Unendlich viel Zeit kann nicht vorbei sein. Also muss sie eben doch angefangen haben. Aber vorher? Ein Vorher vor der Zeit? Schwindlig wird einem. So wie in den Bergen, wenn man in eine Klamm schaut.
Einmal, erzählt er jetzt, habe er in so eine gesehen, in der Schweiz, da habe ein Senner ihn zum Almauftrieb mitgenommen. Die Kühe hätten große Glocken getragen, und der Name des Senners sei Ruedi gewesen. Claus stutzt, dann erinnert er sich, was er eigentlich hat sagen wollen. Da habe er also in die Klamm geschaut, und die sei so tief gewesen, dass man den Grund nicht habe sehen können. Da habe er den Senner, der übrigens Ruedi geheißen habe – ein seltsamer Name –, also da habe er den Ruedi gefragt: «Wie tief ist die denn?» Und der Ruedi habe ihm so schleppend, als hätte ihn die Müdigkeit ergriffen, geantwortet: «Die hat keinen Boden!»
Claus seufzt. Die Löffel schaben in der Stille. Erst habe er gedacht, erzählt er weiter, das sei nicht möglich und der Senner sei ein Lügner. Dann habe er sich gefragt, ob die Schlucht vielleicht der Eingang zur Hölle sei. Aber plötzlich sei ihm klargeworden, dass es darauf gar nicht ankomme: Auch wenn die Schlucht einen Grund habe, so müsse man doch bloß nach oben blicken, um eine Schlucht ohne Grund zu sehen. Mit schwerer Hand kratzt er sich am Kopf. Eine Schlucht, murmelt er, die einfach immer weitergehe, weiter und weiter, immer noch weiter, in die also alle Dinge der Welt passten, ohne auch nur den kleinsten Teil ihrer Tiefe zu füllen, eine Tiefe, an der alles zunichte werde … Er isst einen Löffel Grütze. Ganz übel werde einem da, so wie einem ja auch marod zumute sei, sobald man sich klarmache, dass die Zahlen nie endeten! Dass man zu jeder Zahl noch eine hinzutun könne, als gäbe es keinen Gott, um solchem Treiben Einhalt zu gebieten. Immer noch eine! Zählen ohne Ende, Tiefe ohne Boden, Zeit vor der Zeit. Claus schüttelt den Kopf. Und wenn –
Da schreit Sepp auf. Er presst die Hände an den Mund. Alle sehen ihn an, verdutzt, aber vor allem froh über die Unterbrechung.
Sepp spuckt ein paar braune Kiesel aus, die genauso aussehen wie die Teigklumpen in der Grütze. Es ist nicht leicht gewesen, sie unbemerkt in seine Schüssel zu schmuggeln. Für so etwas muss man auf den richtigen Moment warten, und wenn nötig, muss man selbst Ablenkung schaffen: Deshalb hat der Junge vorhin Rosa, die Magd, gegen das Schienbein getreten, und als sie aufgeschrien und ihm gesagt hat, dass er ein Rattenvieh, und er ihr gesagt hat, dass sie eine hässliche Kuh sei, und sie ihm wieder gesagt hat, dass er dreckiger sei als der Dreck, und seine Mutter ihnen beiden gesagt hat, dass sie sofort ruhig sein sollten, in Gottes Namen, oder es gebe heute kein Essen, hat er sich schnell vorgebeugt und genau in dem Moment, da alle auf Agneta geblickt haben, die Steine in Sepps Schüssel plumpsen lassen. Der richtige Augenblick ist schnell versäumt, aber wenn man aufmerksam ist, kann man ihn spüren. Dann könnte ein Einhorn durchs Zimmer laufen, ohne dass die anderen es bemerken würden.
Sepp tastet mit dem Finger im Mund, spuckt einen Zahn auf den Tisch, hebt den Kopf und sieht den Jungen an.
Das ist nicht gut. Der Junge war sich ziemlich sicher, dass Sepp es nicht durchschauen würde, aber der ist offenbar doch nicht so blöd.
Da springt der Junge auf und rennt zur Tür. Leider ist Sepp nicht nur groß, sondern auch schnell, und er bekommt ihn zu fassen. Der Junge will sich losreißen, es gelingt nicht, Sepp holt aus und schlägt ihm die Faust ins Gesicht. Der Schlag saugt alle anderen Geräusche auf.
Er blinzelt. Agneta ist aufgesprungen, die Magd lacht, sie mag es, wenn geprügelt wird. Claus sitzt mit gerunzelter Stirn da, gefangen in seinen Gedanken. Die zwei anderen Knechte reißen neugierig die Augen auf. Der Junge hört nichts, der Raum dreht sich, die Zimmerdecke ist unter ihm, Sepp hat ihn sich über die Schulter geworfen wie einen Mehlsack. Dann trägt er ihn hinaus, und der Junge sieht Gras über sich, drunten wölbt sich der Himmel, durchzogen von den Wolkenfasern des Abends. Jetzt hört er wieder etwas: Ein hoher Ton hängt zitternd in der Luft.
Sepp hält ihn an den Oberarmen und starrt ihm aus nächster Nähe ins Gesicht. Der Junge kann das Rot im Bart des Knechts sehen. Dort, wo der Zahn fehlt, blutet es. Er könnte dem Knecht mit aller Kraft die Faust ins Gesicht schlagen. Sepp würde ihn wohl fallen lassen, und wenn er schnell wieder auf die Füße käme, könnte er Abstand gewinnen und den Wald erreichen.
Aber wozu? Sie leben in derselben Mühle. Wenn Sepp ihn heute nicht erwischt, so erwischt er ihn morgen, und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Besser, man bringt es jetzt hinter sich, da alle zusehen. Vor den Augen der anderen wird Sepp ihn wahrscheinlich nicht umbringen.
Sie sind alle aus dem Haus gekommen: Rosa steht auf den Zehenspitzen, um besser sehen zu können, sie lacht noch immer, und auch die zwei Knechte neben ihr lachen. Agneta ruft etwas; der Junge sieht sie den Mund aufreißen und die Hände schwingen, aber hören kann er sie nicht. Neben ihr blickt Claus immer noch drein, als dächte er an etwas anderes.
Da hat der Knecht ihn hoch über den Kopf gehoben. Der Junge befürchtet, dass Sepp ihn auf den harten Boden schleudern wird; er hebt die Hände schützend vor die Stirn. Aber Sepp tritt einen und noch einen und einen dritten Schritt vor, und plötzlich beginnt das Herz des Jungen zu rasen. Das Blut pocht in seinen Ohren, er beginnt zu schreien. Er kann seine Stimme nicht hören, er schreit lauter, er hört sie noch immer nicht. Er hat begriffen, was Sepp vorhat. Begreifen es auch die anderen? Noch könnten sie einschreiten, aber – jetzt nicht mehr. Sepp hat es getan. Der Junge fällt.
Er fällt immer noch. Die Zeit scheint langsamer zu werden, er kann sich noch umsehen, er spürt den Sturz, das Gleiten durch die Luft, und er kann auch noch denken, dass ganz genau das geschieht, wovor er sein Leben lang gewarnt worden ist: Steig nicht vor dem Rad in den Bach, geh niemals vor dem, geh vor dem Mühlrad nicht, auf keinen Fall geh nie, nie, geh nie vor dem Mühlrad in den Bach! Und jetzt, da das gedacht ist, ist der Sturz noch immer nicht vorbei, und er fällt noch immer und fällt und fällt immer noch, aber gerade, als er einen weiteren Gedanken fasst, nämlich dass womöglich gar nichts passieren und der Sturz immer weiter andauern wird, schlägt er klatschend auf und sinkt, und wieder dauert es einen Augenblick, bevor die Eiseskälte zubeißt. Seine Brust schnürt sich zu, vor seinen Augen wird es schwarz.
Er spürt, wie ein Fisch seine Wange streift. Er spürt das Wasser strömen, spürt, wie es schneller und schneller fließt, spürt den Sog zwischen seinen Fingern. Er weiß, dass er sich festhalten müsste, aber woran nur, alles ist in Bewegung, nichts Festes irgendwo, und dann spürt er eine Bewegung über sich, und er muss daran denken, dass er sich das sein Lebtag vorgestellt hat, mit Grauen und Neugier, die Frage, was er tun müsste, wenn er tatsächlich einmal vor dem Mühlrad in den Bach fiele. Nun ist alles anders, und er kann gar nichts tun, und er weiß, dass er gleich tot sein wird, zerdrückt, zerpresst, zermahlen, aber er erinnert sich doch, dass er nicht auftauchen darf, droben ist kein Entkommen, droben ist das Rad. Er muss nach unten.
Aber wo ist das, unten?
Mit aller Kraft macht er Schwimmstöße. Sterben ist nichts, das begreift er. Es geht so schnell, es ist keine große Sache, mach einen falschen Schritt, einen Sprung, eine Bewegung, und du bist kein Lebender mehr. Ein Grashalm reißt, ein Käfer wird zertreten, eine Flamme geht aus, ein Mensch stirbt, es ist nichts! Seine Hände graben im Schlamm, er hat es auf den Grund geschafft.
Und da weiß er plötzlich, dass er heute nicht sterben wird. Fäden aus langem Gras streicheln ihn, Dreck kommt in seine Nase, er spürt einen kalten Griff am Nacken, hört ein Knirschen, spürt etwas am Rücken, dann an den Fersen; er ist unterm Mühlrad durch.
Er stößt sich vom Boden ab. Während er aufsteigt, sieht er kurz ein bleiches Gesicht, die Augen groß und leer, der Mund offen, es leuchtet schwach in der Wasserdunkelheit, wahrscheinlich der Geist von einem Kind, das irgendwann weniger Glück hatte als er. Er macht Schwimmstöße. Schon ist er an der Luft. Er atmet ein und spuckt Schlamm und hustet und krallt sich im Gras fest und kriecht keuchend ans Ufer.
Ein Fleck bewegt sich auf dünnen Beinchen vor seinem rechten Auge. Er blinzelt. Der Fleck kommt näher. Es kitzelt an seiner Braue, er drückt die Hand ans Gesicht, der Fleck verschwindet. Droben schwebt, rund schillernd, eine Wolke. Jemand beugt sich über ihn. Es ist Claus. Er kniet sich hin, streckt die Hand aus und berührt seine Brust, murmelt etwas, das er nicht versteht, weil der hohe Ton immer noch in der Luft hängt und alles andere übertönt; aber da, während sein Vater spricht, wird der Ton leiser und leiser. Claus steht auf, der Ton ist verstummt.
Jetzt ist auch Agneta da. Und neben ihr Rosa. Jedes Mal, wenn wieder jemand auftaucht, braucht der Junge einen Augenblick, um das Gesicht zu erkennen, etwas in seinem Kopf ist langsam geworden und arbeitet noch nicht wieder. Sein Vater macht kreisende Handbewegungen. Er fühlt seine Kräfte zurückkehren. Er will sprechen, aber aus seinem Hals kommt nur Krächzen.
Agneta streicht ihm über die Wange. «Zweimal», sagt sie, «bist du jetzt getauft.»
Er versteht nicht, was sie meint. Wahrscheinlich liegt das am Schmerz in seinem Kopf, einem Schmerz so stark, dass er nicht nur ihn, sondern die Welt selbst ausfüllt – alle sichtbaren Dinge, die Erde, die Menschen um ihn, auch die Wolke dort droben, die immer noch weiß ist wie frischer Schnee.
«Na komm ins Haus», sagt Claus. Seine Stimme klingt tadelnd, als hätte er ihn bei etwas Verbotenem ertappt.
Der Junge setzt sich auf, beugt sich vornüber und übergibt sich. Agneta kniet neben ihm und hält seinen Kopf.
Dann sieht er, wie sein Vater weit ausholt und Sepp eine Ohrfeige gibt. Sepps Oberkörper kippt vornüber; er hält sich die Wange und richtet sich wieder auf, da trifft ihn der nächste Schlag. Und dann ein dritter, wieder weit ausgeholt, die Wucht schleudert ihn fast zu Boden. Claus reibt sich die schmerzenden Hände, Sepp torkelt. Dem Jungen ist klar, dass er das nur vorspielt: Es hat ihm nicht sehr weh getan, er ist wesentlich stärker als der Müller. Aber auch er weiß, dass man dafür bestraft werden muss, wenn man das Kind seines Brotgebers fast tötet, so wie wiederum der Müller und alle anderen wissen, dass man ihn nicht einfach fortjagen kann, Claus braucht drei Knechte, mit weniger geht es nicht, und wenn einer davon ausfällt, kann es Wochen dauern, bis ein neuer Müllersknecht auf Wanderschaft auftaucht – die Bauernknechte wollen nicht in der Mühle arbeiten, sie liegt zu weit vom Dorf, und der Beruf ist ehrlos, nur die Verzweifelten sind dazu bereit.
«Komm ins Haus», sagt nun auch Agneta.
Es ist fast dunkel. Alle haben es eilig, denn keiner will mehr draußen sein. Jeder weiß, was sich nachts in den Wäldern herumtreibt.
«Zweimal getauft», sagt Agneta wieder.
Als er sie fragen will, was sie meint, merkt er, dass sie nicht mehr bei ihm ist. Hinter ihm murmelt der Bach, durch den dicken Vorhang des Mühlenfensters dringt etwas Licht nach draußen. Claus muss schon die Talgkerze angezündet haben. Offenbar hat sich keiner die Mühe machen wollen, ihn hineinzuschleppen.
Frierend steht der Junge auf. Überlebt. Er hat überlebt. Das Mühlrad hat er überlebt. Er hat das Mühlrad überlebt. Das Mühlrad. Hat er überlebt. Er fühlt sich unsagbar leicht. Er macht einen Sprung, aber als er aufkommt, gibt sein Bein nach, und er fällt ächzend auf die Knie.
Vom Wald her kommt ein Flüstern. Er hält die Luft an und horcht, nun ist es ein Knurren, nun ein Zischen, dann hört es für einen Moment auf, dann beginnt es von neuem. Ihm ist, als bräuchte er nur besser hinzuhören, und er könnte Worte verstehen. Aber das will er auf keinen Fall. Hastig humpelt er zur Mühle.
Wochen vergehen, bis sein Bein ihm erlaubt, zurück aufs Seil zu gehen. Schon am ersten Tag taucht eine der Bäckerstöchter auf und setzt sich ins Gras. Er kennt sie vom Sehen, ihr Vater kommt oft zur Mühle, denn seit Hanna Krell ihn nach einem Streit verflucht hat, plagt ihn das Rheuma. Die Schmerzen lassen ihn nicht schlafen, deshalb braucht er den Abwehrzauber von Claus.