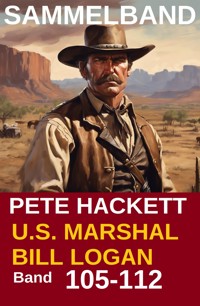
U.S. Marshal Bill Logan, Band 105 bis 112: Acht Romane (U.S. Marshal Western Sammelband) E-Book
Pete Hackett
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
U.S. Marshal Bill Logan – die neue Western-Romanserie von Bestseller-Autor Pete Hackett! Abgeschlossene Romane aus einer erbarmungslosen Zeit über einen einsamen Kämpfer für das Recht. Über den Autor Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war - eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen. Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung." Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress. INHALT Band 105 Marshal Logan und der gefährlicher Auftrag Band 106 Marshal Logan und der Trail des Verderbens Band 107 Schatzsucher des Todes Band 108 Und ich gab den Stern zurück Band 109 Marshal Logan und der blutige Trail Band 110 Bruderhass Band 111 Marshal Logan und die tödliche Quittung Band 112 Marshal Logan im Fadenkreuz des Todes Cover: Steve Mayer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1076
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
U.S. Marshal Bill Logan
Sammelband 14 (Band 105-112)
von Pete Hackett
Pete Hackett Western– Deutschlands größte E-Book-Western-Reihe mit Pete Hackett's Stand-Alone-Western sowie den Pete Hackett Serien "Der Kopfgeldjäger", "Weg des Unheils", "Chiricahua" und "U.S. Marshal Bill Logan".
U.S. Marshal Bill Logan
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© der Digitalausgabe 2014 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
1. digitale Auflage 2014 Zeilenwert GmbH
ISBN 9783956171161
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Über den Autor
Band 105 Marshal Logan und der gefährliche Auftrag
Band 106 Marshal Logan und der Trail des Verderbens
Band 107 Schatzsucher des Todes
Band 108 Und ich gab den Stern zurück
Band 109 Marshal Logan und der blutige Trail
Band 110 Bruderhass
Band 111 Marshal Logan und die tödliche Quittung
Band 112 Marshal Logan im Fadenkreuz des Todes
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war– eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
Band 105 Marshal Logan und der gefährliche Auftrag
Es klopfte an die Tür des Büros von Richter Humphrey. Der Richter blickte von seiner Arbeit auf und rief: »Herein!«
Die Tür ging auf, ein Mann von etwa fünfzig Jahren trat in das Büro. Er hatte den Hut abgenommen. Seine Haare waren grau. Ein Grinsen zog seine Lippen in die Breite. »Hallo, Jerome.«
Ein erfreuter Zug glitt über das Gesicht des Richters. »Hallo, Joshua. Gott, hab ich dich lange nicht gesehen.« Der Richter erhob sich, kam um seinen Schreibtisch herum und streckte dem Besucher die Hand hin.
Dieser schüttelte sie. »Ja, es sind wohl sieben oder acht Jahre, Jerome. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Wie geht es dir?«
»Mir geht es gut. Und dir?«
»Ich habe eine Herde Longhorns nach Amarillo gebracht und werde einige Tage in der Stadt bleiben.«
Joshua Brewster ahnte nicht, dass er für immer in Amarillo bleiben sollte. Seine letzten Stunden waren angebrochen…
Die Hände der beiden Männer lösten sich. »Setz dich«, forderte der Richter seinen Besucher auf und wies auf einen der Stühle, die um einen kleinen, runden Tisch gruppiert waren. Auch der Richter setzte sich an den Tisch. »Erzähle, Joshua. Wie ist es dir in all den Jahren ergangen?«
»Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich züchte nach wie vor Rinder am Dry Devils River. Meine beiden Kinder sind in der Zwischenzeit erwachsene Leute geworden. Erzähl mir von dir, Jerome. Du hast ja eine steile Karriere gemacht, nachdem du damals aus dem Val Verde County weggegangen bist. Ich habe schon gehört, dass du oberster Gerichtsherr hier im Panhandle bist.«
»Oftmals ein harter Job, das darfst du mir glauben.«
»Wie geht es deiner Frau?«
Der Richter erzählte, dann berichtete Joshua Brewster über sein Leben im Süden, und so verging mehr als eine Stunde, bis sich Brewster wieder verabschiedete. Er versprach, noch einmal beim Richter vorbeizuschauen, ehe er Amarillo verließ…
*
Es war Abend. Im Cristal Palace in Amarillo summte es wie in einem Bienenkorb. Die drei Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun. An einigen Tischen wurde Karten gespielt; Black Jack und Poker. Stimmen schwirrten durcheinander, vermischte sich mit dem Gelächter der Männer, die Stimmung war ausgelassen und nichts deutete darauf hin, dass der Tod den Saloon bereits betreten hatte.
Er begleitete Joshua Brewster, der jetzt in den Schankraum gekommen war. Die Flügel der Pendeltür schlugen hinter ihm aus. Er schaute sich um. Dann ging er zu einem Tisch, an dem drei Männer saßen, die gekleidet waren wie Cowboys. »Hallo, Leute. Ihr habt die Stadt also noch nicht verlassen.«
Es waren Reiter der Treibermannschaft, die Brewster eingestellt hatte, um die Herde nach Amarillo zu bringen. Junge Burschen, denen die Verwegenheit in die Gesichter geschrieben stand.
»Wir bleiben noch einen oder zwei Tage hier«, sagte Dennis Carter, ein blonder Bursche mit blauen Augen.
»Wohin werdet ihr dann reiten?«, wollte Brewster wissen.
»Hinauf nach Kansas. Dort gibt es sicher einen Job für uns.«
»Solltet ihr im nächsten Herbst wieder in den Süden kommen, habe ich sicher wieder eine Arbeit für euch.«
»Wir werden es sehen.«
An einem der Tische, an dem gepokert wurde, warf ein Mann seine Karten hin und erhob sich mit einem Ruck. Sein Stuhl rutschte polternd zurück, der Mann knirschte: »Ich habe heute kein Glück. Verdammt! Darum steige ich aus, ehe ich meine letzten Dollars verliere. Das Glück ist wohl tatsächlich ein Rindvieh und sucht seinesgleichen.« Er schob sich den Stetson aus der Stirn und ging zum Tresen. »Gib mir einen doppelten Whisky, Jeff!«
»Will jemand für ihn einsteigen?«, fragte der Spielertyp, der die Bank hielt.
»Ein Spielchen kann nicht schaden«, murmelte Joshua Brewster und erhob sich. »Ich steige ein«, sagte er laut genug, so dass ihn der Mann am anderen Tisch hören konnte. Er ging zu dem Spieltisch hin, ließ sich nieder und zog seine Brieftasche aus der Innentasche seiner Weste.
»Wir spielen ohne Limit«, sagte der Spieler, ein Mann von etwa fünfunddreißig Jahren, der einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd trug, das am Hals von einer weinroten Schnürsenkelkrawatte zusammengehalten wurde. Er hatte ein scharfliniges Gesicht, das von einem pulvergrauen Augenpaar beherrscht wurde. »Einsatz sind fünf Dollar, jede Karte kostet einen Dollar. Wer nicht mehr setzen kann, muss aussteigen.«
»Dann geben Sie mal die Karten aus«, forderte Brewster und grinste. Vor ihm lagen zweihundert Dollar.
Er bekam zwei Buben und kaufte drei Karten. Es blieb bei den beiden Buben. Der Spieler links vom Bankhalter setzte fünf Dollar. Der nächste Spieler hielt mit, und auch Brewster schob fünf Dollar in den Pot. Der Bankhalter erhöhte um zehn Dollar. Der nächste Spieler stieg aus, der andere wollte sehen, auch Brewster passte. Das Spiel ging an die Bank. Neue Karten wurden ausgegeben, die Einsätze wurden in die Tischmitte geschoben. Brewster kaufte wieder drei Karten und hielt schließlich drei Neunen in der Hand. Er steigerte mit, bis nur noch der Spieler links vom Bankhalter mit von der Partie war. Der Mann sagte: »Ihre zwanzig, Mister, und noch mal zwanzig drauf. Wenn Sie sehen wollen, müssen Sie zwanzig Bucks bringen.«
Brewster schob den geforderten Betrag in die Tischmitte. Dann zeigten sie ihre Karten. Der andere Spieler hatte zwei Paare; Assen und Zehner. Der Pot ging an den Rancher aus dem Val Verde County.
Sie spielten mit wechselndem Glück. Es ging auf Mitternacht zu, als Brewster ein Full House bekam. Der Bankhalter kaufte zwei Karten und der Rancher vermutete, dass er über einen Dreier verfügte. Sie begannen zu setzen. Der Spieler, der die Bank hielt, trieb den Einsatz immer weiter in die Höhe. Die beiden anderen Männer stiegen aus. Brewster ging mit. Dann war das Geld, das er vor sich auf dem Tisch liegen hatte, alle. Er holte weiteres aus seiner Brieftasche und schließlich lagen mehr als tausend Dollar im Pot.
Der Bankhalter sagte: »Ihre fünfzig und weitere hundert.«
Brewster schob zweihundert Dollar in die Tischmitte. »Ich erhöhe um hundert.«
»Okay. Und noch einmal hundert drauf.« Auch der Spieler legte zweihundert Dollar auf den Haufen Geld in der Tischmitte.
Langsam wurde Brewster unsicher. Er spürte Erregung. Sein Herzschlag hatte sich beschleunigt. Es war viel Geld, das sich im Pot befand, und wenn er verlor, war das ein herber Verlust. Er entschloss sich, das Spiel zu beenden und warf einen Hunderter in die Tischmitte. »Ich will sehen.«
Der Spieler legte seine Karten mit den Bildern nach oben auf den Tisch. »Vier Damen.«
Einen Moment lang wurde es Brewster schwindlig. Er stieß scharf die Luft durch die Nase aus. Dann grollte er: »Wie können Sie vier Damen haben, Mister. Eine Dame habe ich abgelegt. Es gibt keine fünf Damen in einem Spiel.«
Der Spieler kniff die Augen zusammen. Sein starrer Blick verkrallte sich an Joshua Brewster. »Was wollen Sie damit sagen?«
»Dass Sie falsch gespielt haben.«
Wie von Schnüren gezogen erhob sich der Spieler. »Das lasse ich mir nicht bieten.«
»Eine andere Antwort gibt es nicht. Bei fünf Damen ist eine zu viel im Spiel. Aber ich will mich nicht mit Ihnen streiten, Mister. Ich nehme mein Geld wieder heraus und…«
»Der Pot gehört mir!«
Die Worte fielen wie Hammerschläge. Füße scharrten, Stühle wurden gerückt. In der Runde war man auf den Streit aufmerksam geworden. Die Gespräche verstummten. Die Atmosphäre im Saloon war plötzlich angespannt und gefährlich. Die Luft schien zu knistern wie vor einem schweren Gewitter.
»Sie sollten Vernunft annehmen«, murmelte Brewster. Er hielt dem stechenden Blick des Spielers stand. »Hier…« Er drehte die Karten um, die er abgelegt hatte. Tatsächlich befand sich eine Dame darunter.
Der Spieler sagte: »Ich weiß nicht, wer die fünfte Dame ins Spiel gebracht hat. Ich jedenfalls nicht. Und darum gehört der Pot mir.«
»Nein.« Brewster schüttelte den Kopf. »Notfalls holen wir den Sheriff und…« Er griff unter seine Jacke.
Der Spieler zog blitzschnell seinen Revolver und feuerte. Brewster bekam die Kugel in die Brust und kippte samt Stuhl nach hinten um. Seine Hand rutschte unter der Jacke hervor. Sie hielt die Brieftasche. »Ich– ich wollte doch nur…« Seine Stimme erstarb. Ein Gurgeln kämpfte sich in seiner Brust hoch und platzte über seine Lippen.
Vor dem Gesicht des Spielers schwebte eine Pulverdampfwolke. Ein Rauchfaden kräuselte aus der Mündung des Bullcolts, den er unter der Jacke hervorgezaubert hatte. Seine Augen flackerten.
»Verdammt!«, rief jemand. »Der Mann war unbewaffnet.«
Jemand kniete bei dem Verletzten ab. Brewster murmelte mit verlöschender Stimme. »Holt Richter Humphrey her. Schnell. Es– es ist sehr wichtig. Bitte, holt den Richter…«
Der Spieler schwenkte den Revolver in die Runde. Er vermittelte einen gehetzten Ausdruck. »Er griff unter die Jacke, und ich dachte, er greift nach einem Revolver«, hechelte er. »Versucht nur nicht, mich aufzuhalten. Es– es war ein Unfall. Er hätte nicht unter seine Jacke greifen sollen…«
Er schob sich zum Ausgang. Niemand hinderte ihn. Er war voll Panik, und das machte ihn unberechenbar und gefährlich. Dann war er draußen. Da standen einige Pferde. Er band eines der Tiere los und schwang sich in den Sattel. Hart trieb er das Tier an…
*
Es war früher Morgen, als jemand an die Tür meiner Unterkunft klopfte. Ich lag noch im Bett. Das Zimmer teilte ich mir mit einigen anderen Marshals. Sie waren– abgesehen von meinem Partner Joe Hawk– irgendwo im Panhandle unterwegs. Im nächsten Bett lag Joe. Ich richtete meinen Oberkörper auf und rief: »Wer ist draußen?«
Es war Simon Calispel, der Sekretär des Richters. Er sagte: »Raus aus den Betten, ihr faule Bande. Der Richter will euch sehen. Also schwingt die müden Hufe!«
Joe schoss von seinem Bett in die Höhe. »Ich mache der kleinen Kanaille einen Knoten in den Hals…«
Simon verschwand wie der Blitz.
Es war immer dasselbe mit den beiden.
Ich erhob mich, ging zu der Waschschüssel auf einem eisernen Dreibein und warf mir einige Hände voll Wasser ins Gesicht. Vor dem Fenster hing noch die Morgendämmerung. Es wunderte mich, dass der Richter um diese Zeit schon im Dienst war. Ich griff nach dem Handtuch, das an der Wand hing…
Zwanzig Minuten später betraten wir das Büro des Richters. Humphrey sah müde aus. Unter seinen Augen lagen dunkle Ringe. Sein Gesicht war ausgesprochen ernst. »Guten Morgen, Marshals«, begrüßte er uns. »Bitte, nehmen Sie Platz.«
Wir setzten uns an den kleinen, runden Tisch.
»Ich habe einen besonderen Auftrag für Sie«, sagte der Richter. »Heute Nacht wurde im CristalPalace ein alter Freund von mir erschossen. Sein Name ist Joshua Brewster. Er betreibt eine Ranch unten im Val Verde County. Um die Ranch ist es nicht besonders gut bestellt. Darum hat Josh eine Herde nach Amarillo getrieben. Der Erlös der Herde– 20.000 Dollar– ist dafür bestimmt, eine Hypothek bei der Bank in Comstock abzulösen.«
Der Richter machte eine Pause.
Joe und ich schwiegen.
Der Richter fuhr fort: »Der Mann, der Josh erschoss, heißt James Lancer. Er erschoss Josh, als dieser in die Tasche griff, um seine Brieftasche herauszuholen. Der Bursche ist geflohen, als er merkte, dass er einen waffenlosen Mann niedergeschossen hat.«
»Wir sollen ihn schnappen und zurückbringen, wie?«, fragte Joe.
»Das wird Ihr Job sein, Joe«, versetzte der Richter, dann heftete er seinen Blick auf mich. »Mit seinem letzten Atemzug hat mich Josh gebeten, sicherzustellen, dass die 20.000 Dollar auf jeden Fall die Dry Devils Ranch erreichen. Ohne das Geld kommt sie unter den Hammer. Darum bitte ich Sie, Logan, das Geld auf die Ranch zu bringen.«
»Kann nicht jemand anderes…?«
»Es ist mir sehr wichtig, Logan.«
Ich konnte mich der Bitte des Richters nicht verschließen.
*
Das Geld war bei der Bank hinterlegt. Ich sattelte mein Pferd, verabschiedete mich von Joe, dessen Job es war, James Lancer zu stellen und nach Amarillo zurückzubringen, dann schwang ich mich in den Sattel und ritt zur Bank.
Richter Humphrey hatte bereits mit dem Bankier gesprochen. Er händigte mir ohne große Formalitäten die Satteltaschen mit dem Geld aus. Als ich die Bank verließ, sah ich einige junge Kerle in der Nähe herumlungern. Sie waren gekleidet wie Cowboys und schauten zu mir her. Ich schnallte die Taschen hinter meinem Sattel fest und saß auf. Mit einem Schenkeldruck trieb ich mein Pferd an. Es war ein Rotbrauner, der sich leicht führen ließ. Er setzte sich in Bewegung. Ich wandte mich in eine Gasse, die nach Süden aus der Stadt führte.
Wenig später lag Amarillo hinter mir. Hin und wieder schaute ich mich um. Hügel begrenzten jedoch mein Blickfeld. Mir kamen die Kerle in den Sinn, die mich beim Verlassen der Bank beobachtet hatten, und ein beklemmendes Gefühl machte sich in mir breit. Ich folgte den Windungen zwischen den Hügeln. Das Gras war staubig. Der Wind brachte den feinen Staub, der alles puderte, von Süden, vom Llano Estacado herauf. Es war ein klarer, kalter Tag im Dezember. Bäume und Sträucher waren entlaubt. Schnee war noch nicht gefallen. Die Sonne schien und der Himmel, der sich über mir spannte, war blau. Hier und dort zogen weiße Wolken.
Dumpf pochten die Hufe meines Pferdes. Weiße Dampfwolken standen vor den Nüstern des Tieres. Ich schaute zurück und konnte die Spur, die mein Pferd hinterließ, deutlich erkennen. Sie zog sich wie ein dunkler Strich durchs kniehohe Gras. Als ich einmal auf einen Hügel ritt, um auf meiner Fährte zurückzublicken, sah ich die fünf Reiter. Mir war klar, dass sie mich verfolgten. Schlagartig wurde mir bewusst, dass es ein Himmelfahrtskommando war, mit dem mich der Richter betraut hatte.
Ich ritt weiter, wandte mich aber nach Westen, um auf felsiges Terrain zu geraten, wo ich hoffte, meine Spur zu verwischen. Meile um Meile zog ich dahin. Die Vegetation wurde karger, und schließlich ritt ich zwischen die ersten Felsen. Der Boden war steinig, manchmal klirrte es, wenn ein Hufeisen gegen Gestein schlug. Die Vegetation bestand aus Mesquitesträuchern und dornigen Comas.
Die Wüste schien nur aus totem Gestein, Wind und Staub zu bestehen. Wispernd strich der Wind an den kahlen Felsen entlang, raschelte in den Zweigen der halbverdorrten Sträucher und wühlte im feinkörnigen Sand, der das ganze Land wie grauer Puder überzog. Gerölltrümmer lagen überall umher und zwangen mich, manchmal große Bogen zu reiten. Vor mir erhob sich eine Hügelkette mit steilen Geröllfeldern, und ich befürchtete schon, dass ich mitten hindurchreiten musste, als ich den schmalen Pfad entdeckte, der sich in Windungen über einen der Hügel hinwegzog.
Ich folgte diesem Pfad, durchritt ein staubiges Tal, folgte einem aufsteigenden Canyon zu einem Bergsattel, dann ging es wieder einen sich abwärts senkenden Canyon hinunter. Der Canyon war tief und ich hatte das Gefühl, ins Innere der Erde hinabzusteigen.
Und als ich aus dem Canyon hinausritt, kam mir aus einer Schlucht ein Reiter entgegen. Er saß vornübergeneigt im Sattel, sein Pferd ging im Schritt. Das Gesicht des Mannes lag im Schatten der Hutkrempe.
Ich hielt an. Mein Pferd trat auf der Stelle. Ich nahm es in die Kandare. In mir loderte die Flamme des Misstrauens. Die Kerle, die mich vor der Bank in Amarillo beobachtet hatten, kamen mir wieder in den Sinn. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, dass es sich um die Treibermannschaft handelte, die mit Joshua Brewster die Herde nach Amarillo gebracht und die Brewster nach erfolgreichem Trieb entlassen hatte.
Dann war der Bursche heran. Er hatte die rechte Hand unter die linke Achsel geklemmt. Er hob das Gesicht. Der Bursche war höchstens Mitte zwanzig und stoppelbärtig. Und unvermittelt zog er seine Hand unter der Achsel hervor. Sie hielt einen Revolver. Ich gab meinem Pferd die Sporen. Aus dem Stand sprang das Tier an, und ehe sich der Bursche versah, rammte mein Pferd das seine. Zugleich zog ich den Remington.
Der Kerl wurde aus dem Sattel katapultiert und krachte auf den Boden. Ich jagt davon, auf die Schlucht zu, aus der der Bursche gekommen war. Ein Schuss krachte, aber die Kugel verfehlte mich. Dann stob ich zwischen die Felsen. Als ich mich einmal umschaute, sah ich, dass zwei Reiter hinter mir hersprengten. Sie mussten irgendwo zwischen den Felsen gesteckt haben. Die Hufe trappelten und die Echos vervielfältigten die hämmernden Geräusche. Die Schlucht war voll vom Krachen der Hufe. Und dann sah ich zwei Reiter, die mir den Weg versperrten. Ich zerrte mein Pferd in den Stand und sprang ab. Mit zwei Griffen löste ich die Taschen mit dem Geld vom Sattel, dann schnappte ich mir die Winchester und rannte in einen Felsriss, der sich rechterhand öffnete. Eisige Luft strömte mir entgegen. Der Boden stieg an. Er war geröllübersät. Der Riss erweiterte sich. Das Poltern der Hufe holte mich ein. Der Anstieg wurde immer steiler. Unter meinen Schritten löste sich Geröll und kollerte in die Tiefe.
Bald pumpten meine Lungen. Ich spürte, wie mir trotz der Kälte der Schweiß ausbrach. Dann endete der Anstieg und ich befand mich auf einem Plateau, aus dem zerklüftete Felsen ragten. Der Wind trieb Staubwirbel vor sich her. Ich verschnaufte kurz und lauschte hinter mich. Das Poltern von Geröll verriet mir, dass meine Verfolger auf dem natürlichen Pfad zwischen den Felsen nach oben kamen.
Ich lief ein Stück über das Plateau und versteckte mich zwischen den Felsen. Herzschlag und Atmung nahmen bei mir wieder den regulären Rhythmus auf. Ich hatte die Satteltaschen zu meinen Füßen abgestellt und hielt mit beiden Händen die Winchester. Eine Patrone befand sich in der Kammer.
Und dann kamen drei der Kerle. Sie liefen sofort auseinander und gingen in Deckung. Ich hörte ihre Stimmen. Sie verständigten sich gegenseitig. Und dann sah ich einen von ihnen hinter einem Felsen hervortreten. Er bewegte sich geduckt, in seinen Händen lag das Gewehr. Er hielt es schräg vor seiner Brust. Langsam näherte er sich mir. Ich schoss. Die Kugel pflügte vor seinen Füßen den Boden und ließ den Staub spritzen. Der Bursche stieß sich ab und rannte wie von Furien gehetzt in Deckung. Und dann krachten die Gewehre der drei. Es war ein hämmerndes Stakkato. Querschläger quarrten ohrenbetäubend. Schlagartig brach der Krach ab. Pulverdampf zerflatterte über den Deckungen. Wie ein Leichentuch senkte sich die Stille zwischen die Felsen.
»Gib auf, Marshal!«, schrie einer rau. »Wir kriegen dich.«
Ich gab keine Antwort sondern zog mich zurück, darauf bedacht, immer die Felsen zwischen mir und meinen Gegnern zu haben. Dann musste ich ein Stück freies Terrain überqueren, ehe mir wieder Felsen Deckung boten. Ich spurtete los. Ein Schuss peitschte. Ich schlug einen Haken. Dann erreichte ich die Felsen und sprang in einen Felsspalt, der mir Schutz bot.
Die Kerle griffen an. In der Zwischenzeit hatten sich auch die beiden anderen hinzugesellt. Es wurde für mich brenzlig. Einer der Kerle verließ seine Deckung und rannte zu nächsten. Ehe er sie erreichte, schoss ich ihm eine Kugel ins Bein. Er stürzte und kroch zwischen die Felsen, dann erklang seine schmerzgepresste Stimme: »Er hat mich erwischt! O verdammt, er hat mir eine Kugel in den Oberschenkel geknallt.«
Ich setzte mich in Bewegung. Die Satteltaschen hatte ich mir über die Schulter gehängt. Im Gewirr der Felsen gelang es mir, mich abzusetzen. Ich beobachtete die Kerle, wie sie das Plateau verließen. Es war ihnen wohl zu gefährlich geworden, mich offen anzugreifen. Einer stürzte sich schwer auf seinen Komplizen. Es war der Kerl, dem ich eine Kugel ins Bein geschossen hatte.
Ich hatte kein Pferd. Zu Fuß machte ich mich auf den Weg nach Süden. Mir war klar, dass die Kerle nicht aufgeben würden.
*
»Es ist ein glatter Durchschuss«, sagte Dennis Carter.
Herb Callagher saß am Boden. Er hatte die Hose hinuntergelassen. Blut sickerte aus den beiden Wunden, die die Kugel in seinen Oberschenkel gerissen hatte.
Jim Morgan kam mit einer Binde, die er aus der Satteltasche genommen hatte, und machte sich daran, die Wunden zu verbinden. »Daran stirbst du nicht.«
Jesse Jackson räusperte sich und sagte: »Er kommt nicht weit ohne Pferd. Irgendwo weiter südlich werden wir ihn abfangen. Und dann werden wir keine Rücksicht mehr auf sein Leben nehmen.«
»Der Hurensohn ist gefährlicher als ein Nest voller Klapperschlangen«, bemerkte John Prewitt. »Wir dürfen ihn auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.«
Dennis Carter ergriff das Wort: »Wir versuchen, seine Spur aufzunehmen. Jesse hat recht. Ohne Pferd kommt er nicht weit. Wenn wir ihn eingeholt haben, kreisen wir ihn ein. Und dann…«
»Das gefällt mir nicht«, murmelte Herb Callagher, dem der Schmerz die Tränen in die Augen trieb. »Mord an einem U.S. Marshal ist sicher kein Kavaliersdelikt. Sind es 20.000 Dollar wert, dafür gejagt zu werden wie ein tollwütiger Hund und am Ende vielleicht gehängt zu werden?«
»Wir verschwinden aus Texas, sobald wir das Geld haben«, erklärte Dennis Carter. »Außerdem wird nie jemand erfahren, was aus dem Marshal wurde. In diesem Land kann ein Mann verschwinden wie ein Sandkorn in der Wüste. Mach dir keine Sorgen, Herb.«
Dann hatte Jim Morgan die Wunde verbunden. Herb Callagher erhob sich stöhnend und zog seine Hose in die Höhe. Das Hosenbein war am Oberschenkel blutgetränkt. Er schloss die Hose. »Dafür werde ich diesem Hurensohn die Haut streifenweise abziehen.«
Dennis Carter zog seinen Tabakbeutel aus der Jackentasche und drehte sich eine Zigarette. Als sie brannte, sagte er: »Jesse, John, versucht, seine Spur aufzunehmen. Und wenn ihr sie gefunden habt, gebt uns Rauchzeichen. Wir warten hier.«
Jesse Jackson und John Prewitt stiegen auf ihre Pferde und ritten davon. Die Nasen ihrer Pferde wiesen nach Westen.
Nach zwei Stunden kamen sie zurück. Jackson legte beide Hände auf das Sattelhorn und beugte den Oberkörper ein wenig nach vorn. »Nichts. Der Hundesohn scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Aber die nächste Stadt weiter südlich ist Canyon. Dort versucht er vielleicht, sich ein Pferd zu beschaffen. Wir sollten dem Ort einen Besuch abstatten.«
»Reiten wir«, sagte Dennis Carter, der so etwas wie die Rolle des Anführers des Rudels einnahm.
*
Meine Füße brannten. Ich hatte mich wieder nach Osten gewandt und folgte dem Palo Duro Creek in den gleichnamigen Canyon. Die Felsen zu beiden Seiten erhoben sich steil und muteten mich himmelhoch an. Es ging auf den Abend zu. In der Schlucht war es schon düster. Langsam wurde für mich jeder Schritt zur Tortur. Aber ich hatte ein Ziel. Und das war der Ort Canyon. Dort wollte ich mir ein Pferd beschaffen und die Nacht verbringen.
Mechanisch setzte ich einen Fuß vor den anderen. Der Creek rauschte und gurgelte. Hier und dort wuchs am Ufer ein Strauch. Es gab keinen Weg. Felsen ragten aus dem Boden. Ich schaute nach oben. Der Wind trieb Staubfahnen über die Ränder der Felsen. Im Canyon war es windstill.
Schnell kam die Finsternis. Am Himmel flimmerten Myriaden von Sternen. Der Mond war noch hinter den Felsen im Osten verborgen. Meine Füße wurden schwer wie Blei. Leise klirrten meine Sporen. In der Schlucht war es finster. Mit dem Einbruch der Nacht hatte die Kälte zugenommen.
Irgendwann sah ich weit vor mir einige Lichter. Erleichtert atmete ich auf. Ich hatte Canyon erreicht. Der Anblick der Lichter beflügelte mich. Ich mobilisierte noch einmal sämtliche Reserven, die in mir steckten. Die Lichter rückten näher. Und dann taumelte ich zwischen die ersten Häuser der Stadt. Aus den Schornsteinen stieg Rauch. Es roch nach verbranntem Holz. Viele der Häuser lagen schon in Dunkelheit.
Ich ging zum Mietstall. Das Tor war geschlossen. Ich hob den Riegel aus der Verankerung und öffnete einen der Torflügel. Er knarrte in den Angeln. Warme Luft schlug mir entgegen, durchsetzt von der Ausdünstung der Pferde und dem Geruch von Heu und Stroh. Ich riss ein Schwefelholz an, vager Lichtschein umgab mich, der allerdings schon nach einem halten Schritt endete. Neben dem Tor hing an der Wand eine Lampe an einem Nagel. Ich nahm sie herunter und zündete sie an. Es schepperte, als ich den Glaszylinder wieder über die Flamme stülpte. Das Licht kroch auseinander.
Eine Leiter führte hinauf zum Heuboden. Ich stieg sie empor und löschte oben die Laterne. Dann legte ich mich ins Stroh.
Lautes Knarren weckte mich. Es war düster. Durch die Ritzen zwischen den Brettern der Stallwand sickerte Tageslicht. In den schrägen Bahnen tanzten winzige Staubpartikel. Ich erhob mich und klopfte Heureste von meiner Kleidung. Dann stieg ich nach unten. Überrascht musterte mich der Stallmann. Er kannte mich. »Guten Morgen, Marshal«, grüßte er.
»Ich war so frei und habe hier im Stall übernachtet«, sagte ich. »Sie haben doch sicher nichts dagegen.«
»Warum sollte ich? Wann sind Sie denn angekommen?«
»Irgendwann gegen Mitternacht. Ich bin auf dem Weg nach Süden und habe mein Pferd verloren. Einige Banditen haben es mir abgejagt. Sie werden mir ein Reittier leihen müssen.«
»Waren es fünf Kerle, Marshal, die Ihnen das Pferd abjagten?«
»Ja, das kann hinkommen.«
»Die sind in der Stadt. Einer von ihnen hat eine Kugel im Bein und hat ärztliche Hilfe in Anspruch genommen.«
»Das sind sie«, sagte ich. »Sie befinden sich noch in Canyon?«
»Ja. An Ihrer Stelle würde ich mich aber nicht mit den fünf Burschen anlegen. Das sind keine Anfänger. Ich kann Männer einschätzen. Und die fünf sind Wölfe.«
Ich nagte an meiner Unterlippe. Dann sagte ich: »Wahrscheinlich haben Sie recht. Suchen Sie mir ein gutes und ausdauerndes Pferd aus und legen Sie ihm einen Sattel auf. Ich werde unverzüglich die Stadt verlassen.«
»Warum hat es das Quintett auf Sie abgesehen, Marshal?«
»Sie sind hinter dem Geld her, das sich hier in diesen Satteltaschen befindet«, antwortete ich. »20.000 Dollar, die ich ins Val Verde County zu bringen habe. Diese Summe bringt so manchen Mann auf krumme Gedanken.«
Der Stallmann pfiff zwischen den Zähnen. »Das ist eine Menge Geld.«
Er holte ein Pferd aus einer Box. Es war ein hochbeiniger Grauer mit breiter Brust, was Schnelligkeit und Ausdauer verriet. »Ist der in Ordnung?«, fragte der Stallmann.
Ich nickte.
Er sattelte und zäumte ihn. Ich schnallte zuletzt die Satteltaschen fest und versenkte mein Gewehr im Sattelschuh, dann führte ich das Pferd aus dem Stall und saß auf. Ich ritt nicht auf die Straße, sondern benutzte eine Gasse, um die Stadt zu verlassen. Die nächste Stadt, Tulia, war etwa vierzig Meilen von Canyon entfernt. Ich wollte sie bis zum Abend erreichen.
*
Grazia Esteban schaute aus dem verstaubten Fenster. Es war um die Mitte des Vormittags. Auf der Straße und den Gehsteigen bewegten sich einige Passanten. Ein Mann erregte die Aufmerksamkeit der schönen Mexikanerin. Er war Ende zwanzig und kam langbeinig über die Straße. Ein Lächeln umspielte die sinnlichen Lippen der Frau. Ihre dunklen Augen begannen in einem besonderen Licht zu glänzen. Sie wandte sich vom Fenster ab.
Ja, Grazia Esteban war eine sehr schöne Frau von fünfundzwanzig Jahren. Sie hatte lange, schwarze Haare, die in sanften Wellen auf ihren Rücken und ihre Schultern fielen. Ihr Gesicht verriet Rasse, sie war schlank, aber dennoch wohlproportioniert und mittelgroß.
Es klopfte gegen ihre Tür.
»Es ist offen.«
Die Tür ging auf, Jack Webb betrat das Zimmer. Der Ranchersohn blickte düster drein. Von ihm ging etwas aus, das Grazia seltsam berührte. Ihr Lächeln erlosch. »Hola, Cariño«, sagte die Frau. Erwartungsvoll-fragend musterte sie den Mann.
Dieser baute sich vor ihr auf, stemmte beide Hände in die Seiten und sagte grollend: »Ich habe mich gestern mit Kim Merewither verlobt. Wir wollen heiraten.«
Grazia war wie vor den Kopf gestoßen. »Aber…«
»Kein aber! Es ist so.«
»Aber sagtest du nicht, dass du mich liebst und dass ich deine Frau…«
Er verzog geringschätzig den Mund. »Sicher, das sagte ich.« Er zeigte ein scharfes Grinsen, das jedoch seine Augen nicht erreichte. »Schließlich musste ich dich mit etwas ködern. Anders hätte ich dich wohl kaum bekommen.« Sein Grinsen zerrann, seine Brauen schoben sich düster zusammen. »Damit ist Schluss. Ich hatte nie vor, dich zu heiraten. Das hätte mein Vater auch gar nicht geduldet.«
Grazias Gesicht verzerrte sich. »Ich kann das nicht glauben.«
Er winkte ungeduldig ab. »Diese Stadt lebt im Schatten meines Vaters, und eines Tages wird sie in meinem Schatten leben. Für dich gibt es hier keinen Platz mehr, Honey. Du weißt, was ich meine.«
»Du– du willst mich aus dem Weg haben. Por Dios, was bist du für ein Schuft. All die Monate war ich dir recht. Du– du hat mich benutzt, du hast mich schamlos ausgenutzt. Du heiratest Kim Merewither doch nur, weil ihr Vater ein reicher Viehhändler ist und…«
Hart unterbrach er sie: »So ist es. Was bist du denn? Ein mexikanisches Flittchen, das jeden Abend im Saloon singt. Denkst du wirklich, mein Vater ließe zu, dass du dich auf der Ranch einnistest? Niemals! Nimm es hin, wie es ist. In einer Stunde fährt die Postkutsche nach Süden. Nimm sie, Honey. Ich kann dich fertigmachen. Das weißt du sicher. Ich kann dafür sorgen, dass du hier keinen Fuß mehr auf die Erde kriegst. Also sei vernünftig und verschwinde.«
»Du bist ein verdammtes Schwein.«
Er zog auf und schlug ihr die flache Hand ins Gesicht. Seine Finger zeichneten sich rot auf ihrer Wange ab. »Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was du zu erwarten hast, wenn du nicht verschwindest!«, zischte Jack Webb. Er packte sie am Oberarm, schob sie zum Bett und versetzte ihr einen Stoß, der sie auf die Liegestatt warf. »Bevor ich jedoch gehe, will ich dich noch einmal haben, Honey. Also stell dich nicht an und zieh dich aus…«
Er begann, seine Hose aufzuknöpfen.
»Du– du musst verrückt sein!«, stieß Grazia hervor. »Wie könnte ich dir noch zu Willen sein? Geh zu deiner Kim! Ich…«
Er beugte sich über sie und schlug ihr den Handrücken bretterhart auf den Mund. Ihre Lippe platzte auf, Blut rann über ihr Kinn. Ein Aufschrei entrang sich ihr. »Hier gilt nur ein Wille!«, knurrte Jack Webb. »Und das ist meiner. Also, zieh dich aus! Oder muss ich mir mit Gewalt nehmen, was du mir freiwillig nicht geben willst?«
Ein Blick in sein Gesicht verriet Grazia all die Skrupellosigkeit, die in ihm steckte. Seine Worte und sein Verhalten waren erschreckend in ihrer Unmissverständlichkeit. In seinen Augen glitzerte ein böses Licht der Unduldsamkeit und der Habgier.
Grazia warf sich herum. Ihre Hand fuhr unter das Kopfkissen. Als sie wieder zum Vorschein kam, hielt sie einen Derringer. Sie richtete ihn auf Jack Webb und zischte: »Verschwinde aus meinem Zimmer, Jack, oder ich erschieße dich!«
Er erstarrte. In seinem Gesicht arbeitete es. Dann knirschte er: »Das würdest du nicht wagen.«
»Doch!«, versetzte sie mit klirrender Stimme.
Er lachte rasselnd. »Nein, o nein, das wagst du nicht. Mein Vater würde dir den schönen Hals lang ziehen. Also, nimm das Spielzeug runter und lass es über dich ergehen. In einer Stunde verlässt du die Stadt und…«
»Ich zähle bis drei! Und wenn du dann nicht zur Tür hinaus bist, schieße ich.«
Er fuhr fort, seine Hose aufzuknöpfen. »Du bluffst doch nur, Honey. Komm, nimm Vernunft an. Ich werde es dir noch einmal richtig besorgen und du wirst…«
»Eins!«
Er warf sich auf sie. Grazia drückte ab. Ein zerrinnender Ton brach aus Jack Webbs Kehle. Seine Gestalt erschlaffte auf der Frau. Grazia wand sich unter ihm hervor. Entsetzt starrte sie ihn an. In seinen Mundwinkeln zuckte es. »Hölle«, keuchte er. »Du– du hast mir– eine Kugel…«
Er bäumte sich auf, fiel zurück und war tot. Ausdruckslosigkeit senkte sich in sein Gesicht– es war die absolute Leere des Todes…
»O mein Gott!«, entrang es sich der Frau. Sie war fassungslos, in ihren Augen irrlichterte es. Schlagartig wurde ihr die Tragweite ihres tödlichen Schusses bewusst. Kalt und stürmisch kam die Angst vor Big Adam Webb, dem Boss der Diamant-W Ranch.
Grazia zwang sich zur Ruhe. Ihre Hand, die den Derringer hielt, hing schlaff nach unten. Im Saloon unten war noch kein Betrieb. Sie fragte sich, ob jemand auf der Straße den Schuss gehört hatte. Grazia ging zum Fenster, schob es in die Höhe und beugte sich hinaus. Vor dem Saloon hielt sich niemand auf. Wahrscheinlich war der Knall des Derringers gar nicht bis auf die Straße gedrungen.
Die Frau wandte sich ab. Auf dem Bett lag der tote Ranchersohn. Seine gebrochenen Augen drückten Unglauben und das letzte Entsetzens seines Lebens aus. Grazia schluckte würgend. Ihr Kehlkopf rutschte hinauf und hinunter. Sekundenlang stand sie wie gebannt auf der Stelle, die linke Hand auf den Halsansatz gepresst, also versuchte sie so, ihren fliegenden Atem zu beruhigen.
Schließlich aber kam Leben in ihre Gestalt. Sie legte den Derringer auf den Tisch, öffnete den Kleiderschrank, nahm eine Reisetasche heraus und begann, sie mit ihren Utensilien vollzustopfen. Wahllos warf sie alles an Kleidung hinein, was ihr in die Hände fiel. Zuoberst verpackte sie den Derringer, dann zog sie sich eine warme Jacke an und verließ das Zimmer. Sie sperrte es von außen ab.
Im Schankraum befand sich niemand. Grazia verließ den Saloon durch die Hintertür. Auf Schleichwegen erreichte sie den Mietstall. Der Stallbursche machte große Augen, als er sie sah. »Sie, Señorita«, sagte er erstaunt.
»Man hat mich aus der Stadt gewiesen«, sagte Grazia. »Ich brauche ein Pferd und einen Wagen. Einen Einspänner. Ich kann alles bezahlen.«
»Wie bitte? Wer hat Sie aus der Stadt gewiesen?«
»Jack Webb, im Namen von Big Adam Webb.«
»Aber, ich dachte…«
»Er hat mich nur ausgenutzt. Gestern hat er sich mit Kim Merewither verlobt, und nun bin ich ihm im Weg. Er hat mir eine Stunde Zeit gegeben. Die Stunde ist gleich vorbei. Können Sie mir einen Wagen und ein Pferd verkaufen?«
»Natürlich, Señorita. Ich spanne das Pferd an. Warten Sie nur wenige Minuten.«
»Beeilen Sie sich.«
Der Stallbursche machte sich an die Arbeit. Und während er ein Pferd vor den Buggy spannte, sagte er: »Webb ist vor einer halben Stunde in die Stadt gekommen. Er hat sein Pferd bei mir untergestellt. Ich war schon verwundert, weil er mitten in der Woche am helllichten Tag in die Stadt kam und ich sagte mir, dass es schon ein besonderer Grund sein müsse, das ihn herführt. Wo ist er jetzt?«
»Im Saloon.«
Schweigend vollendete der Stallmann seine Arbeit. Grazia zahlte das Gespann, verstaute ihr Gepäck hinter dem Sitz, dann stieg sie in den Wagen. Der Stallbursche reichte ihr die Zügel. »Hüh!« Sie ließ die Zügel auf den Rücken des Pferdes klatschen. Das Tier zog an, der Wagen setzte sich in Bewegung. Der Stallmann blickte der Frau hinterher. Ein ungewisses Gefühl sagte ihm, dass etwas nicht stimmte. Woher es rührte, entzog sich seinem Verstand.
*
»Mein Sohn ist tot, sagst du«, stieß Big Adam Webb hervor. »Erschossen! Und dieses Satansweib ist spurlos verschwunden!«
Die Stimme des Ranchers klang wie fernes Donnergrollen. Sie wies einen unheilvollen Unterton auf. Durchdringend starrte Webb den Mann aus Abernathy an, der ihm die Hiobbotschaft überbracht hatte. Sie befanden sich in der Halle des Ranchhauses. Sie war prunkvoll eingerichtet. Schwere Polstermöbel nahmen die Mitte des Raumes ein. An den Wänden standen Vitrinen mit viel Kristall. Die Wand über einem offenen Kamin war mit alten Waffen und indianischen Handarbeiten dekoriert.
Big Adam strich sich mit fahriger Geste über die Augen. Schwerfällig ging er zu einem der Sessel und ließ sich hineinfallen. »Und niemand in der Stadt will den Schuss gehört haben«, murmelte er.
»Ihr Sohn kam kurz vor zehn Uhr in die Stadt. Er hat sein Pferd im Mietstall untergestellt. Dann ging er in den Saloon und besuchte sofort die Sängerin in ihrem Zimmer. Was dort geschah, weiß niemand. Vom Stallmann weiß ich, dass Grazia einen Wagen und ein Pferd kaufte und die Stadt verließ.«
»Jack war mein einziger Sohn.« Der Rancher murmelte es wie im Selbstgespräch vor sich hin. Gedankenverloren starrte er auf die Tischplatte. In seinem Gesicht zuckten die Muskeln. Nur das Ticken des Regulators an der Wand war zu vernehmen. Rhythmisch schwang das Messingpendel der Uhr hin und her. Der Bote aus der Stadt hatte trotz der Uhr das Gefühl, dass die Zeit plötzlich stillstand.
Das änderte sich, als sich der Rancher mit einem Ruck erhob. Ein entschlossener Ausdruck prägte jeden Zug seines kantigen Gesichts. »Ich reite mit den verfügbaren Männern in die Stadt.« Er ging zur Tür und riss sie auf, trat hinaus auf die Veranda, legte beide Hände auf das Geländer und brüllte: »Wilson!«
Aus einem Anbau, in dem das Ranch Office untergebracht war, trat ein hochgewachsener Mann. »Hier, Boss. Was gibt es?«
»Jack ist tot«, grollte der Rancher. »Die mexikanische Hure hat ihn erschossen. Wir reiten in die Stadt. Jag alle verfügbaren Männer in die Sättel.«
»Was?!«
»Du hast richtig gehört. Mein Sohn ist tot. Soeben hat man mir die Nachricht überbracht. Lass mein Pferd satteln. In einer Viertelstunde reiten wir.«
Fünfzehn Minuten später waren ein halbes Dutzend Reiter auf dem Weg nach Abernathy. Der Rancher ritt mit Trauer im Herzen. Er war erschüttert und fassungslos– aber da war noch mehr. Da war verzehrender Hass– Hass auf die Frau, die seinen Sohn auf dem Gewissen hatte. Ein Hass, der kein Verständnis, keine Zugeständnisse und keine Versöhnung kannte.
Der Ranch ritt mit seinem Vormann Hank Wilson an der Spitze des kleinen Rudels. Die Hufe rissen kleine Staubwolken in die klare Luft. Der Mann aus Abernathy hatte sich der Crew angeschlossen. Er ritt am Ende. Die Männer ritten in dumpfes Schweigen versunken. Die Hufe pochten, Gebissketten klirrten, Sattelleder knarrte. Manchmal wieherte ein Pferd.
Sie erreichten die Stadt nach einer Stunde. Menschen standen auf der breiten, staubigen Main Street in Gruppen zusammen. Sie gestikulierten und debattierten. Als das Rudel auftauchte, brachen die Gespräche ab. Mit gemischten Gefühlen beobachteten die Menschen den kleinen Pulk.
Big Adam ritt zum Haus des Totengräbers und saß ab. »Wartet hier auf mich«, sagte er halblaut, dann ging er sattelsteif hinein. Der Undertaker empfing ihn in der Halle des Hauses. Auf zwei Böcken stand ein offener Sarg, in dem Jack Webb lag. Sein spitzes Gesicht mutete wächsern an. Man hatte ihm die Augen geschlossen. Big Adam trat vor den Sarg hin, sein Blick saugte sich am Gesicht seines Sohnes fest. »Warum hast du keine Kerzen angezündet, Kellog?«
»Ich– ich dachte, Sie– Sie werden ihn auf der Ranch aufbahren und beerdigen. Darum…«
»Schon gut. Du hast recht. Jack soll auf der Ranch neben seiner Mutter seine letzte Ruhe finden. Bring ihn auf die Ranch, Kellog, und bahre ihn in der Halle des Haupthauses auf. Wir werden ihn begraben, wenn ich zurück bin.«
Der Rancher schwang auf den Absätzen herum und marschierte nach draußen. Dort saß er auf. »Zum Saloon, Leute.«
Sie setzten die Pferde in Bewegung. Ein kalter Hauch schien durch die Stadt zu ziehen. Big Adam verströmte eine tödliche Entschlossenheit. Seine Mannschaft vermittelte einen unübersehbaren Eindruck von Wucht und Stärke. Vor dem Saloon zügelten sie die Pferde und saßen ab. Nachdem sie die Pferde angebunden hatten, gingen sie hinein. Ihre Schritte riefen ein hallendes Echo auf den Dielen des Fußbodens wach. Ihre Sporen klirrten. Die Männer, die sich im Schankraum befanden, schwiegen. Die Leute von der Diamant-W gingen zum Tresen und bauten sich dort auf. »Whisky«, forderte Big Adam.
Der Keeper stellte sechs Gläser vor die Männer hin, angelte sich eine Flasche Whisky und schenkte ein. Der Rancher trank das Glas mit einem Zug leer. »In welche Richtung ist die dreckige Hure geflohen?«
»Einige Leute sahen sie in Richtung Süden die Stadt verlassen«, antwortete der Keeper.
»In Ordnung. Trinkt aus, Leute. Ich will sie vor dem Abend noch einholen.«
Der Ranch machte kehrt und ging zur Tür. Seine Männer beeilten sich, ihm zu folgen. Wenig später stob das Rudel in wilder Karriere aus der Stadt. Es gab keine Schonung für die Pferde. Der Pulk zog eine Staubfahne hinter sich her. Die Poststraße nach Lubbock war von Wagenrädern zerfurcht und von Hufen aufgewühlt. Den Pferden trat weißer Schaum vor die Nüstern. Der Reitwind bog die Krempen der Hüte vorne senkrecht in die Höhe. Die Halstücher flatterten.
»Wir müssen das Tempo drosseln, Boss!«, schrie der Vormann. »Andernfalls halten sie keine halbe Stunde mehr durch.«
Widerwillig fiel der Rancher seinem Pferd in die Zügel. Die Tiere röchelten und röhrten. Ihre Flanken zitterten. Das Fell war dunkel vom Schweiß. Auch die anderen Reiter reduzierten die Geschwindigkeit. Sie ließen die Pferde eine Viertelstunde im Schritt gehen und verschnaufen. Dann trieben sie sie wieder an. Big Adam war voll tödlicher Ungeduld. In ihm wühlte eine böse Leidenschaft. Er wollte seinen Sohn rächen. Dabei spielte es für ihn keine Rolle, dass er eine Frau jagte. Sie hatte seinen Sohn getötet, und nur das zählte. Dafür musste sie büßen.
In einem hämmernden Stakkato stoben die Reiter dahin. Und als die Sonne im Südwesten stand, sahen sie weit vor sich auf der Straße den einsamen Wagen. Ein Stück weiter bohrte sich die Straße zwischen die Hügel. Big Adam riss sein Pferd in den Stand. Der Pulk kam zum stehen. »Wir haben sie eingeholt. Vorwärts, Männer, schnappt sie euch. Ich will dieses Weibsbild hängen sehen. Schnappt sie euch!«
Die Reiter spornten ihre Pferde an…
*
Grazia vernahm den brandenden Hufschlag und wandte sich um. Der Schreck ging tief. Das Herz drohte ihr in der Brust zu zerspringen. Sie trieb das Pferd an. Der Wagen rumpelte und holperte. Die Frau wurde durch und durch geschüttelt. An ihr schien die Gegend vorbeizufliegen. Es ging zwischen die Hügel. Immer wieder ließ sie die Zügelleinen auf den Rücken des Pferdes klatschen. »Lauf!«, feuerte sie mit schriller Stimme das Tier an.
Angst umkrallte Grazias Herz und wütete in ihren Eingeweiden. ‚Angst‘ war vielleicht gar nicht das richtige Wort, um auszudrücken, was sie empfand. Panik kroch in ihr hoch. Beim Gedanken daran, was Big Adam mit ihr anstellen würde, drohte ihr das Blut in den Adern zu gefrieren. Ihre Nerven lagen blank. Ein Laut, der sich anhörte wie trockenes Schluchzen, entrang sich ihr.
Noch wirbelten die Hufe des Pferdes in einem regelmäßigen Rhythmus. Aber wie lange hielt das Tier noch durch? Sie hatte es nach ihrer Flucht aus Abernathy nicht geschont, weil sie mit Verfolgung gerechnet hatte. Das machte sich nun bemerkbar. Bald würde sich der Hufewirbel verlangsamen…
»Hüh, hüh, lauf!«
Das Pferd schien das Letzte aus sich herauszuholen. Grazia schaute über die Schulter zurück. Die Reiter hatten aufgeholt. Das Grauen griff mit knöcherner Klaue nach ihr. Ein eisiger Schauer rann ihr über den Rücken hinunter.
Das Pferd konnte nicht mehr. Es wurde langsamer. Grazia versuchte es mit schrillem Geschrei und mit den Zügeln anzufeuern. Vergebens. Das Tier war total verausgabt. Schaum tropfte von seinen Nüstern.
Schnell holten die Reiter auf. Und dann überholte einer das Fuhrwerk, ritt neben das dahinstolpernde Pferd und griff nach dem Zaumzeug. Er brachte das Gespann zum Stehen. Grazia sprang ab und versuchte zu Fuß zwischen die Hügel zu fliehen. Einer der Reiter folgte ihr und ritt sie über den Haufen. Sie stürzte. Ihre Finger verkrallten sich im gefrorenen Boden. Ihre Nägel brachen. Stoßweise atmete sie, ihre Augen flackerten.
Die Reiter kreisten sie ein. Hank Wilson, der Vormann, stieg vom Pferd und trat vor Grazia hin. »Steh auf.«
Als sie nicht sogleich reagierte, packte er sie an den Oberarmen und zerrte sie auf die Beine. Die Frau konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ihre Zähne schlugen wie im Schüttelfrost aufeinander. »Es– es war Notwehr«, stammelte sie. »Jack– wollte mich vergewaltigen.«
»Erzähl das dem Teufel in der Hölle«, erwiderte der Vormann kalt. Dann schaute er einen der Cowboys an. »Nimm mein Pferd, Curly. Ich fahre mit der Lady im Wagen.«
Er bugsierte Grazia zu dem Buggy und nötigte sie, einzusteigen. Er setzte sich neben sie und angelte sich die Zügel. Dann fuhren sie zurück. Die Reiter eskortierten sie. Grazias Hals war trocken wie Wüstensand. Das Herz schlug ihr bis zum Hals hinauf. Ihre Gedanken wirbelten. Die Aussichtslosigkeit ihrer Situation drohte sie wie mit tonnenschweren Gewichten zu erdrücken.
Sie kamen bei Big Adam an. Schwer und wuchtig saß der grauhaarige Rancher auf seinem lehmgelben Wallach. Sein Gesicht hatte sich verkniffen. Seine Augen blickten hart wie Bachkiesel. Der Wagen kam zum Stehen, das Rumpeln und Poltern endete. Auch die Hufschläge und anderen Geräusche verklangen. Nur das Schnauben und Prusten der Pferde war zu vernehmen.
Der Rancher erhob seine Stimme: »Du hast Jack ermordet.«
Grazia zog den Kopf zwischen die Schultern. Ihre Stimmbänder wollten ihr nicht gehorchen. Sie musste zweimal ansetzen, dann sagte sie mit belegter Stimme: »Ich wollte Ihren Sohn nicht töten, Sir. Aber nachdem er mich geschlagen hat, versuchte er mich zu vergewaltigen. Ich setzte mich zur Wehr und bedrohte ihn mit dem Derringer. Er– er…«
»Du bist ein dreckiges Flittchen. Du hast dich meinem Jungen an den Hals geworfen, weil du dachtest, er würde dich heiraten. Ich weiß alles. Um dich zu nehmen, brauchte er dich nicht zu vergewaltigen.– Hängt sie auf, Leute.«
»Nein!« Gellend schrie es Grazia. »Es– es war ein Unfall! Er stürzte sich auf mich und der Schuss löste sich. Ich– ich will vor ein ordentliches Gericht gestellt werden. Darauf habe ich ein Recht.«
Big Adam nickte seinem Vormann zu. Dieser gab den Männern einen Wink. Zwei saßen ab und packten Grazia. Ein dritter nahm sein Lasso vom Sattel und ritt zu einer Eiche mit dicken, ausladenden Ästen. Über einen dieser Äste warf er das Lasso.
Grazias Hände wurden mit einer Lederschnur auf den Rücken gefesselt. Dann setzte man sie auf ein Pferd und führte es unter die vom Ast baumelnde Schlinge. Einer ritt heran und griff nach der Schlinge. In dem Moment, als er sie der Frau über den Kopf streifen wollte, peitschte ein Schuss.
Die Männer riss es herum. Auf dem Kamm des Hügel weiter westlich verhielt ein Reiter. An seiner linken Brustseite schimmerte ein Stern. Er feuerte noch einmal einen Schuss in die Luft ab, dann trieb er sein Pferd an…
*
Ich erreichte das Rudel. Stechende Augen taxierten mich, schienen mich einzuschätzen, die Kerle machten sich ein Bild von mir. Einer, der war ungefähr Mitte fünfzig und grauhaarig, stach mir in die Augen. Er verströmte natürliche Autorität und Unduldsamkeit. Der Mann war dazu geboren, Anordnungen zu erteilen, zu loben und zu tadeln und– zu bestrafen. Er starrte mich düster an.
Die Hände der anderen befanden sich nahe bei den Revolvern. Das war eine hartgesottene hartbeinige Mannschaft, die ihrem Boss gehorchte wie Landsknechte ihrem Fürsten. Die Gesichter waren verkniffen, ein Hauch von Unerbittlichkeit und Gnadenlosigkeit ging von ihnen aus.
»Ich habe einiges gegen Lynchjustiz einzuwenden«, rief ich und ließ den Grauhaarigen nicht aus den Augen. »Mein Name ist Bill Logan. Ich bin Deputy Marshal des Bezirksgerichts in Amarillo.«
»Ich sehe Ihren Stern, Marshal«, grollte der Grauhaarige. »Mein Name ist Adam Webb. Man nennt mich Big Adam. Diese Frau hat meinen Sohn ermordet. Und dafür strafe ich sie. Das ist legitim und mein gutes Recht.«
Ich schüttelte den Kopf. »Sie irren sich, Webb. Die Zeit, in der jemand ohne entsprechenden gerichtlichen Beschluss gehängt werden durfte, ist vorbei.«
»Sie ist eine Mörderin, und auf Mord gibt es nur eine Antwort.«
»Es stimmt nicht!«, rief die Frau mit hartem Akzent. »Sein Sohn versuchte mich zu vergewaltigen. Ich habe mich nur gewehrt. Als er sich auf mich stürzte, löste sich der Schuss. Es war ein Unfall, außerdem setzte ich mich nur zur Wehr.«
»Macht weiter«, gebot Adam Webb. »Und Sie sollten sich raushalten, Marshal. Ich tue nur, was getan werden muss. In Abernathy gibt es kein Gesetz. Wir sind auf uns alleine gestellt. Das Gesetz vertrete in diesem Fall ich.«
Einer der Männer legte der Frau den Strick um den Hals und zog die Schlinge ein wenig zu. Ich konnte das Entsetzen in den Augen der Lady erkennen. »Sie– Sie dürfen es nicht zulassen, Marshal«, keuchte sie.
Ich richtete das Gewehr auf Adam Webb und sagte hart: »In dem Moment, in dem Sie den Befehl geben, das Pferd unter ihr wegzutreiben, schieße ich Sie aus dem Sattel. Mir scheint, das ist die einzige Sprache, die Sie verstehen, Mister.«
»Meine Leute würden Sie in Fetzen schießen, Marshal«, drohte Webb.
»Allerdings werden Sie nicht mehr viel davon haben«, versetzte ich kalt und repetierte. Das scharfe, metallische Geräusch hing für einen Sekundenbruchteil in der Luft, dann versank es. »Nimm der Frau den Strick wieder ab!«, kommandierte ich. »Mach schon.«
Aus den Augenwinkeln sah ich eine Bewegung. Ich zuckte halb herum und feuerte, repetierte sofort wieder und richtete das Gewehr erneut auf Adam Webb. Der Bursche, der nach dem Revolver gegriffen hatte, stürzte vom Pferd. Ein langgezogenes Stöhnen war zu vernehmen.
Im Gesicht des Ranchers arbeitete es krampfhaft. Seine Kiefer mahlten. Seine Lippen waren nur ein dünner, messerrückenscharfer Strich. In seinen Augen las ich die tödliche Drohung. Es war ein stummes Duell. Unsere Blicke kreuzten sich wie Degenklingen. Schließlich nickte Webb. »Okay, Lane, nimm ihr den Strick ab.« Und an mich gewandt sagte der Rancher: »Aber in dieser Sache ist nicht das letzte Wort gesprochen, Marshal.«
Zwei Männer saßen ab und kümmerten sich um den Verwundeten. Ich hatte ihm eine Kugel in die Schulter geschossen.
»Ich bringe die Frau nach Lubbock und übergebe sie dort dem Sheriff«, erklärte ich. »Er wird ermitteln, was sich zugetragen hat, und das Gericht wird ein entsprechendes Urteil fällen. Sie, Webb, sind weder Richter noch Henker. Das Gesetz der freien Weide gibt es nicht mehr.«
»Sie hat meinen Jungen ermordet«, knurrte der Rancher, kaum die Lippen bewegend. »Und dafür wird sie sterben. Ich verlasse mich nicht auf die so genannte Gerechtigkeit. Die Gesetze haben Lücken. Sie darf nicht ungeschoren davonkommen.«
»Ich sehe es schon«, sagte ich. »Sie sind nicht zur Vernunft zu bringen. Na schön. Ich werde Ihnen die Möglichkeit nehmen, uns zu folgen. Runter von den Pferden!«
»Bis jetzt geht es nur um die Frau«, grollte der Rancher. »Sie sind nur eine Figur in diesem Spiel, Marshal. Sie sollten aber vermeiden, sich meinen persönlichen Zorn zuzuziehen. Ich warne Sie.«
»Absteigen!«
Der Rancher dachte nicht daran, meiner Aufforderung Folge zu leisten. Ich schoss seinem Pferd eine Kugel zwischen die Vorderhufe. Erdreich spritzte. Das Tier stieg erschreckt auf die Hinterhand und wieherte. Sofort lud ich nach und ließ die Mündung der Winchester über die Kerle pendeln.
Der Rancher hatte Mühe, sich im Sattel zu behaupten und sein Pferd wieder unter Kontrolle zu bringen.
»Mit der nächsten Kugel schieße ich Ihnen das Pferd unter dem Hintern weg!«, drohte ich.
Die Mundwinkel des Ranchers zeigten tiefe Kerben. Ein rasselnder Atemzug entrang sich ihm. Das Flirren in seinen Augen verriet, wie sehr die Wut in ihm wütete.
»Ich warte nicht mehr lange«, stieß ich hervor.
Plötzlich schwang sich Webb vom Pferd. »Das werden Sie büßen, Marshal.«
»Sparen Sie sich Ihre Drohungen.«
»Steigt ab, Leute. Er sitzt am längeren Hebel. Aber noch ist nicht aller Tage Abend.«
Sie schwangen sich aus den Sätteln.
»Und jetzt legt eure Waffen ab!«, befahl ich.
Zähneknirschend kamen sie meinem Befehl nach. Und dann gebot ich ihnen, zu verschwinden. Einer stützte den Verwundeten. Von ihnen ging eine stumme Prophezeiung aus. Die Feindschaft berührte mich wie ein heißer Atem. Adam Webb drohte nicht mehr. Ich blickte den Kerlen nach, bis sie hinter einem Hügel aus meinem Blickfeld verschwanden. Dann ritt ich zu der Frau hin und knüpfte ihre Handfessel auf. Ich saß ab und half ihr vom Pferd.
»Sie hat der Himmel geschickt, Marshal.«
»Sieht so aus«, erwiderte ich. »Machen wir, dass wir wegkommen von hier.«
Ich band die sechs Pferde mit dem Diamant-Brandzeichen zusammen, indem ich immer den Zügel eines Tieres am Sattelhorn des anderes festzurrte. Das vorderste Pferd band ich am Buggy fest. Dasselbe machte ich mit meinem Pferd. Dann half ich der Mexikanerin in den Buggy und setzte mich neben sie. Ich trieb das Pferd an. Die Achsen quietschten leise in den Naben. Ich spürte, dass mich die Frau von der Seite beobachtete.
*
»Dieser verdammte Bastard!«, fluchte der Rancher.
»Ohne Pferde sind wir aufgeschmissen«, gab Hank Wilson, der Vormann, zu bedenken.«
»Ich weiß, verdammt! Holen wir unsere Revolver.«
Die Waffen lagen dort im Gras, wo sie sie hingeworfen hatten. Der Marshal hatte sich nicht die Mühe gemacht, sie aufzusammeln. Ihre Gewehre steckten in den Scabbards an den Sätteln der Pferde. Webb schickte einen der Cowboys auf einen Hügel, damit er Ausschau nach dem Buggy hielt. Der Cowboy kam zurück und sagte: »Sie sind zwischen den Hügeln verschwunden. Zur Hölle mit diesem Marshal. Bis Abernathy sind es gut und gerne zehn Meilen, und bis Lubbock ist es genauso weit. Wir werden einen halben Tag unterwegs sein.«
»Jammern bringt uns nicht weiter«, knurrte der Vormann. »Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Umkehren oder nach Lubbock laufen.«
»Wir gehen nach Lubbock«, stieß Webb hervor.
Das Rudel setzte sich in Bewegung. In den Gesichtern spiegelte sich wider, was die Männer empfanden. Ihr Zorn auf den Marshal war grenzenlos…
*
»Er hat mir das Blaue vom Himmel versprochen«, erzählte Grazia Esteban. »Immer wieder beteuerte er, wie sehr er mich liebt und dass er mich auch gegen den Willen seines Vaters heiraten würde. Ich vertraute ihm und gab ihm alles, was eine Frau einem Mann geben kann. Aber dann kam er auf mein Zimmer, eröffnete mir, dass er sich mit Kim Merewither verlobt habe und dass er sie heiraten werde. Er schlug mich, und dann verlangte er von mir, dass ich mich ihm…«
Grazias Stimme brach.
»Erzählen Sie weiter«, forderte ich.
»Ich– ich nahm den Derringer und bedrohte ihn. Doch er ließ sich nicht beirren und stürzte sich auf mich. Da löste sich der Schuss. Ich wollte ihn nicht töten. Es– es war eine Verkettung unglücklicher Umstände.«
»Wohin wollten Sie fliehen?«, fragte ich.
»Zu meinem Bruder Sebastiano. Er besitzt am Arroyo de la Zorra, jenseits des Rio Grande, eine Hazienda. Zu ihm will ich. Bei ihm kann ich leben.«
»Ich muss Sie dem Sheriff in Lubbock übergeben«, sagte ich. »Die Umstände des Todes von Jack Webb müssen geklärt werden.«
»Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt, Marshal. Das Gericht wird mir glauben müssen. Ich habe in Notwehr gehandelt. Bitte, Marshal, glauben Sie mir. Ich will nicht, dass man mich in Lubbock festhält. Big Adam wird kommen, und er wird nicht ruhen, bis ich elend an einem Strick krepiere. Bringen Sie mich zu meinem Bruder, Marshal. Der Arroyo de la Zorra befindet sich in der Nähe von Del Rio.«
»In diese Gegend muss ich auch«, sagte ich. Dann schüttelte ich den Kopf. »Ich muss Sie nach Lubbock bringen. Schließlich haben Sie einen Mann erschossen.«
Grazia seufzte. »Sind Sie in einer besonderen Mission unterwegs?«
»Ja«, versetzte ich kurz angebunden.
Von da an schwiegen wir.
Die Sonne näherte sich unaufhaltsam dem Westen. Es war kalt. Der Himmel im Osten verfärbte sich grau. Dann ging die Sonne unter und die Düsternis kam. Schnell wurde es finster. Ich wollte an diesem Abend noch Lubbock erreichen. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hatte ich keine Lust, die Nacht im Freien zu verbringen.
Zu beiden Seiten des Weges buckelten die Hügel und Tafelberge. Sie erinnerten an riesige, geduckt daliegende, lauernde Raubtiere aus grauer Vorzeit. Am Himmel blinkten die Sterne. Im Osten schob sich groß und kugelrund der Mond über den Horizont. Wir zogen in den Schattenfeldern der Anhöhen nach Süden.
Und dann sah ich weit vor uns die Lichter von Lubbock. Zehn Minuten später passierten wir die ersten Häuser der Stadt. Aus vielen Fenstern fiel Licht. Ich war schon einige Male hier und kannte mich aus. Mein erster Weg führte mich zum Sheriff's Office. Es war erleuchtet. Ich zügelte das Pferd. Das Poltern und Quietschen endete. Lose schlang ich die Zügel um den Bremshebel, dann stieg ich aus dem Wagen. »Wenn Ihre Geschichte stimmt, dann haben Sie nichts zu befürchten, Ma'am«, sagte ich und half Grazia, auszusteigen. Sie holte ihre Reisetasche aus dem Buggy.
Ich klopfte gegen die Tür des Büros und wurde aufgefordert, einzutreten. Ich ließ Grazia den Vortritt. Hinter mir drückte ich die Tür zu. Am Schreibtisch saß ein Mann und musterte uns interessiert. Ich stellte mich vor, dann sagte ich: »Bei der Lady handelt es sich um Grazia Esteban. Sie hat in Abernathy Jack Webb erschossen. Sie behauptet, es war Notwehr.«
»Big Adam Webb wollte mich hängen«, stieß Grazia hervor. »Ich hatte schon den Strick um den Hals. Der Marshal hat mich gerettet.– Ich bin unschuldig. Als ich Jack erschoss, geschah das in Notwehr.«
Der Gesetzeshüter erhob sich. »Ich bin Deputy Sheriff Matt Jones. Wenn das so ist, muss ich Sie in Gewahrsam nehmen, Lady«, sagte er. »Morgen früh wird Sheriff Wilcox entscheiden, was mit Ihnen zu geschehen hat.« Er holte einen Schlüsselbund aus einem Schub seines Schreibtisches. Dann zündete er eine Laterne an, die auf einem Brett an der Wand stand. »Folgen Sie mir.« Er ging zu einer Tür und öffnete sie. Ich konnte Gitterstäbe sehen. Die Tür führte in den Zellentrakt.
Grazia starrte mich an. Ich nickte. Sie atmete tief durch, dann setzte sie sich in Bewegung und ging am Deputy vorbei in den Zellentrakt. Eine raue Stimme erklang: »Was ist denn das? Gütiger Gott, eine Frau! Und was für eine! Das ist eine Göttin!«
Ich vernahm das Scheppern einer Gittertür.
Wieder erklang die raue Stimme: »Warum sperrst du sie nicht zu uns in die Zelle, Deputy? Wir würden eine Menge Spaß mit ihr haben. Du gönnst uns aber auch gar nichts.«
»Halt die Klappe, Mason!«
Der Deputy kam zurück und schloss die Tür. »Was ist dran an ihrer Geschichte?«
»Sie klingt glaubhaft. Und es gibt keinen Zeugen. Man wird ihre Aussage kaum widerlegen können.«
»Ich habe von Big Adam Webb gehört«, erklärte der Deputy. »Ein Weidekönig. Sein Wort ist oben in Abernathy Gesetz.«
»Ich habe ihn kennengelernt«, antwortete ich, und dann erzählte ich die Geschichte von meinem Zusammentreffen mit der Webb-Mannschaft. Aufmerksam hörte der Deputy zu, er unterbrach mich mit keinem Wort. Schließlich sagte er, als ich geendet hatte: »Das sieht Webb ähnlich. Er hält sich für den lieben Gott. Nun, Sie haben ihm einen gehörigen Denkzettel verpasst, Marshal. Ich glaube aber nicht, dass ihn das zur Vernunft bringen wird. Im Gegenteil– es wird seinen Zorn schüren.«
»Ich musste mir die Kerle vom Hals schaffen.«
»Ich denke, Sie bleiben die Nacht über in der Stadt.«
»Sicher.«
Ich verließ den Deputy und fuhr zum Mietstall. Eine Laterne an der Stallwand warf einen großen Lichtkreis auf den Boden vor dem Stall. Auch im Stallinnern brannte eine Laterne. Vor dem Tor hielt ich an. Der Stallmann kam aus dem Verschlag, der ihm als Stall Office und Aufenthaltsraum diente. Ich wies auf die Pferde und sagte: »Ich habe die Tiere Adam Webb und seinen Leuten abgenommen und bitte Sie, sich um sie zu kümmern. Das ist mein Pferd. Ich werde die Nacht über in Lubbock bleiben. Der Wagen und das Gespannpferd gehören einer Lady namens Grazia Esteban. Kümmern Sie sich auch um dieses Pferd. Ich weiß nicht, wann es die Lady abholen kann.«
Ich schnallte die Satteltaschen mit dem Geld los, nahm mein Gewehr und verließ den Mietstall. Unter meinen Stiefelsohlen mahlte Staub. Melodisch klirrten meine Sporen. Aus einem Saloon, der auf meinem Weg zum Hotel lag, drang wüster Lärm. Ich verspürte Hunger und Durst.





























