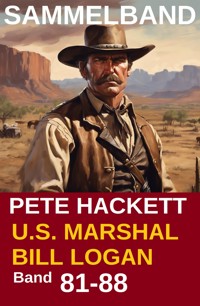
U.S. Marshal Bill Logan, Band 81-88: Acht Romane: Sammelband Nr.11 (U.S. Marshal Western Sammelband) E-Book
Pete Hackett
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sammelband 11 (Band 81-88) U.S. Marshal Bill Logan von Pete Hackett U.S. Marshal Bill Logan – die neue Western-Romanserie von Bestseller-Autor Pete Hackett! Abgeschlossene Romane aus einer erbarmungslosen Zeit über einen einsamen Kämpfer für das Recht. Über den Autor Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war - eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen. Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung." Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress. Ein CassiopeiaPress E-Book © by Author © der Digitalausgabe 2014 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen www.AlfredBekker.de [email protected] INHALT Band 81 Zweibeinige Wölfe Band 82 Marshal Logan und der Bankräuber Band 83 Der verschollene Bruder Band 84 Blutige Gerechtigkeit Band 85 Raubzug der Skrupellosen Band 86 „Es war kaltblütiger Mord“ Band 87 Phil Jameson will Rache Band 88 Der Tod wartet in Tuscola
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1097
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
U.S. Marshal Bill Logan
Sammelband 11 (Band 81-88)
von Pete Hackett
Pete Hackett Western– Deutschlands größte E-Book-Western-Reihe mit Pete Hackett's Stand-Alone-Western sowie den Pete Hackett Serien "Der Kopfgeldjäger", "Weg des Unheils", "Chiricahua" und "U.S. Marshal Bill Logan".
U.S. Marshal Bill Logan
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© der Digitalausgabe 2014 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
1. digitale Auflage 2014 Zeilenwert GmbH
ISBN 9783956171130
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Über den Autor
Band 81 Zweibeinige Wölfe
Band 82 Marshal Logan und der Bankräuber
Band 83 Marshal Logan und der verschollene Bruder
Band 84 Blutige Gerechtigkeit
Band 85 Raubzug der Skrupellosen
Band 86 „Es war kaltblütiger Mord“
Band 87 Phil Jameson will Rache
Band 88 Der Tod wartet in Tuscola
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war– eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
Band 81 Zweibeinige Wölfe
Es war Nacht. Durch die Ritzen des Blendladens vor einem Fenster des Farmhauses fiel Licht. Zweihundert Yards von der Farm entfernt zügelten ein Rudel Reiter ihre Pferde. Die Tiere stampften auf der Stelle. Eines der Pferde wieherte. Sattelleder knarrte.
Auf der Farm begann der Hund zu bellen. Sein Kläffen erfüllte die Nacht. Die Tür des Farmhauses wurde geöffnet, Licht flutete ins Freie. Ein Mann kam heraus und rief etwas. Seine Worte gingen im wütenden Bellen des Hundes unter. Die Kette, von der der Hund festgehalten wurde, rasselte metallisch.
Tod und Verderben lauerten in der Dunkelheit. Der Tod streckte die Knochenfaust aus und griff mit gebieterischer Hand nach den Bewohnern der Farm. Das Unheil nahm seinen Lauf.
Mit dem Peitschen eines Schusses brach der Farmer zusammen. Die Banditen trieben ihre Pferde an. In diesem Moment riss die Wolkendecke auf und kaltes Mondlicht ergoss sich über die Farm. Hufschläge rollten vor den Reitern her wie eine Botschaft von Untergang und Tod. Staub wallte unter den wirbelnden Hufen.
Der Blendladen vor dem Fenster des Hauses wurde aufgestoßen. Ein Schuss peitschte. In der Tür zeigte sich eine Gestalt, bei ihr blitzte es auf. Der Knall wurde den Banditen entgegengeschleudert. Aber die Kugel verfehlte das Ziel. Die Reiter waren auseinander geschwärmt. Und nun fingen sie an zu schießen. Der Mann in der Tür brach zusammen. Aus dem Fenster feuerte jemand mit monotoner Gleichmäßigkeit. Die Reiter schwenkten vor dem Haus ein und stoben im Kreis um das Gebäude herum. Ihre Kugeln harkten in die Wand und pfiffen durch das Fenster. Einige der Kerle sprangen von den Pferden und rannten in das Farmhaus. Geschrei ertönte, ein Revolver krachte dumpf. Dann schleppten zwei der Kerle einen Mann aus dem Haus und warfen ihn in den Staub.
Die anderen Reiter zügelten im Hof die Pferde. Aufgewirbelter Staub senkte sich auf die Erde zurück. Pulverdampf wurde vom lauen Nachtwind zerpflückt. Zwei Frauen wurden ins Freie getrieben. Die eine war um die fünfzig, die andere allenfalls zwanzig. Einer der Banditen, der jetzt das Haus verließ, trug eine Laterne. Licht und Schatten wechselten.
Es war ein bunter Haufen verwegener Gestalten. Unter ihnen waren drei Indianer, ein Halbblut und drei Weiße.
Der Mann, der im Hof lag, bewegte sich. Er drückte sich mit den Armen hoch und lag auf allen Vieren. Einer der Kerle, ein dunkelhäutiger Mann mit schulterlangen Haaren, zog den Revolver, zielte kurz, dann drückte er eiskalt ab. Der Mann im Hof wurde auf die Seite geworfen, seine Gestalt erschlaffte. Die ältere der beiden Frauen schrie auf, riss sich los und rannte zu dem Mann hin, warf sich bei ihm auf die Knie und keuchte: »James, mein Gott. Du– du auch noch…«
»Wir verschwinden!«, rief der Kerl, der den Farmer erschossen hat. »Die junge Lady nehmen wir mit.«
Ann Wilson wurde zu einem der Pferde gezerrt und musste bei einem der Kerle aufsitzen. Ihre Mutter, die bei dem toten Farmer kniete, sprang auf, lief zu ihr hin und klammerte sich an das Pferd. »Bitte«, stammelte sie. »Lassen Sie Ann in Ruhe. Reicht es denn nicht, dass sie meinen Mann und meine beiden Söhne erschossen haben. Lassen Sie mir meine Tochter.«
Einer der Kerle kam aus dem Haus. »Es gibt nichts, was sich lohnen würde, mitzunehmen«, rief er.
Der Reiter versetzte Kathe Wilson einen brutalen Tritt. Die Frau wurde zurückgeschleudert, strauchelte und stürzte. Ihr verzweifeltes Aufheulen konnte die Banditen nicht erweichen.
Der Bandit, der eben noch das Haus verlassen hatte, trat vor sie hin. »Habt ihr Geld im Haus versteckt?«
»Nein«, murmelte Kathe Wilson. »Wir– wir müssen sogar im Store schon anschreiben lassen.« Ihre Stimme brach. Sie wurde von ihren Gefühlen überwältigt.
Die Kerle, die abgesessen waren, warfen sich in die Sättel. Die Petroleumlampe flog durch das Fenster ins Innere des Hauses und zerschellte. Petroleum rann aus, bläuliche Flammen leckten über den Boden. Die tödliche Horde stob in die Nacht hinein. Das wenige Hab und Gut der Wilsons verbrannte.
*
Ich war gerade von einem Einsatz in der Nähe von Pampa zurückgekehrt und versorgte im Stall mein Pferd. Joe war in einer anderen Sache unterwegs und ich hatte keine Ahnung, wann er nach Amarillo zurückkehren würde.
Als beim Stalltor mein Name gerufen wurde, drehte ich mich um. Es war Simon Calispel, der Sekretär von Richter Humphrey. »Was willst du, Simon?«, fragte ich, obgleich ich ahnte, was den kleinen, agilen Burschen in den Pferdestall getrieben hatte.
»Du sollst zum Richter kommen«, erklärte Simon. »Ich glaube, es brennt wieder einmal. Und zwar ganz gewaltig.«
Ich ließ alles liegen und stehen und begab mich ins Gerichtsgebäude. Wenig später saß ich in Richter Humphreys Büro. Der Richter schaute ziemlich ernst drein, richtete den Blick auf mich und sagte: »Am Sweetwater wurden in den vergangenen zwei Wochen drei Farmen überfallen. Die meisten der Bewohner wurden getötet. Drei junge Frauen und vier Kinder wurden verschleppt.«
Ich war ziemlich betroffen.
Der Richter fuhr fort: »Es handelt sich um eine Bande, in der Indianer, ein Halbblut und drei Weiße reiten. Der Anführer ist ein Indianer. Wohin die jungen Frauen und die Kinder verschleppt wurden, ist unbekannt. Aber es ist zu befürchten, dass die Bande weitere Farmen überfällt. Legen Sie ihr das Handwerk, Logan. Ich kann Ihnen leider keinen Partner zur Seite stellen, weil sämtliche Marshals irgendwo im Panhandle unterwegs sind. Sie werden also völlig auf sich alleine gestellt sein.«
»Das ist nicht zu ändern«, versetzte ich.
»Ich wünsche Ihnen Hals- und Beinbruch, Logan«, sagte der Richter.
Ich bedankte mich und ritt noch in der derselben Stunde. Mein Ziel war Wheeler. Für die hundert Meilen kalkulierte ich zweieinhalb Tage ein. Da ich um die Mittagszeit los ritt, würde ich am dritten Tage gegen Abend die Stadt erreichen.
Ich ritt nach Osten und erreichte gegen Mittag des nächsten Tages die Quelle des McClellan Creek. Das Land, über das ich ritt, gehörte der Diamant-B Ranch, einer Unterranch der Green Belt. Rudel von Rindern kreuzten meinen Weg. Einmal begegnete ich zwei Cowboys.
Es war ein regnerischer Tag. Die Wolken hingen tief, ein scharfer Wind trieb sie nach Osten. Es war nasskalt. Ich hatte die Jacke zugeknöpft und den Kragen hochgeschlagen. Aus den Wäldern ringsum stieg weißer Dampf. Bis vorgestern war es noch heiß gewesen. Wir schrieben April. Der Frühling zeigte seine Launen.
Die Nacht verbrachte ich zwischen den Hügeln, durch die der McClellan Creek sein Bett gegraben hatte. Mond und Sterne waren hinter Wolken verborgen. Wenigstens regnete es nicht. Aber der Boden war feucht. Die Kälte kroch durch die Decke und durch meine Kleidung und zog in mich hinein. An Schlaf war kaum zu denken. Das Säuseln des Windes umgab mich. Manchmal schrie ein Kauz, der in der Dunkelheit auf Jagd war. Es klang gespenstisch durch die Nacht.
Als ein heller Streifen über dem östlichen Horizont den Tagesanbruch ankündigte, stand ich auf. Ich fühlte mich wie gerädert. Aber je länger ich mich bewegte, umso geschmeidiger wurde ich. Ich rollte die Decke zusammen und schnallte sie hinter dem Sattel fest. Dann aß ich etwas Dörrfleisch und Brot und trank dazu Wasser.
Dann ritt ich weiter. Es wurde grau. Über dem Creek hingen Nebelbänke. Der McClellan Creek mündete in den North Fork Red River. Ich hatte noch etwa zwanzig Meilen bis Wheeler zurückzulegen.
Der Tag kam. Es begann zu nieseln. Ich zog meinen Regenumhang an. Meile um Meile trug mich das Pferd dahin. Ich ritt über das Gebiet der Circle-M Ranch, einer Hauptranch der Panhandle Cattle Company. Irgendwann verließ ich den North Fork und ritt quer durch die Wildnis. Wheeler lag drei Meilen südlich des Sweetwater Creek. Gegen Mittag lag die Stadt vor mir. Rauch stieg aus den Schornsteinen der Häuser. Eine Dunstglocke hing über der Stadt. Typische Geräusche klangen mir entgegen; Hammerschläge, das Rumpeln eines Fuhrwerks, das die Main Street entlang fuhr, Kindergeschrei.
Ich ritt zwischen die ersten Häuser. Der Regen hatte den Staub der Main Street in Matsch verwandelt. Tief sanken die Pferdehufe ein. Die Spuren füllten sich sofort mit Wasser. Von den Vorbaudächern tropfte Regenwasser. Einige Passanten blieben stehen und beobachteten mich. Ein Hund zog schräg über die Straße und verschwand zwischen zwei Häusern.
Ich ritt zum Mietstall. Das Tor stand offen. Drin war es düster. Beim Tor saß ich ab und führte das Pferd an der Trense ins Stallinnere. Der Stallbursche war dabei, eine Box auszumisten. Mit einer Forke spießte er Stroh und Mist auf und schaufelte es in eine Schubkarre. Jetzt lehnte er die Mistgabel weg und kam mir entgegen.
»Hallo, Logan«, grüßte er. »Lange nicht mehr in Wheeler gewesen. Sie kommen sicher wegen der Überfälle auf die Farmen.«
»Das ist richtig.«
»Zuletzt wurde die Wilson Farm überfallen«, erklärte der Stallmann. »Den alten Wilson und eine beiden Söhne haben die Banditen getötet, Ann Wilson haben sie verschleppt. Eine Woche vorher überfiel die Bande die Campbell Farm. Ken Campbells zehnjähriger Sohn wurde geraubt. Campbell überlebte. Eine Kugel streifte ihn am Kopf und die Banditen hielten ihn für tot.«
»Weiß man etwas über die Bande?«, fragte ich.
»Drei Amerikaner, drei Rothäute und ein Halbblut«, antwortete der Stallmann. »Der Anführer soll Kayitah heißen. Sagt man. Auf der Bush Farm, die zuerst überfallen wurde, soll der Name gefallen sein.«
»Kathe Wilson soll den Überfall auf ihre Farm überlebt haben. Wo befindet sie sich?«
»Sie ist bei Nachbarn untergeschlüpft. Bei den Osbornes. Die arme Frau. Hat den Mann und zwei Söhne bei dem Überfall verloren. Sie können sich denken, dass sie mit den Nerven am Ende ist.«
Ich nickte. »Versorgen Sie mein Pferd. Ich werde etwas essen und dann weiterreiten.« Mit dem letzten Wort zog ich das Gewehr aus dem Scabbard, dann verließ ich den Mietstall, um in den Saloon zu gehen. Ich aß ein Steak und trank ein Bier, danach rauchte ich eine Zigarette, und dann kehrte ich zum Mietstall zurück.
»Sieht so aus, als würde die Bande nach ihren Überfällen ins Indianerterritorium verschwinden«, sagte der Stallmann. »Wenn Sie sie dort aufstöbern wollen, Marshal, wird sich das wie die Suche nach der Nähnadel im Heuhaufen gestalten.«
»Das ist zu befürchten«, pflichtete ich bei, dann übergab mir der Mann mein Pferd und ich führte es nach draußen, wo ich aufsaß und dem Tier die Zügel freigab.
Ich ritt zum Sweetwater und folgte ihm nach Westen. Nach einer Stunde Ritt stand ich vor einer niedergebrannten Farm. Vom Farmhaus war nur noch ein Brandschutthaufen übrig. Verkohlte Balken und Bretter lagen kreuz und quer durcheinander. Es roch brenzlig. Asche wurde vom Wind hochgewirbelt und fortgetragen. Ich saß ab und ging um dieses Werk sinnloser Zerstörung herum. Hinter einem Schuppen sah ich drei frische Gräber. Provisorische Holzkreuze steckten in den flachen, noch feuchten Erdhügeln.
Mein Mund war wie ausgetrocknet. Die Gräber waren Zeugnis dafür, dass in unserem Land Recht und Ordnung noch auf recht schwachen Beinen standen. In den wenigen Städten und kleinen Ortschaften, die es im Panhandle gab, war kein Gesetz etabliert. Die Menschen nahmen oftmals das Recht selbst in die Hand. Auf dem Land der PCC herrschte das Gesetz der freien Weide, wogegen wir natürlich ankämpften, aber wir standen oft auf verlorenem Posten.
Ich stand vor den drei Gräbern. Meine Gedanken bewegten sich. Was war aus den jungen Frauen und Kindern geworden, die die Bande verschleppt hatte? Verkauften sie sie an die Indianer? Ich schwor mir, den Mördern das Handwerk zu legen. Der Tod dieser Männer musste vergolten werden. Und es waren nicht nur die drei Wilsons, die auf das Konto der Bande gingen.
Ich ritt weiter. Und nach etwa einer weiteren Stunde lagen die Gebäude einer Farm vor mir. Alles mutete grau in grau an. In zwei Pferchen tummelten sich Ziegen und Schafe. In einer Koppel weidete eine Milchkuh. Hühner pickten in den Schlamm auf der Suche nach Fressbarem. Ein Hahn empfing mich mit durchdringendem Krähen.
Zunächst blieb alles ruhig. Aber mir entging nicht der Gewehrlauf, der aus dem Fenster links neben der Tür ragte. Gleich darauf aber erschien ein Mann im Türrechteck. »Hallo, Marshal.«
Ich hielt vor dem Farmhaus an und ließ mich vom Pferd gleiten. »Hallo. Bin ich auf der Osborne Farm?«
»Ja. Ich bin Brad Osborne. Im Moment ist es gut, misstrauisch zu sein, wenn Fremde auf die Farm kommen.« Es klang wie eine Entschuldigung dafür, dass er zunächst auf mich gezielt hatte.
»Ich weiß. Bei Ihnen befindet sich Mrs. Wilson?«
»Ja. Die arme Kathe. Sie ist krank. Die Psyche. Aber das ist ja kein Wunder, nach allem, was ihr widerfahren ist.«
Ich schlang den langen Zügel um den Hitchrack, der vor dem Haus errichtet war. »Ich möchte mit der Frau sprechen.«
Der Farmer ging vor mir her ins Haus. In der Küche befanden sich zwei Frauen und zwei Kinder. Die beiden Kinder, ein Junge und ein Mädchen von etwa sechs Jahren, spielten auf dem Fußboden mit Bauklötzen, die ihnen ihr Vater aus einem dünnen Balken gesägt hatte. Eine der Frauen stand am Herd. Sie war um die dreißig und schätzungsweise handelte es sich um Mrs. Osborne. Die andere Frau saß am Tisch. Sie war um die fünfzig. Ihre Augen waren gerötet, ihr Gesicht vom Weinen verquollen. Mit erloschenem Blick schaute sie mich an.
Ich war mir sicher, Kathe Wilson vor mir zu haben.
Mein Gruß wurde von Mrs. Osborne erwidert. Die beiden Kinder musterten mich mit großen Augen. Brad Osborne forderte mich auf, Platz zu nehmen und ich setzte mich auf einen der Stühle, die um den Tisch herum standen. »Ich möchte mit Ihnen sprechen, Mrs. Wilson«, sagte ich leise.
Die Frau nickte. "Es war so schrecklich. Mein Mann und meine Söhne hatten keine Chance. Diese Banditen haben Ann mitgenommen. Ich– ich werde meine Tochter wohl nie wieder sehen.«
»Ich werde alles daransetzen, was in meiner Macht steht, um Ihnen Ihre Tochter zurückzubringen«, sagte ich und es klang wie ein Versprechen.
Die Frau senkte den Blick und schwieg.
»Sind bei dem Überfall Namen gefallen?«, fragte ich sie.
Sie schüttelte nach kurzer Überlegung den Kopf.
»In welche Richtung sind die Banditen davon geritten?«
»Sie folgten dem Creek nach Osten.«
Mehr war aus der Frau nicht herauszuholen. Ich gab es auf. Sie tat mir Leid. Leider half ihr mein Mitleid nichts. Und ich leistete einen Schwur– den Schwur erst zu ruhen, wenn ich ihre Tochter gefunden und ihr zurückgebracht hatte.
Ich verabschiedete mich und ging hinaus. Brad Osborne folgte mir. »In ihr ist seit jener Nacht etwas zerbrochen«, sagte er. »Ich bitte Sie, Marshal, tun Sie alles, um ihr Ann zurückzubringen.«
»Ich werde mein Möglichstes tun«, versprach ich, saß auf und ritt an. Ich kehrte zur Wilson Farm zurück und folgte von ihr aus dem Creek nach Osten. Wildnis umgab mich. Im Ufergebüsch zwitscherten Vögel. Das Land war hügelig. Der Wind kam von Westen. Es gab einige Hufabdrücke, aber ich wusste nicht, ob sie von den Banditen stammten. Weit vor mir erhob sich Wald. Das Land stieg an. Die dunkle Front des Waldes wirkte bedrohlich. Ich hielt an und ließ meinen Blick schweifen. Aber da war nichts, das auf Gefahr hingedeutet hätte. Ich verspürte Anspannung und war darauf eingestellt, gedankenschnell zu reagieren. Langsam ritt ich weiter. Ungeschoren erreichte ich den Waldrand.
Als ein Mann aus dem Unterholz trat, fuhr meine Hand zum Gewehr. Er hielt die Winchester in der Armbeuge. Der Lauf wies schräg zum Boden. Der Mann rief: »Lassen Sie Ihr Gewehr ruhig stecken, Marshal. Mein Name ist Campbell. Die Bande hat meine Farm überfallen und meinen Jungen geraubt.«
Ich hielt inne, meine Hand sank nach unten. Unabhängig davon wäre ich niemals schnell genug gewesen. Wenn er sich als Feind entpuppt hätte, wäre er mir gegenüber auf jeden Fall im Vorteil gewesen. Ich legte beide Hände übereinander auf das Sattelhorn und beugte mich etwas im Sattel nach vorn. »Sie reiten auf der Spur der Bande?«
»Ja. Ich will meinen Jungen zurückholen.«
Ich schaute mir den Mann genauer an. Er war ungefähr einsachtzig groß und grobschlächtig. Gekleidet war er mit einer braunen Hose und einer schwarzen, zerschlissenen Jacke. Er hatte sich einen Revolver umgeschnallt. Seine Pranken waren gut, um einen Pflug zu führen. Ob er damit besonders geschickt einen Revolver und ein Gewehr bedienen konnte, bezweifelte ich. Unter dem verbeulten Hut lag um seinen Kopf eine verschmutzte Binde.
»Die Bande besteht aus sieben Mann«, gab ich zu bedenken.
»Sie hat meinen Jungen geraubt. Ich will Kenny zurückholen. Meine Frau wird wahnsinnig, wenn sie den Jungen nicht zurück erhält. Darum werde ich erst wieder nach Hause zurückkehren, wenn ich Kenny aus der Gewalt der Bande befreit habe.«
»Reiten Sie nach Hause«, sagte ich. »Überlassen Sie es mir, Ihren Jungen und die anderen Entführten zu befreien. Sie wollen doch nicht, dass Ihre Frau Sie auch noch verliert.«
»Nein, Marshal. Ich habe es geschworen. Ohne Kenny kehre ich nicht nach Hause zurück. Der Junge ist mein ein und alles. Ich könnte nicht leben mit dem Gedanken, dass er irgendwo in einem Indianerdorf oder bei den Banditen aufwächst. Ich reite mit Ihnen. Vier Augen sehen mehr als zwei.«
»Nein«, lehnte ich ab. »Es ist mein Job. Sie sind Farmer, aber kein Kämpfer. Sie wären mir nur ein Klotz am Bein. Reiten Sie nach Hause und kümmern Sie sich um Ihre Frau. Mein Wort haben Sie, dass ich alles tun werde, um Kenny zu befreien.«
Ich zog mein Pferd halb um die linke Hand und ritt am Waldrand entlang.
*
Ich befand mich längst im Indianerland. Von Ken Campbell hatte ich nichts mehr gesehen, und ich hoffte, dass er meinem Rat gefolgt und nach Hause geritten war. Der Sweetwater mündete in den North Fork Red River. Diesem Fluss folgte ich. Ich ging davon aus, dass sich die Bande nicht allzu weit vom Wasser entfernte. Es war später Nachmittag, als ich einer Kavallerie-Patrouille aus Fort Sill begegnete. Ein Captain führte sie. Ich sprach mit ihm. Doch er konnte mir nicht helfen. »Das Land ist weit und einsam«, sagte er. »Da kann eine Horde Banditen verschwinden wie ein Staubkorn in der Wüste.«
Ich kehrte um und kam, als es schon längst finster war, nach Wheeler zurück.
»Kein Glück gehabt, wie?«, fragte der Stallmann. Im Stall brannte eine Laterne und spendete etwas Licht. Es roch nach Heu, Stroh und Pferdeausdünstung. Einige dicke Fliegen summten um die Laterne herum.
»Nein«, antwortete ich. »Die Spuren sind verwischt. Eine Patrouille, die ich traf, konnte mir auch nicht weiter helfen.«
»Was gedenken Sie jetzt zu tun?«
»Ich muss abwarten«, versetzte ich.
Der Stallbursche verzog das Gesicht. »Abwarten, bis die Bande wieder eine Farm überfällt?«
Ich nickte. »Und eine Spur hinterlässt, der ich folgen kann.«
»O verdammt! Wenn das kein Hohn ist. Es müssen also erst wieder Menschen sterben…«
Ich nahm meine Satteltaschen und die Winchester und verließ den Stall. Im Hotel bekam ich ein Zimmer. Ich zog lediglich die Stiefel aus, nahm den Revolvergurt ab und legte mich aufs Bett. Mit hinter dem Kopf verschränkten Händen starrte ich in die Dunkelheit hinein. Die Worte des Stallmannes klangen in mir nach. Es müssen also erst wieder Menschen sterben…
Mir zog sich der Magen zusammen.
Irgendwann schlief ich ein. Mir steckten die Strapazen des Rittes in den Knochen und die Müdigkeit überwältigte mich. Als ich aufwachte, war es im Zimmer noch düster. Vor dem Fenster hing das Morgengrauen. Sofort begann sich mein Denken wieder um die Bande zu drehen. Ich konnte nicht abwarten, bis wieder Menschen starben. Darum beschloss ich, noch einmal ins Indianerland zu reiten. Vielleicht konnte man mir im Dorf von Häuptling Büffelhorn die Auskünfte erteilen, die ich benötigte, um die Bande zu stellen. Ich schüttete Wasser aus der gusseisernen Kanne in die Waschschüssel und warf mir einige Hände voll ins Gesicht, strich mir mit den feuchten Fingern durch die Haare und schlüpfte dann in meine Stiefel. Nachdem ich den Revolvergurt umgelegt und meinen Hut aufgesetzt hatte, verließ ich das Hotel. Das Tor des Mietstalles war geschlossen, aber nicht verriegelt. Ich zog es auf und es knarrte rostig in den Scharnieren. Auf einer Futterkiste stand eine Laterne, die ich anzündete.
Als ich mein Pferd sattelte, kam aus seinem Verschlag der Stallmann. Er gähnte laut und sagte dann: »Es lässt Ihnen wohl keine Ruhe, Marshal, wie? Sie wollen nicht abwarten, bis wieder Menschen dran glauben müssen. Wo wollen Sie den Hebel ansetzen?«
»Ich reite zum Dorf von Häuptling Büffelhorn. Vielleicht kann man mir dort etwas über die Bande sagen.«
»Die Comanchen sind uns Weißen nicht gerade freundlich gesonnen«, warnte der Stallbursche.
»Ich war schon des Öfteren in dem Dorf.« Mir kam in den Sinn, dass ich vor einigen Wochen von einem Krieger erfahren hatte, dass Büffelhorn nicht mehr Häuptling war. Der Comanche hatte mir erklärt, dass Büffelhorn seiner Häuptlingswürde enthoben worden war, weil ihn die Comanchen für einen Feigling hielten, der alles tat, um den Weißen zu gefallen. Einen Moment wollten Zweifel in mir aufkeimen. Wenn nun ein Weißenhasser an Büffelhorns Stelle getreten war…
Das Pferd war gesattelt und gezäumt. Ich führte es aus dem Stall und kletterte in den Sattel. Dann ritt ich los. Die Nase meines Pferdes wies nach Osten, wo sich der Horizont aufzuhellen begann. Ich ritt dem beginnenden Tag entgegen. In mir war ein Zwiespalt aufgerissen. Hin und wieder hatte ich das Empfinden, dem Tod direkt in die Arme zu reiten.
Ich ritt den ganzen Tag. Gegen Abend sah ich dann fünf berittene Indianer auf einer Hügelkuppe. Sie verhielten in einer Reihe und starrten zu mir herunter. Ein mulmiges Gefühl wollte mich befallen. Mein Pferd hatte ich angehalten. Es trat unruhig auf der Stelle, spielte mit den Ohren und prustete.
Plötzlich trieben die Rothäute ihre Mustangs an. Im Trab kamen sie den Abhang herunter, drei Pferdelängen vor mir hielten sie an. Wortlos fixierten sie mich. Zwei von ihnen waren mit Gewehren bewaffnet. Die anderen hatten nur Pfeil und Bogen. In Rohlederschlingen an den Seiten ihrer Pferde steckten Lanzen. Die Krieger trugen Tomahawks an den Gürteln. Ihre Pferde peitschten mit den Schweifen und tänzelten.
Ich hob die rechte Hand und zeigte ihnen die Handfläche. »Mein Name ist Bill Logan. Ich vertrete das Gesetz des weißen Mannes und komme in Frieden. Versteht einer von euch meine Sprache?«
Einer der Krieger nahm sein Pferd hart in die Kandare und es stand ruhig. »Ich bin Low Dog. Wir sind Comanchen. Was willst du in unserem Land?«
»Ich suche eine Bande von Mördern. In ihr reiten Indianer, ein Halbblut und drei Amerikaner. Ihre Spur verliert sich im Indianerland. Sie haben junge weiße Frauen und Kinder entführt.«
»Und du suchst sie ausgerechnet in unseren Jagdgründen?«
»Ich wollte zu Häuptling Büffelhorn, um ihn nach den Mördern zu fragen. Eure Jäger und Späher kommen im Land herum. Vielleicht haben sie etwas gesehen.«
»Büffelhorn ist ein alter, zahnloser Wolf geworden. Er ist nicht mehr Häuptling.«
»Wer ist an seine Stelle getreten?«
»White Bull. Ein starker Mann, ein tapferer Mann.«
»Bringt mich zu ihm.«
»Er mag keine Weißen. Sie sprechen mit gespaltener Zunge und brechen die geschlossenen Verträge. Ich rate dir, umzudrehen, Mann des Gesetzes.«
»Ist euch die Bande bekannt?«
»Du sprichst von Kayitah und seinen Männern, nicht wahr?«
»So ist es. Wo finde ich die Schufte?«
»Kayitah ist ein Comanche. Du kannst nicht erwarten, dass ich ihn verrate.«
»Er mordet und brandschatzt mit seinen Banditen, und entführt junge Frauen und Kinder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Comanchen das gut heißen. Irgendwann raubt er vielleicht auch eure jungen Frauen und Kinder. Wer weiß das schon.«
»Das wagt er nicht. Wir würden ihn bestrafen.«
»Bringt mich zu White Bull.«
Der Krieger nickte. Der Pulk nahm mich in die Mitte. Dann ritten wir zwischen die Hügel. Nach einer Stunde, es war schon finster, erreichten wir das Lager. Es lag an einem schmalen Creek. Schätzungsweise hundert Tipis standen um einen großen, freien Platz herum, auf dem ein Totempfahl errichtet war. Feuer brannten und erleuchteten den Platz. In mehreren Corrals sah ich wohl an die hundertfünfzig Pferde. Es gab Pferche mit Ziegen und Schafen.
Ich wurde auf den freien Platz in der Dorfmitte gebracht. Männer und Frauen versammelten sich um uns herum. Raunen und Flüstern erfüllte die Luft. Glitzernde Augen starrten mich an. Ich verspürte ein seltsames Kribbeln in der Magengegend…
*
Die Krieger, die mich ins Dorf gebracht hatten, saßen ab. Auch ich stieg vom Pferd. Im Pulk der Neugierigen bildete sich eine Gasse. Ein Mann, der von zwei Kriegern flankiert wurde, betrat den Kreis. Seine Brauen waren finster zusammengeschoben. Er war mittelgroß und untersetzt. In seinem Haarknoten steckten drei Federn. Jetzt verschränkte er die muskulösen Arme vor der Brust und musterte mich herausfordernd.
»Mein Name ist Bill Logan«, sagte ich. »Ich bin US-Deputy-Marshal beim Distrikt Gericht in Amarillo. Als ich das letzte Mal hier war, war Büffelhorn noch Häuptling.«
»Das ist lange her. Jetzt bin ich Häuptling dieses Dorfes. Ich bin White Bull. Was willst du?«
»Ich suche Kayitah und seine Bande.«
»Kayitah hat den Kampf gegen die Weißen wieder aufgenommen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Er mordet und brandschatzt und entführt unschuldige Frauen und Kinder. Das ist kein Krieg, den er führt. Kayitah ist ein Bandit. Nach dem Gesetz der Weißen erwartet ihn der Galgen.«
»Ich weiß nicht, wo sich Kayitah versteckt hält«, erklärte White Bull. »Du magst Recht haben, Marshal. Er ist ein Bandit. Aber er ist auch Comanche. Selbst wenn ich wüsste, wo er sich befindet, würde ich es dir nicht verraten.«
»Dann machst du dich mitschuldig, wenn Kayitah wieder tötet und verschleppt. Kämpfen die Comanchen seit Neuem gegen Frauen und Kinder?«
»Hüte deine Zunge, weißer Mann.«
»Was wird aus den jungen Frauen und Kindern, die Kayitah verschleppt?«, fragte ich unbeeindruckt.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht verkauft er sie. Es gibt viele weiße Männer, die in unser Land kommen, um mit uns Geschäfte zu machen.«
»Comancheros«, sagte ich. »Sie beliefern die Indianer mit Schnaps und Waffen. Auch das ist verboten. Machst du auch mit ihnen Geschäfte, White Bull?«
Der Häuptling winkte ab. »Wir können dir nicht helfen, Marshal. Ich rate dir, unser Land so schnell wie möglich zu verlassen. Wenn wir dich noch einmal antreffen, werden wir dich wie einen Feind behandeln. Was das heißt, brauche ich dir sicher nicht zu sagen.«
»Du hilfst einem Mörder, White Bull.«
»Geh, ehe ich es mir anders überlege, Marshal. Und verlass auf dem schnellsten Weg unser Land. Wir wollen dich hier nicht. Ich habe dir sonst nichts zu sagen.«
Ich sah ein, dass ich hier nicht weiter kam. Deshalb stieg ich auf mein Pferd, zog es herum und ritt an. Ich trieb es in den Creek hinein und durchquerte ihn. Hinter mir herrschte Stille. Bald schlug die Finsternis über mir zusammen. Ich schaute zurück. Im Schein der Feuer sah ich die Indianer.
Meine Mission war ein Misserfolg gewesen. Ich verspürte Enttäuschung.
Ich blieb in der Nähe des Dorfes und es gelang mir sogar, einige Stunden zu schlafen. Als der Morgen graute, erwachte ich. In dem Dorf wurden Feuer angezündet. Ich schlich näher und sah zunächst nur Squaws, die ihr Tagwerk begonnen hatten. Nach und nach kamen aber auch die Krieger und Kinder ins Freie. Irgendwo bellte ein Hund. Aus dem Dorf sickerten verworrene Geräusche heran. Ich sah einen Mann zu den Corrals gehen. Er fing sich ein Pferd und ritt wenig später davon.
Ich holte meinen Vierbeiner und folgte ihm. Er ritt nach Norden. Nach zwei Stunden ritt er in ein Tal, in dem ein kleiner See lag, der von einem Bach gespeist wurde. Bei dem See standen einige Zelte. In einem Seilcorral befanden sich über ein Dutzend Pferde. Drei Kinder spielten am Rand des Sees. An einem Tisch, der im Freien errichtet war, saßen vier Männer und spielten Karten. An einem großen Kochfeuer standen zwei Frauen. Über den Flammen hing ein verrußter Kessel von einem eisernen Dreibein.
Ich war mir sicher, am Ziel zu sein. Der Krieger hatte mich zum Versteck von Kayitah und seiner Bande geführt. Zufriedenheit breitete sich in mir aus.
Ich beobachtete das Lager. Der Indianer ritt bis zu den Zelten. Die vier Männer am Tisch erhoben sich. Aus den Zelten krochen weitere Männer. Auch einige Frauen kamen heraus. Die Männer scharrten sich um den Indianer, der von seinem Mustang gestiegen war. Jetzt erzählte er ihnen sicherlich, dass ein US-Deputy-Marshal ins Indianerland gekommen war, um der Bande das blutige Handwerk zu legen.
Plötzlich löste sich einer der Kerle aus dem Pulk und rannte nach Süden, kletterte auf einen Hügel und schaute in die Richtung, aus der der Indianer gekommen war. Nach kurzer Zeit kehrte er um und lief in das Lager zurück. Der Indianer verließ das Lager wieder.
Ich hatte das Camp der Banditen gefunden. Aber konnte ich es wagen, mich an die siebenfache Übermacht heranzumachen? Alleine war es mir unmöglich, die Bande zu überwältigen. Ich wünschte mir Joe her. Aber selbst zu zweit wäre es ein tödliches Risiko gewesen.
Ich beschloss, das Camp zu beobachten. Und am Nachmittag sattelten die Banditen ihre Pferde und ritten fort. Ich setzte mich auf ihre Fährte. Die Kerle zogen nach Westen, und ich war davon überzeugt, dass sie wieder auf Raubzug gingen. Aber dieses Mal wollte ich ihnen die Suppe versalzen.
Die Abenddämmerung senkte sich ins Land, und bald kam die Nacht. Die Banditen hatten einen kleinen Fluss erreicht, dem sie nach Nordwesten folgten. Ich orientierte mich an den Geräuschen, die die Bande verursachte. Das Klopfen der Hufe meines Pferdes ging in diesen Geräuschen unter.
Dann sah ich das einsame Licht vor mir. Es war eine Farm. Die Hufschläge vor mir brachen ab. Das Klirren von Gebissketten drang heran. Ein Wiehern ertönte. Ich saß ab, band mein Pferd an einen Strauch, nahm das Gewehr und lief zu Fuß weiter, schlug einen Bogen um die Bande und erreichte die Farm.
Da erbebte auch schon die Erde unter achtundzwanzig Hufen. Die Banditen griffen an. Sie kamen nicht leise, still und heimlich, sondern mit viel Lärm. Schüsse krachten, Querschläger jaulten.
Aus einem Fenster der Farm wurde das Feuer eröffnet. Die Banditen schwenkten in eine Kreisbahn ein und stoben um das Farmhaus herum. Ich begann zu schießen und putzte einen Sattel leer. Mein zweiter Schuss fällte ein Pferd. Der Reiter flog durch die Luft und überschlug sich am Boden, taumelte hoch und wurde im nächsten Moment von einer Kugel umgerissen. Geschrei wurde laut. Spitze, abgehackte Rufe erklangen. Es war das Kriegsgeschrei der Comanchen, das einige der Banditen ausstießen. Wieder wurde ein Sattel leergefegt. Die anderen Banditen drehten plötzlich ab und donnerten in die Nacht hinein. Aus dem Haus folgte ihnen eine Kugel und riss einen der Kerle vom Pferd. Drei Banditen gelang die Flucht.
Dann war der Spuk zu Ende. Die Waffen schwiegen. Der Pulverdampf verzog sich. Ich rief: »Ich bin U.S. Marshal Bill Logan und komme jetzt aus der Deckung. Schießen Sie nicht auf mich.«
»Das kann jeder behaupten!«, erklang es wild. »Nehmen Sie die Arme hoch. Und seien Sie versichert, dass ich bei der geringsten falschen Bewegung schieße.«
Ich verließ den Schlagschatten des Schuppens und ging in den Hof. Stöhnen war zu vernehmen. Im Haus erklang eine Stimme: »Pass auf, Archie. Wenn er eine falsche Bewegung macht, schicke ihm heißes Blei.«
»Worauf du dich verlassen kannst, Pa.«
Eine Frauenstimme sagte: »Gib acht, Jason. Diesen Schuften ist nichts heilig.«
»Keine Sorge, Susan.«
Ein Mann kam ins Freie. Er näherte sich mir mit angeschlagenem Gewehr. Ein leichter Druck genügte…
Doch dann schien er meinen Stern zu sehen. »Sind Sie wirklich Marshal?«
»Haben Sie denn nicht bemerkt, dass ich Ihnen geholfen habe, die Bande in die Flucht zu schlagen?«
»Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, die Kerle mit heißem Blei einzudecken. Wo kommen Sie plötzlich her?«
Zuletzt war wieder Misstrauen im Ton seiner Stimme zu hören.
»Ich bin den Banditen gefolgt, und als mir ihre Absicht klar wurde, habe ich die Bande überholt und hier erwartet. Es handelt sich um Kayitah und seine Outlaws. Aber schätzungsweise haben wir die Bande ziemlich dezimiert.«
Der Mann senkte das Gewehr. Er ging zu einer der schlaffen Gestalten hin und beugte sich über sie. Ich folgte ihm. »Der scheint tot zu sein.«
Ich fühlte den Puls des Banditen und kam zu demselben Schluss. Zwei der Kerle lebten noch. Einer hatte eine Kugel in die Schulter bekommen, der andere in die rechte Brustseite. Wir verbanden die Banditen, den Burschen mit dem Schulterschuss fesselte ich. Dann sagte ich zu dem Farmer: »Die beiden brauchen einen Arzt. Ich kann nicht in die Stadt reiten, um ihn zu holen. Übernehmen Sie das. Ich muss den übrigen Banditen folgen.«
»Es sind immerhin noch drei Mann«, murmelte der Farmer. »Und es sind mit allen schmutzigen Wassern gewaschene Halsabschneider.«
»Ich kann sie nicht entkommen lassen«, sagte ich. »Außerdem kenne ich ihr Versteck.« Ich wandte mich an den Banditen mit der zerschossenen Schulter. Es war ein Amerikaner. »Wo sind die jungen Frauen und Kinder geblieben, die ihr geraubt habt?«
Der Kerl spuckte mich an. Mir juckte es mächtig in den Händen. Doch ich zwang mich zur Ruhe. Mit dem Halstuch wischte ich mir den Speichel aus dem Gesicht. »Wie ist dein Name?«
»Das geht dich einen Dreck an, Sternschlepper. Meine Freunde werden mich befreien. Und dich schicken sie zum Satan.«
Der Bursche saß auf einem Stuhl in der Küche des Farmhauses. Ich packte ihn an der Hemdbrust und zog ihn in die Höhe. »Du wirst dir jetzt die beiden Toten ansehen und mir sagen, ob Kayitah unter ihnen ist.«
Ich bugsierte ihn hinaus und nahm die Lampe mit, die auf dem Tisch stand. Der Lichtschein fiel in die bleichen Gesichter der Toten. Es waren ein Indianer und das Halbblut. Ich deutete auf den Indianer. »Ist das Kayitah?«
»Nein. Kayitah wird dir die Haut streifenweise abziehen.«
»Ich erwische ihn vorher«, versprach ich und trieb den Banditen ins Haus zurück.
*
Ich war auf dem Trail. Das Versteck der Banditen kannte ich, und so musste ich mich nicht mit Spurensuche abgeben. Ich ritt zwischen den Hügeln, ab und zu hielt ich an, um zu lauschen. Einmal glaubte ich fernen Hufschlag zu vernehmen. Doch ich konnte mich auch getäuscht haben, denn das Geräusch erklang nicht wieder.
Ich schonte mein Pferd nicht, denn ich wollte die Banditen überholen, um ihnen den Weg zu verlegen. Und dann war ich der Meinung, weit genug geritten zu sein. Bei einer Gruppe von Sträuchern saß ich ab und stellte mein Pferd ab. Dann postierte ich mich hinter einem hüfthohen Felsblock, der aus dem Boden ragte. Meine Geduld wurde auf keine lange Probe gestellt, dann war das Pochen von Hufen zu vernehmen. Die Banditen ritten langsam. Wahrscheinlich rechneten sie nicht mit Verfolgung.
Dann schälten sich drei Reiterschemen aus der Dunkelheit. Ich riegelte eine Patrone in die Kammer der Winchester. Für den Bruchteil einer Sekunde stand das metallische Geräusch in der Luft. Die drei fielen ihren Pferden abrupt in die Zügel. Aber ihre Überraschung dauerte wirklich nur zwei Herzschläge lang. Dann erklang ein scharfer Laut, sie trieben ihre Pferde auseinander und griffen nach den Revolvern.
Die Waffen begannen zu brüllen. Mündungsblitze zuckten aus den Läufen und zerrten für Augenblicke die Schützen aus der Dunkelheit. Das Wummern erfüllte die Nacht.
Ich feuerte aus der Hüfte. Ein Pferd stieg wiehernd auf die Hinterhand, ein dumpfer Fall erklang. Die beiden anderen Reiter verschwanden in der Finsternis. Brandendes Hufgetrappel erklang, das aber jäh abbrach. Wahrscheinlich waren die Kerle abgesessen und bezogen nun Position.
Ich war auf das linke Knie niedergegangen, um ein möglichst kleines Ziel zu bieten. Der Nachtwind streifte mein Gesicht wie ein Hauch des Todes. Die Detonationen waren verebbt. Das Stampfen von Hufen ertönte, irgendwo knackte ein dürrer Ast.
Ich lief zu meinem Pferd, band es los und führte es davon, um den Platz zu verlassen, ehe sie mich in die Zange nahmen. Das Gewehr stieß ich in den Scabbard. Dafür nahm ich den Remington in die Hand und spannte den Hahn. Einen der Banditen hatte ich erwischt. Sie waren nur noch zu zweit. Aber ich durfte sie auf keinen Fall unterschätzen.
Obwohl das Gras den Hufschlag dämpfte, war er zu hören. Ich spürte Anspannung. Jeder meiner Sinne war aktiviert, meine Muskeln waren gestrafft. Ich ließ meinen Instinkten freien Lauf. Da sah ich die huschende Bewegung vor mir. Sofort hielt ich drauf. Mein Schuss donnerte, wie eine glühende Speerspitze stieß die Mündungsflamme in die Finsternis hinein. In der Dunkelheit glühte es auf, aber ich hatte den Zügel sausen lassen und war zur Seite geglitten. Mein Pferd schnaubte erregt und scharrte mit dem Huf. Mit einem Satz kam ich in den Sattel, mit einem harten Schenkeldruck trieb ich das Tier an. Es setzte sich in Bewegung.
Einige Schüsse folgten mir. Aber ich bot ein schlechtes Ziel, und die Banditen schossen viel zu hastig und ungezielt. Die Dunkelheit mutete fast stofflich und greifbar an. Nach etwa hundert Yards zügelte ich und stieg ab. Hufgeräusch prallte heran. Es entfernte sich. Die Banditen setzten ihre Flucht fort.
Es konnte aber auch eine Heimtücke sein. Deshalb wartete ich. Doch nach einer Viertelstunde war ich mir sicher, dass die Kerle fort waren. Ich ließ mein Pferd zurück und huschte zu der Stelle, an der ich einen der Schufte vom Pferd geschossen hatte. Er lag am Boden. Sein Pferd hatten wohl seine Kumpane mitgenommen, denn von dem Tier war weder etwas zu sehen noch zu hören. Ich beugte mich über den Burschen. Er stöhnte lang gezogen.
»Wie heißt du?«, fragte ich flüsternd, erhielt aber keine Antwort. Lediglich ein erneutes Röcheln ertönte. Ich wagte nicht, ein Streichholz anzuzünden. Mit der linken Hand tastete ich den Mann ab. Und dann spürte ich Feuchtigkeit an meinen Fingerkuppen.
»Kannst du mich verstehen?«, fragte ich.
Ein Ächzen war die Antwort.
Ich holte mein Pferd, nahm die Wasserflasche vom Sattel, schraubte sie auf und gab dem Burschen zu trinken. »Geht es jetzt?«, fragte ich, nachdem ich die Flasche abgesetzt hatte.
»Es– es geht dahin«, keuchte der Bandit. »Wer– wer bist du?«
»U.S. Deputy Marshal Bill Logan. Wie ist dein Name?«
»John Walker. Hölle, Marshal, du hast ganz schön aufgeräumt mit uns. Du– du bist schlimmer als ein Wolf.«
»Was habt ihr mit den Frauen und Kindern gemacht, die ihr entführt habt?«
»Richards hat sie uns abgekauft.« Die Stimme klang schwach wie ein Windhauch, und ich musste mein Ohr ganz nahe an den Mund des Sterbenden heranbringen, um ihn überhaupt zu verstehen. »Louis Richards. Er treibt Geschäfte mit den Indsmen. Die– die Frauen und Kinder bringt er nach Mexiko.«
»Wo befindet sich das Versteck von Richards?« Der Bandit wimmerte leise vor sich hin. Ich rüttelte ihn leicht an der Schulter. »Sprich. Wo hält sich Richards versteckt?«
»Am– am Beaver Creek hat er ein Camp. Aber er ist wohl auf dem Weg nach Mexiko.«
»Wie viele Leute hat Richards?«
Ich erhielt keine Antwort. Der Bandit bäumte sich auf, fiel zurück, ein Seufzer brach aus seiner Kehle, dann rollte sein Kopf zur Seite. Es war vorbei. Ich richtete mich auf, schraubte die Wasserflasche zu und hängte sie an den Sattel. Dann saß ich auf und ritt weiter.
Ich war ein Bündel angespannter Aufmerksamkeit. Die Konturen der Hügel zeichneten sich scharf gegen den etwas helleren Hintergrund des Himmels ab. Die Gefahr war allgegenwärtig. Der Tod konnte hinter jedem Hügel, hinter jedem Strauch lauern. Bis jetzt konnte ich jedoch zufrieden sein. Ich hatte einen Überfall auf eine Farm verhindert, und ich hatte erfahren, was mit den geraubten Frauen und Kindern geschah. Mir kam das das Versprechen in den Sinn, das ich Kathe Wilson gegeben hatte, das Versprechen, alles zu tun, um ihr Ann zurückzubringen. Aber Mexiko war viele hundert Meilen entfernt. Und ich hatte keine Ahnung, wohin ich mich wenden musste. Einen Moment dachte ich mit Beklemmung daran, dass ich mein Versprechen wohl nicht würde einhalten können.
Meile um Meile trug mich das Pferd durch die Nacht. Und nach einigen Stunden erreichte ich das Tal, in dem die Banditen ihr Camp aufgeschlagen hatten. Es war ruhig. Ich beobachtete das Tal. Die beiden Banditen kamen nicht. Wahrscheinlich waren sie schon vor mir angekommen. Ich setzte mich an einen Felsen und döste vor mich hin. Mein Pferd machte es sich auf dem Boden bequem. Als der Morgen graute, wurde es in dem Camp lebendig. Die Zelte wurden abgebrochen und auf Pferde verladen. Ich zählte sechs Frauen, drei Kinder und sah die beiden Banditen, denen ich in der Nacht gefolgt war.
Der Zug bewegte sich in östliche Richtung aus dem Camp. Ich saß auf und ritt zu der Stelle, an der er sich zwischen die Hügel bewegen würde. Die beiden Banditen ritten voraus. Zwei der Frauen waren aufgesessen. Die anderen gingen neben den Pferden und führten sie am Zaumzeug. Die Kinder und ein Hund liefen zwischen den Pferden.
Ich trieb mein Pferd hinter dem Hügel hervor, der mich schützte. Der Zug kam zum Stehen. Die Hände der Banditen hatten sich auf die Revolverknäufe gelegt. Mit einer Mischung aus Erschrecken und lauernder Wachsamkeit fixierten sie mich.
Ich hielt den Remington in der Faust. Langsam ritt ich auf die Kerle zu. Plötzlich rissen sie die Revolver aus den Holstern. Ich feuerte zweimal. Die beiden kippten von den Pferden und stürzten zu Boden. Die Detonationen verklangen mit geisterhaftem Geraune. Die Frauen starrten mich an. Die Kinder waren zu ihren Müttern gelaufen und klammerten sich an sie.
Ich schwang mich vom Pferd und ging, den Revolver im Anschlag, zu den beiden Banditen hin. Es waren ein Amerikaner und ein Indianer. Der Amerikaner hatte meine Kugel in die Brust bekommen. Ich wandte mich dem Indianer zu. »Du bist Kayitah, nicht wahr?«
Er musterte mich unter halb gesenkten Lidern hervor. In seinen Augen glomm der Hass. In seinen Mundwinkeln zuckte es. »Du bist der Marshal, vor dem uns White Bull warnen ließ, wie?«
»Ja. Ich bin dem Boten White Bulls zu eurem Lager gefolgt.«
Eine der Frauen kam nach vorn und beugte sich über den Banditen. Leise sprach sie auf ihn ein. Dann schaute sie mich an. Es war eine Indianerin. Sie sagte: »Die Kugel hat sein Schlüsselbein zerschmettert. Ich werde ihn verbinden. Du hast doch sicher nichts dagegen.«
»Nein. Verbindet auch den anderen Mann.«
Die Indianerin ging zu einem der Pferde und holte Verbandszeug aus der Satteltasche. Die anderen Frauen halfen ihr, die beiden Banditen zu verbinden. Die Indianerin trat an mein Pferd heran. »Mitch Fletcher wird sterben. Seine Lunge ist verletzt.«
»Ich lasse ihn bei euch. Kayitah nehme ich mit. Was werdet ihr tun?«
Die Indianerin zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich gehen wir nach Fort Sill. Und dann sehen wir weiter. Die weißen Frauen, die sich bei uns befinden, kehren sicher in die Zivilisation zurück.«
»Steh auf, Kayitah«, sagte ich. »Ich bringe dich nach Amarillo. Dort wirst du vor Gericht gestellt. Auf dich wartet der Henker.«
Der Indianer spuckte verächtlich auf den Boden und stand auf. Er hielt sich ziemlich schief. Die Indianerin half ihm aufs Pferd und sagte zu ihm etwas in der Sprache der Comanchen. »Noch sind wir nicht in Amarillo«, knurrte der Bandit.
»Vorwärts«,, gebot ich und fügte warnend hinzu: »Solltest du versuchen, mir Probleme zu bereiten, wirst du quer über dem Pferderücken in Amarillo ankommen.«
Er knirschte mit den Zähnen.
*
Ich verspürte Müdigkeit. Der Körper verlangte sein Recht. In den vergangenen Tagen war ich kaum richtig zur Ruhe gekommen. Vor mir ritt der Bandit. Gegen Mittag erreichten wir die Farm, auf der ich zwei verwundete Banditen zurückgelassen hatte. Einer der Kerle war gestorben. Der Farmer sagte: »Der Doc war da und hat dem Schuft die Kugel aus der Schulter geholt. Für den anderen kam jede Hilfe zu spät.«
»Den mit der zerschossenen Schulter werde ich mitnehmen«, erwiderte ich und fühlte mich nicht wohl in meiner Haut beim Gedanken daran, mit den beiden Banditen hundert Meilen bis Amarillo reiten zu müssen. Aber das musste ich auf mich nehmen. Ich würde eben auf der Hut sein müssen, denn die beiden Banditen würden alles unternehmen, um dem Henker zu entgehen.
»Ich brauche einige Stunden Schlaf«, sagte ich zu dem Farmer.
»Sie können sich in der Scheune ins Heu legen. Auf die beiden Höllenhunde passen wir schon auf.«
»Ich werde sie an den Wagen fesseln.«
Das Fuhrwerk stand am Rand des Hofes. Ich fesselte die beiden Banditen mit Handschellen an zwei der Räder. Dann kroch ich ins Heu. Ich schlief bis zum Abend. Die Farmerfrau hatte essen gekocht. Nachdem ich gesättigt war, brachte ich auch den beiden Banditen eine Portion von dem Gemüse mit Pökelfleisch. Sie aßen schweigend. Dann brachen wir auf. Die Banditen ritten mit auf den Rücken gefesselten Händen. Ich ging kein Risiko ein. Die Zügel der beiden Pferde hatte ich miteinander verknüpft, das Tier, auf dem Kayitah saß, führte ich an der Longe.
Am zweiten Tag nach unserem Aufbruch erreichten wir den McClellan Creek. Ich ritt zur Diamant-B Ranch, wo ich mich ausschlief. Die beiden Banditen hatte ich im Pferdestall an eine Futterraufe gefesselt. Ich gab ihnen nicht den Hauch einer Chance. Der Hass, den sie verströmten, berührte mich geradezu körperlich.
Weitere anderthalb Tage später erreichte ich Amarillo. Ich lieferte die beiden Gefangenen im Gefängnis ab, dann machte ich mich daran, die Pferde zu versorgen.
Ein Mann betrat den Pferdestall. »Hallo, Logan-Amigo.«
Es war Joe Hawk.
»Hi, Joe. Alles klar?«
»Ich habe meinen Job in Borger erledigt«, sagte Joe. »Ab sofort stehe ich dir wieder zur Verfügung.« Mein Freund und Partner grinste.
»Dann kannst du mir ja gleich helfen, die Pferde zu versorgen«, sagte ich und erwiderte sein Grinsen.
Joe ließ sich nicht zweimal bitten. »Wie war es bei dir?«
»Ich habe die Bande, die die Überfälle im Grenzgebiet durchführte, zerschlagen«, erzählte ich. »Einige der Kerle starben. Zwei habe ich nach Amarillo gebracht, unter ihnen den Anführer des Rudels. Sein Name ist Kayitah. Er ist Comanche.«
»Ich habe in Borger Pat Henderson und Cash Reynolds geschnappt. Henderson starb. Reynolds sitzt im Gefängnis.«
»Also warst du auf der ganzen Linie erfolgreich.«
»So kann man es sagen. Hast du schon einen neuen Fall?«
»Meiner ist noch nicht abgeschlossen«, erklärte ich. »Ein Bandit namens Richards hat von Kayitah die geraubten Frauen und Kinder übernommen und nach Mexiko gebracht. Ich habe mir geschworen, Richards das Handwerk zu legen und die Frauen und Kinder zurückzubringen.«
»Hast du das schon mit dem Richter abgesprochen?«
»Nein. Aber ich schätze, der Chef wird nichts dagegen einzuwenden haben.«
Eine halbe Stunde wusste ich es genau. »Es ist in Ordnung, Logan«, sagte der Richter. »Bereiten Sie den Machenschaften dieses Louis Richards ein Ende und holen Sie die Frauen und Kinder zurück. Ich wünsche Ihnen viel Glück.«
»Danke.«
Eine weitere halbe Stunde später waren Joe und ich auf dem Weg.
Der Beaver Creek verlief südöstlich von Fort Sill. Bis Fort Sill lagen zweihundert Meilen vor uns. Wir planten eine Woche ein. Nach drei Tagen überschritten wir die Grenze zum Indianerterritorium. Ich dachte an die Warnung White Bulls. Wenn mich die Comanchen noch einmal in ihren Jagdgründen erwischten, würden sie mich als Feind behandeln.
Meine Augen waren unablässig in Bewegung und sicherten in die Umgebung. Wälder bedeckten die Hügelflanken und zogen sich weit in die Senken hinein. Ich hatte das Gefühl, von tausend Augen beobachtet zu werden. Wir ritten an einem Waldrand entlang. Dichtes Unterholz wucherte zwischen den uralten Stämmen. Im Wald war es düster.
Die Nacht kam und wir lagerten auf einer Waldlichtung. Ein Feuer wagten wir nicht anzuzünden. Wir aßen Pemmican und tranken dazu Wasser. Über uns spannte sich ein bewölkter Himmel. Es roch nach Regen. Ein kühler Wind wehte.
Wir wachten abwechselnd. Ich übernahm die erste Wache. Gegen Mitternacht weckte ich Joe. »Alles ruhig«, sagte ich. »Aber das kann sich Morgen ändern. Wir sollten uns nicht in Sicherheit wiegen.«
»Bei Gott– nein«, murmelte Joe.
Ich rollte mich in meine Decke und schlief wenig später ein.
Am Morgen weckte mich Joe, nach einem kargen Frühstück ritten wir weiter. Um die Mitte des Vormittags trieben vier Indianer ihre Mustangs aus einer Lücke zwischen den Hügeln. Sie zügelten und starrten zu uns her.
Auch wir hatten angehalten. Anspannung hatte von mir Besitz ergriffen. Ich hatte keine Ahnung, ob uns die Indianer freundlich oder feindlich gesonnen waren. Vorsichtshalber griff ich nach der Winchester und zog sie aus dem Scabbard. Auch Joe nahm seine Waffe zur Hand und repetierte.
Plötzlich zogen die vier Comanchen ihre Pferde herum und trieben sie zwischen die Hügel zurück. Joe und ich wechselten einen Blick. Dann setzten wir unsere Pferde in Bewegung. Wir ritten an der Hügellücke vorbei und waren darauf gefasst, dass die Indianer jeden Moment über uns herfielen.
Der Angriff erfolgte dennoch wie aus heiterem Himmel. Sie kamen über den Hügelkamm zu unserer Rechten und stoben pfeilschnell den Abhang herunter. Spitzes, abgehacktes Geschrei wurde laut und vermischte sich mit dem trommelnden Hufschlag zu einer Art Höllensymphonie.
Wir sprangen von den Pferden und gingen hinter den Tieren in Deckung, legten an und schossen, zielten aber über die Köpfe der Krieger hinweg. Vielleicht konnten wir sie einschüchtern und bewegen, zu verschwinden.
Als sie auf fünfzig Yards heran waren, trieben sie die Pferde auseinander. Sie begannen zu schießen. Zwei der Kerle schossen mit Pfeilen. Jetzt wurde es ernst. Ich feuerte auf eines der Pferde und das Tier brach vorne ein, rutschte ein Stück über den Boden und kippte schließlich um. Der Reiter sprang ab und ging auf das Knie nieder, feuerte mit einem Gewehr auf uns. Mein Pferd brach zusammen. Ich warf mich dahinter in Deckung. Joes Pferd riss sich los und stob mit fliegenden Steigbügeln davon. Mein Partner warf sich neben mich in die Deckung des Tierkadavers.
Ich zielte auf einen der Krieger, der weit über den Pferdehals gebeugt heranjagte. Er bäumte sich auf und stürzte vom Pferd, überschlug sich einige Male am Boden und blieb liegen. Joe schoss den Kerl von den Beinen, dessen Pferd ich getötet hatte. Einer der anderen Reiter war heran und warf sich mit dem Dolch in der Faust auf mich. Ich kam hoch und empfing ihn mit einem wuchtigen Faustschlag, der ihn auf den Rücken warf. Dann zog ich blitzschnell den Remington, und als der Krieger auf die Beine schnellte, schoss ich. Ich konnte keine Rücksicht mehr nehmen. Es ging um Leben oder Tod.
Joes Gewehr krachte. Das Pferd mit dem letzten der Comanchen brach zusammen. Der Krieger sprang auf und setzte seinen Angriff zu Fuß fort. Mit dem Peitschen von Joes Gewehr brach er zusammen.
Wir hatten den Kampf für uns entschieden.
Einer der Krieger lebte noch. Aber sein Gesicht war bereits vom nahen Tod gezeichnet. Er röchelte. Joe holte sich einen der Mustangs, saß auf und folgte seinem Pferd. Nach einer Viertelstunde kam er zurück. Er hatte sein Pferd gefunden und führte das Indianerpferd am Rohlederzügel mit sich. Ich hatte meinem Tier den Sattel abgenommen und legte ihm nun dem Mustang auf, den Joe führte.
Ich ging zu dem sterbenden Indianer hin. »Kommt ihr aus White Bulls Dorf?«
Der Comanche schwieg. In seinem Gesicht zuckten die Muskeln. Schmerz wütete in seinen Zügen. Die Augen wiesen einen fiebrigen Glanz auf. Blut pulsierte aus der Wunde in seiner Brust.
»Wir müssen ihn verbinden«, sagte ich zu Joe. »Wenn es für ihn auch keine Hilfe gibt. Gib mir dein Verbandszeug.«
Es dauerte eine Viertelstunde. Dann hatte ich den Krieger versorgt. Ich zündete ein Feuer an und warf feuchtes Holz in die Flammen. Vielleicht sahen andere Jagdtrupps den Rauch und kamen her…
*
Joe und ich ritten weiter.
Eine Woche nach unserem Aufbruch in Amarillo erreichten wir Fort Sill. Das Tor war geöffnet. Über dem Tor standen zwei Posten auf dem Wehrgang. Wir wurden von einer Torwache angehalten. Der wachhabende Offizier kam aus dem Wachlokal. »Was hat Sie denn ins Indianerland verschlagen?«, fragte er. »Kommen Sie aus Fort Smith? Sind Sie Marshals von Richter Parker?«
»Wir kommen aus Texas«, sagte ich. »Mein Name ist Bill Logan. Das ist mein Kollege Joe Hawk. Wir sind zum Beaver Creek unterwegs. Dort soll das Versteck eines Comancheros namens Louis Richards sein. Er verkauft geraubte Kinder und junge Frauen nach Mexiko.«
»Ich denke, ein Bursche namens Kayitah macht das Grenzgebiet unsicher«, bemerkte der Wachhabende.
»Der sitzt in Amarillo im Gefängnis«, versetzte ich. »Sie wissen also nichts von diesem Richards?«
»Nie gehört den Namen. Aber im Indianerterritorium versteckt sich eine Menge Gesindel vor dem Gesetz.«
Wir ritten weiter und hielten vor der Kommandantur an, saßen ab und schlangen die Zügel um den Querholm. Dann gingen wir hinein. Ein Ordonnanzsoldat meldete uns bei Major Duncan, dem Fortkommandanten, an. Und eine Minute später schon betraten wir das Büro Duncans.
Der Major war ein mittelgroßer, schlanker Mann mit Glatze. Ein Bart zierte sein Gesicht. Der Blick seiner Augen war stechend. Er saß hinter seinem Schreibtisch. Hinter ihm an der Wand war eine Karte des Gebietes befestigt, das er von Fort Sill aus kontrollierte. Da standen auch die Flagge der Vereinigen Staaten und die Flagge der Kavallerieeinheit, die im Fort stationiert war.
Nachdem wir saßen, begann der Major: »Für das Indianerterritorium ist das US-District Criminal Court des Western District of Arkansas zuständig, über das Charles Parker Gerichtsherr ist. Was also verschlägt US-Deputy-Marshals aus Texas in diesen Landstrich?«
»Es gab immer wieder Überfälle im Grenzgebiet«, sagte ich. »Ein Mann namens Kayitah überfiel mit seiner Bande Farmen in Texas und raubte Kinder und junge Frauen. Die Bande ist zerschlagen, Kayitah wartet in Amarillo auf den Henker. Von einem der Banditen erfuhr ich, dass Kayitah die Kinder und Frauen an einen Comanchero namens Louis Richards verkaufte. Und dessen Versteck soll am Beaver Creek liegen.«
»Nie gehört den Namen«, erklärte der Fortkommandant.
»Wir dachten, dass wir im Fort vielleicht einen Hinweis erhalten könnten«, knurrte Joe. »Aber das war wohl ein Trugschluss.«
»Captain O'Leary ritt am Beaver Creek Patrouille«, sagte Duncan und erhob sich, ging zur Tür und öffnete sie. »Schicken Sie Captain O'Leary zu mir!«, rief er in das Vorzimmer mit den Ordonnanzen, dann kam er zum Schreibtisch zurück und ließ sich wieder nieder. »Hatten Sie Begegnungen mit Rothäuten?«
»Vier Krieger griffen uns an«, antwortete ich. »Es kam zu einem Kampf.«
»Da Sie in Fort Sill angekommen und unversehrt sind, nehme ich an, dass es den vier Kriegern schlecht bekam.«
»Drei mussten wir tot zurücklassen. Der vierte bekam eine Kugel in die Brust. Wir haben ihn verbunden. Ob er überlebt hat ist fraglich.«
»Diese Burschen reagieren oftmals ziemlich sauer, wenn Weiße durch ihr Gebiet streifen.«
»White Bull ist ein Weißenhasser«, sagte ich. »Ich war auf der Suche nach Kayitah in seinem Dorf. Er hat Büffelhorn abgesetzt und sich an dessen Stelle geschwunden.«
»Mit White Bull ist nicht gut Kirschen essen. Ich weiß. Und auf dem Rückweg werden Sie höllisch aufpassen müssen.«
Der Captain kam und salutierte vor seinem Vorgesetzten.
»Stehen Sie bequem, Captain«, sagte der Major, dann fuhr er fort: »Sie sind am Beaver Creek Patrouille geritten. Sind Sie auf das Camp eines Comancheros gestoßen? Sein Name ist Louis Richards.«
Der Captain nickte. »Da war ein Camp. Zwei Männer und einige Frauen sowie Kinder befanden sich dort. Bei den Frauen handelte es sich um Indianerinnen, bei den Männern um Amerikaner. Sie erzählten uns, dass sie beschlossen hatten, am Beaver Creek zu leben. Zwischen ihnen und den Comanchen herrsche Frieden. Es gab für mich keinen Grund, sie zu vertreiben.«
»Ich vermisse diese Ausführung in Ihrer Meldung, Captain.«
»Ich hielt es nicht für wichtig, Sir. Warum sollten sich nicht zwei Weiße mit ihren indianischen Frauen im Indianerterritorium ansiedeln?«
»Schon gut, Captain. Nannten die Weißen Namen?«
»Ben Nichols und Warren Coulter.«
»Kam Ihnen nicht der Verdacht, dass es sich um Comancheros handelt?«, fragte ich.
»Doch. Wir haben auch das Camp durchsucht. Aber Nichols und Coulter hatten nichts auf ihren Planwagen, das sich für Geschäfte mit den Indianern geeignet hätte. Schon gar keinen Schnaps oder Waffen. Ich hatte nichts in der Hand gegen die beiden.«
»Sie können gehen, Captain«, sagte der Major. »Vielen Dank.«
Der Captain legte die Hand an die Mütze, machte zackig kehrt und verließ das Büro. Nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hatte, sagte ich: »Es handelt sich wahrscheinlich um das Camp von Richards. Richards selbst dürfte auf dem Weg nach Mexiko sein, um die Frauen und Kinder, die ihm Kayitah geliefert hat, zu verkaufen. Wir reiten sofort weiter.«
Eine Viertelstunde später waren wir auf dem Weg. Wir ritten nach Osten und erreichten nach zwölf Meilen den Beaver Creek, dem wir nach Süden folgten. Es ging auf den Abend zu. An diesem Tag war manchmal die Sonne herausgekommen. Jetzt stand sie über dem Horizont im Westen. Wolkenbänke schoben sich immer wieder vor sie. Der Himmel begann sich rot zu verfärben. Die Schatten waren lang.
Schließlich ging die Sonne unter. Die Schatten verblassten. Die Dämmerung hüllte das Land ein. Der Himmel im Westen schien zu brennen. Rötlicher Schein lag auf den Hügelflanken. Der Fluss hatte die Farbe flüssiger Bronze.
Die Nacht kam. Wir kampierten. Am Morgen ging es weiter. Und wir fanden das Camp. Es lag in einem Canyon, durch den der Creek floss. Es gab Gras für die Pferde, die in einem zum Fluss hin offenen Seilcorral standen. Zwei Conestoga-Schoner standen am Felsen. Ein Feuer brannte, über dem ein eiserner Kessel hing. Zwei Männer, die bei einem der Wagen saßen und würfelten, erhoben sich und griffen nach ihren Gewehren, die an einem der Räder lehnten.
Eine Frau war am Flussufer und wusch Wäsche. Eine andere trug einen Eimer voll Wasser zum Feuer. Vier Kinder spielten am Fluss. Auf einem der Fuhrwerke zeigte sich eine dritte Frau. Es waren Squaws. Bei den Kindern handelte es sich um Halbbluts.
Zehn Schritte vor dem Feuer hielten Joe und ich an. Die beiden Weißen belauerten und. Jeder hielt das Gewehr an der Hüfte und die Mündung zeigte schräg zum Boden.
»Aaah«, rief einer der beiden. »Zwei Sternschlepper. Wen jagt ihr denn?«
»Einen Hombre, der von Kayitah geraubte Frauen und Kinder gekauft und sie nach Mexiko verschleppt hat«, versetzte ich kühl.
Das Lauern in den Augen der beiden verstärkte sich. Die Gesichter waren jetzt wie aus Granit gemeißelt. »Wie soll denn dieser Hombre heißen?«, fragte einer der beiden.
»Louis Richards.«
Von einer der Frauen kam ein verlöschender Ton.
»Ihr beide seid Nichols und Coulter, nicht wahr?«, fragte ich.
Einer nickte.
»Wo finden wir Richards? Ist er unterwegs nach Mexiko?«
Die Gewehre der beiden ruckten hoch. Ohne jede Warnung wollten sie uns von den Pferden schießen. Ich ließ mich augenblicklich zur Seite kippen, schüttelte die Steigbügel ab, krachte auf den Boden und rollte herum. Schüsse peitschten. Doch die beiden Banditen hatten sich nicht mehr schnell genug auf das so jäh veränderte Ziel einstellen können. Und als sie sich von ihrer Überraschung erholt hatten und das neue Ziel suchten, brüllten unsere Revolver auf.
Die beiden wurden herumgerissen. Der eine brach sofort zusammen, der andere machte das Kreuz hohl und griff sich mit beiden Händen an die Brust. Sekundenlang stand er schwankend auf den Beinen. Dann stürzte auch er. Aus den Mündungen unserer Revolver kräuselten Rauchfäden. Die Squaws standen vor Schreck wie gelähmt da. Die Kinder beim Fluss beobachteten uns. Plötzlich fing einer der Kleinen an zu weinen und rannte zu seiner Mutter, die ihn schützend in den Arm nahm.





























