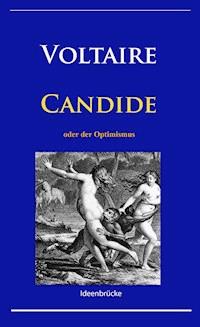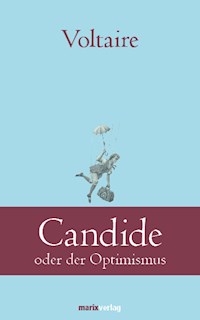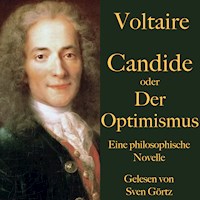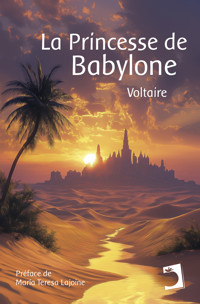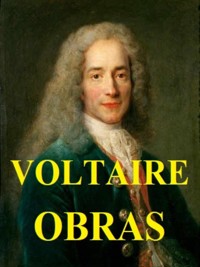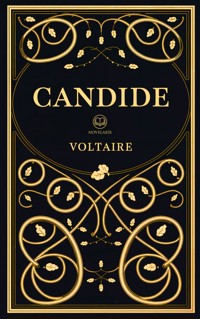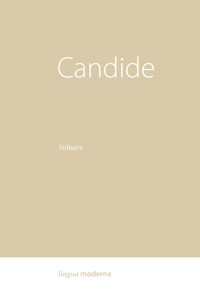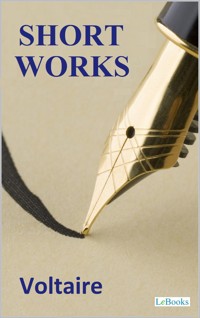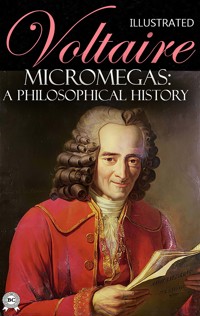7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Voltaires 1763 erschienenes Plädoyer für Toleranz zwischen den Religionen war nie so aktuell wie heute. Seit den Anschlägen auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo hat sich seine Kritik des religiösen Fanatismus wie ein Lauffeuer verbreitet, er selbst gilt als zentrales Symbol für die Freiheit des Geistes: Voltaire-Plakate, versehen mit dem Slogan »Je suis Charlie«, sind in ganz Paris zu sehen. Seine Streitschrift Über die Toleranz wird zusammen mit Kugelschreibern und Stiften als Mahnmal auf vielen Straßen Frankreichs platziert und ist zur Schullektüre avanciert. 250 Jahre nach ihrem Erscheinen ist Voltaires Kampfansage an den Fanatismus und den Aberglauben brisanter und dringlicher denn je. Höchste Zeit, sie zu lesen! Mit einem Vorwort von Laurent Joffrin (Chefredakteur "Libération")
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Voltaires 1763 erschienenes Plädoyer für Toleranz zwischen den Religionen war nie so aktuell wie heute. Seit den Anschlägen auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo hat sich seine Kritik des religiösen Fanatismus wie ein Lauffeuer verbreitet, er selbst gilt als zentrales Symbol für die Freiheit des Geistes: Voltaire-Plakate, versehen mit dem Slogan »Je suis Charlie«, sind in ganz Paris zu sehen. Seine Streitschrift Über die Toleranz wird zusammen mit Kugelschreibern und Stiften als Mahnmal auf vielen Straßen Frankreichs platziert und ist zur Schullektüre avanciert. 250 Jahre nach ihrem Erscheinen ist Voltaires Kampfansage an den Fanatismus und den Aberglauben brisanter und dringlicher denn je. Höchste Zeit, sie zu lesen!
Voltaire (1694-1778), eigentlich François-Marie Arouet, war einer der einflussreichsten französischen Philosophen. Mit seinen Werken zur Vernunft und zur Toleranz bereitete er den Weg für die Französische Revolution. Er gilt als der bedeutendste Protagonist der europäischen Aufklärung.
Laurent Joffrin, geboren 1952 in Vincennes, ist der Chefredakteur der französischen Tageszeitung Libération.
VoltaireÜber die Toleranz
Mit einem Vorwort vonLaurent Joffrin
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4656.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung
nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlagabbildung: FinePic*, München
Umschlag: Werbeagentur ZERO, München
ISBN 978-3-518-74169-6
www.suhrkamp.de
Über die Toleranz
Inhalt
I.
Von brennender AktualitätEin Vorwort von Laurent Joffrin
II.
Philosophisches Wörterbuch
Fanatismus
Toleranz
III.
Über die Toleranz; veranlaßt durch die Hinrichtung des Johann Calas im Jahre 1762
I. Von brennender Aktualität
Ein Vorwort von Laurent Joffrin
Als man Voltaire zum ersten Mal von der Affäre berichtet, geht er nicht gerade zimperlich mit der Familie Calas um: »Wir sind nicht viel wert, aber die Hugenotten sind schlimmer als wir, und außerdem haben sie gegen die Komödie gewettert.« An einem Oktoberabend des Jahres 1761 findet man in der Rue des Filatiers 16 in Toulouse Marc-Antoine, den Sohn der Familie Calas, erhängt an einem Strick im Erdgeschoss des Wohnhauses. Die Familie beschuldigt einen unbekannten Eindringling, der sich Zugang zum Haus verschafft haben soll. Aber die Tür zur Straße ist von innen verschlossen. In Windeseile kursiert in der Öffentlichkeit eine andere Version: In diesem protestantischen Haushalt wollte der junge Mann zum Katholizismus konvertieren; um dies zu verhindern, habe die Familie beschlossen, ihn umzubringen. Es ist diese Art eines Verbrechens aus Fanatismus, die Voltaire bestürzt. Zu diesem Zeitpunkt ist er noch schlecht informiert.
Am Ende eines ungerechten Prozesses in Zeiten des Protestantenhasses wird Jean Calas, der Vater, zum Tode verurteilt. Man zermalmt ihm die Knochen, man zwingt ihn, zwanzig Krüge Wasser zu trinken, man fesselt ihn auf das Rad und bricht ihm Arme und Beine, bevor man ihn erdrosselt und seinen Leib verbrennt. Jean Calas gesteht nicht. Trotz unsagbarer Schmerzen beharrt er bis zuletzt auf seiner Unschuld und bittet Gott, seinen Peinigern zu vergeben.
Wenig später wird Voltaire von einem Freund aufgeklärt. Der Prozess sei skandalös. Calas sei unschuldig, sein Sohn nicht umgebracht worden, er habe sich das Leben genommen. Der gemeinschaftliche Mord sei eine Erfindung der vox populi, gestützt von einer parteiischen Justiz, eine auf Intoleranz zurückgehende Lügengeschichte. Marc-Antoine sei melancholisch, er ertrug nicht den Gedanken an die ihm vorherbestimmte Zukunft. Wenn die Familie einen Herumstreunenden des Verbrechens beschuldigt habe, so deshalb, um ihrem Sohn das Schicksal von Selbstmördern zu ersparen, deren Körper erst mit dem Gesicht nach unten über den Boden geschleift und anschließend verscharrt wurden. Diese anfängliche Lüge hatte Verdacht erregt, die Voreingenommenheit des Toulouser Volkes ein Übriges getan. Die Untersuchungen leitete ein örtlicher Angestellter voller Vorurteile gegen die Hugenotten. Man setzte auf öffentliche Denunziation und die Strategie der Vorladung, die darin besteht, in Kirchen einen Text vorzulesen, der unter Androhung der Exkommunikation zur Zeugenaussage aufruft. Die Anschuldigungen gegen die Familie Calas häuften sich, allesamt basierend auf Gerüchten. Jean Calas wurde ohne Beweise verurteilt, auf der Grundlage eines Gerüchtes und des herrschenden Fanatismus.
Angestachelt von diesem Kriminalrätsel und entrüstet über die barbarische Exekution, empfängt Voltaire einen der Calas-Söhne in der Nähe von Genf. Die Anschuldigungen sind nicht haltbar, sagt der junge Mann. Der Vater, Jean Calas, habe Marc-Antoine sehr geliebt. Einer seiner Brüder sei zum Katholizismus konvertiert, ohne dass der Vater groß Anstoß daran genommen hätte. Als die Familie die Leiche entdeckte, stieß sie so laute Verzweiflungsschreie aus, dass sogar die Nachbarn sie hören konnten, was gegen einen gemeinschaftlichen Mord spricht. Und warum hätten die Calas ihren Sohn im Beisein eines Gastes umbringen sollen, vor der katholischen Dienerin, wozu deren Aussage riskieren, hätten sie den Mord doch in aller Ruhe zu einem besser geeigneten Zeitpunkt planen können? Einzig der Selbstmord ist logisch.
Voller Überzeugung zieht Voltaire in den Kampf. Mit 67 Jahren ist er auf dem Gipfel seines Ruhms angelangt. Gefragter Dramatiker, Verfasser unzähliger Schriften, Seele der philosophes, Vertrauter der Königshäuser, Liebling der Salons, ein ebenso bewunderter wie von der Kirche gefürchteter Schriftsteller. Zurückgezogen nach Ferney in der Nähe von Genf, wo er das Leben eines weisen Aufklärers führt, widmet er sich seinen Ländereien und korrespondiert mit ganz Europa. Zutiefst erschüttert über das Justizverbrechen, in dessen ungerechtem Urteil er den Beweis für seine Haltung zum religiösen Fanatismus zu erkennen glaubt, setzt er alles aufs Spiel – sein Ansehen, seinen Reichtum und bald sogar seine eigene Person –, um die Revision des Urteils und die Rehabilitation Calas' zu erreichen. Er schreibt unzählige Briefe an seine aristokratischen Freunde und an den Hof, er veröffentlicht Flugschriften, appelliert an die Obrigkeit, widerlegt schonungslos die Ankläger, spöttelt über die Argumente der Frömmler, sorgt für finanzielle Unterstützung der Familie Calas und lädt die Witwe des zu Tode Gefolterten zu sich.
Schließlich erfährt sein unermüdlicher Einsatz die Anerkennung der Mächtigen. Gnädig gestimmt von den Philippiken des Herren aus Ferney und im Bewusstsein, dass sich ein Großteil der Mitstreiter der Aufklärung für die Revision ausgesprochen hat, empfängt Ludwig XV. 1765 die Familie Calas. Sogleich beruft er seinen Ministerrat ein und beschließt, das Urteil aufzuheben. In einem zweiten Prozess wird Jean Calas für unschuldig erklärt; der König gewährt der Familie eine beträchtliche Entschädigung.
Der Autor setzte sich durch gegen die Kirche, gegen die Devoten, gegen die Justiz. Ein Jahrhundert vor Zola und der Geburt des »Intellektuellen« schuf Voltaire die durch und durch französische Figur des Schriftstellers, der sich im Namen universeller Werte gegen die Ungerechtigkeit der Obrigkeit engagiert.
Im Jahre 1763 erkennt er, mitten im Kampf, dass das Schicksal der Familie Calas im Grunde die gesamte Menschheit betrifft. Die gepeinigte Familie ist nicht nur traurige Hauptgestalt eines Justizfalles. Sie ist das symbolische Opfer der religiösen Intoleranz, die das 16. Jahrhundert mit Blut tränkte, die Tyranneien des 17. Jahrhunderts unterstützte und auch im Zeitalter der Aufklärung noch ihren verhängnisvollen Einfluss ausübt.
Unter Aufbietung all seiner stilistischen und intellektuellen Fähigkeiten verfasst Voltaire die Abhandlung über die Toleranz, die auch heute mächtige Auswirkungen nach sich zieht. Es ist ein aus bestimmten Umständen hervorgegangener Text: Er enthält einen Bericht über die Affäre Calas, satirische und philosophische Dialoge, lange historische Exkurse sowie mitreißende und überzeugende Plädoyers für das Recht auf Religionsfreiheit, solange sie sich auf den privaten Raum bezieht. Es ist ein klassischer Text: Angesichts der theokratischen Mächte, angesichts jeglicher Fanatismen, ist er ein Gift gegen Vorurteile, eine Anklage gegen die cagots, ein literarischer Rammbock, der mit wuchtigen Hieben die Tore des religiösen Dogmatismus einschlägt.
Wenn die Abhandlung auch heute noch einen unerwarteten Erfolg hat, so liegt es wohl daran, dass sie die neuen Mächte infrage stellt. Die katholischen Diktaturen haben sich rar gemacht, doch ist es der politische Islam mit seiner Modernisierungsverweigerung und seiner Tendenz, Religion in Tyrannei zu verwandeln, der zur aktuellen Zielscheibe der Voltaire'schen Prosa wird. Ein Journalist, der zu tausend Peitschenhieben verurteilt wird, eine Schülerin, die sich durch ihren Willen zur Bildung schuldig macht und Todesdrohungen erhält, enthauptete Geiseln, entführte und zwangsverheiratete Mädchen – sie sind die Calas von heute, geopfert im Namen eines tyrannischen Gottes von Gläubigen ohne Menschlichkeit. Ein von Vorurteilen beherrschtes Gericht, eine im Namen Gottes hasserfüllte Menschenmasse, die Ablehnung der Vernunft, das Gesetz Gottes als Ersatz für jenes der Menschen, politische Abrechnungen unter dem Deckmantel des Mitgefühls, grausame Strafen: Das Frankreich des Jahres 1763 hat nicht wenige Gemeinsamkeiten mit den heutigen Theokratien. Mit einer Ausnahme: Voltaire wurde weder gefangen genommen, noch wurde er mit dem Tode bedroht, seine Plädoyers konnten trotz allem verbreitet werden, und die politischen Mächte ließen sich am Ende davon überzeugen, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Die Modernisierungsbewegung hatte das Frankreich des 18. Jahrhunderts in eine pluralistische, vielgestaltige Gesellschaft verwandelt, die Monarchie war reformwillig, und die herrschenden Klassen waren gespalten in Traditionalisten und Verfechter der neuen Ideen. Die Revolution schwelte.
Was ist davon im heutigen Saudi-Arabien zu spüren? Ganz zu schweigen von den Grausamkeiten, die auf der Tagesordnung des »Islamischen Staats« stehen. Was Frankreich damals erlebte, spüren zahlreiche muslimische Nationen im Kampf, im Widerspruch; man denke nur an Tunesien, das die islamistische Gefahr durch einen Kompromiss vermied – eine Lösung, die Voltaire garantiert gutgeheißen hätte.
Die Kommentatoren werden zu bedenken geben, dass die Abhandlung über die Toleranz nicht gänzlich auf die Situation anzuwenden sei, die seit den Massakern von Charlie Hebdo und dem Hyper-Casher-Supermarkt herrscht. Voltaire plädiert eher für Gewissensfreiheit denn für Meinungsfreiheit. Farel, dem calvinistischen Extremisten, der seine Gegner auf den Straßen von Genf angreift, wirft er nicht vor, die Meinung der anderen zu unterdrücken, sondern ganz gezielt ihren Glauben. So macht er deutlich, das Gewissen muss frei sein, nicht aber dessen öffentliche Bekundung, die stets im Rahmen des guten Einvernehmens zwischen den Religionen zu verbleiben habe. Eine Besonderheit der Epoche, gewiss, in der die französischen Katholiken danach strebten, nicht nur die öffentliche Meinung bestimmen zu können, sondern auch die Ideen, die im privaten Raum entwickelt und verteidigt wurden. Voltaire will, dass jeder die Freiheit hat, das zu denken, was er möchte. Er ist nicht bereit, Provokationen oder direkte Angriffe auf diese oder jene Glaubensrichtung zu akzeptieren. Voltaire ist ein Mann des Geistes, der Mäßigung, heute würde man wohl sagen ein Pragmatiker, ein Verfechter des Laizismus.
Aber gerade in theokratischen Ländern würde die Gewissensfreiheit bereits einen enormen Fortschritt bedeuten. Die religiösen Minderheiten werden in Ländern des radikalen oder fundamentalistischen Islam in erster Linie dafür verfolgt, was sie sind, nicht dafür, was sie tun. Man will sie nicht nur in die Privatheit zurückdrängen, man will sie ausrotten. Die Voltaire'sche Toleranz würde sie einen bedeutenden Schritt voranbringen; die Abhandlung bleibt von brennender Aktualität, auch wenn sie durch das 18. Jahrhundert geprägt ist und durch die allumfassende Einflussnahme der Katholiken auf das soziale Leben, die man erst einmal aus den Häusern verbannen musste, bevor man die Freiheit des öffentlichen Raums verkünden konnte.
Ob Voltaire Charlie gewesen wäre? Wir werden diese Frage nicht beantworten. Denn sein Stil und die Klarheit seiner Argumente zerstreuen alle Vorbehalte. Die Sprache ist eine Waffe. Voltaire wendet sie gegen die Borniertheit von Dogmen, die Dummheit offenbarter Wahrheiten, törichte Tyrannei, die Einfältigkeit der Fanatiker. Darin besteht das Wesentliche. Darin liegt die unendliche Kraft dieser leuchtenden Prosa, deren Schein noch immer die Kakerlaken des Obskurantismus in die Flucht schlägt.
Aus dem Französischen von Sabine Erbrich
II. Philosophisches Wörterbuch
Fanatismus
I
Der Fanatismus verhält sich zum Aberglauben wie der Wahn zum Fieber oder die Raserei zum Zorn.
Wer in Ekstase verfällt und Visionen hat, wer Träume für Wirklichkeit nimmt und seine Einbildungen für Prophezeiungen, ist ein angehender Fanatiker, von dem viel zu erwarten ist: Bald wird er aus Liebe zu Gott zum Mörder werden können.
Bartolomeo Diaz war ein fanatischer Mönch. In Nürnberg hatte er einen Bruder mit Namen Johann, der als begeisterter Lutheraner fest überzeugt war, daß der Papst der Antichrist mit allen Merkmalen des Tieres sei. Bartolomeo, noch fester überzeugt, daß der Papst Gott auf Erden sei, brach von Rom auf, um einen Bruder zu bekehren oder zu töten, und er ermordete ihn. Das sind Tatsachen. Wir haben uns an anderer Stelle mit diesem Diaz genauer beschäftigt.
Polyeuktes,[1] der an einem Festtag in den Tempel stürmt, um die Standbilder umzustürzen und die Verzierungen abzuschlagen, ist zwar ein nicht so gräßlicher, aber ebenso dummer Fanatiker wie Diaz. Die Mörder des Herzogs François de Guise, des Prinzen Wilhelm von Oranien, der Könige Heinrich III. und Heinrich IV. und die vieler anderer waren von der gleichen Tollwut wie Diaz besessen.
Das abscheulichste Beispiel von Fanatismus lieferten die Pariser, als sie in der Bartholomäusnacht ihre Mitbürger, die nicht zur Messe gingen, ermordeten, aus dem Fenster stürzten und in Stücke rissen.
Guyon, Patouillet, Chaudon, Nonnotte und der ehemalige Jesuit Paulian sind nur unbedeutende Fanatiker, elende Schurken, die man ignoriert; aber an einem Bartholomäustag würden sie von sich reden machen.
Es gibt kaltblütige Fanatiker. Das sind die Richter, die Menschen nur deshalb zum Tode verurteilen, weil sie anderer Ansicht sind als sie selbst. Die Schuld dieser Richter wiegt um so schwerer, sie verdienen um so mehr den Abscheu der Menschheit, als sie nicht im Affekt handeln wie Clément, Chastel, Ravaillac und Damiens, sondern auf die Stimme der Vernunft hören könnten.
Hat der Fanatismus das Gehirn einmal verpestet, so ist die Krankheit fast unheilbar. Ich habe Verzückte gesehen, die sich im Gespräch über die Wunder des heiligen Paris in immer größere Raserei steigerten. Ihre Augen begannen zu glühen, sie zitterten am ganzen Leib, der Wahnsinn verzerrte ihr Gesicht, und sie hätten jeden getötet, der gewagt hätte, ihnen zu widersprechen.
Gegen diese Seuche gibt es kein anderes Mittel als den Geist der Philosophie, der, wenn er allmählich um sich greift, schließlich die Sitten der Menschen läutert und den Anfällen des Übels vorbeugt; denn wenn dieses Übel erst einmal Fortschritte macht, muß man flüchten und abwarten, bis die Luft wieder rein ist. Gesetze und Religion vermögen wenig gegen die Verpestung der Seelen. Die Religion ist keine bekömmliche Nahrung für solche verseuchten Seelen; in den infizierten Gehirnen wird sie zum Gift. Diese Elenden denken ständig an Aod, der den König Eglon ermordet, an Judith, die mit Holofernes schläft und ihm den Kopf abschneidet, an Samuel, der den König Agag in Stücke hackt, an den Priester Jojada, der seine Königin ermordet, wo die Rosse zum Hause des Königs gehen, usw. Sie denken immer nur an solche Taten, die in alten Zeiten achtbar gewesen sein mögen, in unserer Zeit aber Abscheu erregen müssen. Sie nähren ihren Fanatismus gerade mit der Religion, die ihn verdammt.
Die Gesetze vermögen noch weniger gegen solche Wahnsinnsanfälle: Das ist, als lese man einem Tobsüchtigen einen Ratsbeschluß vor. Solche Leute sind überzeugt, daß der Geist, von dem sie besessen sind, über den Gesetzen steht, daß ihre Verzückung das einzige Gesetz ist, dem sie Gehör schenken sollen.
Was soll man einem Menschen entgegenhalten, der sagt, er wolle lieber Gott als den Menschen gehorchen, und daher überzeugt ist, in den Himmel zu kommen, wenn er einem den Hals abschneidet?
Fast immer sind es Schurken, die die Fanatiker lenken und ihnen den Dolch in die Hand spielen. Sie gleichen dem Alten vom Berge, der, wie man sich erzählt, die Freuden des Paradieses Schwachköpfen zu kosten gab und ihnen diese Wonnen, von denen er ihnen einen Vorgeschmack gewährt hatte, für alle Ewigkeit versprach, falls sie alle umbringen würden, die er ihnen nannte. Nur eine einzige Religion in der Welt hat sich nicht mit dem Fanatismus besudelt, die der Gebildeten Chinas. Die Schulen der Philosophen waren nicht nur frei von dieser Seuche, sondern boten auch das Heilmittel gegen sie; denn die Philosophie bewirkt die Ruhe der Seele, und der Fanatismus ist mit der Gemütsruhe unvereinbar. Wenn unsere heilige Religion so oft durch diesen Höllenwahn korrumpiert worden ist, so ist das auf die Torheit der Menschen zurückzuführen.
Von dem Gefieder, das man ihm gab,machte Ikarus falschen Gebrauch:Es sollte zum Heile ihm dienen,doch nahm er nur Schaden davon.(Bertaud, Bischof von Séez)
II[2]
Die Fanatiker führen nicht immer die Kriege des Herrn, ermorden nicht immer Könige und Fürsten. Es gibt unter ihnen Tiger, aber noch mehr Füchse.
Was für ein Netz von Betrügereien, Verleumdungen, Schurkereien haben die Fanatiker der römischen Kurie gegen die Fanatiker Calvins, die Jesuiten gegen die Jansenisten gesponnen, et vicissim! Gehen wir weiter zurück, so erweist sich die Kirchengeschichte nicht nur als eine Schule der Tugend, sondern auch als eine Schule der Ruchlosigkeit in den Beziehungen der Sekten untereinander. Sie tragen alle die gleiche Binde vor den Augen, ob es nun darum geht, die Städte und Dörfer ihrer Gegner in Brand zu stecken und die Einwohner zu erwürgen oder zu foltern, oder ganz einfach darum, zu betrügen, sich zu bereichern und zum Herrn aufzuwerfen. Der Fanatismus macht sie blind, sie glauben, recht zu tun. Alle Fanatiker sind Schurken mit gutem Gewissen und morden in gutem Glauben an eine gute Sache.
Man lese, falls man dazu imstande ist, die fünf- oder sechstausend Bände mit all den Vorwürfen, die sich Jansenisten und Molinisten hundert Jahre lang ihrer Schurkereien wegen machten: Scapin und Trivelin[3] kommen da nicht mit.
[4]Eine besonders hübsche theologische Schurkerei hat sich meines Erachtens einmal ein kleiner Bischof geleistet (in der Erzählung wird uns versichert, es sei ein biskayischer Bischof gewesen; eines Tages werden wir schon seinen Namen und sein Bistum ergründen). Seine Diözese gehörte teils zur Biskaya und teils zu Frankreich.
Im französischen Teil lag ein Kirchspiel, das früher einmal von marokkanischen Mauren bewohnt worden war. Der Herr des Kirchspiels war kein Mohammedaner, sondern ein guter Katholik, wie die Allgemeinheit es sein sollte, da ja das Wort katholisch »allgemein« bedeutet.
Dieser arme Mann, der nur Gutes tat, wurde vom Bischof verdächtigt, in der Tiefe seines Herzens schlechte Gedanken und schlechte Gefühle zu hegen, so etwas wie ein Ketzer zu sein. Der Bischof beschuldigte ihn sogar, einmal im Scherz gesagt zu haben, in Marokko gäbe es ebenso anständige Menschen wie in der Biskaya und ein anständiger Marokkaner brauche durchaus kein Feind Gottes zu sein, der ja der Vater aller Menschen sei.
Unser Fanatiker schrieb einen großen Brief an den König von Frankreich, den Lehnsherrn dieses armen kleinen Pfarrherrn. In seinem Brief bat er den Lehnsherrn, dem verirrten Schäflein einen Wohnsitz in der Bretagne oder in der Normandie zuzuweisen, ganz wie es Seiner Majestät beliebe, damit er die Basken nicht mehr durch seine schlechten Scherze beeinflussen könne.
Der König von Frankreich und seine Räte machten sich mit Recht über diesen Narren lustig.
Als unser biskayischer Hirt einige Zeit später erfuhr, daß sein französisches Schäflein erkrankt war, untersagte er dem Hostienpriester des Kantons, ihm das Abendmahl zu reichen, falls es nicht einen Beichtzettel vorweise, aus dem hervorgehen müsse, daß der Sterbende nicht beschnitten sei, die mohammedanische Ketzerei und jede andere Ketzerei dieser Art, wie etwa den Calvinismus und Jansenismus, von ganzem Herzen verabscheue und in allen Dingen so denke wie er, der biskayische Bischof.
Beichtzettel waren damals sehr Mode. Der Sterbende ließ seinen Pfarrer, einen schwachköpfigen Trunkenbold, zu sich kommen und drohte, er werde ihn durch das Parlament von Bordeaux hängen lassen, wenn er ihm nicht sofort die heilige Wegzehrung reiche, nach der er dringendes Verlangen trage. Der Pfarrer hatte Angst. Er spendete dem Mann die Sakramente, und der erklärte nach der Zeremonie vor Zeugen laut und vernehmlich, der biskayische Seelenhirt habe ihn beim König fälschlich der Neigung zur mohammedanischen Religion beschuldigt, er sei ein guter Christ, der andere sei ein Verleumder. Diese Erklärung unterzeichnete er vor einem Notar.[5] Damit war die Sache geregelt. Sein Zustand besserte sich, und die Ruhe eines guten Gewissens machte ihn bald ganz gesund.
Der kleine Biskayer war außer sich, daß ein todkranker alter Mann sich über ihn lustig gemacht hatte, und beschloß, sich an ihm zu rächen. Das machte er folgendermaßen.
Er ließ vierzehn Tage danach in seiner Mundart ein angebliches Glaubensbekenntnis fabrizieren, das der Pfarrer entgegengenommen haben wollte. Unterzeichnet wurde es von dem Pfarrer und von drei oder vier Bauern, die der Zeremonie gar nicht beigewohnt hatten. Dann ließ man die Fälschung registrieren, als ob sie dadurch rechtsgültig würde.
Ein solches Dokument, einzig nicht unterzeichnet von dem, den es anging, vierzehn Tage nach dem Vorfall von Unbekannten unterschrieben und von glaubwürdigen Zeugen in Abrede gestellt, war offensichtlich eine Fälschung. Da es sich um Glaubenssachen handelte, mußte das Verbrechen den Pfarrer samt seinen falschen Zeugen in dieser Welt ins Zuchthaus und in jener in die Hölle bringen.
Der kleine Schloßherr, der ein Spaßvogel und nicht bösartig war, hatte Mitleid mit Leib und Seele jener Elenden. Er wollte sie nicht der menschlichen Gerechtigkeit ausliefern und begnügte sich damit, sie lächerlich zu machen. Doch erklärte er, er werde sich gleich nach seinem Tode den Spaß erlauben, den ganzen Schwindel nebst den Beweisen aufschreiben und drucken zu lassen, nicht etwa, um die Menschheit zu unterrichten, sondern um die wenigen Leser zu amüsieren, die solche Geschichten lieben. Es gibt so viele Autoren, die sich an die ganze Menschheit wenden, sich einbilden, die Aufmerksamkeit aller zu erregen, und meinen, alle gäben sich mit ihnen ab, daß der Schloßherr nicht daran glaubte, von einem Dutzend Menschen in der ganzen Welt gelesen zu werden. Doch zurück zum Fanatismus!
Jene Bekehrungswut, jene Sucht, andere für seine Ansicht zu gewinnen, veranlaßte die Jesuiten Castel und Routh, den sterbenden Montesquieu aufzusuchen. Die beiden Besessenen wollten sich rühmen können, ihn von den Vorzügen der Zerknirschung und der ausreichenden Gnade Gottes überzeugt zu haben. Wir haben ihn bekehrt, sagten sie, er war im Grunde ein guter Kerl und hatte für die Gesellschaft Jesu viel übrig. Es hat uns einige Mühe gekostet, seine Zustimmung zu gewissen Grundwahrheiten zu erlangen, aber da man in solchen Augenblicken immer besonders klar denkt, hatten wir ihn bald überzeugt.
Diese Bekehrungswut ist so stark, daß der ausschweifendste Mönch seine Geliebte verlassen würde, um am andern Ende der Stadt eine Seele zu bekehren.
Wir haben erlebt, wie der Franziskanerpater Poisson in Paris sein Kloster ruinierte, um seine Freudenmädchen bezahlen zu können, und wie er seiner sittlichen Verkommenheit wegen ins Gefängnis gesperrt worden ist. Er gehörte zu den beliebtesten Pariser Kanzelrednern und zu den wildesten Proselytenmachern.
Dies gilt auch für den berühmten Pfarrer Fantin in Versailles. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen, aber man soll die Torheiten gewisser Leute, die gewisse Stellungen einnehmen, nicht ans Licht ziehen. Es ist bekannt, was Ham geschah, weil er die Schande seines Vaters enthüllte; er wurde schwarz wie Kohle.
Wir wollen uns darauf beschränken, Gott morgens und abends zu bitten, uns von den Fanatikern zu erlösen, so wie die Mekka-Pilger ihn bitten, unterwegs keinen traurigen Gesichtern begegnen zu müssen.
III[6]
Ludlow, der eher ein Freiheitsschwärmer als ein religiöser Fanatiker war, jener wackere Mann, der Cromwell mehr haßte als den König Karl I., berichtet, daß die Soldaten des Parlaments in der ersten Zeit des Bürgerkrieges immer von den Truppen des Königs geschlagen worden sind, ähnlich wie zur Zeit der Fronde die königlichen Truppen dem großen Condé nicht gewachsen waren. Cromwell sagte zu General Fairfax: »Wie sollen die undisziplinierten Londoner Lastträger und Ladengehilfen einem Adel Widerstand leisten, den das Phantom der Ehre begeistert? Wir wollen ihnen ein stärkeres Phantom, den Fanatismus, zeigen. Unsere Feinde kämpfen nur für den König; wir wollen unseren Leuten einreden, daß sie für Gott in den Krieg ziehen. Gebt mir eine Vollmacht, dann will ich ein Regiment von Mördern aufstellen, und ich garantiere Euch, daß ich sie zu unbesiegbaren Fanatikern mache.«
Cromwell hielt Wort. Er bildete sein Regiment roter Brüder aus melancholischen Narren und machte sie zu willfährigen Wüterichen. Bessere Soldaten hatte Mohammed nicht gehabt.
Aber um solchen Fanatismus zu schüren, muß man sich auf den Geist der Zeit stützen können. Ein französisches Parlament würde heute vergeblich versuchen, ein derartiges Regiment aufzustellen; es würde nicht einmal zehn Marktweiber zusammentrommeln können.
Es gehört Geschick dazu, Fanatiker aus den Menschen zu machen und sie dementsprechend zu lenken. Aber Schwindel und Dreistigkeit allein genügen nicht; wir haben bereits gesehen, daß alles davon abhängt, im richtigen Augenblick auf die Welt zu kommen.
[1] Polyeuktes, römischer Offizier und christlicher Märtyrer. Held eines gleichnamigen Märtyrerdramas von Corneille (1643) (Anm. d. Hg.).
[2] Questions sur l'encyclopédie, 6e partie (1771).
[3] Typen des verschlagenen Dieners in der comédie italienne (Anm. d. Hg.).
[4] Das folgende bezieht sich auf den berühmt gewordenen Streit Voltaires mit dem Bischof von Annecy, Biord.
[5] All das ist keine Erfindung.
[6] Questions sur l'encyclopódie, 6e partie (1771).
Toleranz
I
Was ist Toleranz? Sie ist Menschlichkeit überhaupt. Wir sind alle gemacht aus Schwächen und Fehlern; darum sei erstes Naturgesetz, daß wir uns wechselseitig unsere Dummheiten verzeihen.
Laßt an der Börse von Amsterdam, London, Surat oder Basra den zarathustrischen Perser, den Banian, den Juden, den Muslim, den zur Gottheit betenden Chinesen, den griechischen Christen, den römischen Christen, den protestantischen Christen, den christlichen Quäker miteinander Handel treiben: keiner wird den Dolch gegen den andern zücken, um seiner Religion neue Seelen zu gewinnen. Warum dann haben wir uns beinahe pausenlos seit dem ersten Konzil von Nizäa die Hälse durchgeschnitten?
Konstantin begann mit einem Erlaß, der alle Religionen gestattete; am Ende wurde er zum Verfolger. Vor ihm erhob man sich gegen die Christen nur, weil sie eine Partei im Staate zu bilden anfingen. Die Römer ließen allen ihre Götter, selbst den Juden und Ägyptern, für welche sie so viel Verachtung empfanden. Warum duldete Rom deren Religionen? Weil weder Ägypter noch Juden versuchten, die alte Religion des Reiches auszutilgen; weil sie nicht Länder und Meere bereisten, um Jünger zu gewinnen: sie trachteten nur Geld aufzuhäufen; aber die Christen wollten unbestreibar, daß ihre Religion herrsche. Den Juden war die Statue Jupiters ärgerlich in Jerusalem, den Christen aber war sie ärgerlich auf dem Kapitol. Der heilige Thomas gibt aufrichtig zu, daß die Christen nur darum die Kaiser nicht entthronten, weil sie es nicht konnten. Ihre Meinung war, daß die ganze Erde christlich sein müsse. Notwendig waren sie also der ganzen Erde feind, solange diese nicht bekehrt war.
Sie waren untereinander feind in allen Punkten ihrer Auseinandersetzung. Soll man zunächst Jesus Christus für Gott ansehen, so werden jene, welche das leugnen, als Ebioniten verflucht und verfluchen ihrerseits die Anbeter des Jesus.
Wollen einige von ihnen, daß alles Gut gemein sei, wie man das von der Apostelzeit behauptet, so schimpfen ihre Gegner sie Nikolaiten und beschuldigen sie der ruchlosesten Frevel. Streben manche zu einer mystischen Andacht, so schimpft man sie Gnostiker und erhebt sich rasend gegen sie. Erörtert Marcion die Dreieinigkeit, so schmäht man ihn als Götzendiener.
Tertullian, Praxeas, Origenes, Novatian, Sabellius, Donatus werden allesamt vor Konstantin von ihren Brüdern verfolgt, und kaum hat Konstantin die christliche Religion zur Herrschaft erhoben, zerfleischen sich die Athanasianer und Eusebianer. Seit jener Zeit ist die christliche Kirche bis zu unseren Tagen in Blut getaucht.
Das jüdische Volk war gewiß sehr barbarisch. Es metzelte mitleidlos alle Bewohner eines unglücklichen Ländchens, worauf es nicht mehr Recht besaß als heute auf Paris und London. Doch als Naaman nach siebenmaligem Eintauchen im Jordan von seinem Aussatz geheilt ist und er dem Elisa, welcher ihn dies Geheimnis gelehrt hatte, zum Dank verheißt, er wolle seiner Erkenntlichkeit halber den Gott der Juden anbeten, da behält er sich vor, weiterhin den Gott seines Königs zu verehren; er fragt den Elisa dazu um Erlaubnis, und der Prophet zögert nicht mit seiner Einwilligung. Die Juden verehrten ihren Gott; aber sie waren nicht erstaunt, daß jedes Volk seinen eigenen habe. Sie fanden in Ordnung, daß Chamos den Moabitern einen bestimmten Landstrich gegeben hatte, sofern nur ihr eigener Gott auch ihnen solch einen gab. Jakob freite ohne Zaudern die Töchter eines Götzendieners. Laban hatte seinen Gott wie Jakob auch. Das sind einige Beispiele für Toleranz beim intolerantesten und grausamsten Volk des ganzen Altertums: wir haben seine unsinnigen Greuel nachgeahmt, nicht aber seine Duldsamkeit.
Eindeutig ist jeder ein Scheusal, wer seinen menschlichen Bruder verfolgt, weil dieser nicht seiner Meinung ist. So zu urteilen fällt niemandem schwer. Aber Regierung, Amtspersonen und Fürsten, wie verfahren denn sie mit jenen, die einen anderen Gottesdienst haben als sie selber? Sind es Mächtige im Ausland, so wird ein Fürst gewiß mit ihnen Bündnisse schließen. Der allerchristlichste Franz I. verbündet sich mit den Muselmanen gegen den allerkatholischsten Karl V. Franz I. gibt den deutschen Lutheranern Geld, um sie bei ihrem Aufruhr gegen den Kaiser zu unterstützen; doch vorher brennt er die Lutheraner bei sich zuhaus, wie es der Brauch ist. Der Politik halber bezahlt er sie in Sachsen, der Politik halber schmort er sie in Paris. Allein was geschieht? Die Verfolgungen schaffen neue Jünger; bald ist Frankreich voller Protestanten. Zunächst lassen sie sich hängen, dann hängen sie selber andere. Bürgerkriege brechen aus; endlich kommt die Bartholomäusnacht, und in diesem Erdenwinkel tut sich Schlimmeres, als was die Alten und Modernen jemals von der Hölle gesagt haben.
Ihr Wahnsinnigen, die ihr niemals in Reinheit dem Gott