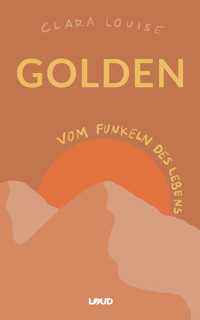9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eines Morgens wacht Lina auf und stellt fest: Über ihr schwebt eine dunkle Wolke. Was sie auch unternimmt, die Wolke folgt ihr auf Schritt und Tritt und verhagelt ihr wortwörtlich das Leben – bis sie auf einen alten Kapitän und seine illustre Mannschaft trifft, die sich mit Schietwetter richtig gut auskennen. Es ist der Beginn einer inspirierenden Reise, hinaus auf hohe See, die Lina mitten hinein ins Herz des Sturms führt. Die Singer-Songwriterin und Dichterin Clara Louise erzählt eine poetische und ermutigende Geschichte über die dunklen Tage im Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Clara Louise
Über mir die Wolke
Eine hoffnungsvolle Geschichte für dunkle Tage
Über dieses Buch
Eines Morgens wacht Lina auf und stellt fest: Über ihr schwebt eine dunkle Wolke. Was sie auch unternimmt, die Wolke folgt ihr auf Schritt und Tritt und verhagelt ihr wortwörtlich das Leben – bis sie auf einen alten Kapitän und seine illustre Mannschaft trifft, die sich mit Schietwetter richtig gut auskennen. Es ist der Beginn einer inspirierenden Reise, hinaus auf hohe See, die Lina mitten hinein ins Herz des Sturms führt. Die Singer-Songwriterin und Dichterin Clara Louise erzählt eine poetische und ermutigende Geschichte über die dunklen Tage im Leben.
Vita
Clara Louise, geboren 1992, schreibt schon seit sie denken kann berührende Gedichte und Aphorismen. Mit 16 Jahren zog es die Singer-Songwriterin und Dichterin der Liebe und der Musik wegen nach Salzburg, wo sie noch heute lebt und arbeitet. Neben ihren gefühlvollen Folk-Alben veröffentlicht Clara Louise liebevoll illustrierte Gedichtbände und berührt damit tausende Leserinnen und Leser in ganz Deutschland.
www.claralouise.at, Instagram:@missclaralouise
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung zero-media.net, München
Coverabbildung Clara Louise; FinePic®, München
ISBN 978-3-644-01195-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Als ich meinen Freunden von dieser Buchidee erzählte und den Titel und die Wolke erwähnte, um die es gehen würde, nickten alle gleich verständnisvoll, wohl wissend, wofür in ihrem eigenen Leben die Wolke steht.
Sie ist ein Symbol für etwas, das zuweilen schwer auf den Schultern lastet, die Sicht einschränkt, den Himmel für eine gewisse Zeit verdunkelt. Ich glaube, jeder Mensch hat von Zeit zu Zeit seine eigene Wolke, aber manchmal bleibt sie länger, und dann unterscheidet sie sich von einem kurzen Tief. Für jeden, der von ihr betroffen ist, nimmt sie eine andere Form an: Die eine türmt sich hoch auf, ist laut und bedrohlich, die andere vielleicht kleiner und dafür hartnäckig. Welche Gestalt sie auch annehmen mag, wichtig ist, dass wir miteinander sprechen – über die dunklen Tage im Leben, die verhagelten, die grauen, die mit den tiefhängenden Wolken, die Tage, an denen wir die Verbindung zu verlieren drohen – zu uns und zur Welt.
Allein zu wissen, dass es anderen Menschen wie uns ergeht, kann tröstlich sein und uns stärken. Manchmal mögen wir glauben, wir seien nur dann liebenswert, wenn wir «leicht» sind, wie meine Protagonistin Lina, deren Geschichte ich in diesem Buch erzähle. Doch zum Glück erfährt sie, dass dem nicht so ist, und im Laufe dieser kleinen Erzählung wird sie immer wieder überrascht – von Menschen, sich selbst, dem sich stetig wandelnden Wetter. Diese überraschenden Momente und Wendungen im Leben sind es, die uns zeigen, dass es sich lohnt, die Hoffnung nicht zu verlieren.
Jeder Sturm fühlt sich anders an, jede Wolke ist einzigartig, so wie jeder Mensch, weshalb es auch kein Patentrezept gibt im Umgang mit Schlechtwetterfronten, keine festgelegten Lösungen.
Dennoch, ein paar Dinge habe ich gelernt, die mir geholfen haben – und wer weiß, vielleicht helfen sie auch dir, liebe Leserin, lieber Leser. Eines weiß ich ganz genau, eine Gemeinsamkeit haben Sturm wie Gewitter: Beides geht vorbei.
In all den dunklen Tagen, und davon gab es bisher reichlich in meinem Leben, habe ich mir eines deshalb immer im Herzen bewahren können: einen Funken Hoffnung. Diesen Funken und meine Erfahrungen möchte ich mit dir teilen. Das Leben ist lebenswert, und jeder Moment birgt eine neue Chance, um dies zu erkennen.
Alles Liebe
Clara Louise
Alle kennen sie,
doch meine ist anders.
Sie zieht nicht mehr davon,
bleibt stur über mir hängen.
Dicht und dunkel schwebt sie da,
kein Licht dringt durch sie hindurch,
in ihr tobt ein grausamer Lärm,
der mich nicht mehr ruhen lässt.
Renne ich vor ihr davon,
dann folgt sie mir.
Bleibe ich liegen,
so liege ich im Wolkenbett.
Meine Wolke,
sie ist mein Schatten.
Sie kam plötzlich,
ich war nicht vorbereitet.
Ich schloss die Augen,
wollte nicht sehen,
was mein Spiegelbild mir offenbarte,
doch selbst dann spürte ich sie,
spürte, wie sie meine Augen mit Regentropfen füllte.
Jetzt ist sie da,
und ich habe vergessen,
wie die Zeit vor ihr war.
Ich weiß gar nicht mehr,
wer ich selbst noch bin.
Verstummt bin ich durch die Wolke,
den Nebel, der mir in der Kehle brannte,
bis irgendwann eine Hand vor meinen Augen erschien
und ich nicht anders konnte,
als nach ihr zu greifen.
Jetzt stehen wir hier zusammen unter den Wolken,
und es tut ein bisschen weniger weh.
Seitdem ich weiß,
dass ich nicht mehr alleine bin,
seitdem weiß ich auch,
ich werde den Sturm überstehen.
1
Es geschah wie aus heiterem Himmel, an einem Montag. Der Tag in der Woche, vor dem ich mich am meisten fürchtete. Es war Herbst. Die ersten Blätter fielen von den Bäumen, und draußen wehte ein Wind, der die Kälte ins Land brachte. Er wusste, was er tat, dieser starke, selbstbewusste Wind, trat bestimmt in den September, und wir alle schauten dabei zu, wie sich die Landschaften im Nu veränderten, wie sich die Blätter an den Bäumen verfärbten, alles im Wandel begriffen. Ich erinnere mich noch genau an diesen Morgen. Ich kann ihn förmlich einatmen, wenn ich an ihn zurückdenke. Plötzlich war sie da – die Wolke.
Ich lag reglos im Bett und spielte dieses Spiel, hatte die Augen geschlossen und war doch wach. Ich sah kleine Lichteffekte, die durch meine Lider drangen, doch in mir war es dunkel. Manchmal macht mir das Angst, obwohl ich ja weiß, dass jeder Mensch in sich die Dunkelheit sieht, wenn er die Augen schließt.
Allein bei dem Gedanken, was ich alles erledigen musste, wurde mir flau im Magen. Ich setzte mich auf die Bettkante und fühlte mich schwer, als drückte mich etwas nieder. Draußen war es grau, der Himmel verhangen, und in mir sah es kaum anders aus.
Alles an jenem Morgen wirkte wie hinter einem Schleier. Als hätte sich etwas zwischen mich und die Dinge geschoben. So kannte ich mich gar nicht. Eigentlich kam ich trotz meiner Sorgen morgens gut aus dem Bett, war immer pünktlich, immer zur Stelle. Ich funktionierte tadellos, wie ein gut gewartetes Gerät. Man konnte stets auf mich zählen. Meine große Stärke.
Andere Menschen standen für mich oft an erster Stelle, und so fand ich meinen Platz in dieser Welt, an einem Ort, wo man mich nicht so gut sehen konnte, vielleicht, das denke ich heute, auch ein Ort, an dem ich mich selbst nicht so gut sehen konnte.
Als ich an jenem Morgen einen Blick in den Spiegel warf, erschrak ich. Ich sah so aus, wie ich mich fühlte: niedergeschlagen, blass und über mir: die Wolke, kaum erkennbar, und doch war sie da, schwer, blaugrau, diffus und bedrohlich. Die Erklärung für einen grauen Morgen, für das Gefühl von Schwere und eine Kälte, die sich in mir breitgemacht hatte. Das Wetter hatte gewechselt, und es traf mich unvorbereitet.
Sie bedeckt die Sonne, den Mond, die Sterne. Sie verdunkelt den Himmel, den Tag, die Nacht.
2
Ich ignorierte die Wolke, oder besser: Ich versuchte es, obwohl ich wusste, dass sich schon lange etwas in mir zusammengebraut hatte. Ich hatte die Zeichen nicht bemerkt, und nun glaubte ich, keine Zeit zu haben, mich um das Tiefdruckgebiet zu kümmern, das in mein Leben Einzug gehalten hatte. Am Anfang hoffte ich noch. Vielleicht würde diese düstere Wolke zusammen mit dem flauen Gefühl im Magen von selbst wieder verschwinden, ganz so, wie sie gekommen war. Ich hatte sie schließlich nicht bestellt und konnte sie auch nicht gebrauchen. Mein Leben war angefüllt mit Aufgaben und Verpflichtungen. Ich opferte meine Zeit, um es allen recht zu machen. Ich wollte niemanden enttäuschen, und vor allem durfte ich auf keinen Fall eine Pause einlegen, denn ich konnte die Stille, die Zeit mit mir selbst, nur schwer ertragen. Dann überrannten mich meine Zweifel.
Monster wuchsen in mir heran, die mit tickenden Uhren hinter mir standen und mich antrieben, die dafür sorgten, dass meine Energiereserven zur Neige gingen. Ist das wirklich das Leben, das du leben möchtest? Gefangen in einem bedrohlich tickenden Uhrwerk? Das fragte ich mich oft und verspürte dabei stets eine panische Unruhe, sodass ich mich schnell wieder beschäftigte. Hektisch wütete ich durch die Tage. Ich lief durch mein Leben wie auf einem Laufband, das niemals anhielt. Kleine Schritte, müde Beine, immer weiter, nur weiter.
In den ersten Nächten mit der Wolke wachte ich mit umwölkter Stirn auf und lag wach. Ich sorgte mich: Was würde nur werden? Was würden meine Freunde und Eltern sagen, wenn ich ihnen davon erzählte? Nein, das könnte ich auf keinen Fall! Sie würden mir nicht glauben – und selbst wenn … Ich wollte ihnen nicht zur Last fallen.
Verbissen hielt ich mich an die Weisheiten, die ich verinnerlicht hatte: Reiß dich zusammen. Du musst erst etwas leisten, bevor du eine Pause verdient hast. Also kämpfte ich mich durch, eigentlich so, wie ich es schon lange getan, wie ich es gelernt hatte.
Der angespannte Kiefer, die Rückenschmerzen, der dröhnende Kopf – all das konnte mich nicht davon abhalten, funktionieren zu wollen. Mein Leben lang kämpfte ich schon darum, mein Bestes zu geben, und das würde ich auch jetzt tun: Leistung bringen.
Auf der Arbeit trat ich in Konkurrenz mit mir selbst, erledigte meine Aufgaben trotz der Erschöpfung, die sich in mir breitgemacht hatte. Doch Herausforderungen, die ich sonst mit Leichtigkeit angenommen hatte, türmten sich im Schatten der Wolke wie unbezwingbare Gebirge vor mir auf. Jeden Tag stieg ich steile Pfade hinauf, die kein Ende zu nehmen schienen. Hinauf, hinauf, immer weiter, bloß nicht stehen bleiben.
Und sosehr ich mir auch wünschte, die Wolke würde verschwinden, sosehr ich auch versuchte, sie zu ignorieren, sie blieb, wo sie war, und nahm immer mehr Raum in meinem Leben ein. Die Tage waren eingehüllt in einen dumpfen Nebel, der meine Sicht auf die Welt veränderte. Wohin sollte ich meine Schritte wenden, wenn ich um mich herum doch nur Dunkelheit sah?
Durch meine Gedanken braust der Nordwind, doch ich bin wie festgewurzelt am Boden. Ich möchte fliehen, aber ich kann es nicht.
3
Von meinem Lieblingsplatz am Fenster konnte ich sehen, wie sich die Blätter an den Bäumen herbstlich verfärbten. Manchmal stellte ich mir vor, sie würden mir ihre Geschichte erzählen. Was sie in all den Jahrzehnten bereits gesehen und erlebt hatten. Auf der tiefen Fensterbank mit Kissen, die ich mir schon als Kind so sehr gewünscht hatte, kam ich mir sonst vor wie in einem kleinen, warmen, geborgenen Nest. Dort fühlte sich die Welt immer etwas leichter an, und ich konnte für einen Moment aus meinem Alltag entfliehen. Oben an der Decke hatte ich Lichterketten befestigt, um aus dem Platz so viel Romantik wie möglich herauszuholen. Doch in jenen verhangenen Tagen fühlte es sich anders an. Die Blätter mochten in der Herbstsonne noch so schöne Farben annehmen und vom Wind spielerisch durch die Luft gewirbelt werden, ich fand mich in einer Welt, in der die Sonne keinen Platz mehr hatte und sich kaum noch etwas bewegte. Es schien, als hätte jemand über Nacht alle Farben gelöscht und sie ausgetauscht gegen kühle Grautöne.
In der Reflexion des Fensters sah ich die Wolke. Schwer lastete sie auf meinen Schultern, und meine Augen füllten sich mit Regentropfen. Mein Herz, das raste wie ein Schnellzug dahin, den Gedanken hinterher, die auf den immer gleichen Gleisen im Kreis fuhren.
Wenn ich heute zurückblicke, dann sehe ich: Es hatte sich etwas verändert, oder es wollte sich etwas verändern, aber ich konnte nicht, noch nicht.