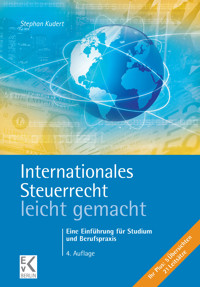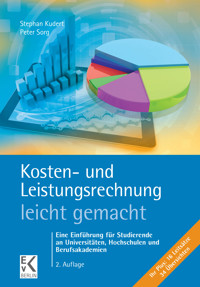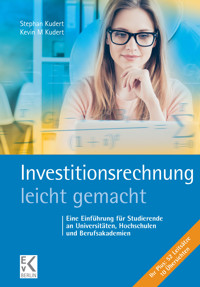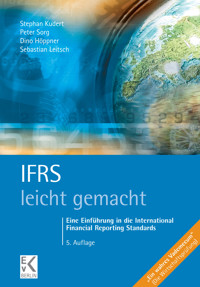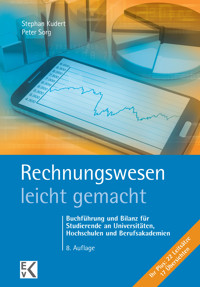14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zwei erfahrene und anerkannte Professoren stehen Ihnen zur Seite. Ein umfassendes Arbeitsbuch. Einprägsam und lebendig. Hier finden Sie: – Klare Lernziele vor jeder Lektion – Umfassende Leitsätze als Lerngrundlage – Kontrollfragen mit genauen Antworten – Übungsaufgaben nebst konkreten Lösungen Das methodisch-didaktische Übungsbuch zum Erfolgsband Rechnungswesen - leicht gemacht. Inhaltlich abgestimmt. Übergreifend verständlich. Die ideale Prüfungsvorbereitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
★★
leicht gemacht®... Fachwissen aus Taschenbüchern
▇Die Gelbe Serie: Recht
▇Die Blaue Serie: Steuer und Rechnungswesen
[1]
BLAUE SERIE leicht gemacht®
Herausgeber: Dr. jur. Dr. jur. h.c. Helwig Hassenpflug Richter Dr. Peter-Helge Hauptmann
Übungsbuch Rechnungswesen
leicht gemacht
Lernziele, Übungen, Lösungen
4. überarbeitete Auflage
von
Professor Dr. Stephan Kudert
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
und
Professor Dr. Peter Sorg
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[2]
Besuchen Sie uns im Internet:www.leicht-gemacht.de
Autoren und Verlag freuen sich über Ihre Anregungen
Umwelthinweis: Dieses Buchwurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedrucktGestaltung: Michael Haas, Joachim Ramminger, BerlinDruck & Verarbeitung: Druckerei Siepmann GmbH, Hamburgleicht gemacht® ist ein eingetragenes Warenzeichen
© 2020 Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[3]
Vorwort
„Übung macht den Meister“! Dieser Leitsatz findet Anwendung in allen Bereichen unseres Lebens. Die einfachsten Dinge - z. B. essen, sprechen, laufen - erlernt man nur durch ständige Übung. Üben begleitet uns ein Leben lang. Ein Musiker, zum Beispiel aus dem derzeit besten Orchester der Welt, den Berliner Philharmonikern, kann nur durch täglich viele Übungsstunden die besten Töne aus seinem Instrument hervorzaubern. Jeder Spitzensportler, ob Skifahrer oder Golfer, ist nur durch intensives Üben und Trainieren zu Bestleistungen fähig.
Mit dem betrieblichen Rechnungswesen und insbesondere mit der Buchführung verhält es sich ebenso. Das komplexe Fachgebiet lässt sich nicht durch bloßes Lesen, sondern nur durch selbständiges Üben am praktischen Fall durchdringen. Besonderer Wert in diesem Übungsbuch wurde daher auf die methodisch-didaktische Aufbereitung des Stoffes in „Lernziele - Leitsatz - Wissenskontrollfragen - Übungen“ sowie auf eine praxisbezogene Auswahl der Übungsaufgaben gelegt. Der Aufbau des Übungsbuches lehnt sich (auch hinsichtlich der Gliederung in 12 Lek¬tionen) an das Lehrbuch Rechnungswesen - leicht gemacht® an, indem die dort vorgestellten Themengebiete fallorientiert behandelt werden. Es kann aber ebenso unabhängig vom Lehrbuch als Lektüre verwendet werden.
Unseren Sekretärinnen, Frau Angelika Blank und Frau Claudia Kudert, sei für die stets zuverlässige Erledigung der umfangreichen Schreib- und Korrekturarbeiten herzlich gedankt.
Prof. Dr. Stephan Kudert
Prof. Dr. Peter Sorg
[5]
Inhaltsüberblick
I.Betriebswirtschaftliche Grundlagen des Bilanzrechts
Lektion 1:Buchführung und Bilanzrecht zur Abbildung der betrieblichen Realität
Lektion 2:Der Jahresabschluss als Teilbereich des Rechnungswesens
II.Die doppelte Buchführung
Lektion 3:Grundlagen der doppelten Buchführung
Lektion 4:Technik der doppelten Buchführung
III.Das Bilanzrecht nach HGB und IAS/IFRS
Lektion 5:Rechtsgrundlagen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses
Lektion 6:Informationen über die Vermögens- und Ertragslage
Lektion 7:Anschaffungskosten
Lektion 8:Herstellungskosten
Lektion 9:Planmäßige Abschreibungen beim abnutzbaren Anlagevermögen
Lektion 10:Außerplanmäßige Abschreibungen
Lektion 11:Periodenübergreifende Zahlungen
Lektion 12:Das Eigenkapital als Saldogröße
Sachregister.
[6]
Inhalt
I.Betriebswirtschaftliche Grundlagen des Bilanzrechts
Lektion 1:Buchführung und Bilanzrecht zur Abbildung der betrieblichen Realität
Lernziel
Leitsatz: Der Zugangsschlüssel zum Bilanzrecht
Wissenskontrollfragen
Übungen
Übung 1:Rechnungswesen als modellhafte Abbildung der betrieblichen Realität
Übung 2:Einkommen versus Vermögen
Übung 3:Forderungen und Verbindlichkeiten
Übung 4:Gewinnrealisationszeitpunkt
Übung 5:Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen
Lektion 2:Der Jahresabschluss als Teilbereich des Rechnungswesens
Lernziel
Leitsatz: Teilbereiche des Rechnungswesens und deren Grundbegriffe
Wissenskontrollfragen
Übungen
Übung 6:Bestandteile des handelsrechtlichen Einzelabschlusses
Übung 7:Gewinnverteilung und Gewinnverwendungsbeschluss
Übung 8:Internes versus externes Rechnungswesen
Übung 9:Insolvenzrisiko durch Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit
[7]
Ergänzung zu Übung 9
Übung10:Einzahlung-Einnahme-Ertrag und Auszahlung-Ausgabe-Aufwand
II.Die doppelte Buchführung
Lektion 3:Grundlagen der doppelten Buchführung
Lernziel
Leitsatz: Grundlagen der doppelten Buchführung
Wissenskontrollfragen
Übungen
Übung 11:Handels- und steuerrechtliche Buchführungspflicht
Übung 12:Handels- und steuerrechtliche Buchführungspflicht
Übung 13:Handels- und steuerrechtliche Buchführungspflicht
Übung 14:Handels- und steuerrechtliche Buchführungspflicht
Übung 15:Erstellung eines Inventars
Übung 16:Ableitung einer Bilanz aus dem vorherigen Inventar
Übung 17:Aktivtausch, Passivtausch, Bilanzverlängerung und Bilanzverkürzung
Lektion 4:Technik der doppelten Buchführung
Lernziel
Leitsatz: Technik der doppelten Buchführung
Wissenskontrollfragen
Übungen
Übung 18:Von der Eröffnungsbilanz zur Schlussbilanz
Übung 19:Buchungen auf Aufwands- und Ertragskonten mit Kontenabschluss über das GuV-Konto
Übung 20:Buchungen auf Bestands- und Erfolgskonten mit Abschluss der Konten bis zum Kapitalkonto
[8]
III.Das Bilanzrecht nach HGB und IAS/IFRS
Lektion 5:Rechtsgrundlagen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses
Lernziel
Leitsatz: Rechtsgrundlagen und Bestandteile des handelsrechtlichen Jahresabschlusses
Wissenskontrollfragen
Übungen
Übung 21:GmbH ft Co. KG und UG (h.b.) ft Co. KG
Übung 22:Anlage- versus Umlaufvermögen
Übung 23:Bilanz- und GuV-Gliederung
Übung 24:GuV in Staffelform nach UKV und GKV
Übung 25:Benchmarking beim UKV
Übung 26:Risikoberichterstattung im Lagebericht
Übung 27:Offenlegungspflichten und Erleichterungen
Übung 28:Prüfungspflicht bei Kapitalgesellschaften
Übung 29:Prüfungspflicht und Erwartungslücke
Übung 30:Pflicht zur Konzernrechnungslegung
Lektion 6:Informationen über die Vermögens- und Ertragslage
Lernziel
Leitsatz: Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
Wissenskontrollfragen
Übungen
Übung 31:Bilanzierung bei Eigentumsvorbehalt
Übung 32:Bilanzierung bei Sicherungsübereignung
Übung 33:Gewinnrealisation
Übung 34:Antizipation drohender Verluste
Übung 35:Wertaufhellung versus Wertbeeinflussung
Übung 36:Wechselkursrisiken und -chancen
Übung 37:Asset Deal versus Share Deal
Übung 38:Bilanzierung des derivativen Geschäftswertes
Übung 39:Bilanzierung des originären Geschäftswertes
[9]
Übung 40:Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Lektion 7:Anschaffungskosten
Lernziel
Leitsatz: Anschaffungskosten, Umsatzsteuer und Warenverkehr
Wissenskontrollfragen
Übungen
Übung 41:Anschaffungskosten bei Grundstücken
Übung 42:Anschaffungskosten einer Maschine
Übung 43:Anschaffungskosten beim Fuhrpark
Übung 44:Buchung der Umsatzsteuer und der Vorsteuer
Übung 45:Kauf auf Ziel mit Vorsteuer
Übung 46:Verkauf auf Ziel mit Umsatzsteuer
Übung 47:Buchung von erhaltenen Rabatten
Übung 48:Buchung von gewährten Rabatten
Übung 49:Buchung von gewährten Skonti
Übung 50:Buchung von erhaltenen Skonti
Übung 51:Abschluss der Warenkonten nach der Bruttomethode
Übung 52:Abschluss der Warenkonten nach der Nettomethode
Übung 53:Buchung von Retouren beim Käufer
Übung 54:Buchung von Retouren beim Verkäufer
Übung 55:Buchung laufender Geschäftsvorfälle
Lektion 8: Herstellungskosten
Lernziel
Leitsatz: Herstellungskosten
Wissenskontrollfragen
Übungen
Übung 56:Handelsrechtliche Wertuntergrenze der Herstellungskosten
[10]
Übung 57:Handelsrechtliche Wertobergrenze der Herstellungskosten
Übung 58:GuV-Konten nach dem Gesamtkostenverfahren
Übung 59:GuV-Konten nach dem Umsatzkostenverfahren
Übung 60:Buchungen beim Gesamtkostenverfahren
Übung 61:Nochmals Buchungen beim Umsatzkostenverfahren
Übung 62:Nochmals Buchungen beim Gesamtkostenverfahren
Übung 63:Nochmals Buchungen beim Umsatzkostenverfahren
Übung 64:Betriebsergebnis nach dem Gesamt- und Umsatzkostenverfahren für das Jahr 01
Übung 65:Betriebsergebnis nach dem Gesamt- und Umsatzkostenverfahren für das Jahr 02
Übung 66:Buchungen bei zweistufigen Produktionsprozessen nach dem Umsatzkostenverfahren
Übung 67:Buchungen bei zweistufigen Produktionsprozessen nach dem Gesamtkostenverfahren
Übung 68:Betriebsergebnis nach dem Gesamtkostenverfahren unter Einbezug der sonstigen Erträge und Aufwendungen
Übung 69:Betriebsergebnis nach dem Umsatzkostenverfahren unter Einbezug der sonstigen Erträge und Aufwendungen
Lektion 9:Planmäßige Abschreibungen beim abnutzbaren Anlagevermögen
Lernziel
Leitsatz: Planmäßige Abschreibungen
Wissenskontrollfragen
Übungen
Übung 70:Buchung der linearen Abschreibung
Übung 71:Abschreibungspläne bei Anwendung verschiedener Abschreibungsmethoden
[11]
Übung 72:Berechnung der Abschreibungsbeträge bei fünf Abschreibungsmethoden
Übung 73:Begründung der Wahl einer bestimmten Abschreibungsmethode bei einem Existenzgründer
Übung 74:Monatsgenaue Abschreibung
Übung 75:Keine planmäßige Abschreibung beim nicht abnutzbaren Anlagevermögen
Übung 76:Buchungen von Anschaffungskosten, Anschaffungsnebenkosten, Anschaffungspreisminderungen und planmäßiger monatsgenauer Abschreibung beim abnutzbaren Anlagevermögen
Lektion 10:Außerplanmäßige Abschreibungen
Lernziel
Leitsatz: Niederstwertprinzip, außerplanmäßige Abschreibungen, Zuschreibungen und striktes Wertaufholungsgebot
Wissenskontrollfragen
Übungen
Übung 77:Niederstwertprinzip, Abschreibung und Zuschreibung bei Finanzanlagen
Übung 78:Buchung von Forderungen aus L.u.L
Übung 79:Uneinbringliche Forderung
Übung 80:Zweifelhafte Forderung
Übung 81:Pauschalbewertung von Forderungen
Übung 82:Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibung
Lektion 11:Periodenübergreifende Zahlungen
Lernziel
Leitsatz: Periodenübergreifende Zahlungen
Wissenskontrollfragen
[12]
Übungen
Übung 83:Forderungen und erhaltene Anzahlungen mit Umsatzsteuer
Übung 84:Rechnungsabgrenzungsposten mit Umsatzsteuer
Übung 85:Rechnungsabgrenzungsposten ohne Umsatzsteuer
Übung 86:Steuerrückstellung
Übung 87:Ausgaben für eine Werbekampagne
Übung 88:Garantie- und Kulanzrückstellungen
Übung 89:Garantierückstellungen
Übung 90:Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
Übung 91:Außerplanmäßige Abschreibung und Rückstellungen wegen drohender Verluste
Übung 92:Disagio versus Zinsaufwand
Lektion 12:Das Eigenkapital als Saldogröße
Lernziel
Leitsatz: Die Eigenkapitalkonten bei verschiedenen Rechtsformen
Wissenskontrollfragen
Übungen
Übung 93:Einlagen und Entnahmen
Übung 94:Sachentnahme
Übung 95:Körperschaftsteuererstattung
Übung 96:Gewinnverteilung bei der OHG
Übung 97:Bilanzierung der Gewinnverteilung bei der KG
Übung 98:Tätigkeits- und Haftungsvergütung als Aufwand
Übung 99:Tätigkeits- und Haftungsvergütung als Gewinnvorab (fast wie Übung 98)
Übung100:Bilanzierung der Gewinnausschüttung bei einer GmbH
Übung101:Gewinnausschüttung bei Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Übung102:Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.
[13]
I.Betriebswirtschaftliche Grundlagen des Bilanzrechts
Lektion 1:Buchführung und Bilanzrecht zur Abbildung der betrieblichen Realität
Lernziel
Ziel der Lektion 1 ist, ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum Mo-dellbildungen für die Lösung vieler praktischer Probleme unumgänglich sind. Darüber hinaus soll das Rechnungswesen als modellhafte Abbildung der ökonomischen Realität von Unternehmen verstanden werden.
Leitsatz
Der Zugangsschlüssel zum Bilanzrecht
Man kann Rechnungswesen einfach auswendig lernen und damit irgendwie sogar die Klausur bestehen. Das haben Generationen von Studierenden und Auszubildenden so gemacht. Allerdings wird der Stoff dann sehr trocken und langweilig sein.
Man kann aber auch versuchen, Rechnungswesen zu verstehen, indem man jeweils darüber nachdenkt, welche betriebliche Realität sich hinter einem Bilanzposten, einer speziellen Bewertung, einem T-Konto oder einem Buchungssatz verbirgt. Rechnungswesen ist eine modellhafte Abbildung der ökonomischen Realität. Wer das Bilanzrecht trocken und langweilig findet, hat diesen Zusammenhang wahrscheinlich nicht verstanden oder schlicht kein Interesse an der ökonomischen Beurteilung von Unternehmen.
Die idealtypischen Unternehmen lassen sich nach ihren Leistungser-stellungsstrukturen in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen unterscheiden. Da sich ihre ökonomische Realität unterscheidet, muss auch deren Abbildung im Rechnungswesen Unterschiede aufweisen.
[14]
Wissenskontrollfragen
1.Warum verwendet man in der Wissenschaft und Praxis häufig Modelle?
2.Welches sind die beiden wichtigsten ökonomischen Kerngrößen, zu deren Ermittlung der handelsrechtliche Jahresabschluss dient?
3.Was verstehen Sie unter dem leistungswirtschaftlichen und dem finanzwirtschaftlichen Bereich eines Unternehmens?
4.In welchem Zeitpunkt entsteht ein Gewinn?
5.Welche Unternehmenstypen kann man nach ihren Sachzielen unterscheiden?
6.Können Sie Beispiele für Bestandsgrößen nennen, die in Industrie-unternehmen, aber nicht in Handels- und Dienstleistungsunternehmen existieren?
zu1.Die Realität ist oft so komplex, dass man einzelne Wirkungs-zusammenhänge kaum überblicken kann. Durch die Modellbildung erfolgt eine Reduktion dieser komplexen Zusammenhänge. Charakteristisch dabei ist, dass diejenigen Aspekte der Realität hervorgehoben werden, die für eine bestimmte Fragestellung als wesentlich erachtet, während unwesentliche Aspekte vernachlässigt werden. Man vereinfacht also die Realität, um sie so besser zu verstehen.
Diese Vereinfachung auf ein überschaubares gedankliches Gebilde soll einen Erkenntnisgewinn ermöglichen, der Wirkungszusammenhänge erklärbar macht (Beschreibungsmodelle) und uns in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen (Entscheidungsmodelle).
zu2.Die beiden wichtigsten ökonomischen Kerngrößen, zu deren Ermittlung der handelsrechtliche Jahresabschluss dient, sind der Gewinn und das Reinvermögen. Der Gesetzgeber benutzt hierfür die Begriffe „Jahresüberschuss“ und „Eigenkapital“. In einigen [15]Paragrafen spricht er aber auch von der Ertrags- und Vermögenslage; hierzu mehr in Lektion 6.
Durch die Quantifizierung der Kerngrößen sind Vergleiche möglich. Wurde etwa der Jahresüberschuss eines Unternehmens festgestellt (gemessen), so lässt er sich mit den Jahresüberschüssen anderer Geschäftsjahre (Zeitvergleich) oder mit denen anderer Unternehmen der gleichen Branche (Branchenvergleich) oder mit einer Sollgröße (Soll-Ist-Vergleich) vergleichen.
zu3.Der leistungswirtschaftliche Bereich umfasst die Beschaffung von Produktionsfaktoren, deren Kombination im Unternehmen und den Absatz der erstellten Leistungen. Leistungen, die das Unternehmen vom Beschaffungsmarkt bezieht oder am Absatzmarkt erbringt, können Sachgüter, Immaterialgüter, Dienstleistungen, Arbeitsleistungen, Nutzungsrechte und andere marktfähige Leistungen sein. Die Beschaffungs- und Absatzvorgänge werden in der Regel entgeltlich durchgeführt. Es bestehen also marktmäßige Beziehungen. Den Realgüterströmen stehen immer Nominalgüterströme (Geldströme) gegenüber. Dabei muss die Bezahlung nicht zwingend zeitgleich mit der Leistungserbringung erfolgen. Somit entstehen Forderungen, Verbindlichkeiten und Anzahlungen. Jede Zahlung, die im leistungswirtschaftlichen Bereich erfolgt, wird irgendwann in der Buchführung als Aufwand beziehungsweise Ertrag ausgewiesen.
Im finanzwirtschaftlichen Bereich werden die Geldströme erfasst, die nicht Entgelt für die Beschaffung oder den Absatz von Leistungen darstellen. Diese basieren insbesondere auf Beziehungen des Unternehmens zum Kapitalmarkt und zum Staat. Jedes Unternehmen benötigt für den Leistungserstellungsprozess finanzielle Mittel. Diese können in Form von Eigenkapital oder Fremdkapital auf dem Kapitalmarkt beschafft werden. Kapitalabflüsse aus dem Unternehmen sind Zahlungen an die Eigen- oder Fremdkapitalgeber (z.B. in Form von Kapitalrückzahlungen und Kredittilgungen). Der Staat wirkt auf das Unternehmen ein, indem er ihm zum einen finanzielle Mittel entzieht (insbesondere in Form von Steuern), zum anderen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen kann (z.B. in Form von Subventionen).
zu4.Ein Gewinn kann erst dann entstehen, wenn einem Unternehmen für die abgesetzte Leistung mehr Entgelt zusteht (Ertrag), als es [16]selbst für diese Leistung aufwenden musste (Aufwand). Der Gewinn ist daher in dem Zeitpunkt, in dem das Unternehmen seine Leistung an den Kunden erbracht hat, realisiert.
zu5.In Handelsunternehmen werden die Waren, die sie beschaffen, ohne Weiterverarbeitung verkauft. Es findet nach der physischen Beschaffung lediglich eine Lagerung bis zum Absatz statt. Die Abbildung im Rechnungswesen ist daher auch relativ einfach. Man bildet die Zugänge und Bestände auf so genannten Warenbestands- oder Wareneinkaufskonten ab; die Abgänge werden auf Warenverkaufskonten erfasst.
Industrieunternehmen hingegen beschaffen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und verarbeiten diese zu neuen Produkten. Der Produktionsprozess ist in der Regel mehrstufig, d.h. es werden zunächst unfertige Erzeugnisse hergestellt, die dann zwischengelagert werden, um sie später aus dem Zwischenlager zu entnehmen und zu Fertigerzeugnissen zu verarbeiten. In der Praxis finden sich Unternehmen mit zahlreichen Produktionsstufen und entsprechend vielen Zwischenlagern, die wiederum im Rechnungswesen abzubilden sind. Daher sind bei diesen Unternehmen weitaus mehr Konten auszuweisen, auf denen die Zugänge, Bestände und Abgänge der Vorräte, der unfertigen Erzeugnisse und der Fertigfabrikate erfasst werden, als bei Handelsunternehmen. Dienstleistungsunternehmen haben die Besonderheit, dass die Dienstleistungen zwingend gemeinsam mit externen Faktoren (Produktionsfaktoren, die der Kunde zur Verfügung stellt) hergestellt werden. Leistungserstellung und Absatz erfolgen daher immer zeitgleich (man nennt das Uno-Actu-Prozess). Damit ist die Abbildung von Dienstleistungsunternehmen im Rechnungswesen auch einfacher als die Abbildung von Industrieunternehmen.
zu6.Die drei idealtypischen Unternehmen unterscheiden sich zum Beispiel hinsichtlich der Lagerbestände. Da keine stufenweise Produktion erfolgt, gibt es bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen keine Läger für Halbfertigerzeugnisse (auch unfertige Erzeugnisse genannt). In Dienstleistungsunternehmen erfolgen Leistungserstellung und Absatz in einem Uno-Actu-Prozess. Daher gibt es auch keine Läger für Fertigerzeugnisse. Die Taxifahrt, die Theateraufführung, die Zahnwurzelbehandlung und die Beinamputation können nicht gelagert werden.
[17]
►Zur Beantwortung aller Wissenskontrollfragen vergleiche Kudert/ Sorg: Rechnungswesen - leicht gemacht®, Lektion 1.
Übungen
Übung 1: Rechnungswesen als modellhafte Abbildung der betrieblichen Realität
Die (verkürzte) Fußballabschlusstabelle 2025 weist nach dem 34. und letzten Spieltag der Saison folgende Daten aus:
Verein
Tore
Punkte
1.
Bertha HSC
68 : 32
100
2.
Stahlharte Union
41 : 12
62
3.
Energie Brandenburg
105 : 78
59
4.
...
Welcher Verein wurde deutscher Meister? Wie oft hat Bertha unentschieden gespielt? Welcher Verein hat wahrscheinlich den attraktivsten Fußball geboten?
►►Sie haben keinen Schimmer? Dann interessieren Sie sich nur be-dingt für Fußball. Der Auszug aus der Abschlusstabelle ist eine modellhafte Abbildung der gesamten Saison. Klar erkennbar ist, dass Bertha deutscher Meister geworden ist; sonst ständen sie nicht mit dem sehr ungewöhnlich großen Vorsprung von 38 Punkten auf dem ersten Platz. Die Mannschaft muss über die gesamte Saison unglaublich gut gespielt haben. Wenn sie in 34 Spielen 100 Punkte erreicht hat, muss sie 33 Siege (= 99 Punkte) sowie ein Unentschieden (= 1 Punkt) eingefahren haben. Die erfolgloseste der ersten drei Mannschaften war Energie Brandenburg. Während aber die Stahlharte Union offensichtlich mit einer ausgeprägten Defensivtaktik gespielt hat (nur 12 Gegentore), konnten die Zuschauer bei Energie Brandenburg die totale Offensive (offensichtlich unter Vernachlässigung der eigenen Verteidigung) bestaunen. Das war sicher attraktiver als die Betontaktik der Unioner.
[18]
Und was hat das mit Rechnungswesen zu tun?
Wir wollen Ihnen hier lediglich zeigen, dass für Freunde des Fußballs ein paar Zahlen, systematisch aufbereitet, viel über die Realität in der abgelaufenen Saison verraten. Genauso ist es mit den Daten des Rechnungswesens. Sie sollen die Realität beschreiben und dem Leser ermöglichen, daraus ökonomische Entscheidungen abzuleiten.
Übung 2: Einkommen versus Vermögen
Was ist für Sie ein Millionär?
►►Die Frage scheint trivialer zu sein, als sie tatsächlich ist. Man muss nämlich zwischen Einkommens- und Vermögensmillionären unterscheiden. Ein Vermögensmillionär ist Eigentümer von Vermögensgegenständen, deren Wert (abzüglich seiner Schulden) mindestens eine Mio. € beträgt. Beispiel: X hat ein schickes Haus am Scharmützelsee (Wert: 1 Mio. €), Aktien (Wert: 0,5 Mio. €) und Geldvermögen (Bankguthaben und Bargeld: 0,1 Mio. €). Auf dem Haus lastet aber eine Grundschuld in Höhe von 0,5 Mio. €. Sein Reinvermögen beträgt damit 1,1 Mio. €. Er ist Vermögensmillionär.
Wenn X hingegen jedes Jahr mindestens 1 Mio. € „verdienen“ würde, wäre er ein Einkommensmillionär. Beispiel: X erzielt aus seinem Einzelunternehmen in jedem Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,1 bis 1,5 Mio. €.
Man sieht, dass zwischen den beiden ökonomischen Kerngrößen „Jah-resüberschuss“ und „Reinvermögen“ sauber zu unterscheiden ist. Ver-mögensmillionär zu werden, ist nicht einfach; Einkommensmillionär zu werden, ist ungleich schwieriger.
Übung 3: Forderungen und Verbindlichkeiten
Diskutieren Sie Beispiele für Geschäftsvorfälle, aus denen Forderungen oder Verbindlichkeiten entstehen können.
►►Forderungen entstehen in der Regel, wenn der Gläubiger gegenüber dem Schuldner eine entgeltliche Leistung erbracht, dieser aber noch nicht gezahlt hat. Dies können etwa Warenlieferungen oder Dienstleistungen auf Ziel sein (= Forderungen aus Lieferungen und Leistungen). Analog besteht beim Schuldner bis zur Zahlung eine Verbindlichkeit [19]aus Lieferungen und Leistungen. Hat der Gläubiger dem Schuldner ein Darlehen gewährt, so hat der Gläubiger eine Darlehensforderung; der Schuldner muss das Darlehen (= Darlehensverbindlichkeit) tilgen und Zinsen zahlen.
Übung 4: Gewinnrealisationszeitpunkt
Die Z-GmbH handelt mit Wintersportartikeln. Am 20.12. bestellt ein Kunde verbindlich (Kaufvertrag) ein Paar Ski der Marke „Monosal Tornado X Wing TI“. Die Ski holt er am 30.12. im Laden der Z-GmbH ab und überweist den Kaufpreis am 2.1. des Folgejahres. Zu welchem Zeitpunkt ist der Gewinn der GmbH realisiert?
►►Grundsätzlich sind alle drei Zeitpunkte denkbar. Juristen plädieren häufig für den Vertragsabschluss (20.12.), andere Laien für den Zahlungs-zeitpunkt (2.1.). Der Gesetzgeber hat sich aber für den Zeitpunkt, zu dem der Bilanzierende seine Leistung erbracht hat (das ist hier der 30.12.), als so genannten Realisationszeitpunkt entschieden. Sind ihre Erträge (= Umsatzerlöse) höher als die eigenen Aufwendungen, hat die Z-GmbH am 30.12. einen Gewinn erzielt.
Übung 5: Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen
Die Z-GmbH verkauft Küchen im Landhausstil. In der Regel kauft sie die Waren bei polnischen und tschechischen Möbelfabriken und verkauft diese dann an die Endkunden weiter. Planung, Lieferung frei Haus und Montage gehören zum Service. Auch werden auf Kundenwunsch von den hauseigenen Tischlern kleine Anpassungen vorgenommen, wenn etwa die Maße der Küche nicht genau zum Grundriss passen. Ist die Z-GmbH ein Handels-, ein Industrie- oder ein Dienstleistungsunternehmen?
►►Ja! Diese Dreiteilung stellt idealtypische Unternehmen dar. In der Praxis ist aber fast jedes Unternehmen zugleich Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen; nur die Gewichtungen sind verschieden. Unsere Z-GmbH ist eigentlich ein Handelsunternehmen. Durch die individuelle Planung, die Lieferung und den Transport ist sie aber auch ein Dienstleistungsunternehmen und wenn die Küchen stark an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden („Customized“), kann man sogar von einem Industrieunternehmen sprechen.
►Vergleiche zur Lösung aller Übungen Kudert/Sorg: Rechnungswesen - leicht gemacht®, Lektion 1.
[20]
Lektion 2: Der Jahresabschluss als Teilbereich des Rechnungswesens
Lernziel
Ziel der Lektion 2 ist, ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum es verschiedene Teilbereiche des Rechnungswesens gibt, mit welchen Begrifflichkeiten diese arbeiten und warum es für manche Teilbereiche gesetzliche Vorschriften gibt und für andere nicht.
Leitsatz
Teilbereiche des Rechnungswesens und deren Grundbegriffe
Das Rechnungswesen lässt sich nach den Informationsempfängern in ein internes und ein externes Rechnungswesen unterscheiden. Während bdas externe Rechnungswesen (der handelsrechtliche Einzelabschluss, der handelsrechtliche Konzernabschluss und die Steuerbilanz) rechtlich geregelt ist, sind für das interne Rechnungs¬wesen (Kosten- und Leistungsrechnung, Investitionsrechnung und Finanzplanung) Rechtsnormen überflüssig. Externes Rechnungswe¬sen sowie Investitionsrechnung und Finanzplanung gehen von einem pagatorischen Kostenbegriff aus; sie knüpfen also an Zahlungs¬ströme an.
Ein- und Auszahlungen (= Änderungen des Zahlungsmittelbestan¬des) sind liquiditätswirksam und daher bei der Planung und Messung der Liquidität (zur Finanzplanung beziehungsweise Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit) zu berücksichtigen.
Ebenso haben Erträge und Aufwendungen (= betriebsbedingte Änderungen des Eigenkapitals) eine eindeutige Funktion im Rahmen der Erfolgsmessung des externen Rechnungswesens.
Weniger klar ist jedoch die Funktion der Einnahmen und Ausgaben (Änderungen des Geldvermögens oder auch Wert der bezogenen beziehungsweise abgesetzten Leistungen). Wenn man im Rahmen der Investitionsrechnung die Finanzierungsseite vernachlässigt (so etwa bei der Kapitalwertmethode), ist dort mit Ausgaben und Ein¬nahmen zu rechnen.
[21]
Wissenskontrollfragen
1.Nennen Sie die Teilbereiche des Rechnungswesens und ordnen Sie diesen ihre wesentlichen Aufgaben zu!
2.Was ist der zentrale Unterschied zwischen internem und externem Rechnungswesen?
3.Nennen Sie drei Ziele, die mit der Kosten- und Leistungsrechnung verfolgt werden!
4.Wie ist der Ertragswert einer Investition definiert?
5.Was verstehen Sie unter dem finanziellen Gleichgewicht?
6.Welches sind die drei zentralen Aufgaben der handelsrechtlichen Rechnungslegung?
7.Was verstehen Sie unter Gewinnthesaurierung?
8.Was verstehen Sie unter dem Grundsatz der Pagatorik?
9.Definieren Sie die Begriffe Auszahlung, Ausgabe, Aufwand sowie Einzahlung, Einnahme und Ertrag!
10.Nennen Sie Beispiele dafür, wie für ein Unternehmen Schulden ge¬genüber einer Bank, gegenüber einem Zulieferer, gegenüber einem Kunden oder gegenüber einem Arbeitnehmer entstehen!
zu1.
Teilbereichedes internenRechnungswesens:
Wesentliche Aufgaben:
Kosten-und Leistungs rechnung
Preiskalkulation und -beurteilung, Wirtschaftlichkeitskontrolle, Pro grammplanung
Investitionsrechnung
Rentabilitätsprognose -und vergleich für geplante Investitionen
[22]
Finanzplanung
Prognose der Liquidität und Sicherung des finanziellen Gleichgewichts
Teilbereichedes externenRechnungswesens:
Wesentliche Aufgaben:
Einzelabschluss
Dokumentation, Information, Ausschüttungsbemessung
Konzernabschluss
Information
Steuerbilanz
Steuerzahlungsbemessung