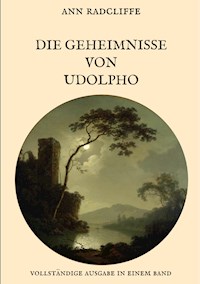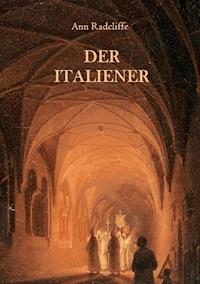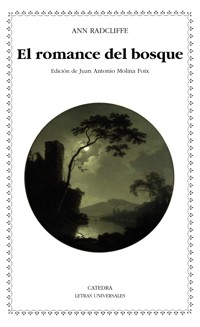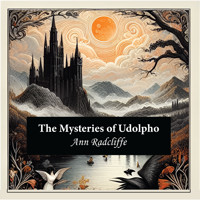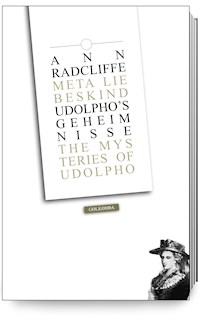
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Emilie St. Aubert ist das einzige Kind einer adeligen Familie, die zurückgezogen auf ihren kleinen Ländereien lebt. Nachdem sie mehrere Schicksalsschläge erlitten hat, sieht sich die feinsinnige junge Frau gezwungen, zu einer Tante zu ziehen, mit der sie nur wenig verbindet. Als sie sich weigert, nur um des Geldes willen eine Ehe mit einem Grafen einzugehen, wird sie auf das abgelegene Schloss Udolpho verschleppt. Mysteriöse Vorfälle drohen sie in den Wahnsinn zu treiben, und nur der Gedanke an ihren Geliebten Valancourt hält sie bei Verstand. Doch auch dieser hütet ein finsteres Geheimnis − Emilies Schicksal scheint unter einem dunklen Stern zu stehen ... Der große Klassiker der Schauerromantik nach weit über 200 Jahren erstmals wieder auf Deutsch: 1795, nur ein Jahr nach der Originalausgabe The Mysteries of Udolpho, erschien die herausragende Übersetzung aus der Feder von Meta Forkel-Liebeskind. Sie wird hier, wie die Vorlage in vier Bänden, neu herausgegeben, und zwar in sorgfältigem, möglichst zeichengetreuem Neusatz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1164
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ann Radcliffe
Udolpho’s Geheimnisse
Deutsch von Meta Liebeskind
Mit einem Vorwort von Alexander Pechmann
Herausgegeben von Hannes Riffel
[GOLKONDA]
The Mysteries of Udolpho
(London: G. G. & J. Robinson, 1794)
Udolpho’s Geheimnisse.
(Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1795/96)
Redaktion: Gudrun Hahn
Texterfassung: Alexander Schepke
Korrektur: Ralf Neukirchen & Hannes Riffel
Titelgestaltung: s.BENeš [www.benswerk.de]
E-Book-Erstellung: Hardy Kettlitz
© dieser Ausgabe 2016 by Golkonda Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Golkonda Verlag
Charlottenstraße 36 | 12683 Berlin
[email protected] | www.golkonda-verlag.de
ISBN 978-3-944720-96-8 (E-Book)
Die Buchausgabe ist in vier Bänden erschienen.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Inhalt
Titel
Impressum
Inhalt
Ann Radcliffe und die Schule des Schreckens.Eine Einleitung
Udolpho’s Geheimnisse. Erster Theil.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Udolpho’s Geheimnisse. Zweiter Theil.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Udolpho’s Geheimnisse. Dritter Theil.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Ende des dritten Theils.
Udolpho’s Geheimnisse. Vierter Theil.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Klassiker bei GOLKONDA
Bücher im Golkonda Verlag
Ann Radcliffe und die Schule des Schreckens.Eine Einleitung
Für ihre begeisterten Leser war sie »The Great Enchantress« – »die große Zauberin«, für spätere Generationen die wohl einflussreichste und erfolgreichste Autorin des klassischen englischen Schauerromans. Ann Ward Radcliffe wurde im selben Jahr geboren, in dem das erste, maßgebliche Werk dieses Genres, The Castle of Otranto von Horace Walpole, erschien und die Unterhaltungsliteratur einer ganzen Epoche prägte. Sie kam am 9. Juli 1764 als Tochter des Londoner Kurzwarenhändlers William Ward zur Welt und übersiedelte 1772 mit ihrer Familie nach Bath, wo ihr Vater ein Porzellangeschäft führte. Sein Teilhaber war der berühmte Josiah Wedgwood, der auch das Königshaus mit seinen neoklassizistischen Töpferwaren belieferte.
Über Anns Kindheit und Jugend weiß man so gut wie nichts, doch dürfte sie eine vorzügliche, den Idealen der Aufklärung verpflichtete Schulbildung in einer Mädchenschule genossen haben und hatte möglicherweise die Gelegenheit, Elizabeth Montagu, Hester Lynch Piozzi oder andere Damen des sogenannten »Bluestocking Circle« zu treffen, in deren literarischen Salons die wichtigen Dichter, Schriftsteller und Gelehrten des späten 18. Jahrhunderts wie Samuel Johnson und auch der eingangs erwähnte Erfinder des Schauerromans Horace Walpole verkehrten.
Ann heiratete 1787 den Oxforder Juristen William Radcliffe, der als Teilhaber und Mitherausgeber der Zeitung The English Chronicle mit ihr nach London zog. Das kinderlos bleibende Paar führte ein eher zurückgezogenes Leben, besuchte Theater- und Opernvorstellungen und teilte eine Vorliebe für Musik, Literatur, Kunst und Reisen. Ann Radcliffe begleitete ihren Mann in den malerischen Lake District und auch auf den Kontinent – nach Holland und Deutschland, aber nicht nach Italien, dem Schauplatz vieler ihrer Romane, deren detaillierte Landschaftsbeschreibungen nie dem eigenen Erlebnis entsprangen, sondern vor allem dem Studium der Gemälde von Künstlern wie Claude Lorrain und Salvator Rosa, die in den Galerien Londons ausgestellt waren.
Die Schriftstellerei war für Ann Radcliffe anfangs lediglich ein Mittel, um der Langeweile zu entfliehen und einsame Abende mit sinnvoller Beschäftigung zu füllen. Ihr erster Roman, The Castles of Athlin and Dunbayne: A Highland Story, erschien 1789 und wurde bislang nicht ins Deutsche übersetzt. Er erzählt die Geschichte zweier verfeindeter Clans im mittelalterlichen Schottland und lässt sich nur anhand einzelner, in den nachfolgenden Werken wiederkehrender Motive mit dem Genre der »gothic novel« verbinden: Dies sind vor allem die Figuren des charismatischen Schurken, der mittels einer erzwungenen Eheschließung ein Erbe an sich reißen will, und der tugendhaften Jungfrau, die allerlei Unbill ertragen muss, ehe sie mit ihrer wahren Liebe vereint wird. Das Buch enthält auch einen Vorgeschmack auf die detailreichen und stimmungsvollen Schilderungen von Landschaften und labyrinthischen Burgen in Ann Radcliffes späteren Romanen, doch fehlt noch deren mit unheimlichen Andeutungen gewürzte Spannung und die unheilvolle Atmosphäre.
In ihrem zweiten Werk, A Sicilian Romance (1790, dt. Die nächtlichen Erscheinungen im Schlosse Mazzini [1792]), fügte die Autorin dem ins Italien des 16. Jahrhunderts verlegten historischen Hintergrund eine Komponente hinzu, die zu einem wichtigen Bestandteil ihres Erfolgsrezepts werden sollte: das Spukphänomen, das letztlich eine rationale Erklärung findet. Die eigentliche Handlung dreht sich jedoch erneut um eine Jungfrau in Nöten, den Versuch, sie gewaltsam unter die Haube zu bringen, sowie ihre Flucht und Rettung durch den tot geglaubten Geliebten. Der Schurke ist in diesem Fall der eigene Vater, der zudem seine Frau in einem Verließ versteckt hält, um erneut heiraten zu können – ein Motiv, das Sheridan Le Fanu in A Chapter in the History of a TyroneFamily (1839, dt. Der schwarze Vorhang [2009]) und The Wyvern Mystery (1869) sowie Charlotte Brontё in Jane Eyre (1847) überzeugend variierten.
Radcliffes dritter Roman, The Romance of the Forest (1791, dt. Adeline oder die Abentheuer im Walde [1793]), könnte man als ihre erste wirkliche »gothic novel« bezeichnen, da er den bis dahin wichtigsten Werken dieses Genres, Walpoles Castle of Otranto (1764, dt. Die Burg von Otranto [1794]) und Clara Reeves The Old English Baron (1777, dt. Der alte englische Baron [1789]), am nächsten steht. Der Schauplatz, ein altes Kloster in Frankreich, das einer Räuberbande als Unterschlupf dient, wird zu einem fast lebendigen, von Aberglauben und prophetischen Träumen umrankten Ort voller dunkler Korridore, Geheimverstecke, fauliger Manuskripte und klappernder Skelette.
Die schaurige Burg des Schurken Montoni in The Mysteries of Udolpho (1794, dt. Udolpho’s Geheimnisse [1795-96]) verfeinerte Ann Radcliffes Idee des unheimlichen, von unerklärlichen Ereignissen heimgesuchten Ortes, der in den Augen der hypersensiblen Romanheldin zum Labyrinth und Gefängnis mutiert. Die Geheimnisse der Burg Udolpho sind gewissermaßen Spiegelungen einer überhitzten Wahrnehmung, die Landschaften werden zu Spiegeln der Seele, der Schrecken spielt sich vornehmlich im Kopf ab. Die Autorin löst hier ein Versprechen ein, das Horace Walpole in ihrem Geburtsjahr gab: die Versöhnung des Phantastischen und freien Imaginierens mit dem Wahrscheinlichen und Wirklichkeitsnahen, das die klassizistische Ästhetik einforderte – das Übernatürliche wurzelt in der subjektiven Perspektive und Wahrnehmung.
Ann Radcliffe wusste genau, an welche literarische Traditionen sie anknüpfte. Sie kannte auch die ästhetischen Theorien ihrer Zeit, die vielzitierte Schrift von Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1759) und das darin vorgestellte Konzept des »Erhabenen«, ein Bewusstseinszustand lustvollen Schauderns, der sich bei der Betrachtung des Schönen wie auch des Schrecklichen einstellen kann. In ihrem eigenen theoretischen Essay »On the Supernatural in Poetry«, der postum im New Monthly Magazine and Literary Journal (1826) veröffentlicht wurde, traf sie allerdings eine Unterscheidung, die bei Burke nicht zu finden ist: jene zwischen »terror« und »horror«, »Schrecken« und »Grauen«:
Schrecken und Grauen sind insofern gegensätzlich, als dass das erstgenannte Gefühl die Seele erweitert und im hohen Maße die Lebensgeister weckt, während das zweite sie bannt, lähmt und beinahe auslöscht. Ich gehe davon aus, dass weder Shakespeare und Milton in ihrer Literatur noch Mr. Burke in seiner Philosophie echtes Grauen irgendwo als Quelle des Erhabenen betrachteten, obwohl sie Schrecken sehr wohl als solche ansahen; und wo liegt der große Unterschied zwischen Schrecken und Grauen, wenn nicht in der Ungewissheit und Dunkelheit, die das erste angesichts des gefürchteten Bösen begleiten?
Diese Zeilen wurden möglicherweise als Reaktion auf einen Roman geschrieben, der mit den Traditionen des klassischen Schauerromans brach und das unverhüllte Grauen in den Mittelpunkt der Wahrnehmung rückte: The Monk von Matthew Gregory Lewis (1796, dt. Der Mönch [1798–99]). Während in Ann Radcliffes Romanen das Böse lediglich als Schattenspiel angedeutet und oft als reine Illusion einer sensiblen Person entlarvt wird, gibt es bei Lewis keine Zweideutigkeiten: Das Unheimliche und Phantastische ist keine vage Drohung, sondern Realität, das Böse entlädt sich in Vergewaltigung und Mord. Mit The Monk beginnt somit eine neue Epoche der englischen Schauerliteratur, die man – im Gegensatz zu Radcliffes »School of Terror« – als »School of Horror« bezeichnet.
Ann Radcliffes fünfter Roman The Italian, or the Confessional of the Black Penitents (1797, dt. Die Italienerin oder der Beichtstuhl der schwarzen Büssenden [1797–99]) war eine gezielte Antwort auf die neue »Schule des Grauens«. In diesem letzten Höhepunkt der klassischen Schauerliteratur dreht sich die Handlung um die teuflischen Intrigen des Mönchs Schedoni, der mit allen Mitteln versucht, die Liebe zwischen der armen Ellena Rosalba und dem jungen Adligen Vincentio di Vivaldi zu hintertreiben – eine Liebe also, die althergebrachte Klassenunterschiede aufheben und die traditionelle Bedeutung von Herkunft verwerfen würde.
Nach dem großen Erfolg dieses Buches zog die Autorin sich aus unbekannten Gründen gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Zwar vollendete sie 1802 einen historisch-phantastischen Roman, Gaston de Blondeville (dt. Gaston von Blondeville oder die Hofhaltung Heinrichs des Dritten im Ardennerwalde [1827]), um eine Mordanklage, die die Hochzeit des Titelhelden verhindern soll, doch erschien dieser erst einige Jahre nach ihrem Tod, zusammen mit einer langen Verserzählung, St. Albans Abbey, und weiteren Gedichten (1826). Dem postum veröffentlichten Werk war ein kurzer biographischer Text von Sir Thomas Noon Talfourd beigefügt, der die bis heute verlässlichste Quelle zum Leben der Autorin darstellt, auch wenn er wohl vor allem zu dem Zweck geschrieben wurde, die wilden Gerüchte um ihre letzten Jahre zu widerlegen. Man munkelte, sie sei über ihrer Beschäftigung mit dem Unheimlichen und Schrecklichen wahnsinnig geworden und hätte lange Zeit in einer Heilanstalt für Geisteskranke in Derbyshire verbracht. Tatsächlich litt sie vermutlich nur unter einer schwachen Konstitution und Asthma und starb am 7. Februar 1823 an einer Lungenentzündung.
Die Bücher der »großen Zauberin« fanden zu Lebzeiten wie auch nach ihrem Tod zahlreiche Bewunderer, auch unter den Schriftstellern der nächsten Generation. Sir Walter Scott imitierte ihre Methode, Gedichte in die Romanhandlung einzufügen, Edgar Allan Poe verfeinerte die Idee, psychische Vorgänge in der Landschaftsbeschreibung zu spiegeln, und Mary Shelley übernahm insbesondere in ihren Erzählungen wie »Ferdinando Eboli« (1829) die für Ann Radcliffes Werk typischen Handlungsmuster und Figuren. Dieselben gerieten allerdings immer häufiger ins Visier der Spötter und Parodisten: Jane Austens Northanger Abbey (1818, dt. Die Abtei von Northanger [1948]) könnte man noch als ironische Hommage an das Genre der klassischen Schauerliteratur lesen, wobei sich die von der Hauptfigur imaginierten Schrecken und Geheimnisse als harmlose Alltagserscheinungen entpuppen. Thomas Love Peacocks Nightmare Abbey (1818, Nachtmahr-Abtei [1989]) ist indes eine reine Satire, die sich zudem über das Weltbild und die mitunter an Ann Radcliffes charismatische Schurken angelehnte Selbstdarstellung der großen Romantiker, Lord Byron und Percy B. Shelley, lustig macht.
Die Schauerliteratur wurde fortan eher von der »Schule des Grauens« und herausragenden Werken wie Charlotte Dacres Zofloya (1806), Mary Shelleys Frankenstein (1818) und Charles Maturins Melmoth the Wanderer (1820) geprägt. Die von Ann Radcliffe begründete Tradition wurde jedoch zur Mitte des 19. Jahrhunderts von den Vorläufern der modernen Kriminalliteratur begierig aufgegriffen. Autoren wie Wilkie Collins und Sheridan Le Fanu übertrugen die klassischen Handlungsmuster, die übermenschlich wirkenden Schurken, die von teuflischen Intrigen bedrohten Jungfrauen in ihre Gegenwart, tauschten die mittelalterlichen Klöster und Burgen gegen englische Landsitze und Herrenhäuser und nutzten in ihren komplexen und umfangreichen Romanen eifrig das Prinzip des »rational erklärten Phantastischen«. Die Aufklärung eines unheimlichen, rätselhaften oder schrecklichen Familiengeheimnisses rückte in den sogenannten »sensation novels« in den Mittelpunkt der Handlung und lieferte die Schablone für die ersten Detektiv- und Kriminalromane. Daphne du Mauriers Krimiklassiker Rebecca (1938) zeigt beispielhaft, wie diese Tradition im 20. Jahrhundert fortgeführt und weiterentwickelt wurde.
Während der Einfluss Ann Radcliffes auf die phantastische Literatur genau genommen eher überschaubar ausfiel, wirken ihre Ideen in der Kriminalliteratur bis heute nach. In diesem Kontext werden auch ihre sozialkritischen Ansätze deutlicher. Die Schrecken, mit denen sich ihre jungen Romanheldinnen konfrontiert sehen, stehen oft in Verbindung mit Zwangsheirat oder der Sabotage von klassenüberschreitenden Liebesbeziehungen. Für Leserinnen des 18. und 19. Jahrhunderts hatte dies nichts mit phantastischen Schauermärchen zu tun, sondern reflektierte die wirkliche Situation der Frau, die durch eine Eheschließung das Verfügungsrecht über ihr Vermögen an den Ehemann verlor – aus juristischer Sicht waren sie, ihr Erbe und ihre Kinder weitgehend Eigentum des Mannes. Die Flucht Emilys vor dem Erzschurken Montoni ist also nicht zuletzt eine Flucht vor gesellschaftlichen Konventionen, und das Enträtseln von Udolphos Geheimnissen ist Teil eines Lernprozesses, den man heute Emanzipation nennen würde.
Die ersten – und in den meisten Fällen einzigen – Übersetzungen der Werke von Ann Radcliffe ins Deutsche verdanken wir Sophia Dorothea Margarete »Meta« Liebeskind (1765–1853), die nach der gescheiterten Ehe mit dem Göttinger Musikprofessor Johann Nikolaus Forkel ihren Lebensunterhalt mit der Übertragung von Reiseberichten, historisch-politischen und literarischen Werken aus dem Englischen und Französischen verdiente. Wegen ihres vergleichsweise emanzipierten Lebenswandels wurde sie von ihren Zeitgenossen als »Schlumpe« verachtet, und ihre freundschaftliche Beziehung zu den Mainzer Jakobinern um Georg Forster führte 1793 zu einer Inhaftierung. Nach der Heirat mit ihrem zweiten Mann, dem Juristen und preußischen Regierungsrat Johann Heinrich von Liebeskind, dem sie fünf Kinder gebar, arbeitete sie jedoch weiterhin als Schriftstellerin, Journalistin und Übersetzerin von prägenden Autoren der Aufklärung wie Thomas Paine, William Godwin und Constantin Volney.
Die vorliegende vollständige Neuausgabe von Udolpho’s Geheimnisse nach der vierbändigen deutschen Fassung von 1795–96 würdigt also nicht nur einen Höhepunkt der englischen Schauerliteratur, sondern auch die Arbeit einer mutigen Frau in einer von gesellschaftlichen Zwängen und politischer Unterdrückung geprägten Zeit.
Alexander Pechmann
Udolpho’s Geheimnisse. Erster Theil.
Erstes Kapitel
Im Jahr 1584 stand in der Provinz Gasconien, an den reizenden Ufern der Garonne das Schloß des Herrn St. Aubert. Es gewährte eine Aussicht auf die Landschaften von Guyenne und Gasconien, die sich im Schmucke dicker Gehölze, Weinberge und Olivenwäldchen längs dem Flusse hinzogen. Nach Süden wurde der Blick durch die majestätischen Pyrenäen begränzt, deren Gipfel, bis an die Wolken ragend, bald in schauerlichen Formen da standen, bald von den herabrollenden Dünsten zum Theil verhüllt, kahl und öde durch die blaue Lufthülle schimmerten, oder von düstern Fichtenwäldern eingefaßt, sich in schwarzen Schatten herab senkten. In sanftem Abstich gegen diese schrecklichen Gebürge lagen zu ihren Füßen Fluren, von kleinem Gehölze begränzt, wo unter weidenden Heerden, und einfachen ländlichen Hütten das Auge gern ausruhte, wenn es die schwebenden Klüfte über sich ausgemessen hatte. Nach Norden und Osten verloren sich im fernen Nebel Guyennens und Languedocs Ebnen; nach Westen begränzten Biscayens Gewässer das Gasconische Gebiet.
Herr von St. Aubert mochte gern mit seiner Frau und Tochter am Ufer der Garonne wandeln, und der Musik zuhören, die auf den Wellen zu schweben schien. Im bunten Gewühle der Welt hatte er das Leben in allen Gestalten kennen gelernt; aber nur zu schmerzhaft hatte Erfahrung die verschönerten Gemählde berichtigt, die sich sein Herz in früher Jugend von der Menschheit schuf. Doch waren bei allem Wechsel des Schiksals, bei allen sonderbaren Lagen, worin er geriet, seine Grundsätze unerschüttert, seine wohlwollenden Gefühle ungeschwächt geblieben; und sein Herz fühlte mehr Mitleid als Erbitterung über die Thorheiten des großen Haufens, als er sich aus der Welt zu dem reinern Genusse zurückzog, den einfache Natur, Lectüre und die Ausübung häuslicher Tugenden gewähren.
Er war der jüngere Abkömmling einer vornehmen Familie, nach deren Wunsche eine reiche Heirath, oder eine glänzende Bedienung den Mangel väterlichen Vermögens bei ihm ersetzen sollte. Allein St. Aubert besaß ein zu zartes Ehrgefühl, um das erste zu suchen, und zu wenig Ehrgeitz, um das, was er Glückseeligkeit nannte, dem Streben nach Glanz und Reichthum aufzuopfern. Nach seines Vaters Tode heirathete er ein sehr liebenswürdiges Weib, die ihm an Geburt gleich, und nicht reicher als er war. Der Verstorbene hatte durch seine Freigebigkeit oder vielmehr Verschwendung, seine Angelegenheiten in solche Verwirrung gebracht, daß sein Sohn es nothwendig fand, einen Theil der Familiengüter zu verkaufen. Würklich veräusserte er auch wenig Jahre nach seiner Heirath den größten Theil davon an den Bruder seiner Frau, Herrn Quesnel, und begab sich auf ein kleines Gut in Gasconien, wo er seine Zeit zwischen dem Genusse ehelicher Glückseeligkeit, der Ausübung väterlicher Pflichten und der Beschäftigung mit den Schätzen der Gelehrsamkeit und des Genies theilte.
Er hatte von Kindheit auf an diesem Pläzchen gehangen. Oft machte er als Knabe kleine Reisen dahin, und nichts hatte die frühen Eindrücke vertilgen können, welche die Gutmüthigkeit des freundlichen, grauköpfigen Pachters auf ihn machte, der nie unterließ, seinen jungen Gast mit Sahne und Früchten, und allem, was seine kleine Hütte vermochte, zu bewirthen. Nie dachte er ohne wehmüthige Schwärmerei zurück an die grünen Wiesen, auf welchen er so oft im Wohlgefühl der Gesundheit und jugendlicher Freiheit umhersprang; an die Wälder, unter deren erfrischenden Schatten er zuerst der sinnenden Melancholie Raum gab, die späterhin einen Hauptzug seines Charakters ausmachte – an die wilden Spatziergänge auf den Bergen; an den Fluß, auf dessen Wellen er sich wogte, an die fernen Fluren, die sich eben so gränzenlos ausdehnten, als seine frühen Hoffnungen. Es war ihm unbeschreiblich wohl, als er sich endlich von der Welt losmachen und sich hieher zurückziehn konnte, um die Wünsche so mancher Jahre in Erfüllung zu bringen.
Das Gebäude bestand damals nur aus einer Sommerhütte, die blos durch reinliche Einfachheit und angenehme Lage dem Fremden gefiel, und sehr erweitert werden mußte, um einer Familie bequemen Raum zu geben. St. Aubert fühlte eine gewisse Anhänglichkeit für jeden Theil des Gebäudes, an welchem irgend eine Erinnrung aus seiner Jugend klebte, und konnte sich nicht entschließen, einen Stein aus seiner Stelle zu rücken. Der neue Anbau wurde folglich nur dem alten angepaßt und machte mit ihm zusammen nur eine einfache und elegante Wohnung aus. Der Geschmack der Frau von St. Aubert hatte sich an der innern Einrichtung gezeigt. Dieselbe reine Einfalt, welche die Sitten der Einwohner bezeichnete, blickte auch aus dem Amöblement und wenigem Zierrath der Zimmer hervor.
Die Bibliothek, die mit einer Sammlung der besten Schriften aus den alten und neuen Sprachen bereichert war, nahm die westliche Seite des Schlosses ein. Dieses Zimmer stieß an ein Wäldchen an der Spitze eines kleinen Berges, der sich zum Flusse hinabsenkte. Die schlanken Bäume gaben ihm einen melancholischen, angenehmen Schatten, während das Auge aus dem Fenster die reiche, lachende Landschaft erblickte, die sich nach Westen hinzog und zur Linken von den kühnen Spitzen der Pyrenäen beschattet wurde. An die Bibliothek stieß ein mit schönen und seltnen Pflanzen angefülltes Gewächshaus: denn die Botanik war ein Lieblingsstudium des Herrn von St. Aubert. Oft brachte er den Tag zwischen den benachbarten Gebürgen hin, die dem Naturforscher eine reiche Erndte für seinen Geschmack darboten. Zuweilen begleitete ihn seine Gemahlin auf diesen kleinen Wanderungen, öfterer aber seine Tochter. Mit einem kleinen Körbchen zum Einsammlen der Pflanzen an einem, und einem andern Körbchen voll kalter Küche, die man in der Hütte des Schäfers nicht fand, am andern Arm, durchstrich sie an seiner Seite die romantischen, prächtigen Gegenden, ohne sich durch die Reize der demüthigen Kinder der Natur von der Beschauung ihrer ungeheuern Werke abziehn zu lassen. Waren sie es müde, auf Klippen umher zu klettern, die nur den Fußtritten des Schwärmers zugänglich schienen, und wo nur die Spur der wilden Gemse auf dem Grase das Daseyn eines lebendigen Geschöpfes verrieth, so suchten sie sich eine der grünen Hölen, die so schön den Busen dieser Berge schmücken, und verzehrten unter dem Schatten der Fichte oder Ceder ihr einfaches Mahl, versüßt durch das Wasser des klaren Stroms und durch den Duft der wilden Blumen und aromatischen Pflanzen, welche die Felsen einfaßten und aus dem Grase hervorschimmerten.
An die östliche Seite des Gewächshaußes stieß ein Zimmer, welches Emilie das ihrige nannte, und worin sie ihre Bücher, Zeichnungen und musikalischen Instrumente nebst einigen Lieblingsvögeln um sich versammlet hatte. Hier beschäftigte sie sich gewöhnlich mit den schönen Künsten, die sie blos aus Neigung trieb, und in welchen ihr Genie, durch die Anweisung ihrer Eltern unterstüzt, sie früh Fortschritte machen lehrte. Die Fenster dieses Zimmers, die bis zur Erde herabgiengen, hatten eine vorzüglich angenehme Aussicht auf einen kleinen Grasplatz, der rings das Haus umgab. Hier wurde das Auge zwischen Lustwäldchen von Mandeln, Palmen, Ellern und Myrthen hin auf die ferne Landschaft geleitet, wo die Garonne sich ergoß.
Oft sah man die ländlichen Bewohner dieses glücklichen Himmelsstrichs Abends nach vollendeter Arbeit am Rande des Flusses tanzen. Ihre frölichen Melodien, ihr leichter Schritt, die lebhafte Phantasie, die aus der oft barocken Figur ihrer Tänze hervorleuchtete, mit dem geschmakvollen, schalkhaften Anzug der Mädgen zusammengenommen, gaben der Scene ein durchaus französisches Ansehn.
Die Vorderseite des Schlosses, dessen südliche Aussicht auf die erhabnen Berge stieß, enthielt unten an der Erde einen ländlichen Saal und zwei niedliche Wohnzimmer. Der erste Stock (einen zweiten hatte die Hütte nicht) war zu Schlafzimmern eingerichtet, ein einziges Zimmer, das auf einen Balcon stieß, und wo gewöhnlich gefrühstückt wurde, ausgenommen.
Auf dem umliegenden Grunde hatte St. Aubert sehr geschmackvolle Verbesserungen angebracht. Doch hieng er so sehr an den Eindrücken seiner Knabenjahre, daß er oft den Geschmack der Empfindung aufopferte. So hatte er von zwei alten Buchen, die das Gebäude beschatteten und die Aussicht hinderten, oft gesagt, daß er schwach genug seyn würde, über ihren Fall zu weinen, und statt sie abzuhauen, pflanzte er lieber noch ein kleines Wäldchen von Fichten und Ellern dazu an. Von einer, durch das schwellende Ufer des Flusses gebildeten hohen Terrasse erhub sich ein Wäldchen von Orangen, Limonien und Palmbäumen, deren Früchte in der Abendkühle balsamischen Wohlgeruch aushauchten. In einzelne Gruppen verstreut, standen noch hie und da Bäume andrer Art. Hier, unter dem dicken Schatten eines Ahornbaumes, der seinen majestätischen Wipfel nach dem Flusse hinstreckte, mochte gern in den schönen Sommerabenden St. Aubert mit seiner Frau und Kindern sitzen, und unter dem Laubwerk hervor die untergehende Sonne, den milden Glanz ihres von der Landschaft hinweg schwindenden Lichtes betrachten, bis der Schatten der Dämmerung die mannigfaltigen Formen in ein bleiches Grau zusammenschmolz. Auf diesem Pläzchen las er gerne, sprach mit seiner Frau, oder spielte mit seinen Kindern, und gab sich ganz dem Eindruck der süßen Gefühle hin, die aus Natur und Einfalt quellen. Oft sagte er mit Thränen der Freude in seinen Augen, daß diese Augenblicke unendlich süßer wären, als irgend welche in dem glänzenden Geräusch, wonach die Welt strebt, zugebracht. Sein Herz war ausgefüllt; es kannte keinen Wunsch nach höherer Glückseeligkeit als er empfand. Das Bewußtseyn, recht zu handeln, verbreitete eine Heiterkeit über sein Wesen, welche nur dieß Bewußtseyn bei einem Manne von so feinem moralischen Gefühl hervorbringen konnte, und die den Genuß jeder ihn umgebenden Freude erhöhte.
Der tiefste Schatten der Dämmerung konnte ihn nicht von seinem Lieblingsbaume vertreiben. Er liebte die süße Stunde, wo die lezten Farben des Lichts erstarben, wo die dicht gesäeten Sterne durch den Aether zittern, und aus der dunkeln Fläche des Wassers wiederstrahlen; die Stunde, welche vor allen andern die Seele in wehmüthig süßes Nachdenken verstekt, und sie erst zu erhabnen Betrachtungen emporhebt. Oft verweilte er noch hier, wenn schon der Mond seine sanften Stralen durch das Laub hingoß, und oft wurde sein ländliches Mahl von Milch und Früchten unter seinem Schatten ausgebreitet, bis durch die Stille der Nacht der harmonische Gesang der Nachtigall drang, und die Seele in schwermüthig süße Gefühle einwiegte.
Der Tod seiner Söhne war die erste Unterbrechung des Glücks, das er in seiner ländlichen Einsamkeit genoß. Er verlor sie in dem Alter, wo die kindische Unbefangenheit so sehr fesseln kann, und wenn er gleich um seiner Gattin willen, den Ausdruck seines Schmerzes zu unterdrücken, und alle Philosophie aufzubieten suchte, so fühlte er doch nur zu gut, daß es keine Philosophie giebt, die bei einem solchen Verluste beruhigen kann. Eine Tochter war nunmehr sein einziges Kind, und während er mit sorgsamer Zärtlichkeit die Entfaltung ihrer jungen Geisteskräfte beobachtete, bemühte er sich mit unablässiger Sorgfalt den Zügen in ihrem Charakter entgegen zu arbeiten, die in der Folge ihre Glückseeligkeit stören konnten. Sie verrieth in ihrem frühsten Alter ungewöhnliche Zartheit des Gefühls, und äusserste Güte; nur war mit diesen Eigenschaften ein für ihre künftige Ruhe zu feiner Grad von Zärtlichkeit verbunden. So wie sie an Jahren zunahm, gab diese Fühlbarkeit ihrem Geist einen Hang zum Nachdenken und ihrem Wesen eine Sanftheit, die den Reiz ihrer Schönheit erhöhte, und sie unendlich liebenswürdig machte. Allein St. Aubert besas zu viel gesunde Vernunft, um einen Schmuck einer Tugend vorzuziehn, und war scharfsinnig genug einzusehn, daß dieser Schmuck zu gefährlich für die Besitzerin war, um ein Glück genannt zu werden. Er gab sich alle Mühe, ihre Seele zu stärken, und sie an Herrschaft über sich selbst zu gewöhnen; er lehrte sie, dem ersten Antriebe ihrer Gefühle zu widerstehn, und mit kaltem Blute die Vereitlung ihrer Wünsche zu betrachten, die er selbst ihr oft in den Weg zu legen wußte. Indem er sie unterrichtete, dem ersten Eindrucke zu widerstehn, und sich die standhafte Seelenwürde zu erwerben, die allein den Leidenschaften das Gegengewicht zu halten, und uns über die Gewalt der Umstände empor zu heben vermag, gab er sich selbst eine Lehre der Stärke; denn oft mußte er mit anscheinender Gleichgültigkeit die Thränen und Kämpfe ansehn, welche seine Sorgfalt ihr kostete.
Emilie glich von Person ihrer Mutter; sie hatte ihr feines Ebenmaas der Gestalt, ihre Feinheit der Züge und ihre blauen Augen, voll süßer Zärtlichkeit. Allein so liebenswürdig auch ihre Person war, bestand doch ihr Hauptreiz in dem Ausdrucke ihres Gesichts, das mit zarter Bewegbarkeit alle Gefühle ihrer Seele verrieth, sobald Gespräch und Unterhaltung sie belebten.
St. Aubert bebaute ihren Verstand mit der ängstlichsten Sorgfalt: er brachte ihr eine allgemeine Uebersicht von den Wissenschaften, und eine genaue Bekanntschaft mit allen Theilen der schönen Litteratur bei. Er lehrte sie Latein und Englisch, damit sie die Schönheiten der besten und erhabensten Dichter verstehen konnte. Sie zeigte von Kindheit an besondern Geschmack für Werke des Genies, und es war St. Auberts Grundsatz, sowohl als es seiner Neigung gemäß war, jede unschuldige Mittel der Glückseeligkeit bei ihr zu befördern. Ein wohl angebauter Geist, sagte er oft, ist die beste Sicherheit gegen die Pest der Thorheit und des Lasters. Die leere Seele hascht immer nach Zeitvertreib, und stürzt sich lieber in Verwirrungen, um nur der Langenweile zu entgehn. Man bereichre sie mit Ideen, man lehre sie das Vergnügen des Denkens kosten, und gewiß wird die Befriedigung, die sie in ihrer innern Welt findet, die Versuchungen der äussern aufwiegen. Eine geübte Denkkraft, ausgebildete Seelenkräfte sind gleich nothwendig zum Glück eines ländlichen und städtischen Lebens; beim erstern verhindern sie die unangenehme Empfindung der Unthätigkeit und gewähren ein veredeltes Vergnügen durch den Geschmack, den sie am Großen und Schönen erzeugen; beim leztern machen sie Zerstreuung weniger zu einem Gegenstande des Bedürfnisses und folglich des Bestrebens für uns.
Spatziergänge in der schönen Natur gehörten unter Emiliens frühste Vergnügungen, mehr aber noch als die sanfte und glühende Landschaft liebte sie die wilden Spatziergänge in den Wäldern, die das Gebürge einfaßten; vorzüglich aber die ungeheuern Klüfte und Berghölen, wo die Stille und Größe der Einsamkeit dem Ganzen eine schauerliche Ehrfurcht einflößte, und ihre Gedanken zu dem Gotte des Himmels und der Erde emporhub. Oft wandelte sie hier einsam umher, in melancholischen Zauber gewiegt, bis der lezte Schimmer des Tages vom Westen verschwand; bis nichts mehr, als der einsame Laut einer Schäferglocke, oder das ferne Bellen eines Haushundes die Abendstille unterbrach: dann weckte die Dunkelheit der Wälder, das Zittern des Laubs in dem Lüftchen, die Fledermaus, die durch die Dämmerung schwirrte, das einzelne, bald verschwindende, bald wiederkehrende Licht in den Hütten, die Kräfte ihrer Seele zur Begeisterung und Poesie.
Ihr liebster Gang war zu einer kleinen Fischerhütte, die St. Aubert in einer Waldhöle am Rande eines Flüßchens angelegt hatte, das von den Pyrenäen herab strömte, und nachdem es schäumend die Klippen herabgestürzt war, seinen stillen Lauf unter den Schatten hinwand, die sich in seinen klaren Fluten spiegelten. Ueber den Wäldern, die diese Höle einzäunten, erhoben sich die hohen Gipfel der Pyrenäen, welche oft kühn durch die dunkeln Schatten ins Auge sprangen. Oft sah man nur das zertrümmerte Haupt eines Felsen, mit wildem Gesträuch gekrönt, oder eine Schäferhütte, die von dunkeln Cypressen, oder wallenden Ellern beschattet, an einer Klippe hieng. Aus den Tiefen der Wälder hervorgehend öfnete sich der Prospekt auf die ferne Landschaft, wo die reichen Weiden und mit Wein bedeckten Hügel von Gasconien sich allmählig zu den Ebnen herabneigten, bis endlich an den sich windenden Ufern der Garonne, Wäldchen und Dörfer und Lusthäuser, die Schärfe ihrer Formen in der weiten Ferne verlierend, vor dem Auge in ein reiches harmonisches Colorit zusammenschmolzen.
Dieß war auch St. Auberts Lieblingsaufenthalt, wohin er sich oft von der Hitze des Mittags mit seiner Frau, seiner Tochter und seinen Büchern zurückzog; oft kam er in der süßen Abendstunde, um die schweigende Dämmrung zu begrüßen, oder die Musik der Nachtigallen zu belauschen. Oft auch brachte er sich selbst Musik mit, und weckte das schlafende Echo durch den sanften Laut seiner Hoboe, wofern nicht Emiliens Töne neue Süßigkeit aus den Wellen zogen, über welchen sie bebten.
Einst bemerkte sie auf einem Spatziergange nach diesem Orte einige Zeilen von unbekannter Hand mit einer Bleifeder an die Wand geschrieben. Voll Verwundrung trat sie näher herzu und fand ein niedliches Sonnet, das an die unbekannte Göttin dieser Schatten gerichtet war. Emilie besaß nicht Eitelkeit genug, diese Zeilen auf sich zu deuten, eben so wenig aber konnte sie, wenn sie den kleinen Zirkel ihrer Bekannten durchlief, einen andern Gegenstand finden, an den sie gerichtet seyn könnten. Sie blieb also in Ungewißheit, die einem weniger beschäftigten Geist peinlicher gewesen seyn würde, als sie es ihr war. Sie hatte nicht Musse, diesen zuerst unbedeutenden Umstand, durch öfteres Erinnern wichtiger für sie werden zu lassen. Die kleine Eitelkeit die vielleicht dadurch erregt worden war – denn dieselbe Ungewißheit welche ihr verbot, sich für den Gegenstand zu halten, der den unbekannten Dichter zu diesem Sonnet könnte begeistert haben, verbot ihr auch, bestimmt das Gegentheil zu glauben – gieng wieder vorüber und unter ihren Studien, Büchern und der Ausübung geselliger Tugenden verschwand bald die ganze Sache aus ihren Gedanken.
Bald nachher erweckte eine Unpäßlichkeit ihres Vaters, der von einem Fieber befallen wurde, ängstliche Besorgnisse in ihrem Herzen. Wiewohl seine Krankheit nicht eigentlich gefährlich war, erlitt doch seine Gesundheit dadurch einen harten Stoß. Frau von St. Aubert und Emilie pflegten ihn mit unermüdeter Sorgfalt, allein seine Genesung gieng langsam, und so wie seine Kräfte wiederkehrten, schienen seiner Gattin Kräfte abzunehmen.
Seine liebe Fischerhütte war das erste Pläzchen, das er besuchte sobald er sich wieder stark genug fühlte, der freien Luft zu genießen. Ein Körbchen mit Eßwaaren, mit Büchern und Emiliens Laute wurde vorausgeschickt; Fischergeräth bedurfte er nicht, denn er konnte nie Freude daran finden zu quälen oder zu zerstören.
Nachdem er sich wohl eine Stunde mit Botanisiren beschäftigt hatte, wurde die Mittagsmahlzeit aufgetragen. Es war ein Mahl, durch das Dankgefühl, diesen Ort wieder besuchen zu können, gewürzt, und noch einmahl lächelte reines Familienglück unter diesen Schatten. Herr von St. Aubert sprach mit ungewöhnlicher Heiterkeit; jeder Gegenstand labte seine Sinnen. Die erquickende Freude, welche der erste Anblick der Natur nach dem Schmerz der Krankheit und der Verhaftung im Krankenzimmer gewährt, übersteigt alle Beschreibung, so wie die Begriffe des Gesunden. Die grünen Wälder und Weiden, der blumichte Rasen, das blaue Gewölke des Himmels; die balsamische Luft; das Murmeln des hellen Stroms und selbst das Gesumse jedes kleinen Insekts der Gebüsche schienen die Seele zu beleben und schon das bloße Daseyn zum Seegen zu machen.
Frau von St. Aubert, neu belebt durch die Heiterkeit und Wiedergenesung ihres Gatten, fühlte die Krankheit nicht mehr, die vor kurzem sie niedergebeugt hatte; sie wandelte an der Hand ihres Mannes und ihrer Tochter durch die romantischen Gänge dieses schönen Waldes, und oft wenn sie mit ihnen sprach, und sie abwechselnd ansah, bemächtigte sich ihrer eine wehmüthige Zärtlichkeit, die ihre Augen mit Thränen füllte. St. Aubert bemerkte dieß mehr als einmal und machte ihr einen sanften Vorwurf darüber; allein sie konnte nur lächeln, seine und Emiliens Hand ergreifen und noch stärker weinen. Er selbst fühlte sich bis zum schmerzhaften von gleich zärtlicher Wehmuth durchdrungen, und konnte sich nicht enthalten, insgeheim zu seufzen. »Vielleicht werde ich einst auf diese Augenblicke als auf dem Gipfel meines Glüks mit hofnungsloser Trauer zurückblicken. Aber ich will sie nicht durch voreiliges Grämen trüben; ich will hoffen, daß ich nicht erleben werde, den Verlust derer zu beweinen, die mir theurer sind, als das Leben selbst.«
Um seinen Tiefsinn zu zerstreuen, oder vielleicht ihm ungestört nachzuhängen, bat er Emilien, ihre Laute zu holen, die sie mit so süßem Ausdruck zu spielen wußte. Als sie sich der Fischerhütte näherte, erstaunte sie, die Töne des Instruments zu hören, das von der Hand des Geschmacks berührt, eine klagende Melodie hören ließ, die ihre ganze Aufmerksamkeit anzog. Sie hörte in tiefer Stille zu, und fürchtete, sich von der Stelle zu bewegen, damit nicht der Schall ihrer Tritte sie um eine Note der Musik brächte, oder den Musikus störte. Ausserhalb des Gebäudes war alles still und niemand ließ sich sehen. Sie horchte weiter, bis Ueberraschung und Freude durch Furchtsamkeit verdrängt wurden. Diese Furchtsamkeit stieg höher, wenn sie an die Zeilen an der Wand zurückdachte, und sie besann sich, ob sie weiter gehn oder umkehren sollte.
Indem hörte die Musik auf, und nach einem kurzen Besinnen faßte sie Muth, auf die Fischerhütte los zu gehn, die sie mit schwankenden Schritten betrat und – leer fand. Ihre Laute lag auf dem Tuch, alles schien ruhig, und fast glaubte sie schon, ein andres Instrument gehört zu haben, bis sie sich erinnerte, daß ihre Laute auf der Fensterbank liegen geblieben war, als sie mit ihren Eltern in den Wald gieng. Sie fühlte sich beunruhigt, ohne zu wissen warum; die melancholische Dunkelheit des Abends, die tiefe Stille des Orts, nur durch das leise Zittern des Laubes unterbrochen, erhöhte ihre phantastische Aengstlichkeit, und sie wünschte die Hütte zu verlassen, als eine Schwäche sie anwandelte und sie nöthigte, sich niederzusetzen. Indem sie sich wieder aufzuraffen suchte, fielen ihr die an die Wand geschriebenen Zeilen ins Auge; sie fuhr zusammen als hätte sie einen Fremden gesehn; doch überwand sie endlich ihre Angst und gieng ans Fenster hin; sie sah, daß zu den bereits geschriebnen Zeilen noch andre hinzugesetzt waren, in welchen ihr Name stand.
Sie konnte nun nicht länger mehr zweifeln, daß sie damit gemeint sey, doch blieb es ihr noch eben so unerklärlich, als zuvor, wer der Verfasser seyn könne. Während sie darüber nachsann, glaubte sie einen Fußtritt ausserhalb des Gebäudes zu hören, und aufs neue erschreckt ergrif sie schnell ihre Laute und eilte davon. Ihre Eltern fand sie auf einem kleinen Fußpfade, der sich längs der Hütte hinzog.
Sie setzten sich auf einem grünen von Palmbäumen beschatteten Hügel, von wo man Gasconiens Thäler und Fluren übersah, und während ihre Augen über die prächtige Scene hinirrten, und sie den süßen Duft der Blumen und Kräuter einhauchten, spielte und sang Emilie einige ihrer Lieblingsarien mit der Delikatesse des Ausdrucks, worinn sie so ganz Meisterin war.
Musik und Gespräche hielten sie auf diesem bezauberten Pläzchen fest, bis der Sonne lezter Stral auf die Fluren sank; bis die weissen Seegel, die unter den Bergen auf der Garonne hinglitten, sich verdunkelten, und die Abenddämmrung sich über die Landschaft schlich. Es war eine melancholische aber nicht unangenehme Dämmrung. St. Aubert und seine Familie standen auf und verließen mit Leidwesen den Ort – ach Frau von St. Aubert wußte nicht, daß sie ihn auf immer verließ.
Als sie die Fischerhütte erreichten, vermißte ihre Mutter ihr Armband und besann sich, daß sie es nach der Mahlzeit vom Arm genommen und auf dem Tisch hatte liegen lassen. Nach langem Suchen, wobei Emilie sehr thätig war, mußte sie sich endlich in den Verlust ergeben. Dieß Armband hatte doppelten Werth für sie, weil ein Miniatürgemälde ihrer Tochter, das erst vor einigen Monaten gemalt und ihr sehr ähnlich war, sich daran befand. Emilie erröthete, und wurde nachdenkend; ihre Laute und die neugeschriebenen Zeilen hatten sie bereits überzeugt, daß in ihrer Abwesenheit ein Fremder in der Hütte gewesen seyn mußte und der Inhalt dieser Zeilen machte es nicht unwahrscheinlich, daß der Dichter, der Spieler und der Dieb eine Person waren. Allein ohngeachtet diese Umstände so ziemlich ein Ganzes ausmachten, hielt doch ein gewisses Gefühl sie unwiderstehlich zurück, etwas davon zu erwähnen, nur nahm sie sich insgeheim vor, nie wieder ohne Begleitung ihrer Eltern die Hütte zu besuchen.
Schweigend kehrten sie nach dem Schlosse zurük: Emilie dachte nach über den sonderbaren Vorfall; St. Aubert dachte in stiller Dankbarkeit an das Glück, welches er genoß, und Frau von St. Aubert dachte mit Unruhe und Verlegenheit an den Verlust des Gemäldes. Als sie dem Hause nahe kamen; bemerkten sie ein ungewöhnliches Geräusch; sie hörten deutlich Stimmen; sahen Bedienten und Pferde zwischen den Bäumen und endlich auch einen Wagen, der schnell nach dem Schlosse hinrollte. Wie sie näher kamen, erkannte St. Aubert die Livree seines Schwagers und fand Herrn und Madame Quesnel bereits im Besuchzimmer. Sie hatten einige Tage zuvor Paris verlassen, und waren auf dem Wege nach ihrem Gute, das nur zehn Meilen von La Vallée lag, und das Herr Quesnel einige Jahre zuvor von St. Aubert gekauft hatte. Es war Frau von St. Auberts einziger Bruder; allein da Uebereinstimmung des Charakters die Bande der Verwandschaft nie bei ihnen verstärkt hatte, pflegten sie nicht viel zusammen zu kommen. Herr Quesnel hatte immer in der großen Welt gelebt: Glanz und Schimmer war sein Wunsch und seine Gewandheit und Menschenkenntniß hatte ihm den Besitz beinahe von allem was er suchte verschafft. Es war wohl nicht zu verwundern, daß ein Mann von solchem Charakter St. Auberts Tugenden nicht würdigen konnte, und seinen reinen Geschmack, seine Einfachheit und gemäßigten Wünsche für Zeichen eines schwachen Geistes und eingeschränkten Kopfes hielt. Seiner Schwester Heirath mit St. Aubert war für seinen Stolz kränkend gewesen, denn er hatte immer gehofft eine Verbindung für sie zu knüpfen, die ihm zu der Wichtigkeit helfen könnte, die sein höchster Wunsch war, und wirklich hatte sie auch Anträge von Personen gehabt, deren Rang und Vermögen seinen Hoffnungen schmeichelte. Allein seine Schwester glaubte bey der Bewerbung des Herrn St. Auberts zu finden, daß Glanz und Glückseeligkeit verschiedne Dinge wären, und besann sich nicht, die leztere dem ersten vorzuziehn. Herr Quesnel, wenn er auch die Wahrheit dieser Bemerkung nicht läugnen konnte, würde dennoch gern seiner Schwester Glück der Befriedigung seines Ehrgeizes aufgeopfert haben; und äusserte bey ihrer Heirath mit St. Aubert insgeheim seine Verachtung über ihre einfältige Wahl. Frau von St. Aubert war zwar klug genug, diese Beleidigung vor ihrem Manne zu verbergen, doch fühlte sie eine geheime Erbitterung in ihrem Herzen aufsteigen, und wenn gleich Achtung für ihre eigene Würde und Rücksichten der Klugheit sie verhinderten, ihren Unwillen merken zu lassen, so behielt sie doch stets eine gewisse Zurückhaltung gegen ihren Bruder bey, deren Ursache er sehr wohl verstand.
Er selbst folgte bei seiner Heirath dem Beispiele seiner Schwester nicht. Seine Frau war eine Italienerin, von Geburt eine reiche Erbin, durch Natur und Erziehung aber eine eitle Närrin.
Sie beschlossen, die Nacht bey St. Aubert hinzubringen, und weil das Schloß nicht groß genug war, ihre Bedienten zu beherbergen, wurden diese in das benachbarte Dorf geschickt. Nachdem man sich gehörig begrüßt, und die Einrichtungen für die Nacht getroffen hatte, fieng Herr Quesnel an, seinen Verstand und Wichtigkeit auszukramen, während St. Aubert, der lange genug in der Einsamkeit gelebt hatte, um diese Gegenstände wenigstens neu zu finden, ihm mit einer Geduld und Aufmerksamkeit zuhörte, die sein Gast fälschlich für demüthige Verwunderung nahm. Er beschrieb die wenigen Festivitäten, welche die Unruhe der Zeit damals am Hofe Heinrich des dritten zuließ, mit einer Genauigkeit, welche die Zuhörer einigermaßen für seine Pralerei entschädigte; als er aber auf den Character des Herzogs von Zogeuse, auf einen geheimen Traktat, der, wie er wissen wollte, mit der Pforte in Werke sey, und auf die Art, wie man Heinreich von Navarra empfangen hatte, zu sprechen kam, erinnerte sich Herr von St. Aubert seiner vormaligen Erfahrung genug, um zu merken, daß sein Gast nur zu einer untergeordneten Klasse von Politikern gehörte, und daß er unmöglich die Wichtigkeit, die er vorgab, würklich besitzen konnte, da er so viel Werth auf kleine Gegenstände legte.
Madame Quesnel äusserte indessen der Madame St. Aubert ihre Verwunderung, daß sie es aushalten könnte, ihr Leben in diesem entlegenen Winkel der Welt hinzubringen, und beschrieb, wahrscheinlich um Neid zu erregen, den Glanz der Bälle, Banquete und Prozessionen, die eben zur Hochzeitfeier des Herzogs von Zogeuse mit Margarethen von Lothringen, der Königin Schwester waren veranstaltet worden. Sie beschrieb mit gleicher Umständlichkeit sowohl die Pracht, die sie mit angesehen hatte, als die, von welcher sie ausgeschlossen blieb; indeß Emiliens lebhafte Phantasie, während sie mit der heissen Neugier der Jugend zuhorchte, sich die Scenen erhöhte, die sie beschreiben hörte. Frau von St. Aubert aber dachte, indem sie mit einer Thräne im Auge ihre Familie ansah, daß wenn auch Glanz die Glückseeligkeit schmücken, doch Tugend allein sie geben kann.
Es werden nun zwölf Jahre seyn, St. Aubert, sagte Herr Quesnel, daß ich ihr Familiengut kaufte. – Beinahe – erwiederte St. Aubert, indem er einen Seufzer unterdrückte. – Ich bin nun seit fünf Jahren nicht da gewesen, fuhr Herr Quesnel fort: Paris und seine Nachbarschaft ist doch in der That der einzige Ort, wo man leben kann, und ich bin nun einmal so tief in politische Angelegenheiten verwickelt, und habe alle Hände so voll zu thun, daß es mir schwer wird, mich nur auf ein oder ein paar Monate fortzustehlen.
St. Aubert schwieg und Herr Quesnel fuhr fort – ich habe mich oft gewundert, wie ein Mann, der in der Hauptstadt gelebt hat, und an Gesellschaft gewöhnt gewesen ist, wie Sie, auf dem Lande ausdauern kann – besonders in einem so entlegnen Winkel wie hier, wo Sie nichts sehen und hören, und sich kaum bewußt seyn können, daß Sie leben.
Ich lebe für meine Familie und für mich selbst, und bin zufrieden, jezt nur das Glück zu kennen; vormals kannte ich das Leben.
»Ich bin Willens, ein dreissig oder vierzig tausend Livres auf Verbesserungen zu wenden«, sagte Herr Quesnel, ohne daß er St. Auberts Worte zu bemerken schien, »denn ich habe mir vorgenommen, zukünftigen Sommer meine Freunde, den Herzog von Durefort und den Marquis Ramont auf ein oder ein paar Monate mit mir hieher zu bringen.«
Auf St. Auberts Frage, worinn diese beabsichteten Veränderungen bestehn sollten, antwortete er, daß er den alten östlichen Flügel des Gebäudes niederreissen und statt dessen eine Reihe von Ställen hinsetzen wolle. »Dann«, sagte er, »werde ich einen Eßsaal, einen Gesellschaftssaal, einen Vorsaal und eine Reihe von Bedientenzimmern anlegen: denn gegenwärtig kann ich kaum den dritten Theil meiner Leute lassen.«
»Für unsers Vaters Haushalt war das Gebäude groß genug«, sagte St. Aubert, dem es weh that, daß das alte Haus so verändert werden sollte – »und der war doch wahrlich nicht klein.«
»Unsere Begriffe haben sich seitdem erweitert«, sagte Herr Quesnel, »was damals auf anständigen Fuß leben hieß, wäre jezt nicht zum Aushalten.«
– Sogar dem ruhigen St. Aubert stieg bei diesen Worten das Blut ins Gesicht, doch machte sein Unwillen bald der Verachtung Raum.
»Der Platz um das Schloß ist mit Bäumen überladen; ich denke einige davon umzuhauen.«
»Auch die Bäume umhauen!« sagte St. Aubert.
»Allerdings. Und warum nicht, da sie die Aussicht hindern. Da steht ein Wallnusbaum, der seine Zweige vor der ganzen Südseite des Schlosses ausbreitet, und so alt ist, daß der hohle Stamm, wie ich höre, ein ganzes Dutzend Menschen in sich fassen kann. Bey aller Ihrer Schwärmerei, werden Sie mir doch nicht streitig machen, daß ein so saftloser alter Baum wie dieser, weder zum Nutzen noch zur Schönheit gereichen kann.«
»Um Gotteswillen!« rief St. Aubert, »Sie werden doch den edeln Nußbaum nicht zerstören, der schon seit Jahrhunderten der Stolz der Gegend gewesen ist! Er stand schon in seiner Reife, als das jetzige Gebäude errichtet wurde. Wie oft kletterte ich in meiner Jugend auf seinen breiten Zweigen umher, und saß, wie in einer Laube unter einer Welt von Blättern, wenn es dick über mir regnete, und doch kein Tropfen bis zu mir drang! Wie oft habe ich mit meinem Buche in der Hand da gesessen, bald gelesen, bald zwischen den Zweigen hinauf die weite Landschaft und die untergehende Sonne gesehn, bis die Dämmerung einfiel und die Vögel zu ihren kleinen Nestern zwischen dem Laube nach Haus trieb. Wie oft – aber verzeihen Sie«, sezte er hinzu, indem er sich schnell besann, daß er mit einem Manne sprach, der seine Gefühle weder fassen, noch ihnen Nachsicht einräumen konnte; »ich spreche von Zeiten und Empfindungen, die eben so altmodisch sind, als der Geschmack, der diesen ehrwürdigen Baum verschonen wollte.«
»Er wird zuverlässig abgehauen werden«, sagte Herr Quesnel, »ich werde vermuthlich einige Pappelweiden zwischen die dicken Wallnusbäume setzen, die ich vor dem Schlosse stehen lassen will. Meine Frau hat eine besondere Vorliebe für die Pappelweiden und hat mir oft gesagt, wie sehr ein Lustschloß ihres Onkels, nicht weit von Venedig, dadurch verschönert wird.«
»An den Ufern des Brenta, wo die pyramidalische Form der Pappelweide durch Fichten und Cypressen gehoben wird, und wo ihre Zweige über lichte Portico’s und Säulen wehn, verziert sie unstreitig die Gegend; allein unter den Riesen des Waldes und neben einem schwerfälligen, gothischen Gebäude –«
»Gut, gut«, unterbrach ihn Herr Quesnel – »ich will nicht mit Ihnen streiten, Sie müßten wieder nach Paris gehn, wenn wir in unsern Ideen überein kommen wollten. Aber – weil wir doch einmal von Venedig sprechen, ich bin Willens, nächsten Sommer dahin zu gehn. Vielleicht werden sich die Umstände so fügen, daß ich von dieser Villa Besitz nehme, die über alle Beschreibung schön seyn soll. In dem Falle werde ich mich eine Zeitlang in Italien aufhalten, und die Verbesserungen, wovon wir sprachen, einem andern überlassen.«
Emilie wunderte sich, ihn von einem Aufenthalt in Italien reden zu hören, da er kurz zuvor geäussert hatte, daß seine Gegenwart in Paris so nothwendig wäre, daß es ihm schwer würde, sich nur ein paar Monate von da wegzustehlen: allein St. Aubert durchschaute die Selbstwichtigkeit des Mannes zu gut um sich über so etwas zu wundern; und die Möglichkeit, daß die Verbesserungen, woran er so ungern dachte, verschoben werden konnten, ließ ihn hoffen, daß sie vielleicht ganz unterbleiben würden.
Ehe sie einander gute Nacht sagten, wünschte Herr Quesnel mit St. Aubert alleine zu sprechen, und sie verfügten sich in ein Nebenzimmer, wo sie lange Zeit verweilten. Der Inhalt dieses Gespräches blieb verschwiegen, allein es war merklich, daß St. Aubert, als sie zum Abendessen zurückkamen, ganz ausser Fassung war, und daß ein Unmuth, den er nicht unterdrücken konnte, seine Züge beschattete. Seine Frau wurde unruhig, und gerieth in Versuchung, ihn zu befragen, sobald sie allein waren, aber eine gewisse Delikatesse hielt sie zurück, da sie bedachte, daß St. Aubert nicht auf ihr Fragen warten würde, wenn er sie mit dem Gegenstand seiner Bekümmerniß bekannt zu machen wünschte.
Den andern Tag hatte Herr Quesnel vor seiner Abreise noch eine zweite lange Conferenz mit St. Aubert.
Nachdem die Gäste Mittag im Schlosse gehalten hatten, machten sie sich in der Abendkühle auf den Weg nach Epourville, wohin sie Herrn und Frau von St. Aubert dringend einluden, wahrscheinlich mehr aus Eitelkeit, um ihre Herrlichkeit vor ihnen auszukramen, als aus dem Wunsche, ihren Freunden Vergnügen zu machen.
Emilie kehrte mit großer Freude wieder zu der Freiheit, die dieser Gäste Gegenwart eingeschränkt hatte, zu ihren Büchern, Spaziergängen und zu der verständigen Unterhaltung ihrer Eltern zurück, die sich nicht minder zu freuen schienen, von den Fesseln befreit zu seyn, welche Hochmuth und Frivolität ihnen aufgelegt hatten.
Frau von St. Aubert klagte, daß sie sich nicht wohl genug befände, an dem gewöhnlichen Abendspaziergang Theil zu nehmen, und St. Aubert gieng mit Emilien allein.
Sie wählten einen Spaziergang nach den Gebürgen, um einige arme Alte zu besuchen, die St. Aubert von seinem sehr geringen Einkommen zu unterstützen Mittel fand, welches allem Vermuthen nach Herr Quesnel von seinem sehr großen Vermögen nicht würde gethan haben.
Nachdem er seinen Armen ihr kleines Wochengeld ausgezahlt, geduldig die Klagen von einigen angehört, den Beschwerden andrer abgeholfen und das Leiden aller durch den Blick des zärtlichen Mitleids und das Lächeln des Wohlwollens gemildert hatte, kehrte er mit Emilien durch die Abenddämmerung schweigend zurück, eingewiegt in die süße Ruhe, die aus dem Bewusstseyn guter Handlungen entsteht, und uns geneigt macht, aus jedem Gegenstande um uns her Freude zu schöpfen.
Frau von St. Aubert hatte sich bereits in ihr Schlafzimmer begeben; die Ermattung und Schwermuth, welche sie zeither niedergedrückt hatte, war nach der Anstrengung, womit sie sich vor ihren Gästen zu verbergen suchte, jezt mit doppelter Gewalt wieder zurückgekehrt. Den Tag darauf ließen sich Zeichen von Fieber sehn, und St. Aubert hörte von dem Arzt, den er rufen ließ, daß sie dasselbe Fieber hätte, wovon er erst kürzlich genesen war. Wahrscheinlich hatte er sie angesteckt, während sie ihn in seiner Krankheit verpflegte und das Gift war in ihrem schwachen Körper umher geschlichen, bis es endlich zum Ausbruch kam. St. Aubert, dessen ängstliche Besorgnis für seine Gattin keinen andern Gedanken zuließ, behielt den Arzt im Hause. Er erinnerte sich an die Gefühle und Betrachtungen, die ihn für einen Augenblick niederdrückten, als er das leztemal in Begleitung seiner Frau und Tochter die Fischerhütte besuchte, und konnte einem bangen Vorgefühl nicht widerstehn, das diese Krankheit von gefährlichen Folgen seyn würde. Doch gab er sich alle Mühe diese Gedanken vor ihr selbst und vor seiner Tochter zu verbergen, die er mit der Hoffnung, daß die angewandte Sorgfalt nicht vergebens sehn würde, aufzurichten suchte. Der Arzt antwortete auf St. Auberts Frage, was er von der Krankheit hielte, daß der Ausgang von Umständen abhienge, die er nicht voraus bestimmen könnte. Frau von St. Aubert schien besser zu wissen, wie sie daran war, allein sie gab es nur durch Blicke zu verstehn. Sie sah oft ihre bekümmerten Freunde mit einem Ausdruck von Mitleid und Zärtlichkeit an, als ahndete sie den Kummer vorher, der ihrer wartete, und als wollte sie sagen, daß sie nur um ihrentwillen das Leben ungern verließe. Am siebenten Tage hatte die Krankheit den entscheidenden Punkt erreicht. Der Arzt nahm eine ernsthafte Miene an; sie bemerkte es, und sagte ihm heimlich, sie fühlte, daß ihr Tod nahe wäre. Geben Sie sich nicht die Mühe, mich zu hintergehn, sagte sie, ich fühle, daß ich nicht länger leben kann. Ich bin auf diesen Ausgang gefaßt, und war schon lange darauf vorbereitet. Da ich nicht lange mehr zu leben habe, so lassen Sie sich durch kein falsches Mitleid verleiten, meiner Familie mit leeren Hoffnungen zu schmeicheln; ihr Schmerz würde am Ende nur noch heftiger seyn; ich will mich bemühen, sie durch mein Beispiel Ergebung zu lehren.
Der Arzt versprach voll Rührung ihr zu folgen, und sagte ihrem Manne mit wenigen Worten, daß keine Hoffnung mehr übrig sey. Dieser war nicht Philosoph genug, um seine Empfindungen bey einer solchen Nachricht zu unterdrücken, allein die Betrachtung, wie sehr der Anblick seines Schmerzes seiner Frau Leiden vermehren müßte, sezte ihn bald in Stand, sich in ihrer Gegenwart Gewalt anzuthun. Emilie wurde anfangs von der Nachricht überwältigt, bald aber belebten ihre heissen Wünsche die Hoffnung in ihrem Herzen, daß ihre Mutter doch noch genesen würde, und an dieser Hoffnung hieng sie hartnäckig beinahe bis auf die lezte Stunde.
Bey Frau von St. Aubert zeigte sich der Fortschritt der Krankheit durch geduldiges Ausharren und unterdrückte Wünsche. Die Fassung, womit sie ihrem Tode entgegen sah, konnte nur aus dem Rückblick auf ein Leben entstehn, das, so weit die menschliche Schwäche es zuläßt, durch das Bewußtseyn stets in der Gegenwart Gottes zu seyn, und durch Hoffnung auf eine bessere Welt geleitet wurde. Aber ganz konnte ihre Frömmigkeit nicht den Schmerz besiegen, sich von denen zu trennen, die sie so zärtlich liebte. Sie sprach in ihren lezten Stunden viel mit St. Aubert und Emilien über die Aussicht auf die Zukunft und über andre religieuse Gegenstände. Ihre Ergebung, ihre feste Hoffnung, in einer zukünftigen Welt die Freunde wieder zu treffen, die sie in dieser verlassen mußte, und die sichtliche Anstrengung, womit sie ihren Schmerz über die bevorstehende kurze Trennung zu unterdrücken suchte, rührten ihren Mann oft so sehr, daß er das Zimmer verlassen mußte. Wenn er eine Zeitlang seinen Thränen Luft gemacht hatte, trocknete er sie, und kehrte mit einem Gesicht, dem er gewaltsam eine Fassung zu geben suchte, die nur seinen Schmerz vermehrte, in das Krankenzimmer zurück.
Nie hatte Emilie so tief als in diesen Augenblicken die Wichtigkeit der Lehre empfunden, ihre Fühlbarkeit zu unterdrücken, und nie hatte sie mit so vollständigem Siege sie ausgeübt. Als aber der lezte Augenblick vorüber war, sank sie mit eins unter der Last ihres Schmerzes zu Boden, und fühlte dann, daß sie ihre bisherige Fassung mehr der Hoffnung, die sie noch immer insgeheim genährt hatte, als ihrer Seelenstärke verdankte. St. Aubert war für eine Zeitlang selbst zu trostlos, um seiner Tochter Trost mittheilen zu können.
Zweites Kapitel
Frau von St. Aubert wurde in der benachbarten Dorfkirche begraben: ihr Mann und ihre Tochter begleiteten sie zum Grabe, wohin ein langer Zug von Bauern ihnen folgte, die aufrichtig diese vortrefliche Frau beklagten.
St. Aubert verschloß sich nach seiner Zurückkunft von dem Leichenbegängniß in seinem Zimmer. Als er wieder hervor kam, war sein Gesicht heiter, obgleich blaß von Kummer. Er ließ sein ganzes Hausgesinde zusammenrufen. Emilie hatte, überwältigt von der eben angesehenen Scene sich in ihr Kabinet zurückgezogen, um ungestört zu weinen. St. Aubert folgte ihr dahin; er ergrif stillschweigend ihre Hand, während sie fortfuhr zu weinen, und es verstrichen einige Augenblicke, ehe er Herr genug über seine Stimme ward, um zu sprechen. Mit bebenden Lippen sagte er ihr: »meine Emilie, ich gehe, um mit meinen Leuten zu beten. Wir müssen Hülfe von oben herab flehen, wo sollen wir sonst sie suchen, wo anders sie finden?«
Emilie hielt ihre Thränen zurück und folgte ihrem Vater in den Saal, wo die Bedienten bereits versammlet waren. St. Aubert las mit leiser feyerlicher Stimme die Abendandacht und fügte ein Gebet für die Seele der Abgeschiednen hinzu. Oft bebte seine Stimme, Thränen fielen auf das Buch und endlich hielt er inne. Allmählig aber erhoben die seeligen Gefühle reiner Andacht seine Seele über diese Welt und brachten endlich Trost in sein Herz.
Nachdem er den Gottesdienst geendigt und die Bedienten fortgeschickt hatte, küßte er zärtlich Emilien und sagte: »ich habe von deiner frühsten Jugend an mich bemüht, dir die Pflicht der Selbstbeherrschung zu lehren. Ich habe dich aufmerksam gemacht, wie wichtig sie uns durchs ganze Leben ist, da sie uns nicht nur bey den mancherlei und gefährlichen Versuchungen, die uns von Rechtschaffenheit und Tugend ableiten, aufrecht erhält, sondern auch der weichen Nachsicht entgegen arbeitet, welche Tugend genannt wird, aber über eine gewisse Gränze hinausgetrieben, in Laster ausartet, und traurige Folgen nach sich zieht. Alles Uebermaß ist Fehler; selbst der in seinem Ursprung liebenswürdige Schmerz wird zur selbstsüchtigen ungerechten Leidenschaft, wenn wir ihm auf Kosten unsrer Pflichten nachhängen; unter Pflichten verstehe ich, was wir uns selbst sowohl als andern schuldig sind. Die Nachsicht gegen den übermäßigen Schmerz entnervt die Seele und macht sie unempfänglich für den mannigfaltigen unschuldigen Genuß, den ein wohlthätiger Gott zum Sonnenschein unsers Lebens bestimmte. Erinnre dich, meine Emilie, der Lehren, die ich dir so oft gegeben habe, und die deine eigne Erfahrung dir als weise gezeigt hat. Dein Grämen ist unnütz. Nimm dieß nicht blos als eine Alltagsbemerkung auf, sondern laß würklich deine Vernunft den Gram unterdrücken. Ich wünsche nicht, deine Gefühle zu tödten, mein Kind, sondern blos dich sie beherrschen zu lehren: denn was für Uebel auch aus einem zu empfänglichen Herzen entspringen mögen, so läßt sich doch von einem unempfindlichen nichts hoffen; ein solches ist ganz Laster; und zwar Laster, dessen Häßlichkeit durch keinen Schein oder Möglichkeit des Guten gemildert wird. Du kennst mein Leiden, und bist also gewiß überzeugt, daß dieß nicht leere Worte sind, die bey solchen Gelegenheiten so oft wiederhohlt werden, um selbst die Quellen eines rühmlichen Gefühls zu vernichten oder, die oft blos dazu dienen, die selbstsüchtige Pralerei einer falschen Philosophie auszukramen. Ich will meiner Emilie zeigen, daß ich ausüben kann, was ich lehre. Ich habe so viel gesagt, denn ich kann es nicht ansehn, daß du dich in fruchtlosen Kummer verzehrst, weil dir die Kraft zum Widerstande mangelt, die man von der Seele fordern muß: und ich habe es erst jezt gesagt, weil es einen Zeitpunkt giebt, wo alles Vernünfteln der Natur weichen muß. Dieser ist vorüber; ein andrer aber, wo übertriebne, zur Gewohnheit gewordne Nachsicht alle Spannkraft so niederdrückt, daß der Sieg beynahe unmöglich wird, naht heran: du, meine Emilie, wirst zeigen, daß du ihn zu vermeiden bereit bist.«
Emilie lächelte durch ihre Thränen hin auf ihren Vater. Bester Vater, sagte sie, und ihre Stimme bebte – ich werde mich Ihrer würdig zeigen – wollte sie sagen, aber ein Gemisch von Dankbarkeit, Zärtlichkeit und Schmerz überwältigte sie. St. Aubert ließ sie ungestört ausweinen und fieng dann von andern Gegenständen zu reden an.
Die erste Person, welche dem St. Aubert ihr Beyleid zu bezeugen kam, war ein gewisser Herr Barreaux, ein harter und dem Anschein nach fühlloser Mann. Ein Geschmack an Botanik, der sie oft bey ihren Wanderungen zwischen den Gebürgen zusammen führte, hatte sie zuerst mit einander bekannt gemacht. Herr Barreaux hatte sich von der Welt, und beynahe von der Gesellschaft zurückgezogen, um in einem angenehmen Schlosse, am Saume der Wälder, nahebei La Vallée zu leben. Auch er hatte sich in seiner Meynung vom Menschengeschlechte betrogen, aber er vergoß nicht Thränen um selbiges, wie St. Aubert; er fühlte mehr Unwillen über ihre Laster, als Mitleid mit ihrer Schwäche.
St. Aubert wunderte sich beynahe, ihn zu sehn, denn so oft er ihn auch auf sein Schloß eingeladen hatte, war er doch nie gekommen, und jezt trat er auf einmal ohne alle Umstände als ein alter Freund ins Zimmer. Die Ansprüche des Unglücks schienen alle Rauhigkeit und Vorurtheile seines Herzens besiegt zu haben. Der unglückliche St. Aubert war der einzige Gegenstand, der seine Gedanken beschäftigte. Mehr durch sein Wesen als durch Worte bezeugte er seine Theilnahme an seinen Freunden. Er sprach wenig über den Gegenstand ihres Schmerzes; allein die sorgsame Aufmerksamkeit, die er ihnen widmete; der Ton seiner Stimme und der sanfte Blick, der sie begleitete, kamen aus seinem Herzen und sprachen zu dem ihrigen.
In dieser traurigen Zeit erhielt St. Aubert auch einen Besuch von Madame Cheron, seiner einzigen noch lebenden Schwester, die seit einem Jahre Wittwe war, und jezt auf ihrem Gute, nahe bey Toulouse wohnte. Er hatte nie häufigen Umgang mit ihr gehabt. Sie ließ es nicht an Worten fehlen, ihm ihr Beyleid zu bezeugen; allein die Zauberkraft des Blicks, der zur Seele spricht, der Stimme, die wie Balsam zum Herzen dringt, verstand sie nicht – doch versicherte sie St. Aubert, daß sie aufrichtig mit ihm sympathisire, pries die Tugenden seiner verstorbenen Frau und bot ihm dar, was sie für Trost hielt. Emilie weinte unaufhörlich, während sie sprach. St. Aubert blieb ruhig, hörte sie stillschweigend an, und lenkte dann die Unterredung auf einen andern Gegenstand.
Beym Abschiede lud sie ihn und ihre Nichte dringend ein, sie bald zu besuchen. »Veränderung des Orts wird Euch zerstreuen«, sagte sie, »und es ist nicht recht, dem Kummer zu viel einzuräumen.« So abgedroschen auch diese Worte waren, erkannte doch St. Aubert ihre Wahrheit; nur fühlte er sich weniger als je geneigt, den Ort zu verlassen, den seine verschwundne Glückseeligkeit geheiligt hatte. Die Gegenwart seiner Frau hatte jeden Gegenstand um ihn her geweiht, und jeder neue Tag verstärkte, in eben dem Maße, wie er die Schärfe seines Leidens milderte, den zärtlichen Zauber, der ihn an seine Heimath band.
Allein es gab Aufforderungen, die er nicht ablehnen konnte, und der Besuch, den er seinem Schwager Quesnel machte, gehörte darunter. Eine Sache von Wichtigkeit nöthigte ihn, diesen Besuch nicht länger zu verschieben, und um Emilien aus ihrer Niedergeschlagenheit zu reissen, nahm er sie nach Epourville mit.