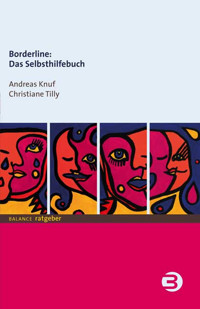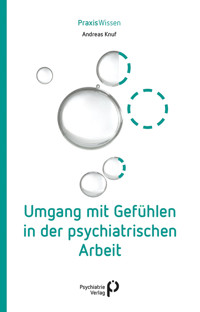
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychiatrie Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Praxiswissen
- Sprache: Deutsch
Sich Gefühlen stellen Psychische Erkrankungen sind eng an Gefühle gekoppelt. Andreas Knuf ermutigt psychiatrisch Tätige, Gefühle in der Behandlung nicht nur als »Beiwerk« zu verstehen, sondern ihnen Raum in der professionellen Arbeit zu geben. Hinter allen psychischen Erkrankungen verbergen sich zumeist sehr unangenehme Gefühle wie Angst, Traurigkeit oder Scham. Das Buch vermittelt Techniken, die Fachpersonen nutzen können, um Klient*innen zu helfen, mit solchen belastenden Gefühlen besser zurechtzukommen. Dabei geht es nicht darum, bestimmte Gefühle »wegzumachen«, sondern einen heilsamen Umgang mit ihnen zu finden. Das Buch zeigt auch, wie Helfende gut mit ihren eigenen Gefühlen wie Ohnmacht oder Ärger umgehen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PraxisWissen
Andreas Knuf
Umgang mit Gefühlen in der psychiatrischen Arbeit
ANDREAS KNUF ist Psychologischer Psychotherapeut mit eigener Praxis in Konstanz. Er hat zahlreiche Bücher und Aufsätze zu Borderline, Empowerment und Achtsamkeit veröffentlicht. Weitere Artikel zum Thema des Buches finden Sie unter www.andreas-knuf.de.
Die Reihe PraxisWissen wird herausgegeben von:
Michaela Amering, Andreas Bechdolf, Michael Eink, Caroline Gurtner, Klaus Obert und Tobias Teismann
Andreas Knuf
Umgang mit Gefühlen in der psychiatrischen Arbeit
PraxisWissen 6
1. Auflage 2020
ISBN: 978-3-88414-955-3
ISBN E-Book (PDF): 978-3-96605-062-3
ISBN E-Book (EPUB): 978-3-96605-065-4
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de.
© Psychiatrie Verlag GmbH, Köln 2020
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
Lektorat: Uwe Britten, Eisenach
Umschlagkonzeption und -gestaltung: studio goe, Düsseldorf, unter Verwendung eines Fotos von dkidpix/iStock.com
Typografiekonzeption und Satz: Iga Bielejec, Nierstein
Inhalt
Cover
Titel
Der Autor
Impressum
Sich Gefühlen stellen – Einleitung
Hinführung
Gefühlsunterdrückung in unserer Gesellschaft
Dysfunktionaler Umgangsstil mit Gefühlen
Gefühlsunterdrückung im psychiatrischen System
Umgang mit Gefühlen und psychische Erkrankungen
Die Angst vor den Gefühlen der Klienten
Gefühle besser verstehen
Was sind Gefühle?
Welche Funktionen haben Gefühle?
Wie viel Kontrolle haben wir über unsere Gefühle?
Die drei Motivationssysteme
Wie entstehen Gefühle?
Wie verlaufen Gefühle?
Was geschieht, wenn Gefühle nicht gespürt werden?
Unterregulation und Überregulation
Was ist emotionale Kompetenz?
Welche Arten von Gefühlen gibt es?
Instrumentelle Gefühle
Primäre adaptive Gefühle
Sekundäre Gefühle
Primäre maladaptive Gefühle
Traumaassoziierte Gefühle
Wie können Klienten beim Umgang mit ihren Gefühlen unterstützt werden?
Drei Bereiche der Unterstützung
Psychoedukation über Gefühle
Den Zugang zu Gefühlen erleichtern
Ungünstige Emotionsregulationsstrategien beenden
Externe Emotionsregulation
Wirkungsvolle Emotionsregulationsstrategien
Kultivierung von Emotionstoleranz
Notfallskills
Gruppenarbeit zu Gefühlen
Psychopharmaka und Emotionen
Umgang mit verschiedenen Gefühlen
Angst
Scham
Trauer und Traurigkeit
Ärger
Freude
Wie können Helfende gut mit ihren eigenen Gefühlen umgehen?
Gefühle der Fachpersonen und der Klienten – Auslöser
Eine kleine Kritik am Konzept der professionellen Distanz
Emotionale Resonanz
Emotionale Abgrenzung
Unbeliebte Gefühle unter Helfenden
Umgang mit Emotionen im direkten Klientenkontakt und danach
Umgang mit Gefühlen im Team
Literatur
Sich Gefühlen stellen – Einleitung
In der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen geht es eigentlich von morgens bis abends um Gefühle. Die Klientinnen und Klienten haben nämlich oft heftige Gefühle: Sie sind verzweifelt, fühlen sich einsam, sind zutiefst beschämt oder haben grenzenlose Angst. Diese Gefühle mitzutragen stellt eine besondere Herausforderung für die professionell Tätigen dar. Andere Klienten wiederum haben kaum einen Zugang zu ihren Gefühlen und empfinden sich eher leblos, taub oder »wie unter einer Käseglocke«.
Die Gefühle der Klienten führen oft zu problematischen Verhaltensweisen: Jemand beginnt neben der psychischen Erkrankung auch noch, Alkohol oder andere Drogen zu konsumieren, weil Gefühle von Einsamkeit oder Empfindungen von Sinnlosigkeit nicht ertragen werden. Niemand bringt sich wegen irgendwelcher Gedanken um, es sind vielmehr die unangenehmen Gefühle, die als »schrecklich«, als nicht mehr aushaltbar erlebt werden.
Jede psychische Erkrankung hat ihre eigenen Emotionen, etwa die starke Wut bei Borderlinebetroffenen oder die paranoide Angst bei Psychoseklienten. Auch wenn es um Genesungsschritte geht, sind es die Gefühle, die maßgeblich darüber entscheiden, ob sich ein Entwicklungsprozess vollziehen kann oder nicht. Wer sich beispielsweise für seine Erkrankung oder ihre Folgen sehr schämt, wird sich womöglich zurückziehen, und in der Folge reduziert sich sein soziales Netz mit zumeist negativen Konsequenzen für den Gesundungsweg. Doch nicht nur die Klientinnen und Klienten sind mit starken Gefühlen konfrontiert, sondern wir Helfenden ebenso. Angst, Ekel, Ohnmacht oder Ärger werden in den Begegnungen mit den Klienten aktiviert, können aber ebenso in Teamsituationen ausgelöst werden.
Der großen Bedeutung von Gefühlen bei psychischen Erkrankungen steht ein psychiatrisches Behandlungssystem gegenüber, das Gefühle vielfach eher als »Beiwerk« betrachtet denn als zentralen Faktor, der über psychisches Wohlbefinden, das Wiederauftreten von Krisen oder über Genesungsprozesse entscheidet. Gefühle werden vielfach ignoriert, vorschnell pathologisiert oder durch Medikamente zu regulieren versucht. Viele Mitarbeitende psychiatrischer Einrichtungen schildern, dass sie in ihren Ausbildungen wenig über Gefühle gelernt haben. Das ist leider über fast alle Berufsgruppen hinweg der Fall, denn selbst angehende Psychotherapeuten lernen viel zu wenig über Gefühle und den Umgang mit ihnen. Über Jahrzehnte dominierte in der psychiatrischen Versorgung, aber auch in weiten Teilen der Psychotherapielandschaft die Kognitive Verhaltenstherapie, die vor allem über die Veränderung von Gedanken bemüht ist, auf das Befinden der Klienten Einfluss zu nehmen. Die Gefühle galten auch hier fast schon als nebensächlich, anfangs wurde sogar versucht, sie völlig auszuklammern.
Innerhalb der Psychotherapie ist nun allerdings schon seit Längerem eine »emotionale Wende« eingeleitet worden. Alle neueren Therapiemethoden wie die Schematherapie oder die Acceptance and Commitment Therapy messen den Gefühlen ihrer Klientinnen und Klienten eine sehr große Bedeutung zu und vermitteln Werkzeuge, die vornehmlich auf der emotionalen Ebene Veränderungen bewirken sollen. Auch in anderen Bereichen, etwa im Management oder in der Erziehung, wird den Gefühlen eine immer wichtigere Rolle zugesprochen. Hintergrund sind vor allem die inzwischen zahlreichen neurowissenschaftlichen Studien, die uns zeigen, dass Gefühle bisher maßlos unterschätzt wurden. Gefühle und unser Umgang mit ihnen entscheiden ganz maßgeblich darüber, wie es uns geht, welche Entscheidungen wir treffen, wofür wir motiviert sind, ob wir in eine psychische Krise geraten und wie leicht oder schwer es uns fällt, davon wieder zu genesen.
Während diese emotionale Wende in vielen Bereichen psychosozialer Arbeit, vor allem in der Psychosomatik und Psychotherapie, langsam zum Standard wird, öffnet sich die Psychiatrie mit etwas Verspätung dieser Dimension unserer Arbeit. So erstaunt es vielleicht auch gar nicht, dass der 1978 gegründete Psychiatrie Verlag nach über vierzigjähriger Geschichte nun erstmals ein Fachbuch über die sozialpsychiatrische Arbeit mit Gefühlen vorlegt.
Wenn man in die Psychiatriegeschichte schaut, so stellt man fest, dass längst nicht immer die Gefühle der Klienten stiefmütterlich behandelt wurden. Schon Eugen Bleuler, der Begründer des moderneren Schizophreniekonzepts, betonte vor rund einhundert Jahren die Bedeutung emotionaler Prozesse selbst bei nicht typischen affektiven Störungen wie der Schizophrenie. Am bekanntesten ist wohl die vom Berner Psychiater Luc Ciompi entworfene »Affektlogik« geworden, die unter anderem in die Arbeitsweise der Soteria-Begleitung eingeflossen ist. Doch diese Ansätze blieben letztlich Randerscheinungen und konnten die Psychiatrie als Ganze nicht sonderlich beeinflussen. Diese hat sich im Rahmen der Psychopathologie zwar immer schon mit Gefühlen beschäftigt; und so wurden zahlreiche Begriffe kreiert, um psychopathologische Symptome zu beschreiben, etwa Parathymie (unangemessener Affekt), Affektarmut, Affektstarre oder Gefühlsambivalenz (das Nebeneinander widerstrebender Gefühle), doch oftmals ist es über die teils sehr differenzierte Beschreibung von Gefühlsabsonderlichkeiten nicht hinausgegangen, denn auf die therapeutische Arbeit hat diese genaue psychopathologische Untersuchung vielfach kaum Einfluss genommen.
Ein psychiatrisches Krankheitsbild hat es aber schon vor fast dreißig Jahren geschafft, als Störung des Umgangs mit Gefühlen verstanden zu werden, nämlich die Borderlinestörung. Auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen ist es offensichtlich, dass die Betroffenen nicht gut mit ihren Gefühlen umgehen können und daher immer wieder in emotionale Ausnahmezustände geraten, die sie zu (selbst-) destruktiven Verhaltensweisen bewegen. Dementsprechend wurde in vielen Einrichtungen schon vor längerer Zeit die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) oder Elemente daraus eingeführt, die sich explizit dem Umgang mit Gefühlen widmet. Heute müssen wir aber eher davon ausgehen, dass alle psychischen Erkrankungen entweder ebenfalls Störungen des Umgangs mit Gefühlen sind oder der Umgang mit Gefühlen zumindest zentral an der psychischen Erkrankung beteiligt ist. Der Unterschied zur Borderlineerkrankung ist lediglich, dass die Schwierigkeiten im Umgang mit Gefühlen nicht so offensichtlich sind, weil beispielsweise ein schlechter Zugang zu den Gefühlen im sozialpsychiatrischen Alltag kaum auffällt.
Nach allem, was wir heute wissen, ist ein ungünstiger Umgang mit Gefühlen nicht nur die Folge psychischer Erkrankungen, sondern trägt mit zu ihrem Entstehen bei und hält diese aufrecht. So entstehen etwa Suchterkrankungen unter anderem dadurch, dass Menschen bestimmte unangenehme Gefühle nicht ertragen können und diese durch das Suchtmittel zu regulieren versuchen. Auch für die Recoveryprozesse ist es ganz entscheidend, wie mit Gefühlen umgegangen wird. Wenn die Scham zu groß ist und nicht überwunden wird, bleibt der Klient in Selbstverurteilung gefangen und kann keine weiteren Gesundungsschritte machen. Wenn Verluste und ungelebtes Leben, etwa die nie gelebte Partnerschaft oder der Verlust der beruflichen Anerkennung, nicht hinreichend betrauert werden, gelingt die für den Recoveryprozess so wichtige Öffnung für neue Lebensmöglichkeiten nicht.
In der sozialpsychiatrischen Arbeit haben wir es mit verschiedensten Klientinnen und Klienten zu tun, die ganz unterschiedliche Formen des ungünstigen oder günstigen Umgangs mit Emotionen leben. Viele von ihnen haben überhaupt keinen oder einen sehr ein- geschränkten Zugang zu ihren Gefühlen. Sie sind oft emotional kaum spürbar, selbst in aufwühlenden Situationen. Wenn es beispielsweise zu einem Todesfall kommt, sind die Gefühle dieser Menschen nur schwer wahrnehmbar. Andere Klienten sind ununterbrochen mit ihren Gefühlen beschäftigt, denn sie haben heftige Gefühle, die sie nicht regulieren können und die oft unkontrolliert ausgedrückt werden, was sowohl für den Betroffenen selbst als auch für sein soziales Umfeld, und zwar inklusive professionell Tätiger, ausgesprochen herausfordernd sein kann. Unter Umständen neigen sie zu selbstschädigenden Verhaltensweisen oder entwickeln Suizidgedanken. Für diese beiden Gruppen, sie werden in der Fachsprache als »unterregulierte« und »überregulierte« Klienten bezeichnet, braucht das Hilfesystem unterstützende Strategien zum Umgang mit Gefühlen, und zwar ganz unterschiedliche, je nach dem emotionalen Umgangsstil des Klienten.
Bei allen Berührungsängsten gibt es in Bezug auf Gefühle seit einigen Jahren ein wahres Zauberwort in der psychiatrischen Versorgung: Emotionsregulation. Wie der Begriff schon sagt, geht es um die Fähigkeit, Gefühle zu regulieren, damit sie uns nicht überschwemmen und sich negativ auf unser Leben auswirken. Diese Fähigkeit ist wichtig, wir brauchen sie für ein zufriedenes Leben und für den Umgang mit all den Alltagssituationen, die Gefühle auslösen. Im psychiatrischen Alltag bedeutet sie aber allzu oft, dass Gefühle herunterreguliert werden sollen, womit vielfach leider nur gemeint ist, dass »störende« Gefühle verschwinden sollen. Doch Gefühle haben einen Sinn oder eine Funktion, sodass es eben nicht einfach darum gehen kann, sie »wegzumachen«. Für einen guten Umgang mit Gefühlen sind zahlreiche Fähigkeiten erforderlich, etwa die Fähigkeit, sie überhaupt wahrzunehmen, sie auszuhalten, ihre Botschaft zu verstehen oder sie anderen zu zeigen. All diese Fähigkeiten sollten wir den Klienten vermitteln, anstatt vornehmlich die Gefühle zu »regulieren«, damit sie niemanden stören.
Aber nicht nur die Klientinnen und Klienten, sondern auch wir Helfende sind mit starken Gefühlen konfrontiert, denn Gefühle sind ansteckend. Helfende werden von den Gefühlen ihrer Klienten berührt und eigene Gefühle werden durch Themen von Klienten aktiviert. Die Arbeit mit unseren Klienten kann beispielsweise Empfindungen von Ohnmacht, Ärger oder Ekel auslösen: Ärger etwa über einen Klienten, der sich nicht an Absprachen hält, Ekelempfinden gegenüber einer Klientin mit starkem Körpergeruch oder Angst vor einem Klienten, der zu impulsivem Verhalten neigt. All das sind Gefühle, die wir Helferinnen und Helfer ganz und gar nicht mögen und die uns oft an die Grenze unserer psychischen Belastbarkeit und unserer professionellen Handlungsfähigkeit bringen. Wenn Mitarbeitende ihre Arbeitsstelle wechseln wollen oder in die Nähe eines Burnouts geraten, dann hat das vielfach etwas mit solchen unerträglich erscheinenden und belastenden Gefühlen zu tun. Diese ergeben sich aber nicht nur im Klientenkontakt, sondern ebenso in schwierigen Teamkonstellationen oder dauerhaft erschöpfenden Arbeitsstrukturen.
Auch wir Helfenden sollten also lernen, gut mit unseren Gefühlen umzugehen. In vielen Teams gibt es eine sehr offene und ehrliche Atmosphäre, in der sich Mitarbeitende trauen, sich mit ihren Empfindungen zu zeigen. In anderen Teams allerdings versuchen die Mitglieder möglichst »cool« zu bleiben, weil es dort für unprofessionell gehalten wird, Gefühlen offen und ehrlich Raum zu geben.
Das vorliegende Buch widmet sich all diesen Themen und wendet sich an alle Berufsgruppen, die mit psychisch erkrankten Menschen arbeiten: Sozialpädagogen, Pflegekräfte, Psychologen und Psychiater, Heilerziehungspflegende und natürlich auch an Peers. Sie alle sind mit den Gefühlen ihrer Klienten und mit ihren eigenen konfrontiert und müssen darauf reagieren. Dabei haben sie dafür vielfach keinen direkten therapeutischen Auftrag, aber ihr Handeln hat oft natürlich trotzdem eine therapeutische Wirkung. Gefühle rufen nach einer Antwort, wenn sie »heiß« sind, also wenn sie aktiviert sind. Gefühle warten nicht auf die nächste Stunde beim Psychotherapeuten oder auf den nächsten Termin beim Psychiater in drei Wochen. Dies sind wichtige Situationen, denn über Gefühle zu sprechen, die gerade gar nicht vorhanden sind, bringt oft wenig. Viel sinnvoller ist es, sie zu nutzen, wenn sie »hochkochen«. Daher sollten sich alle Berufsgruppen qualifizieren, um zu wissen, wie sie ihren Klienten helfen können, hilfreich mit ihren Gefühlen umzugehen.
Die lange Zeit vertretene Haltung, Gefühle seien ausschließlich Sache der Psychologen und Ärzte, kann heute nicht weiter aufrechterhalten werden. Ganz im Gegenteil: Jenen Mitarbeitenden, die in den vielen Alltagssituationen, in denen Gefühle ausgelöst werden, mit dem Klienten Kontakt haben, bietet sich eine ganz besondere Chance zur Unterstützung eines guten Umgangs mit Gefühlen.
Gemeinhin wird versucht, die Hilfen für den Klienten von der Diagnose abzuleiten, also beispielsweise bei einem depressiven Klienten zu überlegen, was allgemein ein Mensch mit einer Depression braucht und was ihm helfen könnte. Meiner Meinung nach spricht in der (sozial-)psychiatrischen Arbeit einiges dafür, die Hilfe eher von den individuellen Gefühlen der Klienten abzuleiten, etwa zu überlegen, was genau dieser Mensch braucht, der unter starken Ängsten leidet. Die Emotionen sind oft der Kern des psychischen Leids. Daher ist es in Alltagssituationen ausgesprochen wichtig, zu wissen, wie man beispielsweise Menschen darin unterstützen kann, mit ihrer Angst oder ihrer Verzweiflung umzugehen.
Wer sich den Gefühlen, wie sie sich bei psychischen Erkrankungen ausdrücken, zuwendet, wird angemessener und hilfreicher auf die Verhaltensweisen der Klientinnen und Klienten reagieren können. Und wer sich dabei auch den eigenen Gefühlen stellt, wird zudem zufriedener sein mit der eigenen Arbeit – und ganz nebenbei dann auch noch mit dem eigenen Leben.
Hinführung
Gefühlsunterdrückung in unserer Gesellschaft
Viele von uns haben gelernt, dass Gefühle eher nicht gezeigt werden sollten. Berühmte Sprüche wie »Indianer kennen keinen Schmerz« sind Ausdruck eines eher unterdrückenden Umgangsstils mit Gefühlen, einer sogenannten Emotionssuppression. Vor allem unangenehme Gefühle sollen, so die Botschaft in vielen Herkunftsfamilien, verschwinden oder am besten gar nicht erst auftauchen. Die wenigsten Menschen geben an, dass ihnen ihre Eltern einen authentischen und offenen Umgang mit Gefühlen vermittelt haben und die Eltern für sie ein Modell für einen guten Umgang mit Gefühlen sind oder waren.
Das »Wegdrücken« von Gefühlen ist kein neues Phänomen und es ist auch nicht nur in Mitteleuropa, sondern in vielen Kulturen zu finden. Bereits seit dem 18. Jahrhundert wurden pädagogische Konzepte vertreten, die den Kindern ihre »Rohheit« und Wildheit austreiben sollten (PLAMPER 2012). Gefühle sollten unterdrückt werden, um dadurch die reine Vernunft zu fördern. Im Rahmen der sogenannten Schwarzen Pädagogik wurde im Nazi-Deutschland ein extrem emotionssuppressiver Erziehungsstil vertreten: Kinder sollten wenig berührt, die Bindung sollte eher oberflächlich gehalten werden. Und auch nach dem Krieg wurden in einer traumatisierten Gesellschaft Gefühle wie Scham, Schuld und Trauer beiseitegedrückt, stattdessen versuchte sich die deutsche Gesellschaft in den 1950er-Jahren mit einer aufgesetzten »entpolitisierten Fröhlichkeit« in der Kleinfamilie.
Der hier beschriebene emotionssuppressive Umgangsstil ist entsprechend zahlreichen Untersuchungen nicht hilfreich für psychische Stabilität und für die Verarbeitung herausfordernder biografischer Erfahrungen. Nur bei schweren Bedrohungen und Traumatisierungen kann er vorübergehend sinnvoll sein, ansonsten gehört die Emotionsunterdrückung zu den ungünstigsten Strategien zum Verarbeiten emotionaler Herausforderungen überhaupt.
Diesen gefühlsunterdrückenden Umgangsstil haben viele unserer Klientinnen und Klienten und auch viele von uns Fachpersonen vermittelt bekommen. Er beeinflusst natürlich den Umgangsstil mit den eigenen Gefühlen auch im Erwachsenenalter. Klienten entschuldigen sich beispielsweise, wenn ihnen die Tränen kommen, oder sie versuchen vorab schon aufsteigende Tränen zu unterdrücken. Mitarbeitende trauen sich selbst in Supervisionen manchmal nicht, zu zeigen, wie es ihnen wirklich geht. So werden etwa Angst vor einem Klienten oder Ekel ihm gegenüber verleugnet, statt sich offen mit diesen Gefühlen zu beschäftigen. Erst in jüngster Zeit hat sich durch eine gesamtgesellschaftliche Veränderung im Hinblick auf den Umgang mit Gefühlen auch die Erziehung verändert. Heute wird den Gefühlen der Kinder meistens mehr Raum gegeben und Eltern verbergen ihre eigenen Gefühle vor ihren Kindern vielfach nicht mehr oder weniger stark.
Bevor Sie weiterlesen, halten Sie einen Moment inne, um kurz zu reflektieren, mit welcher Form des Umgangs mit Gefühlen Sie aufgewachsen sind.
? Wurde Ihnen in Ihrer Kindheit und frühen Jugend vermittelt, dass Gefühle normal sind und zum Leben dazugehören? Oder haben Sie eher gelernt, dass sie nicht gezeigt werden sollten? Haben Sie Ihre Eltern weinen gesehen? Wie wurde in Ihrer Familie mit Traurigkeit, Ärger oder Freude umgegangen? Wie haben Ihre Eltern reagiert, wenn Sie als Kind Freude, Angst oder Scham empfunden haben? Wurde darüber gesprochen? Wurden die Empfindungen anerkannt oder in irgendeiner Form negativ bewertet ?
Dysfunktionaler Umgangsstil mit Gefühlen
Die Gefühlsunterdrückung in unserer Gesellschaft wirkt sich darauf aus, wie unsere Klienten und natürlich auch wir Helfenden mit Gefühlen umgehen. Es entscheiden allerdings noch zahlreiche weitere Faktoren darüber, welche Haltung wir im späteren Erwachsenenleben unseren Emotionen gegenüber einnehmen. Wie bei allen Eigenschaften spielt auch beim Umgang mit Gefühlen unsere biologische Ausstattung eine große Rolle. Während manche Kinder von ihrer Veranlagung her ruhig und ausgeglichen sind, neigen andere zu starken Gefühlsausbrüchen. Auch der Verlauf von Schwangerschaft und Geburt kann sich auf jene Bereiche unseres Gehirns auswirken, die für die Emotionsverarbeitung zuständig sind (siehe dazu BERKING 2010).
Vor allem aber ist zentral, welches Modell Eltern ihren Kindern bieten: Zeigen sie ihrem Kind beispielsweise, dass sie ihre eigenen Gefühle »halten« können und sich nicht von ihnen in Panik versetzen lassen? Oder versuchen sie jedes unangenehme Gefühl sofort zu regulieren, etwa indem Beruhigungsmittel oder Ablenkungen genutzt werden? Weiter ist bedeutsam, wie die Eltern auf die Gefühle des Kindes reagieren: Gehen sie verständnisvoll und geduldig auf sie ein? Oder verurteilen oder bagatellisieren sie die Gefühle des Kindes?
LERNGESCHICHTE Manche spätere psychiatrische Klienten haben eher ungünstige Startbedingungen, was ihre emotionalen Lernerfahrungen angeht. Zahlreiche, wenn auch längst nicht alle späteren Klienten wachsen eher mit Eltern auf, denen keine gute Emotionsregulation gelingt, weder bezüglich der eigenen noch der Gefühle des Kindes. So gehen wir heute davon aus, dass Borderlineklienten oft Erfahrungen der Invalidierung ihrer Gefühle gemacht haben. Das bedeutet, dass Gefühle als unangemessen, falsch, überzogen oder ähnlich negativ bewertet wurden. In der Folge tut sich das Kind schwer damit, die eigenen Gefühle als echt wahrzunehmen und ihnen gemäß zu handeln. Manche Eltern waren auch körperlich oder emotional abwesend, sie hatten möglicherweise eigene Traumaerfahrungen oder psychische Schwierigkeiten zu bewältigen.
Viele psychiatrieerfahrene Menschen sind zusätzlich bereits in ihrer frühen Lebensgeschichte mit emotional besonders herausfordernden Erfahrungen konfrontiert worden. So ist davon auszugehen, dass etwa die Hälfte aller Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und höherem Hilfebedarf traumatische Erfahrungen in ihrer Kindheit und Jugend machen mussten. Dazu zählen etwa frühe Verlusterfahrungen oder Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrungen. Ebenfalls sind nicht wenige Klientinnen und Klienten mit bedeutsamen Beziehungsabbrüchen wie Adoptions- oder Heimerfahrungen konfrontiert gewesen. Daneben gibt es viele andere nicht traumatische Herausforderungen, etwa sozialer Ausschluss, Misserfolge oder belastende familiäre Umstände wie Armut oder die Erkrankung eines Elternteils. All diese Erfahrungen lösen zwangsläufig starke Gefühle aus: Angst, Scham Traurigkeit oder andere.
Da ein kleines Kind schwierige Gefühle noch nicht allein regulieren kann, ist es auf die Unterstützung seines engsten sozialen Umfelds angewiesen, meistens sind das die Eltern. Falls sie – aus welchen Gründen auch immer – nicht gut in der Lage sind, dem Kind eine hilfreiche Unterstützung beim Umgang mit Gefühlen zu bieten, wirken sich die herausfordernden biografischen Erfahrungen besonders nachteilig aus.
Wenn diese Unterstützung unterbleibt, versucht das Kind notgedrungen, allein mit den Gefühlen zurechtzukommen. Da ein kleines Kind zum Tragen unangenehmster Gefühle aber noch nicht in der Lage ist, greift es auf ungünstige Strategien zurück, beispielsweise werden Gefühle komplett beiseitegedrückt, das Kind verurteilt sich selbst für die Gefühle oder es beginnt, selbstschädigende Verhaltensweisen zu praktizieren. Diese früh erworbenen ungünstigen Strategien wer- den im Erwachsenenalter fortgesetzt und haben dann oft massive negative Folgen. Während sich das Kind vielleicht noch durch innere Fantasiewelten von äußerem emotionalem Schmerz ablenken konnte, steht diese Strategie Erwachsenen meistens nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen wird etwa durch Alkohol oder andere Drogen versucht, vor den bedrohlich erlebten Gefühlen zu fliehen.
Irgendwann im Laufe der Biografie ist es dann bei den psychiatrischen Klientinnen und Klienten zu einer psychischen Erkrankung gekommen, womit die Entwicklung in eine neue Phase führt: Die Erkrankung selbst und die Folgen der Erkrankung stellen für den Betroffenen natürlich weitere emotionale Herausforderungen dar. Dazu gehören die Erfahrungen rund um die psychische Krise, etwa das Schamerleben darüber, psychisch krank oder sogar zwangsweise in der Klinik behandelt worden zu sein. Oft sind auch Verhaltensweisen aus der Krisenzeit mit starken Scham- und Schuldgefühlen verbunden, wenn beispielsweise die eigenen Eltern bedroht oder gesellschaftliche Tabus verletzt wurden. Belastend kann ebenso die Angst davor sein, dass es nochmals zu einer Krise oder einer stationären Behandlung kommen könnte. Besonders emotional herausfordernd sind für viele Betroffene die Folgen einer psychischen Erkrankung wie der Verlust des Arbeitsplatzes und damit die berufliche Perspektive, die nicht gelebte Partnerschaft oder Elternschaft, der Verlust der selbstständigen Wohnform, die Tatsache, auf Hilfe von außen angewiesen zu sein, und vieles mehr.
Psychisch erkrankte Menschen sind also doppelt herausgefordert, mit Emotionen auf eine gute Art umzugehen, nämlich zum einen mit den biografischen Themen, die vielfach schon belastender sind als bei vielen anderen Personen, und zum zweiten bei der Verarbeitung der psychischen Erkrankung und den damit einhergehenden Folgen, Verlusten und Einschränkungen. Diese beachtlichen Herausforderungen in Kombination mit einer oft schlechten Ausgangslage beim Erwerb von Fähigkeiten zur Emotionsbewältigung führen zu einem hohen Risiko dafür, dass die Emotionsverarbeitung nicht gelingt.
Gefühlsunterdrückung im psychiatrischen System
In der zuvor beschriebenen zweiten Phase ab Erkrankungsbeginn tritt das psychiatrische Hilfesystem hinzu. Die weitere Entwicklung hängt nun zentral davon ab, wie das Hilfesystem auf den Betroffenen und seine Gefühle reagiert. Die Möglichkeiten bewegen sich zwischen zwei Polen: