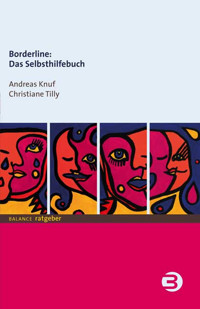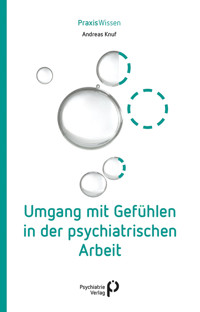Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arbor
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Erfahrungs- und Arbeitsbuch mit vielen Praxistipps Unsere Gefühle haben einen tiefgreifenden Einfluss darauf, wie wir durchs Leben gehen. Ohne Kontakt zu unseren Gefühlen sind wir mit uns selbst und unserer Lebendigkeit nicht gut verbunden. Wir tun uns schwer, Entscheidungen zu treffen, sind nicht motiviert, zu handeln, und kaum in Beziehung mit anderen Menschen. Dieses Buch ist ein Leitfaden für einen achtsamen Umgang mit Gefühlen. Es ist für alle gedacht, die mit Menschen arbeiten – sei es in der Therapie und Beratung, in Achtsamkeitstrainings, im Coaching, in der Seelsorge oder Sozialpädagogik. Es ist als Arbeits- und Erfahrungsbuch konzipiert. Sie finden fachliches Wissen, den neuesten Forschungshintergrund, Praxistipps für verschiedene Settings und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Zugleich können Sie bei sich selbst starten und Ihren eigenen Umgang mit Gefühlen erkunden. Dazu finden Sie im Buch immer wieder Übungen zur Selbstreflexion. Mit zwei Extra-Kapiteln: Emotionen in der Paarberatung von Christine Weiß Achtsamer Umgang mit Emotionen in Unternehmen von Armin Kaupp
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Knuf
Nix wie fühlen!
Achtsamer Umgang mit Gefühlen in Beratung, Therapie und Coaching
Arbor Verlag
Freiburg im Breisgau
Inhalt
Cover
Impressum
Einleitung
Kapitel 1: Hinführung
Die Kultur des Wegdrückens von Gefühlen
Don’t worry, be happy
Der Preis der Emotionssuppression
Umgang mit Gefühlen und professionelle Arbeit
Gefühle sind vielleicht das Wichtigste überhaupt
Kapitel 2: Wie sieht ein guter Umgang mit Gefühlen eigentlich aus?
Achtsamkeit auf die Emotionen
Der fühlende innere Beobachter
Emotionskompetenz statt Emotionsregulation
Die emotionale Wende im professionellen Kontext
Kapitel 3: Gefühle besser verstehen
Was sind Gefühle?
Wie entstehen Gefühle?
Wie verlaufen Gefühle?
Wie viel Kontrolle haben wir über unsere Gefühle?
Die drei Motivationssysteme
Unter- und Überregulation
Psychoedukation: Dem anderen helfen, seine Gefühle besser zu verstehen
Kapitel 4: Welche Arten von Gefühlen gibt es?
Primäre adaptive Gefühle: Unsere wahren und hilfreichen Gefühle
Sekundäre Gefühle: Gefühle, die eine Reaktion auf andere Gefühle darstellen
Primäre maladaptive Gefühle: Zeitreisegefühle
Traumaassoziierte Gefühle: Problematische Gefühle, die durch Traumata entstanden sind
Instrumentelle Gefühle: Wenn wir mit unserem Gefühlsausdruck etwas bezwecken wollen
Kapitel 5: Handlungsstrategien für den Umgang mit Gefühlen in Beratung und Therapie
Gefühlswahrnehmung ermöglichen: Dem anderen helfen, seine Gefühle wahrzunehmen,zu fühlen und auszudrücken
Emotionstoleranz fördern: Dem anderen helfen, seine Gefühle zu tragen
Selbstmitgefühl: Dem anderen helfen, freundlich mit sich und seinen Gefühlen umzugehen
Emotionsregulation: Dem anderen helfen, von Gefühlen nicht überflutet zu werden
Intensive Gefühle: Dem anderen helfen, mit intensiven und überflutenden Gefühlen umzugehen
Emotionale Resonanz und Koregulation: Dem anderen helfen, durch unsere emotionale Resonanz besser mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen
Wie können Fachpersonen gut mit ihren eigenen Gefühlen umgehen?
Kapitel 6: Emotionen in verschiedenen Arbeitsfeldern
Gefühle im Achtsamkeitstraining und während der Meditation
Herausforderung: Umgang mit aktivierten Gefühlen
Christine Weiß: Emotionen in der Paarberatung: Die Musik im Tanz der Liebe
Armin Kaupp: Achtsamer Umgang mit Emotionen in Unternehmen
Anhang
Über die Autoren
Literaturverzeichnis
Orientierungsmarken
Cover
Inhalt
Anhang
Impressum
© 2022 Arbor Verlag GmbH, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2022
Lektorat: Pascal Frank
Titelfoto: Hund links und mitte: ©2022 Elke Vogelsang/www.elkevogelsang.com, Hund rechts: ©2022 smrm1977/istockphoto.com
Umschlaggestaltung und Satz: mediengenossen.de
www.arbor-verlag.de
ISBN E-Book: 978-3-86781-394-5
Einleitung
Stellen Sie sich die folgende Situation vor: Marco ist gerade in einer Trennungssituation. Für ihn vollkommen unerwartet hat sich seine Partnerin Franziska nach 5-jähriger Beziehung von ihm getrennt, weil sie sich neu verliebt hat. Er fühlt sich traurig, wütend, ängstlich und verwirrt. Er verurteilt sich nicht für seine Gefühle, sondern kann sich sagen, dass diese Empfindungen ganz normal sind und es anderen Menschen wohl ähnlich gehen würde, wenn sie in seiner Situation wären. Er lässt sich abends und am Wochenende genug Zeit, um all diese Gefühle zu fühlen, mal ist es der Schmerz und mal die Wut, zwischendurch fühlt er sich auch einsam und minderwertig. Außerdem bespricht er sich immer wieder mit einem guten Freund, von dem er ebenfalls hört, dass seine Gefühle ganz normal seien, und der sich viel Zeit lässt, um mit ihm über die Situation und seine Empfindungen zu sprechen.
Auch Christian ist in einer Trennungssituation, geht aber ganz anders damit um. Er ist äußerst wütend und hat neulich seine Mutter am Telefon beschimpft. Seitdem hat er mit niemandem mehr über die Trennung gesprochen. Er igelt sich ein, zwar geht er weiterhin zur Arbeit, am Abend und am Wochenende trinkt er aber viel Alkohol und hat sich umgehend auf Tinder angemeldet. Doch auch da hat es nur Streit gegeben. Jetzt verbringt er die Abende mit Netflix und fühlt sich immer schlechter.
Wir können auf sehr verschiedene Art und Weise mit unseren Gefühlen umgehen, und dieser Umgang entscheidet darüber, wie wir mit herausfordernden Situationen, Krisen und Belastungen zurechtkommen, ob es uns gut geht oder wir uns unglücklich fühlen. Jeder von uns kennt Beispiele von sich selbst, und wir wissen aus unseren Beratungs- und Therapiegesprächen, aus unseren Achtsamkeitsgruppen oder Trainings natürlich auch, dass Menschen extrem unterschiedlich mit ihren Gefühlen umgehen.
Das fängt schon damit an, ob wir ein Gefühl überhaupt wahrnehmen. Haben wir keinen oder nur einen sehr schlechten Zugang zu unseren Gefühlen, so zahlen wir meistens einen Preis dafür: Wir sind dann womöglich mit uns selbst und unserer Lebendigkeit nicht gut verbunden. Wir tun uns schwer damit, Entscheidungen zu treffen, weil Entscheidungen ohne Gefühle letztlich nicht möglich sind. Wir sind nicht motiviert zu handeln, denn die Motivation für unser Verhalten schöpfen wir aus unseren Gefühlen. Und wir sind kaum in Beziehung mit anderen Menschen und Lebewesen, denn unsere Beziehungen leben von emotionaler Energie. Letztlich sind wir ohne unsere Gefühle noch nicht einmal überlebensfähig, allein schon weil wir nicht in der Lage sind, Risiken abzuschätzen und uns vor Gefahren zu schützen.
Eigentlich geht es von morgens bis abends um Gefühle. Sie sind wohl mit das Wichtigste im Leben überhaupt und entscheiden darüber, wie es uns geht („wie wir uns fühlen“) und was wir tun. Wenn es uns richtig gut geht, bedeutet das, dass wir angenehme Gefühle haben, die zumindest eine gewisse Zeitlang anhalten. Wenn es uns schlecht geht, werden wir von unangenehmen Gefühlen wie Traurigkeit oder Verzweiflung gequält. Seien es die schönsten Momente unseres Lebens oder die herausforderndsten Erfahrungen – immer spielen Gefühle dabei eine wesentliche Rolle.
Und doch haben wir wenig über sie gelernt. Es gab kein Schulfach dazu, und in vielen Elternhäusern wurde kaum über Emotionen gesprochen. Selbst in Forschung und Therapie waren sie lange eine Randerscheinung. Ich erinnere mich noch gut an mein Psychologiestudium in den frühen 1990er-Jahren. Damals hatte die Kognitive Verhaltenstherapie gerade ihre Blütezeit. Alles wurde auf die Gedanken zurückgeführt und entsprechend wurde an der Veränderung von Gedankenprozessen gearbeitet. Mit dem „Schmuddel“ der Gefühle wollte man am liebsten gar nichts zu tun haben.
Aus meinen Seminaren und Trainings weiß ich: Auch bei anderen Berufsgruppen ist es nicht viel anders. Wer eine Ausbildung in einem sozialen Beruf absolviert hat, sei es ein Pflegeberuf, Sozialpädagogik, Heilerziehungspflege oder Medizin, der hat meistens erstaunlich wenig über Gefühle gelernt. Das gilt auch für andere Arbeitsbereiche, etwa in der Führung von Mitarbeitenden oder in der Weiterbildung. Selbst in der Achtsamkeitsbewegung oder in der Meditationsschulung, die sich ja der akzeptierenden Wahrnehmung aller Empfindungen verschrieben haben, geht es meistens eher um die Wahrnehmung von Gedanken oder Sinnesempfindungen – und weniger um Gefühle.
Wer aber schon länger mit Menschen arbeitet, der weiß ganz genau: Es sind die Gefühle, die der Motor für heikle Verhaltensweisen sind, die psychische Krisen begünstigen und die über menschliches Leid oder menschliches Glück entscheiden. Unsere Gedanken und Handlungen werden weit mehr durch unsere Gefühle gesteuert, als wir lange Zeit wussten oder wahrhaben wollten. Die neurowissenschaftliche Forschung macht uns darauf aufmerksam, dass in heiklen Situationen unsere mentalen Prozesse herunterreguliert sind und unsere emotionalen Hirnzentren darüber entscheiden, was wir tun. Im Bereich der Psychotherapie hat die Übergewichtung kognitiver Interventionen mittlerweile ein Ende gefunden, stattdessen ist von der „emotionalen Wende“ die Rede. So betonen alle integrativen Methoden der modernen Psychotherapie, dass eine tiefergehende Veränderung von Menschen nur möglich ist, wenn unsere Gefühle aktiviert sind und wir auch an unseren Gefühlen arbeiten.
Dieses Buch unternimmt den vielleicht etwas gewagten Versuch, die Erkundung der eigenen Gefühle und die Vermittlung von Fachwissen zusammenzuführen. Statt uns nur mit den Gefühlen von (anderen) Menschen zu beschäftigen, die wir beraten oder in irgendeinem Kontext fachlich begleiten, starten wir zunächst jeweils bei unseren eigenen Gefühlen. So können wir von unserem eigenen Erleben ausgehend mehr darüber erfahren, wie wir Menschen unterstützen können, auf eine gute Art und Weise mit ihren Gefühlen umzugehen.
Nix wie fühlen! ist als Arbeits- und Erfahrungsbuch konzipiert. Neben fachlichen Inputs finden Sie hier Übungen zur Selbstreflexion, Praxistipps für verschiedene Settings, konkrete Formulierungsvorschläge und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Natürlich können Sie dieses Buch „in einem Rutsch“ lesen. Sie werden aber noch mehr davon profitieren, wenn Sie die vorgeschlagenen Übungen ausprobieren und sich immer wieder Zeit zum Hinspüren und Reflektieren nehmen. Alle Übungen wurden in Seminaren und Therapiesitzungen erprobt und sind nach meiner Erfahrung sehr wirkungsvoll. Sie dienen uns im Buch für den eigenen Erfahrungsprozess, können aber natürlich auch in Gruppen- und Einzelsettings angewendet werden. Um den eigenen Wahrnehmungsprozess zu unterstützen, finden Sie an verschiedenen Stellen in diesem Buch ein Pausenzeichen:
Dieses lädt zum Innehalten ein, vielleicht sogar kurz die Augen zu schließen, um dem jeweiligen Thema achtsam nachspüren zu können.
Dieses Buch wendet sich in erster Linie an alle, die in verschiedensten sozialen Kontexten tätig sind. Das können helfende Berufe sein wie beispielsweise Mitarbeitende in medizinischen Einrichtungen oder in verschiedenen Beratungssettings, etwa im Bereich der Erziehungshilfe oder des Coachings. Ebenso spreche ich Achtsamkeitstrainerinnen, Meditationslehrende, Seelsorger und andere an, die in verschiedenen Gruppen mit Menschen arbeiten. Und natürlich habe ich auch meine eigene Berufsgruppe vor Augen, denn für Psychotherapeuten ist die Unterstützung beim hilfreichen Umgang mit Gefühlen vielleicht das wichtigste Arbeitswerkzeug überhaupt. Zwei Beratungskontexte werden durch Gastbeiträge befreundeter Autorinnen zusätzlich vertieft. So beschreibt Christine Weiß, wie in der Paarberatung emotionsfokussiert gearbeitet werden kann, und Armin Kaupp, wie die Bedeutung von Gefühlen im Bereich des beruflichen Coachings und der Unternehmensberatung zu sehen ist.
Last but not least kann dieses Buch auch für das bessere Verständnis der eigenen Person oder anderen Menschen in unserem Umfeld gelesen werden, denn auch hier sind die Gefühle der eigentliche Schlüssel für ein zufriedeneres Miteinander.
Mögen wir in der Lage sein, uns unseren Gefühlen achtsam zuzuwenden, und möge dieses Buch einen kleinen Beitrag dazu leisten.
Konstanz, im März 2022 Andreas Knuf
Kapitel 1 Hinführung
Wenn wir auf die Welt kommen, folgen wir einem natürlichen uns mitgegebenen Umgang mit unseren Affekten. Angst, Freude und andere Empfindungen erleben wir vollkommen ungefiltert. Wir sind ihnen gleichsam ausgeliefert und drücken sie unmittelbar aus. Doch schon bald wird aus dem reinen Erleben des Neugeborenen eine Interaktion zwischen Kind und Eltern oder anderen Bezugspersonen – bereits ab dem ersten Tag und zwischen Mutter und Kind sicher auch schon davor.
Jede Interaktion zwischen Kind und Eltern wirkt sich auch auf die Wahrnehmung der Gefühle aus und wie damit umgegangen wird. Der Säugling oder das Kleinkind strahlt vor Freude und die Mutter strahlt ebenfalls. Sie spiegelt also das Empfinden des Kindes und verstärkt es damit. Oder das Kleinkind ist von Angst überflutet und erfährt vielleicht Halt und Trost. Es könnte aber auch sein, dass die schmerzhafte Empfindung des Kindes ignoriert oder auf eine Art mit ihr umgegangen wird, die für das Kind nicht hilfreich ist. Diese Reaktionen von außen bestimmen sehr zentral, wie es in der Folge die eigenen Gefühle empfindet, sie ausdrückt und damit umgeht.
Die Reaktionen des Umfeldes auf die Gefühle des Kindes werden auf verschiedene Weisen vermittelt. Besonders wichtig ist die emotionale Atmosphäre innerhalb des Familiensystems. Beispielsweise könnte die Atmosphäre von Angst geprägt sein oder im Gegenteil natürlich auch von Vertrauen und Zuwendung. Auch die emotionale Resonanz, also die gefühlsmäßige Reaktion der Bezugsperson, ist für das Kind sehr wichtig. Die wesentlichen Bezugspersonen fungieren außerdem als Modell, sie leben dem Kind also vor, wie mit Gefühlen umgegangen werden kann. Zeigen die Eltern ihren Schmerz oder flüchtet die Mutter ins Schlafzimmer, wenn ihr die Tränen kommen? Sind die Eltern auch mal wütend aufeinander und können sich anschließend wieder versöhnen? Tausende solcher Modell-Verhaltenssequenzen erlebt ein Mensch in seiner Kindheit. Da die Eltern zu dieser frühen Zeit vom Kind geradezu wie Götter erlebt werden, prägt sich dieses Modellverhalten besonders stark ein und wird als unhinterfragbare Wahrheit abgespeichert.
Daneben reagieren die Eltern und andere Bezugspersonen auf die Emotionen, die das Kind zeigt. Was macht die Mutter oder der Vater, wenn das Kind wütend ist? Wird der Vater selbst auch wütend und schreit das Kind an oder darf es seine Wut zeigen, ohne dass es zu einer Gefährdung der Beziehung kommt? Reagieren die Eltern ebenfalls freudig, wenn sich das Kind freut, oder sind die Eltern eher unbeteiligt und in ihrem eigenen Empfinden gefangen? Außerdem vermitteln die Eltern und andere wichtige Bezugspersonen dem Kind verbal viel Wissen über Gefühle. Wenn der Vater etwa zum Sohn sagt: „Zeig niemals, wenn du dich schwach fühlst“, dann formen auch solche Sätze natürlich die Reaktionen des Kindes auf eigene Gefühlsimpulse.
Die Kultur des Wegdrückens von Gefühlen
Viele von uns haben gelernt, dass Gefühle besser nicht gezeigt werden sollten. Berühmte Sprüche wie „Indianer kennen keinen Schmerz“ sind Ausdruck eines eher unterdrückenden Umgangsstils mit Gefühlen, einer sogenannten Emotionssuppression. Vor allem unangenehme Gefühle sollen, so die Botschaft in vielen Herkunftsfamilien, verschwinden oder am besten gar nicht erst auftauchen. Wenn es einem nicht gut geht, soll man „die Zähne zusammenbeißen“ und sich „nichts anmerken lassen“. Aber auch angenehme und freudvolle Empfindungen durften manchmal nicht gezeigt oder ausgelebt werden.
Das „Wegdrücken“ von Gefühlen ist kein neues Phänomen, und es ist auch nicht nur in Mitteleuropa, sondern in vielen Kulturen zu finden. Bereits seit dem 18. Jahrhundert wurden pädagogische Konzepte vertreten, die den Kindern ihre „Rohheit“ und Wildheit austreiben sollten (Plamper, 2012). Gefühle sollten unterdrückt werden, um dadurch die reine Vernunft zu fördern. Im Rahmen der sogenannten Schwarzen Pädagogik wurde in Nazi-Deutschland und auch schon davor ein extrem emotionssuppressiver Erziehungsstil vertreten: Kinder sollten wenig berührt, die Bindung eher oberflächlich gehalten werden (Haarer, 1934). Und auch nach dem Krieg wurden in einer traumatisierten Gesellschaft Gefühle wie Scham, Schuld und Trauer beiseite gedrückt. Stattdessen versuchte sich die deutsche Gesellschaft in den 1950er-Jahren an einer aufgesetzten „entpolitisierten Fröhlichkeit“ in der Kleinfamilie. Vor allem die Generation der Nachkriegskinder, aber wahrscheinlich die Geburtsjahrgänge bis in die 1980er-Jahre hinein, sind oft in einer Atmosphäre aufgewachsen, in der Gefühle kaum gezeigt wurden und die Kinder wenig über den Umgang mit Gefühlen lernten. Die wenigsten aus dieser Generation geben an, dass ihnen ihre Eltern einen authentischen und offenen Umgang mit Gefühlen vermittelten und die Eltern für sie ein Modell eines guten Umgangs mit Gefühlen sind oder waren.
Da ein kleines Kind schwierige Gefühle noch nicht allein regulieren kann, ist es auf die Unterstützung seiner engsten Bezugspersonen angewiesen, meistens sind das die Eltern. Das Kind braucht in emotional schwierigen Situationen eine emotionale Resonanz des Gegenübers, Trost und Mitgefühl sowie eine Validierung der eigenen Gefühle, also eine Bestätigung, dass sie stimmig sind, und auch eine Erlaubnis, dass sie da sein dürfen. Ob dieser Prozess gelingt, hängt von der Bindung zu den Bezugspersonen sowie deren emotionaler Verfasstheit und emotionaler Präsenz ab. Hier kann viel schiefgehen, etwa weil Eltern längerfristig nicht hinreichend präsent sind, da sie beispielsweise mit ihrer aktuellen Lebenssituation überfordert sind, selber Krisen durchleben, äußere Ereignisse dominant sind oder auch schlicht, weil sie ein anderes Erziehungsverständnis haben.
Wenn dieser Prozess, aus welchen Gründen auch immer, nicht oder nur unzureichend gelingt, hat das Kind keine andere Möglichkeit als zu versuchen, allein mit dem Gefühl zurechtzukommen, obwohl es eigentlich überfordert ist. Es wird dann auf ungünstige Strategien zurückgreifen, beispielsweise werden Gefühle komplett beiseite gedrückt oder sogar wegdissoziiert, das Kind verurteilt sich selbst für die Gefühle oder es beginnt, selbstschädigende Verhaltensweisen zu praktizieren.
Selbsterforschung
Nehmen Sie sich nun etwas Zeit, um genauer zu erkunden, mit welcher Form des Umgangs mit Gefühlen Sie aufgewachsen sind. Schließen Sie hierfür kurz Ihre Augen und atmen Sie einige Atemzüge lang bewusst und möglichst gelöst ein und aus. Öffnen Sie sich innerlich für Gedanken, Bilder und Erinnerungen, die Ihnen aus Ihrer Kindheit zum Umgang mit Gefühlen kommen.
Bitte stellen Sie sich nun die folgenden Fragen:
Wurde Ihnen in Ihrer Kindheit und frühen Jugend vermittelt, dass Gefühle normal sind und zum Leben dazugehören?Oder haben Sie eher gelernt, dass sie nicht gezeigt werden sollten?Sahen Sie Ihre Eltern weinen?Wie ging man in Ihrer Familie mit Traurigkeit, Ärger oder Freude um?Wie reagierten Ihre Eltern, wenn Sie als Kind Freude, Angst oder Scham empfanden?Wurde darüber gesprochen?Wurden die Empfindungen anerkannt oder in irgendeiner Form negativ bewertet?Wir können sehr froh darüber sein, dass es in den letzten Jahrzehnten vielerorts zu einer deutlichen Veränderung im Umgang mit Gefühlen gekommen ist. Es wird zunehmend leichter, über Gefühle zu sprechen, und in immer mehr Familien bleiben Gefühle nicht länger tabuisiert. Eltern zeigen sich eher mit ihren Gefühlen und vermitteln, dass Gefühle zum Leben dazugehören, man sich ihrer nicht schämen muss und über sie gesprochen werden kann. Dieser Trend ist sehr zu begrüßen und hat unseren gesellschaftlichen Umgang mit Gefühlen bereits deutlich gewandelt. So ist der Umgang mit ihnen zum Teil auch eine Generationenfrage.
Zwei Beispiele
Kerstin wurde Ende der 1960er-Jahre in einem streng katholischen Elternhaus geboren. Gefühle waren zu Hause eigentlich tabu. Sie erzählt, dass sie ihren Vater nie habe weinen sehen und ihre Mutter nur auf dem Friedhof beim Tod ihrer eigenen Mutter. Ansonsten seien Gefühle kaum gezeigt worden. Ausgelassenheit und Freude habe sie zu Hause fast nur im Zusammenhang mit Alkohol erlebt, dann seien auch Ärger und Wut aufgetreten. Diese seien ansonsten in der Familie ganz verpönt gewesen. Wenn sie als Kind ärgerlich geworden sei, sei sie sofort auf ihr Zimmer geschickt worden. Als Erwachsene gehe es ihr heute immer noch so, dass sie sich für ihren Ärger schäme und auch mit Angst reagiere, weil sie fürchte, bestraft zu werden. Wenn sie als Kind ausgelassen und heiter gewesen sei, habe ihre Mutter oft zu ihr gesagt: „So gut wie du möchte ich’s auch mal haben.“ Auch heute habe Freude manchmal für sie immer noch einen irgendwie negativen Beigeschmack, so als ob es ihr nicht zustünde, dass es ihr gut ginge.
Sabrina, Jahrgang 1991, wuchs in einer großen Hofgemeinschaft auf, wo sie in ihrer Kindheit nicht nur von ihren Eltern, sondern auch von den übrigen Hofbewohnern versorgt und erzogen wurde. Sie erzählt, dass dort alle Gefühle gezeigt werden durften und viel über Gefühle gesprochen worden sei. Sie habe auch viel Freude, Lachen und Ausgelassenheit erlebt, manchmal sei hier aber auch mit leichten Drogen nachgeholfen worden. Die Erwachsenen hätten auch wenig Scham gezeigt, so sei Sexualität und Körperlichkeit ganz offen gelebt worden. Seltsamerweise habe sie sich aber manchmal für die Erwachsenen geschämt, und heute sei es bei ihr so, dass sie eher viel Scham empfinde. Auch wenn sie weinen müsse, zeige sie das ungern anderen Menschen, sondern lasse die Tränen eigentlich nur zu, wenn sie allein sei.
Don’t worry, be happy
Während sich die Sprachlosigkeit im Umgang mit Gefühlen zunehmend verliert, ist in den letzten 10–20 Jahren ein Trend zu beobachten, der auf andere Weise problematisch sein kann: ein zunehmender Wunsch nach durchgängig angenehmen Gefühlen. Unsere Kultur ist vermehrt auf Optimierung und Selbstoptimierung ausgerichtet, alles soll immer besser werden. Man muss an sich arbeiten, um sein „wahres Wesen“ oder sein „besseres Ich“ zu verwirklichen. Diese Suche nach dem Besseren bildet sich auch im Umgang mit Gefühlen ab: Wir möchten immer mehr angenehme Gefühle haben, und zwar besonders intensive, und glauben gleichzeitig, dass wir unangenehme Gefühle ganz aus unserem Leben verbannen können.
Diesen Trend bezeichne ich als Glückskult (Knuf, 2018). Er ist vor allem in vielen westlichen Ländern anzutreffen und wird auch von soziologischer Seite beschrieben (Reckwitz, 2017). Der Glückskult schlägt sich in einer wachsenden Zahl von Ratgeberliteratur über vermeintlich „positive Gefühle“ und ein perfektes Leben im „Dauerglück“ nieder.
Wenn sich die angenehmen Gefühle nicht von allein einstellen, wird immer häufiger nachgeholfen, sei es mit Psychotipps, Medikamenten oder irgendwelchen Suchtmitteln. Allein vom Jahr 2000 bis 2018 hat sich der Absatz von Antidepressiva in Deutschland fast verdreifacht, was ganz sicher nicht allein mit der Zunahme von Depressionen erklärt werden kann und vielfältige Gründe hat.
Einer davon ist, dass wir unangenehme Empfindungen immer seltener tolerieren, schnell bereit sind, sie als Teil einer Erkrankung zu verstehen, und uns Abhilfe wünschen. So benutzen Klienten von mir immer öfter den Begriff Depression und beschreiben letztlich eine traurige Stimmungslage, ein „schlechtes Wochenende“ oder wenig freudvolle Gefühle in einer schwierigen und herausfordernden Lebensphase. Eine Klientin sagte mir einmal: „Wenn man unangenehme Gefühle hat, dann stimmt mit einem doch was nicht.“
Wer früher „schlecht drauf“ war, gerade eine „schwierige Zeit“ hatte oder in der „Midlife-Crisis“ feststeckte, der gilt heute schnell als depressiv, empfindet sein Erleben als Erkrankung und lässt sich entsprechend behandeln. Als ich mich neulich in einem Erstgespräch mit einem Klienten über die Ziele der Therapie beriet, sprach ich von dem Ziel, dass er zufriedener werden könnte. Mein neuer Klient unterbrach mich und meinte: „Das wäre mir ehrlich gesagt zu wenig. Ich will, dass es mir immer gut geht.“
So droht aus einer Kultur des Wegdrückens von Gefühlen eine Glückssucht zu werden, bei der ja wieder Gefühle weggedrückt werden, diesmal zumindest nur die unangenehmen. Dabei wäre es viel wünschenswerter, wir würden die Fähigkeit entwickeln, uns für alle Gefühle zu öffnen, egal ob angenehm oder unangenehm.
Das Wegdrücken unangenehmer Empfindungen kann man allerdings nicht nur der Kultur der Selbstoptimierung und des „Immer besser“ anlasten, sondern es ist auch Ausdruck einer biologisch-evolutionär verankerten Grundhaltung: Jedes Lebewesen versucht angenehme Empfindungen herbeizuführen und unangenehme zu vermeiden. Da eine angenehme Empfindungslage normalerweise darauf hinweist, dass unsere Bedürfnisse erfüllt sind, versuchen wir natürlicherweise häufiger, angenehme Empfindungen zu haben. Jeder möchte im Winter im Warmen sein oder genug zu essen haben, wenn er oder sie hungrig ist. Unangenehme Empfindungen wiederum geben uns einen Hinweis, dass eine Gefahr besteht oder ein Bedürfnis unerfüllt ist. Also versuchen wir, diesen Empfindungen aus dem Weg zu gehen.
Während ich das hier schreibe, findet gerade der Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam statt. Deutschland landet ja gerne auf einem der letzten Plätze und so ist es auch diesmal. Jendrik Sigwart belegt mit seinem Song „I don’t feel hate“ nur den vorletzten Platz. In deutschen Medien wird von einem Debakel gesprochen, das Lied von Jendrik sei zu simpel und kindisch. Während er in Interviews vor der Endausscheidung angab, dass er einen der vorderen Plätze anstrebe, sagt er nach der Niederlage „Ich bin wirklich glücklich!“.
Aber das darf natürlich bezweifelt werden, denn wenn man sich etwas erhofft und das Erwünschte nicht eintritt, ist Traurigkeit die angemessene Emotion. Da geht es auf den Fußballplätzen schon ehrlicher zu: Die Verlierer sind todtraurig, den Tränen nah oder trauen sich, diese auch zu zeigen. Die Sieger sind hingegen freudestrahlend und glückselig und lassen sich überschwänglich feiern.
Der Preis der Emotionssuppression
Auch wenn das Wegdrücken von unangenehmen Gefühlen wie auch die Gier nach angenehmen letztlich negative Folgen für uns haben, kann sich die Emotionssuppression zunächst einmal gut anfühlen, da das unerwünschte Gefühl ja weniger intensiv gespürt wird. So kann beispielsweise viel Ablenkung oder Arbeiten in einer Trauersituation dazu führen, dass der Schmerz über den Verlust vorübergehend weniger wahrnehmbar ist. Wir werden also kurzfristig belohnt, längerfristig kann das Gefühl aber nicht „durchfühlt“ und verarbeitet werden.
Es bleibt daher verdeckt bestehen oder die Energie des Gefühls manifestiert sich auf andere Weise. Probanden, denen die Aufgabe gestellt wurde, auf eine experimentell induzierte Angst mit Vermeidung zu reagieren, zeigten eine subjektiv stärkere Angst als die Probanden, welche ihre Angstgefühle einfach nur beobachten sollten (Zvolensky & Forsyth, 2002). Vielfach kommt es zu einer körperlichen Anspannung (Luft anhalten, Mund zusammenpressen, Muskelverkrampfungen, Kloß im Hals, Spannung im Bauch). Der Sympathikus wird aktiviert, was sich in innerer Unruhe, Nervosität, Getriebensein etc. zeigen kann, auch der Blutdruck kann dauerhaft ansteigen. Dies kostet den Körper viel Energie und kann langfristig zu psychosomatischen und körperlichen Erkrankungen führen oder auch eine Schmerzsymptomatik bewirken.
Das Wegdrücken von Gefühlen führt zudem zu einem reduzierten Erleben angenehmer Emotionen. Wir sind nicht in der Lage, nur einzelne unerwünschte Gefühle zu verdrängen, sondern reduzieren dann unsere emotionale Erlebnisfähigkeit generell. In der Folge sind auch Gefühle wie Ausgelassenheit und Zufriedenheit sowie Qualitäten wie Lebendigkeit und Spontaneität weniger zugänglich. Als Metapher lassen sich Gefühle mit dem Wasser in einer gefüllten Badewanne vergleichen: Man kann das Wasser nicht nur an einer Seite der Wanne ablassen. Sobald der Stöpsel gezogen wird, läuft es überall gleichmäßig ab.
Aber natürlich gibt es durchaus auch Situationen, in denen das Wegdrücken von Gefühlen sinnvoll sein kann. Dies betrifft vor allem den Gefühlsausdruck, also ob man eine Emotion zeigt oder nicht. Wir sollten nicht in jeder Situation all unsere Gefühle zeigen, manchmal müssen wir unsere Gefühle bewusst zurückhalten. Außerdem sind wir nicht immer allen Gefühlen gewachsen, weshalb unser Organismus für absolute Hochstresssituationen über einen Mechanismus verfügt, mit dem er die Emotionswahrnehmung gleichsam ausschalten und uns so vor überflutenden Gefühlen schützen kann. Wie wir später noch sehen werden, gilt aber auch in solchen Situationen, dass wir uns zumindest zu einem späteren Zeitpunkt für die bis dahin weggedrückten Gefühle öffnen sollten.
Die Henne und das Ei: Psychische Erkrankungen und der Umgang mit Gefühlen
Eine von zahlreichen Fragen zum Zusammenhang von Gefühlen und psychischen Erkrankungen lautet: Führt ein ungünstiger Umgangsstil mit Gefühlen zur (späteren) psychischen Erkrankung, ist er also eine Ursache der Erkrankung? Oder führt die Erkrankung selbst zum ungünstigen Umgang mit Gefühlen, zum Beispiel, weil die Gefühle infolge der Erkrankung überwältigend sind und nicht so gut verarbeitet werden können?
Aufgrund der aktuellen Studienlage spricht einiges dafür, dass ein ungünstiger Umgangsstil mit Gefühlen tatsächlich eine Ursache zahlreicher psychischer Erkrankungen ist. Der in der Biografie erworbene ungünstige Umgangsstil erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine psychische Erkrankung zu erleiden (zur Übersicht siehe Berking, 2010). So zeigt beispielsweise eine Studie, die an New Yorker Studenten untersuchte, wie diese mit den Anschlägen des 11. September 2001 umgingen: Wer schon vor den Anschlägen Angst vor dem eigenen Gefühlserleben hatte und zu einem vermeidenden Umgangsstil mit Gefühlen neigte, entwickelte durch die Attentate eher eine Angstproblematik als Menschen, die auf eine gute und annehmende Art mit ihren Gefühlen umgehen konnten (Mennin et al., 2002).
Die Art des Umgangs mit Gefühlen scheint also zentral darüber zu entscheiden, wie traumatische Ereignisse verarbeitet werden und ob es zu einer Posttraumatischen Belastungsstörung kommt (Jennissen et al., 2016). Auch bei Jugendlichen konnte gezeigt werden, dass ein vermeidender Umgangsstil in emotional schwierigen Situationen voraussagen konnte, zu welchen psychopathologischen Symptomen es später kommt (Seiffge-Krenke, 2000).
Der Umgang mit Gefühlen entscheidet aber nicht nur mit darüber, ob eine psychische Erkrankung auftritt, sondern auch, wie diese in der Folge verläuft. Ein ungünstiger Umgangsstil ist einer der aufrechterhaltenden Faktoren für psychische Erkrankungen, er begünstigt also erneute Krisen und fortbestehende Symptomatiken. Außerdem hat er Einfluss darauf, ob es neben der ursprünglichen psychischen Erkrankung zum Auftreten weiterer psychischer Symptome kommt, denn diese sind oft Folge eines ungünstigen Umgangs mit Gefühlen, die sich im Laufe der Krankheitsdynamik ergeben.
Umgang mit Gefühlen und professionelle Arbeit
Die eben beschriebenen gesellschaftlichen Trends und kulturellen Entwicklungen prägen unseren eigenen Umgangsstil mit Gefühlen und den unserer Klienten. Außerdem zeigen sie sich auch in der Art, wie wir in Beratung, Therapie, Training etc. arbeiten und dort mit Gefühlen umgehen. Der emotionssuppressive Stil hat zudem großen Einfluss auf unsere Ausbildungen genommen. Die meisten Fachpersonen in psychosozialen Berufen haben nämlich wenig über Gefühle gelernt. Wenn ich in meinen Seminaren die Teilnehmenden danach frage, wie gut sie sich auf die Arbeit mit Emotionen bei ihren Klienten vorbereitet fühlen, dann wird mehrheitlich berichtet, dass sie wenig in ihren Ausbildungen darüber erfahren haben. Das betrifft übrigens sämtliche psychosozialen Berufsgruppen inklusive Psychotherapeuten und erstreckt sich leider in Teilen sogar bis in die heutige Zeit hinein.
Selbsterforschung
Wenden Sie sich nun einen Augenblick nach innen und stellen Sie sich die folgenden Fragen:
Wie viel haben Sie in Ihrer Ausbildung im beraterischen oder psychosozialen Arbeitsfeld über Gefühle gelernt?Empfinden Sie sich gut vorbereitet für die Arbeit mit Gefühlen?Warum lesen Sie dieses Buch? Weil Sie schon intensiv mit Gefühlen arbeiten oder weil Sie sich mehr Sicherheit im Umgang mit Gefühlen wünschen?Auch ich habe das in meinem Studium und teilweise sogar in der Therapieausbildung zu spüren bekommen. An der Universität tauchte die Arbeit mit Gefühlen fast nicht auf. Während meines Studiums in den frühen 1990er-Jahren erlebte die Kognitive Verhaltenstherapie gerade ihren Höhepunkt und galt an vielen deutschsprachigen Universitäten als Nonplusultra. Gefühle galten in diesem Zusammenhang, wie in der Einleitung bereits erwähnt, als etwas „schmuddelig“, sie waren sehr subjektiv und ließen sich schlecht erfassen und messen. So fokussierte man sich damals fast ausschließlich auf die Gedanken und wollte über die Veränderung von Gedankeninhalten auf das Befinden und auf psychische Krisen Einfluss nehmen. Dies war natürlich eine mit nichts zu begründende einseitige Herangehensweise.
Doch wenn ich ganz ehrlich bin, kam mir das einige Jahre gar nicht so ungelegen, denn auch ich bin emotionssuppressiv aufgewachsen und habe mich vor so manchem Gefühl gern gedrückt. Ich zog es vor, wenn es in den Therapiegesprächen nicht allzu viel um Gefühle ging – eine von heute aus betrachtet natürlich etwas sonderbare Haltung für einen Psychotherapeuten.
Gerade zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit habe ich vielfach starke Gefühle meiner Klienten unbewusst umschifft. Ich blieb im Gespräch eher auf einer kognitiven Ebene und stellte gern reflektierte Fragen. Entsprechend ging es dann in meinen Beratungsgesprächen erstaunlich wenig um schwierige Gefühle, es wurde wenig geweint und wir haben vielfach sehr sachlich über letztlich hochemotionale Themen gesprochen. Denn nicht nur mir war unwohl, wenn es um das Fühlen von Emotionen ging, sondern vielen meiner Klienten natürlich ganz genauso. So kam es diesen teilweise sicher auch entgegen, dass ich versuchte, heiklen Gefühlen aus dem Weg zu gehen.
Die gar nicht selten zu beobachtende Emotionsphobie von Fachpersonen ist Folge der schon beschriebenen Emotionssuppression in vielen Bereichen unserer Gesellschaft und der daraus resultierenden fehlenden fachlichen Kompetenz in verschiedenen Arbeitsbereichen. Dabei ist sie keine individuelle Haltung, sondern meistens ein fest integrierter Bestandteil des Hilfssystems.
So gibt es verschiedene Therapiemethoden, die das emotionale Erleben eher zu umgehen versuchen. Dazu gehört die Kognitive Verhaltenstherapie, aber auch weite Teile der Lösungsorientierten Therapie. Selbst die psychoanalytische Methodik steht in der Gefahr, vor allem über Gefühle zu sprechen, statt sich ihnen wirklich zuzuwenden (McCullough, 2019). Und auch in der Systemischen Therapie hat man, zumindest in den Lehrbüchern, das Thema der Gefühle lange vergeblich gesucht (Wagner & Russinger, 2016). Im psychiatrischen Kontext führt die Angst vor den Gefühlen der Klienten und die fehlende Kompetenz im Umgang damit oft zum Zurückgreifen auf medikamentöse Behandlungsstrategien.
In Seminaren höre ich immer wieder die Befürchtungen von Mitarbeitenden verschiedenster Berufsgruppen: „Und was, wenn mein Klient dann psychisch instabil wird?“ Oder: „Wenn ich mit meinem Klienten über Gefühle spreche, werden diese womöglich erst aktiviert, und wenn er sie dann nicht gut kontrollieren kann, bin ich schuld, wenn etwas Heikles passiert.“
Doch wir Helfenden bewahren unsere Klienten nicht vor ihren Gefühlen, indem wir sie nicht ansprechen, denn meistens sind die Gefühle sowieso schon aktiviert oder unterschwellig vorhanden. Auch wenn das Gefühl vom Klienten selbst nicht angesprochen wird oder Fachperson und Klient bestimmte emotionale Themen vermeiden, heißt das noch lange nicht, dass das Gefühl nicht da ist. Unsere Haltung, Gefühle zu umschiffen, ist vergleichbar mit der früher verbreiteten Idee, man solle Klienten nicht auf ihre möglichen Suizidgedanken ansprechen, da man sonst „schlafende Hunde“ wecke und den Klienten erst recht auf solche Gedanken bringe. Heute gilt dieses Vorgehen als unprofessionell und fahrlässig, und es ist gefährlich, keine genaue Suizidabklärung vorzunehmen.
Fast alle Menschen berichten, dass es für sie entlastend sei, mit anderen Personen über schwierige Emotionen zu sprechen. Daher ist es fachlich nicht haltbar, schwierige Gefühle der Klienten zu übergehen, zumindest wenn angenommen werden muss, dass sie sowieso da sind und den Klienten bewusst oder unbewusst beschäftigen. Warum sollte es für den Klienten leichter sein, allein mit seinen Gefühlen zurechtzukommen als mit Unterstützung eines professionell Tätigen?
MERKE:
Bei ehrlicher Betrachtung stehen Fachpersonen vielfach gar nicht vor der Wahl, ob sie bei ihrem Klienten ein Gefühl aktivieren oder nicht, sondern ob ein Klient mit dem sowieso schon aktiviertenGefühl alleingelassen wird oder nicht!
Es gibt viele Strategien, die wir in der Praxis anwenden können, um den Klienten und uns vor Gefühlen zu schützen. Manchmal mag das sogar sinnvoll sein, doch vielfach sind uns diese Techniken gar nicht bewusst. Hier ein paar typische Beispiele (angelehnt an Wendisch, 2015):
Das Gespräch sachlich halten: Mit dem Klienten sehr „verkopft“ und abstrakt über Themen sprechen.Kontrolle behalten: Möglichst konkrete und „kontrollierbare“ Aufträge vom Klienten suchen und sich mit ihnen ausgiebig beschäftigen. Wenn dazugehörige Gefühle sichtbar werden, diese übergehen und sich auf die Handlungsebene „retten“.Vorschnelle Lösungsorientierung: Unter dem Deckmantel des lösungsorientierten Ansatzes werden unangenehme Gefühle quasi „übersprungen“. Anstatt sich zunächst mit den Gefühlen zu beschäftigen, die mit der gegenwärtigen Situation oder dem Thema verbunden sind, wird sofort nach einer Lösung gesucht. Emotionen werden teilweise als „lösungsfeindlich“ betrachtet und ausgeblendet.Die Ressourcen fokussieren und die Defizite ignorieren: Statt sich mit den Schwierigkeiten und heiklen Themen des Klienten zu beschäftigen, werden ständig die Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen des Klienten betont. So schützt sich der Helfende vor der Konfrontation mit problematischen Gefühlen des Klienten.Übervorsichtig sein: Helfende vermeiden alle Themen, die mit unangenehmen Gefühlen verbunden sein könnten, und übernehmen damit die Vermeidungshaltung des Klienten.Selbsterforschung
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und fragen Sie sich:
Welche dieser Strategien habe ich bei mir selbst schon beobachtet?Welche wende ich womöglich häufiger an?Gefühle sind vielleicht das Wichtigste überhaupt
In wirklich krassem Widerspruch zum bisher Gesagten steht die heute einhellige wissenschaftliche Erkenntnis (und ganz nebenbei ja auch die gesunde Alltagswahrnehmung vieler Menschen), dass Gefühle vielleicht mit das Wichtigste in unserem Leben überhaupt sind. Sie entscheiden darüber, wie es uns geht, was wir tun, ob es uns gelingt, unseren Bedürfnissen zu folgen, Gefahren zu vermeiden und Möglichkeiten zu erkennen.
Wie in der Einleitung bereits erwähnt, wären wir ohne unsere Gefühle schlicht nicht überlebensfähig. Wir wären wohl schon in wenigen Tagen tot, wenn wir beispielsweise keine Angst mehr empfinden würden. Unsere Gefühle entscheiden über unser Wohlbefinden, denn dieses hängt natürlich ganz zentral davon ab, mit wie vielen schmerzhaften Gefühlen wir es zu tun haben und ob wir auch Zugang zu angenehmen finden. Unsere Gefühle steuern unser Verhalten und teilweise auch unsere Gedanken. Sie beinhalten wichtige Informationen, ohne die die Erfüllung unserer Bedürfnisse und das Zusammenleben von Menschen gar nicht möglich sind. Und sie entscheiden wesentlich darüber mit, ob wir psychisch und physisch gesund bleiben oder erkranken.
Dabei haben die verschiedenen Gefühle ganz unterschiedliche Funktionen: Angst schützt uns vor Gefahren, Trauer hilft Verluste zu bewältigen, Scham und Schuldempfinden sichern den Zusammenhalt in der Gruppe, Ärger hilft uns bei der Abgrenzung und Selbstbehauptung.
Gefühle sind jedoch nicht nur wegen dieser spezifischen Funktionen wichtig, sondern weil viele unserer Fähigkeiten durch die Wahrnehmung unserer Gefühle und den angemessenen Umgang mit ihnen gesteuert werden. Deshalb muss jede psychosoziale Arbeit eigentlich eine emotionale Arbeit sein, auch wenn der Klient nicht wegen spezieller Probleme mit Gefühlen unsere Unterstützung aufsucht. Der wohl wichtigste Zusammenhang ist dabei der zwischen Gefühlswahrnehmung und Motivation. Niemand handelt allein aufgrund bestimmter Gedanken, sondern aufgrund von Gefühlen, die man entweder als aversiv erlebt und vermeiden möchte oder die als angenehm empfunden werden, weshalb man versucht, sie herbeizuführen.
In der Werbeindustrie ist der Zusammenhang von Emotionen und Motivation schon seit langer Zeit bekannt. In Werbefilmen werden nicht in erster Linie Produktinformationen vermittelt, sondern Gefühle aktiviert. Sie werden oft handlungsleitend und bestimmen dann maßgeblich über unser Verhalten. Menschen kaufen sich neue Produkte, weil sie sich davon erhoffen, sich dann besser zu fühlen.
Nach meiner Erfahrung ist uns Fachpersonen der Zusammenhang von Gefühlen und Motivation vielfach unzureichend bewusst. Daher wird oft auf einer kognitiven Ebene versucht, die Motivation des Klienten zu fördern, etwa indem ihm vermittelt wird, welche Vor- oder Nachteile bestimmte Verhaltensweisen für ihn haben. Da der Antrieb für eine Handlung jedoch stärker von emotionalen Prozessen reguliert wird, mag dem Klienten dann zwar der Vorteil einer Handlung klar sein, er kann sich aber trotzdem nicht dazu überwinden. Wenn jemand keinen Zugang zu angenehmen Emotionen hat, wird seine Motivation zwangsläufig eingeschränkt sein.
Motivationsförderung ist daher eigentlich eine hochemotionale Angelegenheit, bei der es darum geht, angenehme Gefühle wieder zugänglich zu machen und unangenehme Gefühle als solche zu erleben.
Ganz zentral werden auch unsere Entscheidungen von unseren Gefühlen beeinflusst. Wenn wir erwarten, dass sich ein angenehmes Gefühl einstellt, falls wir etwas Bestimmtes erreichen, so werden wir uns natürlich dafür entscheiden. Erwarten wir hingegen eine unangenehme Konsequenz, so werden wir uns in der Regel dagegen entscheiden. Nehmen wir jedoch unsere Gefühle sehr schlecht wahr, spüren wir diesen „emotionalen Zug“ in eine bestimmte Richtung gar nicht mehr, unsere Entscheidungen werden ambivalent und im Extremfall werden wir sogar entscheidungsunfähig, da wir gar nicht „vorausempfinden“ können, welche Gefühle mit welcher Entscheidung verbunden sein könnten.
Auch unsere Gedächtnisinhalte und unsere Gedächtnisleistung hängen wesentlich von unseren Gefühlen ab. Längerfristig erinnert werden lediglich emotional bedeutsame Inhalte, diese aber teilweise so intensiv, dass wir uns von bestimmten Erinnerungen kaum lösen können. Auch die erinnerten Inhalte werden von unseren Gefühlen reguliert. Eine gedrückte Gefühlslage beispielsweise führt zur Aktivierung von Gedächtnisinhalten mit einer ähnlichen emotionalen Qualität.
Ebenso werden unsere sozialen Beziehungen durch unsere Gefühle geprägt. Wer beispielsweise kaum in der Lage ist, seine Gefühle auszudrücken, und nur schlecht eine emotionale Resonanz mit anderen Menschen aufbauen kann, wird weniger enge soziale Bindungen haben, da soziale Beziehungen maßgeblich durch unsere Emotionen entstehen und gefestigt werden.
Wir sehen, dass wir es eigentlich immer mit Gefühlen zu tun haben, sobald wir mit einem Menschen kommunizieren, und jeder von uns ist zwangsläufig mit seinen Gefühlen beschäftigt, sobald er eine Handlung plant, Ziele reflektiert, Zusammenarbeit gestaltet, Beziehungen aufbaut und kultiviert, Entscheidungen trifft etc. Dass es bei all dem maßgeblich um unsere Gefühle geht, ist uns meistens gar nicht bewusst. Das ist den Gefühlen aber egal, sie wirken trotzdem!
Gefühlszusammenhänge bei einigen psychischen Erkrankungen
Menschen in schweren depressiven Krisen sind angenehme Empfindungen nicht mehr zugänglich. Emotionen wie etwa Freude, Zufriedenheit oder Dankbarkeit können nicht mehr empfunden werden. In der Folge reduziert sich die Handlungsmotivation fast gegen null. Im Extremfall verlässt eine Klientin dann das Bett nur noch, um ihren körperlichen Grundbedürfnissen nachzugehen, lässt sich aber ansonsten zu keiner weiteren Handlung bewegen. Da angenehme Empfindungen nicht mehr erfahren werden können und demnach nicht mehr als Belohnung dienen, werden Handlungen bedeutungslos.
Der Zusammenhang von Gefühlen und Erinnerungen zeigt sich sehr eindrücklich bei Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Erinnerungen, die mit starken Gefühlen verbunden sind, meistens mit Angst, drängen sich immer wieder ins Bewusstseinsfeld.
Bei psychotischen Störungen ist die soziale Wahrnehmung vielfach beeinträchtigt und in der Folge wird Scham nicht mehr wahrgenommen. Betroffene missachten dann soziale Regeln und stellen sich häufig selbst außerhalb der Gemeinschaft, was wiederum längerfristig negative Folgen für sie hat.