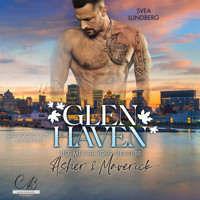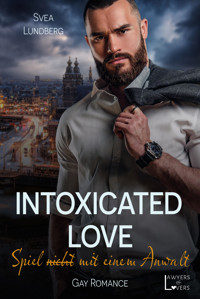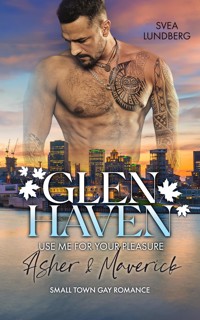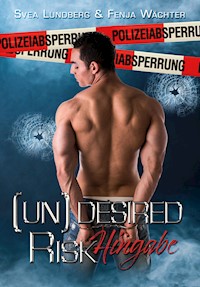
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verstoßen von seiner Familie arbeitet Jascha hart daran, sich ein Leben in Deutschland aufzubauen. Doch noch immer wagt er es nicht, seine tiefsten Begierden frei auszuleben. Im Club Men’s Cage bleibt er stets nur Zuschauer und den Dom anzusprechen, der es ihm besonders angetan hat, würde er nie wagen. Aber dann steht ausgerechnet dieser Mann plötzlich vor ihm – als leitender Ermittler im Tötungsdelikt an Jaschas Schwester. Der einzigen Familie, die ihm noch geblieben war. Maël hat alles, was er will: seinen Job als Kriminaloberkommissar, in dem er aufgeht, eine Familie, die zusammenhält, und heiße Stunden im Men’s Cage. Was er nicht gebrauchen kann, ist ein Zeuge, der ihm in die Ermittlungen pfuscht und noch dazu sein Privatleben durcheinanderbringt. Nicht nur, dass Jascha ihm etwas über die Tote zu verschweigen scheint, dieser Kerl weckt mit seiner widerspenstigen Art den Wunsch in Maël, ihn zu maßregeln – nur um ihn anschließend schützend an sich zu ziehen. Mit jeder Begegnung drohen sich Berufliches und Privates zunehmend mehr zu vermischen. Eine Verbindung, die letztlich auch Jascha ins Visier des Täters bringt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
(Un)desired Risk
Hingabe
Ein Roman von
Fenja Wächter & Svea Lundberg
Impressum
Copyright © 2022 Fenja Wächter & Svea Lundberg
Fenja Wächter
Kinsheck 7
55450 Langenlonsheim
www.fenjawaechter.de
Julia Fränkle-Cholewa (Svea Lundberg)
Zwerchweg 54
75305 Neuenbürg
www.svealundberg.net
Covergestaltung: Fenja Wächter
www.fenjawaechter.de
Bildrechte:
© theartofphoto – stock.adobe.com © zimmytws – stock.adobe.com
© Jörg Lantelme – stock.adobe.com
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte sind vorbehalten.
Die in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Der Inhalt des Romans sagt nichts über die sexuelle Orientierung des Covermodels aus.
Inhalt
Verstoßen von seiner Familie arbeitet Jascha hart daran, sich ein Leben in Deutschland aufzubauen. Doch noch immer wagt er es nicht, seine tiefsten Begierden frei auszuleben. Im Club Men’s Cage bleibt er stets nur Zuschauer und den Dom anzusprechen, der es ihm besonders angetan hat, würde er nie wagen. Aber dann steht ausgerechnet dieser Mann plötzlich vor ihm – als leitender Ermittler im Tötungsdelikt an Jaschas Schwester. Der einzigen Familie, die ihm noch geblieben war.
Maël hat alles, was er will: seinen Job als Kriminaloberkommissar, in dem er aufgeht, eine Familie, die zusammenhält, und heiße Stunden im Men’s Cage. Was er nicht gebrauchen kann, ist ein Zeuge, der ihm in die Ermittlungen pfuscht und noch dazu sein Privatleben durcheinanderbringt. Nicht nur, dass Jascha ihm etwas über die Tote zu verschweigen scheint, dieser Kerl weckt mit seiner widerspenstigen Art den Wunsch in Maël, ihn zu maßregeln – nur um ihn anschließend schützend an sich zu ziehen. Mit jeder Begegnung drohen sich Berufliches und Privates zunehmend mehr zu vermischen. Eine Verbindung, die letztlich auch Jascha ins Visier des Täters bringt …
Vorwort mit Content Notes
Mitreißender Romantic Thrill mit eigenwilligen Charakteren und gefühlvolle Romance mit realistischer Polizeiarbeit – das passt doch gut zusammen!
Nachdem wir monatelang mit der Idee eines gemeinsamen Romanprojekts gespielt haben, war es 2021 endlich so weit. Aus vagen Fantasien wurde in wochenlanger Arbeit ein ausgereifter Plot und schließlich kamen die ersten Wörter aufs Papier. »Projekt FEEA« (kurz für Fenja und Svea) war geboren!
Heute sind wir glücklich, Jascha & Maël in die weite Buchwelt entlassen zu können und hoffen, ihr habt spannende und auch heiße Lesestunden mit den beiden. Bevor ihr startet, möchten wir euch noch auf die Content Notes hinweisen. Dieser Roman beinhaltet u.a. folgende Themen: körperliche Gewalt, Tod/Mord, (verbale) Queerfeindlichkeit und (verbalen) Antislawismus.
Prolog
Frühjahr
~~~ Jakow ~~~
Normalerweise beruhigte mich das Summen der U-Bahn. Doch genau jetzt machte es mich wahnsinnig!
Ich stand bereits vor der Tür und warf schon wieder einen Blick auf mein Handy, obwohl ich das erst vor einer Minute getan hatte. Keine weiteren Nachrichten von Linus. Wenn ich also Glück hatte, war mein namenloser Schwarm noch in seiner Session und falls nicht … tja, dann hatte ich wohl umsonst mein T-Shirt gegen ein Hemd mit Sakko getauscht und meine Pizza auf dem Esstisch stehen gelassen. Aber das Risiko war es definitiv wert, wenn ich schon mal zu Hause in Filderstadt und nicht auf Dienstreise war. Dabei war meine Arbeit noch nicht einmal die einzige unvorhersehbare Variable. Denn der Kerl hatte keine festen Tage im Club, nach denen ich mich irgendwie hätte richten können. Also blieb mir nichts anderes übrig, als saumäßiges Glück zu haben oder mich extrem zu sputen, wenn Linus mir schrieb.
Die Lichter der Haltestelle Stuttgart Charlottenplatz erschienen und ich warf noch einen letzten Blick auf mein Handy, ehe ich es ausschaltete und in die Tasche meiner Jeans steckte. Handys waren im Men’s Cage ein No-Go, an das ich mich tunlichst hielt. Dafür war mir die Mitgliedschaft zu heilig.
Kaum dass sich die Türen öffneten, sprang ich raus und rannte los. Immerhin war die Anzahl an Passanten um kurz vor einundzwanzig Uhr mitten in der Woche überschaubar. Das verringerte die Gefahr, irgendjemanden in der Unterführung über den Haufen zu laufen. Vollkommen außer Atem kam ich am Club auf der anderen Seite des Charlottenplatzes an und joggte noch die paar Stufen zur Tür hinauf. Dabei stellte ich mal wieder fest, dass die knöchelhohen Boots superbequem waren, solange ich ging. Zum Laufen eigneten sie sich definitiv nicht. Ich schnitt eine Grimasse und blieb vor Dirk, dem Türsteher des Clubs, stehen.
»Na«, begrüßte ich ihn, stemmte die Hände in die Hüften und schnaufte erst einmal durch.
Dirk war ein großer, bulliger Kerl, mit dem man sich lieber nicht anlegte. Wie üblich krauste er die Stirn, schnaubte dann belustigt und öffnete mir die Tür. »Na, da hat es aber einer eilig.«
»Du hast ja keine Ahnung«, erwiderte ich und klopfte ihm im Vorbeigehen auf die Schulter.
Das war definitiv kein Umgang, den er normalerweise mit Mitgliedern pflegte, aber wir hatten uns schließlich schon vor sechs Jahren als Kollegen kennengelernt und waren seitdem befreundet.
In einem großzügig bemessenen Windfang hängte ich meinen Mantel an die Garderobe und schloss meine Wertsachen in einem Spind ein. Noch einmal atmete ich tief durch, ehe ich den vorderen Teil des Clubs betrat.
Ganz automatisch hielt ich als Erstes nach Linus Ausschau. Natürlich stand er hinterm Tresen und reichte gerade einem drahtigen Kerl in Lederhose und Harness einen Drink. Unwillkürlich wanderte mein Blick zu dem Sub, der ergeben neben seinem Dom auf dem Boden kniete und mir damit einmal mehr vor Augen führte, dass ich hier eigentlich nicht hingehörte. Allein die Vorstellung, mit meiner freiwilligen Unterordnung könnte wieder die Gefahr von Herabwürdigung einhergehen, ließ mich mitten im Raum erstarren. Ich war und blieb ein beschissener Sub … okay, und gäbe einen noch viel mieseren Dom ab. Bei dem Gedanken schaute ich unweigerlich zu Linus, der mir nicht selten hinhielt, damit ich meinen Frust loswurde. Er mochte das. Sagte er und vermutlich tat er das auch wirklich. Warum sollte er mir sonst Bescheid geben, wenn mein heimlicher Schwarm, dessen Namen er mir aus Gründen der Verschwiegenheit nicht verriet, eine Session hatte?
Linus schenkte mir ein feines, aber dennoch warmes Lächeln, das trotzdem noch als professionell durchging, und ein knappes Kopfnicken. Ich seufzte. Wir beide wussten, worauf es in der nächsten halben Stunde hinauslaufen würde: einen harten Fick im Lager. Doch dafür musste ich mir erst einmal meine Portion Frust abholen gehen, damit ich Linus nicht ›zu sanft‹ war.
Ich verließ den Barbereich, vorbei an den Umkleiden samt Duschen, hin zu den öffentlichen Zimmern, zu denen es der Dom und sein Sub von zuvor nicht mehr geschafft hatten. Der Sub stand vornübergebeugt, stützte sich mit der linken Hand an der Wand ab, und hielt in der anderen den Drink, darauf bedacht nichts davon zu verschütten, während der drahtige Kerl ihn fickte. Grundsätzlich sah ich gern dabei zu, ansonsten wäre ich kein Mitglied in diesem Club. Doch oft wurde ich das Gefühl nicht los, dass die Sessions nicht auf Augenhöhe stattfanden. Die beiden Doms, die sich in einem der ersten Zimmer an einem Sub bedienten, der in seiner Fesselung stöhnte und bebte, waren ein gutes Beispiel dafür. Linus würde es lieben. Ich dagegen hasste es, so zur Schau gestellt zu werden und mich wie ein Objekt zu fühlen, das lediglich der Befriedigung von irgendwelchen Kerlen diente, die diese Hingabe überhaupt nicht verdient hatten. Womöglich bildete ich es mir auch nur ein und es war eher ein persönliches Ding von mir. Immerhin war ich in meiner ersten und einzigen Beziehung – oder Nicht-Beziehung, wie man es nahm – ausschließlich ein Stück Fleisch gewesen, das Ruvim benutzt hatte. Ausnahmslos. Und auf eine verquere Weise passte das sogar zu dem, was mich anmachte. Ich wollte mich durchaus einem anderen Mann unterwerfen und annehmen, was auch immer er mir gab. Ganz gleich, ob das Schmerzen, Lust oder Demütigungen waren. Was ich nicht wollte, war, mich danach wie der letzte Dreck zu fühlen, der besudelt liegen gelassen wurde.
Zum Glück gab es noch so Kerle wie ihn! Ich musste ihn überhaupt nicht sehen, um zu wissen, in welchem Raum er seine Session hielt. Zwei Zuschauer standen bereits davor auf dem Gang. Die wenigsten traten bei ihm ein, denn irgendwie bekam er es hin, eine solch geschützte Atmosphäre zu schaffen, in der man sich zwangsläufig als Fremdkörper oder mindestens fehl am Platz fühlte.
Mit einer kribbeligen Aufregung im Bauch spähte ich, mit gebührendem Abstand zu den beiden anderen Zuschauern, zu ihm. Witzigerweise waren mir bei meiner ersten Begegnung mit ihm zuerst seine Haare aufgefallen. Wie üblich kräuselten sich seine dunklen Locken, was ich für einen Dom unheimlich sympathisch und ja, gut, zugegeben auch irgendwie süß fand. Sagen würde ich ihm das im Leben nicht. Aber für mich sprach es von Charakter, dass er sich gab, wie er war, und nicht versuchte, seine Haare mit Tuben an Gel in irgendeine Form zu bringen – die so vermutlich ohnehin nicht halten würde.
Lustig machte sich über den sicherlich niemand. Es war schon die Art, wie er seinen Sub ansah. Dieser durchdringende und konzentrierte Blick, der sich für mich nach Ruhe und Tiefe anfühlte, die ich gern ergründen würde und vor der ich mich gleichzeitig fürchtete. Jemand wie er würde mir niemals eine Chance geben und der Versuch für mich die hässliche Narbe auf meiner Seele nur noch schwulstiger werden lassen.
Unwillkürlich fröstelte ich bei den Gedanken. Ich mochte seine auffallend hellen Augen wirklich sehr. Dagegen waren die schmale Nase und die feinen, von einem dunklen Dreitagebart eingerahmten Lippen schon gar nicht erwähnenswert, gaben aber ein unheimlich ansprechendes Gesamtbild ab. Doch ich würde ihm niemals näher kommen als das hier und vielleicht war es besser, wenn ich meiner Angewohnheit treu blieb und Reißaus nahm, sobald er vorne in der Bar auftauchte. Da konnte mich Linus noch so sehr damit aufziehen, dass ich nur Schiss vor einem Gespräch mit ihm hatte.
Anschmachten konnte ich den ewig Unbekannten dennoch. Seinen trainierten, aber nicht protzig wirkenden Körper … zu dem ich allein optisch schon nicht passte. Das war mir bereits zuvor klar gewesen, als Ruvim mich immer seltener angerührt hatte. Mit dem regelmäßigen Laufen und ein klein wenig Krafttraining hatte ich trotzdem nicht aufgehört. Dafür hatte es sich zu gut angefühlt, für einen Moment frei zu sein. Das änderte jedoch nichts an der simplen Wahrheit: Ich war nicht der typische Sub wie der junge Mann, der auf allen vieren vor ihm auf einem Podest kniete und den Kopf leicht gesenkt hielt. Der war einfach nur schön, anders konnte man es nicht sagen, und besaß im Gegensatz zu mir definitiv einen Körper samt Ausstrahlung, die förmlich ›Sub‹ schrie.
Der hübsche Mann war nicht fixiert, sondern hielt selbst seine Position. Er könnte jederzeitig aufstehen und gehen, wenn er das wollte … Lediglich ein ringförmiger Knebel hielt seinen Mund offen, aus dem ihm Speichel rann und von seinem Kinn hinab tropfte. Zum Einsatz war sein Mund sicherlich auch schon gekommen. Zumindest wenn es nach meiner Fantasie ging. Denn der Dom hatte zwar sein bestes Stück wieder in seine Lederhose gepackt, aber diese war offen und die beiden waren immerhin schon vierzig Minuten zu Gange.
Bozhe moy, was für eine Vorstellung! Wie der Dom seine Finger in die Haare des jungen Mannes gegraben und den Kopf hochgezogen hatte, um ihn in den Mund zu ficken. Ich hatte es schon einmal bei den beiden gesehen. Es war geil gewesen. Diese Kontrolle und Hingabe … und nichts, was ich selbst konnte. Die beiden jedoch harmonierten perfekt zusammen und nicht zum ersten Mal fragte ich mich, ob sie nicht auch ein Paar waren. Aber würden sie sich dann nicht wenigstens einmal küssen? Das hatte ich tatsächlich noch nie bei ihnen erlebt, was wohl eher gegen meine Beziehungstheorie sprach. Nicht, dass ich Ahnung davon hatte, was normale Partner taten … oder eben auch nicht.
Die Gerte sauste durch die Luft, traf klatschend auf nackte und bereits gerötete Pobacken oder auf die Oberschenkel. Immer wieder variierte der Dom seine Schläge. Mal eine kurze, rasche Abfolge, mal länger und fester. Der Sub zuckte nicht, aber seine Muskeln bebten vor Anspannung. Ich bewunderte ihn für die Beherrschung, die er noch immer aufbrachte. Lediglich seine Atmung wurde sichtlich schneller und vereinzelt stieß er nun doch erstickte Laute hervor, was aber genauso gut seiner Erregung geschuldet sein konnte. Denn sein Schwanz sah knüppelhart aus und erinnerte mich auch wieder an das lustvolle Pochen in meinem Schritt. Aber irgendwie kam ich mir im Vergleich zu ihm erbärmlich vor, wenn ich mir jetzt in irgendeiner Form Abhilfe verschaffte.
Noch während ein Schlag niedersauste, streckte der Dom seine freie Hand aus, streichelte so unsagbar sanft über den Rücken seines Subs, der unter der Berührung sichtlich schauderte. Der Dom zögerte. Nur ganz kurz und so minimal, dass es genauso gut Wunschdenken von mir hätte sein können. Aber ich mochte diese Momente, weil sie ihn so echt wirken ließen. Wenn er ursprünglich etwas anderes geplant hatte und sich dann doch umentschied. So interpretierte ich es zumindest.
Er legte die Gerte zur Seite, streichelte seinem Sub stattdessen ausgiebig über die geschundene Haut. Mal mit den Fingerspitzen und sicherlich auch mit den Nägeln, mal mit den Handflächen. Der Sub vor ihm zeigte keine Reaktion, aber ich bekam allein schon von dem Anblick eine Gänsehaut.
Wie gern ich doch an seiner Stelle wäre, es aber nie sein würde, weil ich das nicht konnte. Nicht wenige Doms würden nun wohl behaupten, dass das alles eine Frage der richtigen Erziehung sei. Doch allein das Wort ging bereits gegen mich. Ich wollte nicht verbogen werden, ich wollte einfach … ein anderer Mensch sein. Wie jedes Mal, wenn diese Erkenntnis in mir hochkam, sackten meine viel zu breiten Schultern nach unten. Warum konnte ich nicht mehr dem Idealbild eines Subs entsprechen? Nicht nur optisch, sondern vor allem überhaupt erst in der Lage zu sein und noch einmal den Mut aufzubringen, mich in die Hände eines anderen zu begeben. Nach Ruvim hatte ich es ein einziges Mal versucht und selbst jetzt, nach knapp fünf Jahren, fragte ich mich immer noch, ob es nicht die kleinere Katastrophe gewesen wäre, wenn ich es einfach ertragen hätte, anstatt mich zu wehren. Die körperliche Auseinandersetzung hatte ich zwar gewonnen, aber die Sätze wurde ich nicht mehr los: Alter, was bist du denn für ein Scheißsub? Hätte ich mir bei einem dreckigen Russen aber auch gleich denken können!
»Glaubst du, du hast es dir verdient, kommen zu dürfen? Antworte«, forderte der Dom rau. Seine Stimme durchdrang mich so intensiv wie jedes Mal und führte mich ins Hier und Jetzt zurück, in dem es keine Lösung für mich gab.
Alles in mir zog sich zusammen und ich musste mich abwenden und gehen. Glück für Linus, denn Frust für einen harten Fick hatte ›der russische Scheißsub‹ jetzt definitiv genug.
Kapitel 1
Herbst – rund sechs Monate später
SONNTAG
~~~ Maël ~~~
Finger legten sich um meine Kehle, drückten zu. Für den Bruchteil einer Sekunde meinte ich, so etwas wie ureigene Furcht durch meinen Körper rauschen zu spüren, doch ich war zu fokussiert, als dass Adrenalin die Beherrschung über meine Bewegungen hätte übernehmen können. Noch während mein Gegner die Finger seitlich gegen meinen Hals presste, umschloss ich mit der Linken sein Handgelenk. Ich zwang seinen Arm mit einem Federn in die Knie nach unten, brachte so ein wenig mehr Abstand zwischen unsere Körper. In derselben Bewegung stieß ich ihm meinen rechten Handballen unters Kinn, nutzte seinen Vorwärtsimpuls, um seinen Kopf nach hinten zu zwingen. Nicht ganz so weit, wie ich es in einem echten Kampf im Zweifelsfall getan hätte. Den winzigen Moment, in dem sich sein beidhändiger Griff um meine Kehle und meinen Nacken lockerte, federte ich noch weiter in die Knie. Hieb meinen Ellbogen gerade mit so viel Kraft in seine Armbeuge, dass sich seine Finger weiter öffneten. Luft strömte ungehindert in meine Lunge, während meinem Gegner ein kurzes Keuchen entwich. Herausgetrieben von meinem festen Griff um sein Handgelenk und schließlich meinem Knie, das ich in der Drehbewegung meines Körpers hochzog und in seinen Magen stieß, ihn so vollends von mir schob. Ein Ausfallschritt nach hinten, die Hände locker zu Fäusten geballt vor mir erhoben verharrte ich. Mein Gegner ebenso. Für einen langen Moment hielten wir unsere Positionen, darauf bedacht, sofort wieder Ruhe in unsere Atmung zu bringen.
Erst als ich das Gefühl hatte, meine Balance gänzlich wiedergefunden zu haben, löste ich die Endstellung. Mein Gegner – Ilyas, mein Trainingspartner und Kumpel – tat es mir gleich, ein Grinsen erschien um seinen Mund.
»Die zwei Wochen Trainingspause haben dir offenbar nicht geschadet.«
Ich bezweifelte, dass er tatsächlich befürchtet hatte, es könnte so sein. Vielmehr fasste ich seine Worte als Neckerei auf und schmunzelte ebenfalls.
»War das dein Plan? Mich beim ersten Training zu erwürgen?«
»Ah, dich einmal bewusstlos auf die Matte zu schicken, hätte mir schon gereicht.« Aus seiner Stimme klang deutlich, dass er es nicht ernst meinte. Daher kommentierte ich seine Fantasien lediglich mit einem gutmütigen Schnauben. Es war nicht gerade so, als wäre es noch nie vorgekommen, dass mir jemand beim Jiu Jitsu kurzfristig die Lämpchen ausknipste – ungewollt, aber nicht minder eindrucksvoll. Ich erinnerte mich noch ziemlich gut daran, einmal nach einem zu unkontrollierten Würgegriff benommen auf der Matte wieder zu mir gekommen zu sein. Die besorgten Gesichter meines damaligen Trainers und diverser anderer Leute direkt über mir. Aber das war Jahre her. Noch mal erleben musste ich es definitiv nicht. Mal abgesehen von den Risiken war das Gefühl, nicht mehr frei atmen zu können, absolut nichts, was ich als erstrebenswert für mich selbst erachtete. Das Gefühl jedoch, wenn ein anderer Mann, der einen Reiz darin fand, die Kontrolle über seine Atmung abzugeben …
»Genug für heute?«
Rasch richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder auf Ilyas. Wenn meine Gedanken noch während einer Trainingseinheit in diese Richtung abdrifteten, war ich eindeutig weniger fokussiert, als ich es hätte sein sollen. Schuld daran waren aber sicher nicht meine zwei Wochen Urlaub und die damit einhergehende Trainingspause.
»Ja.« Nahezu zeitgleich mit Ilyas hockte ich mich in den Kniesitz ab. In der Zeisa-Position nahmen wir uns die notwendige Zeit, noch einmal in unsere Mitte einzukehren, uns wortlos beieinander für die respektvolle Trainingseinheit zu bedanken.
Ilyas nickte mir noch einmal zu, ehe er sich in Richtung der Meditationsecke zurückzog. Ich selbst verließ die Matte und ging hinüber zu den Umkleideräumen. Zu Hause warteten noch ein unausgepackter Koffer und jede Menge Schmutzwäsche auf mich.
Zur Würdigung meines letzten Urlaubstages und auch ein wenig, weil mein Kühlschrank aufgrund meiner fast zweiwöchigen Abwesenheit ziemlich leer war, bemühte ich am Abend das Sushi-Restaurant meines Vertrauens. Ich war ernsthaft versucht, mir dazu eine Flasche Weißwein zu öffnen, blieb dann aber doch bei Wasser. Am kommenden Morgen würde ich mich erfahrungsgemäß erst mal durch sämtliche Berichte der Kriminalinspektion 1 lesen, um auf den neusten Stand zu kommen, was in den letzten vierzehn Tagen so in unserem Zuständigkeitsbereich los gewesen war. Da konnte ich beim besten Willen keinen pochenden Schädel gebrauchen.
Die nackten Füße bequem auf den wuchtigen Couchtisch mit den schwarzen Eisenrädern hochgelegt, schob ich mir gerade das erste Hoso-Maki-Röllchen in den Mund, als neben mir auf dem Sofa mein Smartphone vibrierte. Demonstrativ schloss ich die Augen, ließ mir den würzig feinen Geschmack von Sake, Avocado und Sesam auf der Zunge zergehen. Indessen verkündete das Handy mit wiederholtem Summen den Eingang mehrerer Nachrichten. Erst nach ausgiebigem Kauen griff ich neben mich.
Auf dem Display war lediglich die erste Nachricht zu lesen: OMG OMG OMG!!!!!
Wow, Abkürzungen und Satzzeichen im Rudel – sehr aufschlussreich. Auch wenn ich ahnte – und hoffte – worauf sich dieser Ausbruch höchst eloquenter Redeführung meines Bruders bezog, hätte ich mir doch ein wenig mehr Details gewünscht. Die bekam ich allerdings, als ich mich in unseren WhatsApp-Verlauf klickte.
OMG OMG OMG!!!
Ela disse sim!
Sie hat JA gesagt!!!
Ich hab’s wirklich getan! Und sie hat JAAA gesagt!
Jaaaaa!!!!!!
Dem folgte noch eine unüberschaubare Anzahl an Emojis mit Herzchen-Augen.
Grinsend über Joãos schriftlichen Freudentaumel schüttelte ich den Kopf und stellte die Sushi-Box auf dem Tisch ab, zog einen Fuß aufs Sofa hoch. Kühles Leder – wenn auch nur künstliches – auf nackter Haut. Es war nur ein Sofa, aber Gott, ich liebte dieses Teil. Wenn auch sicherlich auf andere Weise und nicht halb so sehr, wie mein kleiner Bruder seine Freundin – Verzeihung, Verlobte – liebte.
Já não era sem tempo – wurde aber auch Zeit, schrieb ich ihm zunächst statt Glückwünschen zurück, und es stimmte. Hätte er es nicht spätestens im Laufe der kommenden Woche geschafft, Lia endlich diesen verdammten Antrag zu machen, wäre ich noch mal nach Lissabon geflogen, nur um ihm eigenhändig die Löffel langzuziehen. Ich verbrachte doch nicht gefühlte fünfzig Prozent meines Urlaubs in meiner Zweitheimat damit, ihm Mut zuzureden, nur damit er sich dann doch wieder nicht traute, ihr die für ihn so allesentscheidende Frage zu stellen. Ja, João bedeutete diese nun bevorstehende Hochzeit wirklich alles.
Ich freu mich für dich, Irmão. Und für Lia.
Noch während ich meine Antwort tippte, verriet die Anzeige am oberen Displayrand, dass João ebenfalls schrieb. Seine Nachricht trudelte nur Sekunden, nachdem ich meine abgeschickt hatte, ein.
Danke für deinen seelischen Beistand! Ich hatte so Schiss, dass sie Nein sagt.
Als ob Lia das getan hätte … Aufgrund der Distanz Deutschland-Portugal sah ich meinen jüngeren Bruder und seine nun Verlobte nur ein paar Mal im Jahr. Aber die beiden nur wenige Stunden miteinander zu erleben reichte aus, um zu wissen, dass das zwischen ihnen so was wie die perfekte, kitschige Lovestory war. João und Lia waren wie Topf und Deckel, wie Arsch auf Eimer, wie … all das, was meine bisherigen Partner ...
Jetzt müssen wir nur noch dich endlich unter die Haube bringen.
Mir entwich ein Schnaufen, halb amüsiert und halb genervt und vielleicht – ganz eventuell – auch ein bisschen wehmütig. Es war nun wirklich nicht so, dass ich verzweifelt auf der Suche nach einem festen Partner war oder mir einsam vorkam. Ich konnte gut allein sein, mit mir selbst im Reinen die Stille genießen, und ich liebte die Freiheit, genau dann unter Menschen zu gehen und körperliche Nähe zu suchen, wenn ich es wollte. Ich hatte weiß Gott nicht das Gefühl, dass mir mit meinen sechsunddreißig die Zeit ablief. Nichtsdestotrotz waren rein körperliche Beziehungen nicht das, was mich wirklich erfüllte. Was ich eigentlich wollte, war mehr als nur die Stunden im Men’s Cage. Mehr als gemeinsam geteilte Lust. Allerdings war bislang keine Beziehung von einer solch emotionalen Intensität gewesen, als dass sie länger als maximal ein Jahr gehalten hätte.
Mach dir um mich mal keine Sorgen, Irmão. Grüß Lia und habt noch einen schönen Abend.
So unsicher João auch hinsichtlich des Antrags gewesen war, er wäre nicht er gewesen, hätte er nicht noch einen Konter zurückgeschickt. Ich mache mir keine Sorgen, nur Gedanken. Und hör auf, mich ›Brüderchen‹ zu nennen. :-P Und danke!
Die erste Hälfte seiner Nachricht ließ ich unkommentiert. Gern geschehen, ich freu mich wirklich für euch!, schrieb ich zurück und konnte es mir doch nicht verkneifen, erneut den portugiesischen Kosenamen und ein Kuss-Emoji anzuhängen. Kaum hatte ich die Nachricht verschickt, summte mein Smartphone erneut. Keine Nachricht allerdings von João, der tippte noch.
Ich wartete seine Entgegnung ab, schob mir indessen ein Sushi-Röllchen in den Mund. Ein weiteres folgte, während mein Bruder und ich uns verabschiedeten. Noch immer kauend tippte ich auf dem Display herum, wechselte den Chat.
Hey, na, heil aus dem Urlaub zurück? Bleibt es bei morgen 19 Uhr?
Dass Simon nachfragte, konnte ich ihm keinesfalls verübeln. Zwar hatte ich noch nie eines unserer geplanten Treffen erklärungslos platzen lassen, aber da wir uns nur in unregelmäßigen Abständen verabredeten und mein Terminplan dank meiner Arbeit nicht gerade der zuverlässigste war, war es kein Wunder, dass er sich rückversicherte.
Hi! Ja und ja. :-)
Ich setzte mich im Schneidersitz bequem zurecht und zog die Sushi-Box zurück auf meinen Schoß. Es dauerte einen Moment, ehe mir die Statusleiste verriet, dass Simon wieder online ging.
Schön. :-)
Er schrieb noch etwas und ich war mir auf gewisse Weise sicher, dass sich der Ton in seiner nächsten Nachricht ändern würde.
Haben Sie Anweisungen für mich, Sir?
Schmunzelnd leckte ich mir ein wenig Sojasoße vom Finger, ehe ich beidhändig zu tippen begann. Eigentlich hatte ich Simon ganz entspannt an der Bar des Clubs treffen und dann mit ihm gemeinsam in eines der Spielzimmer gehen wollen. Einfach weil ich diese zwanglosen Minuten vor einer Session gern nutzte, um sicherzustellen, dass mein Sub wirklich in guter Verfassung war. Andererseits war Simon erfahren und wir hatten oft genug miteinander gespielt, sodass ich darauf vertrauen konnte, es ihm notfalls auch anzumerken, sollte er nicht bereit sein, sobald ich das Spielzimmer betrat.
Sei kurz vor 19 Uhr im Club und geh in den Roten Raum. Leg dort die Bullwhip bereit. Ich werde Punkt sieben zu dir kommen. Du wirst vor dem Andreaskreuz knien, Rücken zur Tür. Komplett nackt. Mit hartem Schwanz.
Wohl wissend, dass er nicht viel würde tun müssen, um erregt zu sein, bis ich zu ihm kam. So, wie ich Simon kannte, würde die Erwartung auf das gnadenlose Beißen der Bullwhip ausreichen, um ihn heiß zu machen.
Faszinierend eigentlich, dass Sushi doppelt so gut schmeckte, wenn man sich dabei vorstellte, wie der Sub, den man am kommenden Tag quälen und verwöhnen würde, zu Hause auf seinem Sofa hockte. Sich in den Schritt griff, weil sich dort beim Lesen dieser Worte ein Kribbeln ausbreitete. Mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung hatte, ob Simon gerade überhaupt zu Hause war, geschweige denn, wie sein Sofa aussah. Vielleicht besaß er nicht mal eins. Ich kannte seine Wohnung nicht, wir hatten uns nur ein einziges Mal außerhalb des Clubs getroffen. In einem Café. Um festzustellen, dass wir zwar bei Sessions, aber wohl nicht darüber hinaus als Paar funktionieren würden. Dafür war Simon auch im Privaten zu devot. Zu gehorsam. Was nicht heißen sollte, dass er kein toller Mann war. Nur eben nicht der Mann für mich.
Verstanden, Sir. Möchten Sie, dass ich einen Plug trage?
Dieses Mal fiel meine Antwort knapp aus. Nein. Keine Vorbereitung. Ob ich damit meinte, dass ich ihn morgen gar nicht ficken würde oder nur, dass ich seinen Arsch so eng wie möglich wollte, ließ ich bewusst unausgesprochen. Auch, weil ich mir selbst jegliche Option offenlassen wollte.
Ja, Sir.
Mein Daumen schwebte schon über dem Tastenfeld. Der Gentleman in mir wollte Simon noch einen schönen Abend wünschen oder sonst irgendetwas zur Verabschiedung sagen. Der Dom in mir jedoch wusste, dass Simon sich etwas anderes wünschte: diesen Hauch eines Machtgefälles auch außerhalb des Clubs. Vielleicht sogar 24/7. Einer der Gründe, weswegen er und ich nicht dauerhaft als Paar funktionieren würden. Mal abgesehen davon, dass die tiefen Gefühle einfach fehlten.
Ich schloss die App ohne ein weiteres Wort, ließ ihn in den Fantasien zum morgigen Abend zurück. Das Handy ließ ich neben mich aufs Sofa fallen und zog mein Wasserglas zu mir heran. Eine Box voll Sushi, Vorfreude auf eine Session mit einem äußerst gehorsamen Sub und ein kleiner Bruder, der es endlich zur Verlobung geschafft hatte – vielleicht hätte ich mir doch einen Wein genehmigen sollen. Blieb nur zu hoffen, dass der morgige Arbeitstag so angenehm beginnen würde, wie mein letzter Urlaubstag endete.
Ich grinste schief in mein Wasserglas.
Würde der Tag sicher nicht. Das taten Tage bei der Kripo nie, wenn man heimlich darum bat.
~~~ Jakow ~~~
Auf dem letzten Stück der Autostrada 4 nach Triest hatte man bereits eine wundervolle Aussicht auf das Adriatische Meer. Ich mochte Italien – die atemberaubende Landschaft und das leckere Essen – und vor allem den Umstand, dass unser Kunde die von mir entwickelten Handfeuerwaffen wirklich schätzte. Als Ingenieur für Waffentechnik war ich es gewohnt, skeptisch beäugt zu werden. Nicht so von Herrn Marino.
»Alter, du hast ihm echt einen geblasen?«, entfuhr es Gina, die eigentlich Nina hieß, den Namen jedoch nach eigener Aussage ›zu lame‹ fand.
Normalerweise fuhr ich gern bei ihr mit, weil sie im Gegensatz zu den anderen unseres Teams keine Alleinunterhalter beim Fahren mochte und ich die Zeit gern nutzte, um Skizzen für handgefertigte Unikate oder für spezielle Auftragsarbeiten zu erstellen. Normalerweise …
»Da«, erwiderte ich. Das Russische ›Ja‹ und ›Nein‹ wurde ich einfach nicht los und wollte das ehrlich gesagt auch gar nicht. Es erinnerte mich immer ein Stück weit an Heimat, die ich verloren hatte. Mit einem Seufzen riss ich mich vom Anblick des Meeres los und sah Gina an. »Ja, hab ich.«
Wenn ich es recht bedachte, passte ihr Geburtsname tatsächlich nicht zu ihr, weil er selbst in meinen Ohren zu ›zahm‹ für sie klang. Für eine Frau war sie sehr muskulös, hatte aber nach wie vor ihre weiblichen Reize. Solange die beorderte Waffenlieferung noch nicht abgeschlossen war, trug sie ihre lange blonde Mähne zu einem strengen Zopf zurückgebunden, doch das änderte sich, sobald wir Feierabend hatten. Da wurde aus der durchaus knapp angebundenen und hochkonzentrierten Frau eine lebenslustige und draufgängerische Jägerin, deren Beute Männer waren. Meistens zumindest.
Gina schüttelte immer wieder ihren Kopf. Keine Ahnung, ob ihre Aufmerksamkeit gerade wirklich der Straße oder vielmehr dem gepanzerten Transporter vor uns galt, in dem ihr Freund Alex saß. Besagter Kerl, dem ich vor Jahren einen geblasen hatte, während sie es sich im Hotelzimmer nebenan von zwei Kerlen hatte besorgen lassen. Eifersucht konnte es also nicht sein. Die beiden führten, schon seit ich sie kannte, eine offene Beziehung. Etwas, womit ich überhaupt nicht klarkommen würde.
»Was genau stört dich daran?«, hakte ich trotzdem vorsichtig nach.
Sie sah mich an, lächelte dann gutmütig. »Ach, Jascha, du bist unser Küken.«
Wie ich es hasste, wenn sie mich so nannte. Klar war ich mit sechsundzwanzig der Jüngste im Team, aber das musste man mir echt nicht ständig unter die Nase reiben. Mal davon abgesehen, dass ich niemanden brauchte, der mich bemutterte.
»Jetzt schau nicht so.«
Toll, dass man mir das auch noch ansah.
»Gina, ehrlich, ich versteh’s nicht. Ihr vögelt fröhlich in der Gegend rum und ich bin alt genug. Hätte ich gewusst, dass du anfängst, ein Drama daraus zu machen, hätte ich meine Klappe gehalten. Und nebenbei, was auf einer Dienstreise passiert, bleibt auf der Dienstreise.« Die eiserne Regel unseres Teams, von der ich zum ersten Mal Gebrauch machte, worauf ich auch gut und gern hätte verzichten können.
»Darum geht es überhaupt nicht«, sagte sie prompt. »Klar kannst du ihm einen blasen, oder ihr was auch immer treiben, aber …«
Ließ sie mich jetzt echt nachhaken?
Sie warf mir wieder diesen mitleidigen ›auf dich muss man wirklich aufpassen‹ Blick zu. Das durfte nicht wahr sein.
»Aber?«
»Ich will nicht, dass er dich nur benutzt.«
Das hatte gesessen. Verbale Tiefschläge, bei denen einem flau im Bauch wurde, waren ohnehin härter als physische. Ich musste mich abwenden und raus aufs Meer schauen. Was auf einer Dienstreise geschah, blieb halt eben doch nicht nur dort. Zumindest nicht bei mir. Nicht immer. Denn genau jetzt erinnerte ich mich wieder viel zu deutlich an den Moment, in dem Alex mir die Ohren vollgejammert hatte, dass seine Eier bald platzen würden. Ich hatte mich lachend mit den Worten: »Das passiert bestimmt nicht«, abgewendet und er mich am Arm zurückgehalten. Im Spaß, aber doch energisch und fest. Genau so, wie ich eben angefasst werden wollte und er hatte das in dem Moment leider auch begriffen. Trotz Alkohol.
»Das ist es also, was du brauchst, ja?«, hatte er mir zugeraunt und ich ihn genauso leise herausgefordert: »Kannst du es mir denn geben?«
»Es war einvernehmlich«, sagte ich und spürte Alex’ Hände fest um meinen Hals und schwer auf meiner Schulter liegen und wie er mich vor sich auf die Knie zwang. Ein angenehmes Kribbeln erwachte in meinen Hoden. Nur, dass ich das gerade so überhaupt nicht gebrauchen konnte. »Außerdem hat er sich am nächsten Morgen tausend Mal entschuldigt und gesagt, dass es nie wieder vorkommen würde.«
Alex hatte echt ein richtig schlechtes Gewissen gehabt und manchmal war ich mir nicht sicher, ob es nicht immer noch da war.
»Das kann ich mir gut vorstellen.«
»Aha, warum?«
»Jascha, du bist nicht wie er oder ich. Du würdest nie mit jemandem schlafen, mit dem du nicht auf irgendeiner Art eine Vertrauensbasis hast. Oder hast du das jemals in dem Club getan, in dem du bist?«
Im ersten Moment stutzte ich, aber irgendwie ergab das doch Sinn. Ich war mit Ruvim zusammen aufgewachsen und natürlich hatte ich ihm vertraut und mit Linus war ich befreundet. Dagegen hatte ich Alex wie den Rest des Teams durch die Arbeit kennengelernt und durch unsere gemeinsamen Dienstreisen verbrachten wir viel Zeit miteinander. Eben auch privat. Ich wusste, dass ich mich auf Alex verlassen konnte. Er würde mich nie hängen lassen, ansonsten hätte ich mich nicht auf den Blowjob eingelassen. Eine Tatsache, die dann wohl auch Alex bewusst war, der mich bezüglich meiner sexuellen Vorlieben noch viel besser einschätzen konnte, als Gina ahnte. Und … O Mann! Was für ein beschissener Rattenschwanz da mit dranhing, der weit über Alex hinausging.
»Äh, ja … nein.« Ich seufzte, weil sie recht hatte. Der Club nährte lediglich meine Fantasien, die auszuleben ich mir verbot. Eigentlich gab es nur Linus, der mir nicht geben konnte, wonach ich mich wirklich sehnte. »Was ich brauche, ist ein Revolver.«
»Bitte, was?«
Ich hob meinen Skizzenblock hoch, auf dem ich einen Revolver skizziert hatte, zu dessen Umsetzung es nie kommen würde, weil das Unternehmen, in dem wir angestellt waren, diese nicht herstellte. Es war lediglich eine Träumerei von mir, entsprungen aus dem Wunsch nach etwas gänzlich anderem. »Sagen wir mal, Linus ist eine Wasserpistole und Alex ’ne Pistole, dann brauche ich einen Revolver. Etwas, das ganz anders ist.«
Sie schnitt eine Grimasse. »Das ist ein mieser Vergleich.«
»Wieso?«
»Weil’s den Revolver hier nicht geben wird, aber irgendwo bestimmt der richtige Kerl für dich rumläuft.«
Wenn es nicht so traurig wäre, hätte ich darüber lachen können. »Na klar«, murmelte ich und betrachtete meine Skizze, die mir wirklich ausgesprochen gut gefiel. Vielleicht würde ich die Waffe einfach nur für meine Vitrine bauen.
~~~~~
Wie üblich bei einer Waffenlieferung nach Triest, blieben wir die Nacht über in der Stadt. Alex und Gina trieben es mit Sicherheit auf ihrem Hotelzimmer miteinander, während Markus mich dazu überredet hatte, mit ihm Billard zu spielen. Normalerweise war dafür Jonas zuständig, doch der hatte Urlaub, weil er gemeinsam mit Daniil, unserem direkten Vorgesetzten und meinem guten Freund, im gleichen Schützenverein war und die ausgerechnet heute Abend feierten. Etwas, das ich gerade auch gern tun würde. Wirklich bei der Sache war ich also nicht, auch wenn ich mich eigentlich freuen sollte. Herr Marino war einer unserer Stammkunden, der regelmäßig für seine Sicherheitsfirma Standardkurzwaffen bei uns bestellte. Nun hatte er zum ersten Mal ein Unikat in Auftrag gegeben. »Etwas Exquisites« – seine Worte. Er war von meiner Rohanfertigung und der Skizze des Endentwurfs begeistert und hatte nicht einen Änderungswunsch gehabt. Was bedeutete, dass ich die Waffe nun, wie von mir geplant, fertigstellen durfte. Meinen Vater würde es nicht interessieren, wie erfolgreich sein schwuler Sohn mit der Familiengabe war. Niemals würde irgendeine Leistung, die ich erbrachte, ausreichen, um den angeblichen Makel meiner Vorlieben aufwiegen zu können.
»Was ist los?«, fragte Markus und versenkte dabei gekonnt eine Kugel im Loch.
»Hm?«
Er ging um den Tisch und setzte neu an. »Wirkst so nachdenklich.«
»Daaa, net. Würde lieber feiern gehen.«
Markus schnaubte. »Vergiss es. Mir hängt letztes Wochenende noch nach. Aber das verstehst du nicht.«
»Aha, warum?«
Die Kugel prallte knapp neben dem Loch ab und Markus schnitt eine Grimasse. »Na, du weißt schon … Russe halt.«
»Dir ist schon klar, dass das ein Klischee ist?« Ich beugte mich vor und setzte den Queue an. Die Kugel ging vorbei. Billard war nicht meins. »Oder meinst du auch, jeder Deutsche mag Currywurst und Pommes?«
»Na sicher!«, rief er so voller Überzeugung aus, dass ich einfach grinsen musste.
»Und was ist mit Vegetariern?«
»Die mögen das natürlich auch. Warum sonst gibt es so viel veganes Pseudofleisch, hm?«
Ich lachte und schüttelte den Kopf. »Du bist so ein Schwätzer.«
»Ja, okay, du hast ja nicht ganz unrecht, aber Daniil und du trinkt jeden von uns unter den Tisch. Selbst Alex. Und das ist ein Fakt.«
Das war wohl eine Tatsache. Ebenso, dass mein Handy klingelte. Sicherlich war es Daniil, der wissen wollte, wie meine Entwürfe angekommen waren.
»Fakt ist aber auch, dass Daniil eine doppelte Staatsbürgerschaft hat.« Ich zwinkerte Markus zu und schaute auf mein Handy.
Katharina.
Blyat!
Wir beide waren gewissermaßen nach Deutschland geflohen und hatten keinen Kontakt mehr nach Russland. Zu niemandem. Zumindest hoffte ich, dass Katharina sich daran hielt. Denn im Gegensatz zu mir hatte Daniil ihr gefälschte Dokumente besorgen müssen, damit sie ein neues Leben in Sicherheit anfangen konnte. Das lief mal mehr, mal weniger gut und in letzter Zeit eher weniger.
Ich legte den Queue auf den Tisch, nickte Markus knapp zu und zog mich zurück, bis ich außer Hörweite war. Dann ging ich auf Rückruf.
Nach nicht einmal einem Klingeln nahm sie ab: »Privet, Jascha«, begrüßte sie mich und sprach wie immer russisch mit mir: »Vy vie doroge?«
»Da. Geschäftlich in Italien und bitte hör auf damit. Du weißt, dass ich das nicht gut finde.«
Das Rauschen in der Leitung trat anstelle ihrer Antwort und ich nahm das Handy vom Ohr weg. Theoretisch bestand die Verbindung noch.
»Bist du noch dran?«, hakte ich nach.
»The Mosgojebatel’. Ehrlich Jascha, warum können wir uns nicht einmal am Telefon in unserer Muttersprache unterhalten?«
Ich schnaubte. Ja schön, dann sollte sie mich eben für eine Nervensäge halten. Ich könnte ihr jetzt wieder einmal erklären, dass es mit einer gefälschten deutschen Identität nicht hilfreich war, wenn sie immer raushängen ließ, Russin zu sein. Aber darauf würde sie nur entgegnen, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hätte.
»Weil ich keine Lust drauf habe.« Denn im Gegensatz zu ihr lebte ich gern in Deutschland und versuchte, alles andere so gut es ging zu verdrängen.
Wieder schwieg sie.
»Izvinee«, sagte ich leise und es tat mir tatsächlich leid, weil ich wusste, dass sie niemals wirklich in Deutschland angekommen war, ganz gleich wie viel Mühe Daniil und ich uns gegeben hatten.
»Ich will heim!«, stieß sie erstickt, aber immer noch beherrscht hervor. Sie würde nicht weinen.
Ich schloss meine Augen und rieb mir die Nasenwurzel. »Du weißt, dass das nicht geht.«
»Da.«
»Ist was passiert?«
Allein die Dauer, bis sie etwas sagte, reichte mir schon als Antwort.
»Ich hatte einfach gehofft, dass du in der Nähe bist … was ja nicht der Fall ist. Also hat es sich erledigt.«
»Okay, weißt du was? Ich buche mir gleich den nächsten Flug. Dann bin ich zwar nicht so schnell da, als wenn ich in Filderstadt wäre, aber immer noch besser, als wenn ich morgen mit den anderen zurückfahre.«
»Lass den Blödsinn. So dringend ist es auch nicht«, sagte sie und ich hörte förmlich ihr Lächeln. Ihr tat es gut, zu wissen, dass jemand da war.
»Net, es bleibt dabei. Ich setze mich in den nächsten Flieger und komme zu dir. Das kann jedoch ein paar Stunden dauern, je nachdem wann der Flug geht. Du könntest aber Daniil anrufen, der springt solange bestimmt für mich ein.«
Sie lachte verhalten und schnaubte dann. »Damit ich ihm erst einmal ein russisches Gericht kochen darf?«
Unwillkürlich musste ich grinsen. Katharina war eben eine hervorragende Köchin. »Na ja, was wäre daran so verkehrt, du hast gerade Heimweh, oder nicht?«
»Ja, schon, aber … nein … das kann ich jetzt echt nicht bringen … wegen, na ja, du weißt schon …«
Am liebsten hätte ich meinen Kopf irgendwo gegen gehauen, weil ich ahnte, um wen es gerade ging: dieses Arschloch, für das Katharina mit Daniil Schluss gemacht hatte. Etwas, wofür ich sie immer noch schütteln könnte. »Mhm«, erwiderte ich nur, »ich kümmere mich sofort um den Flug. Soll ich mich danach noch mal melden?«
»Net, ist okay. Wir sehen uns ja bald.«
»Gut, bis später dann«, sagte ich und wollte gerade schon auflegen.
»Jascha?«
»Da?«
»Danke!«
Mit einem Lächeln legte ich auf und machte mich daran, den nächsten Flug von Triest nach Stuttgart zu buchen.
Kapitel 2
MONTAG
~~~ Maël ~~~
Das Kopfschütteln des Notarztes, der neben der Frau am Boden kniete, bezeugte lediglich, was ohnehin klargewesen war: Sie war tot – und war es auch bereits gewesen, als die Kollegen vom Streifendienst eingetroffen waren und die Wohnung geöffnet hatten.
»Eine Leiche direkt nach dem Morgenkaffee – willkommen zurück im Dienst. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Urlaub.« Isabell sprach so leise, dass ihre Worte außer mir wohl niemand verstehen konnte. Höchstens der Notarzt, doch wenn, dann kümmerte er sich nicht darum.
Ich warf meiner Kollegin nur einen vielsagenden Blick zu, ehe ich meine Aufmerksamkeit wieder der Toten zuwandte. Sie war vergleichsweise jung, um die dreißig schätzungsweise, wobei das aufgrund ihres in eindeutiger Qual verzogenen Gesichtsausdrucks schwer zu sagen war. Ihre Körperposition – halb auf dem Bauch liegend, einen Arm von sich gestreckt, als wollte sie nach etwas greifen, ein Bein angezogen – deutete darauf hin, dass sie versucht hatte, fortzukommen. Fort von ihrem Peiniger?
Unweigerlich ließ ich meinen Blick in Verlängerung ihrer ausgestreckten Hand durch den Raum schweifen. Auf dem Sideboard fand sich weder ein Telefon, noch sonst etwas, das zu erreichen ihr das Leben hätte retten können.
Die blutigen Schleifspuren bezeugten ebenfalls, dass sie ein Stück weit gekrochen war. Von der ehemaligen Champagnerfarbe ihrer Seidenbluse war nicht mehr viel übrig. Blut hatte den feinen Stoff an zahlreichen Stellen getränkt, ihr schlanker Körper war insbesondere im Torsobereich übersäht mit Einstichstellen.
Über die Schulter des Notarztes neigte ich mich weiter hinab, kniff die Augen zusammen. Der Schatten an ihrem Hals, leicht verdeckt vom verrutschten Blusenkragen, hätte der erste Bote eines Würgemals sein können. Ich war mir jedoch ziemlich sicher, dass nicht Luftnot die Todesursache gewesen war. So oder so, das würde die Rechtsmedizin klären.
Ein letztes Mal ließ ich meinen Blick über das fein geschnittene, erstarrte Gesicht der Toten schweifen, über ihr dunkles Haar, verklebt vom Blut, im Kontrast zu den hellen Bodenfliesen. Dann wandte ich mich dem Kollegen des Kriminaldauerdienstes zu, der neben mich und Isabell trat. Er reichte mir einen beigefarbenen Geldbeutel, ordentlich verpackt in einer Plastiktüte. Obenauf lag der Personalausweis.
»Den haben wir bereits überprüft. Maria Koch, geboren 1987 in München, ledig, keine Kinder. Hier an dieser Adresse gemeldet seit inzwischen sechs Jahren.«
»Okay. Wisst ihr schon was von etwaigen Angehörigen? Irgendwas zum Tathergang?«
»Mein Kollege spricht gerade mit dem Herrn, der uns informiert hat.«
Es war unschwer zu erahnen, dass er mit ›uns‹ die Polizei an sich und nicht explizit den Kriminaldauerdienst meinte. Sicherlich war das Streifenteam vom Revier Gutenbergstraße als Erstes am Tatort gewesen.
Ich tauschte einen kurzen Blick mit Isabell. Eine wortlose Übereinkunft, dass ich mir besagten Zeuge einmal näher ansah, während sie in der Wohnung der Toten blieb und alles Weitere mit KDD und Notarzt abklärte.
Im Hausflur kamen mir bereits die Leute von der Spurensicherung entgegen. Ich winkte sie weiter, hinein in die Wohnung, und eilte selbst mit großen Schritten quer über den breiten Flur, hin zu dem zweiten Kollegen vom KDD und einem Herrn Mitte fünfzig, der in der weit geöffneten Tür seiner Wohnung stand.
»Oberkommissar Cordeiro Pires, Kripo Stuttgart.« Ich wollte schon meinen Dienstausweis ziehen, doch der Herr winkte mit einer müde wirkenden Handbewegung ab.
»Schon gut, schon gut, das glaube ich Ihnen. Muss ich meinen Ausweis jetzt noch mal holen?«
»Nicht, wenn mein Kollege hier Ihre Personalien bereits überprüft hat.« Ich tauschte einen Blick mit besagtem Kollegen, der mir zunickte.
»Udo Lindner«, stellte der Herr sich knapp vor, »ich bin gewissermaßen der Hausmeister dieses Objekts. Deswegen hab ich ab und an Augen und Ohren offen, was im Haus so vor sich geht.«
Auf die Nachbarn zu lauschen, fiel zwar in meinen Augen nicht in den vorgegebenen Tätigkeitsbereich eines Hausmeisters, aber in dem Fall konnte es mir nur recht sein, wenn er irgendetwas mitbekommen hatte.
»Sie haben die Polizei verständigt?«
»Ich habe direkt auf dem Polizeirevier 3 angerufen.« Lindners Unterton klang, als wollte er ein Lob dafür einheimsen, das zuständige Revier kontaktiert zu haben.
Ich überging den Wink. »Weshalb genau haben Sie die Polizei gerufen? Erzählen Sie mir einfach erst mal alles der Reihe nach.«
»Ja, also, angefangen hat es eigentlich schon gestern Abend. Da hatte die Frau Koch mal wieder Besuch von ihrem … Nun, ich weiß auch nicht so genau, was dieser Kerl ist. Ihr Partner? Zeitweise. Es gibt Wochen, da geht er ständig hier ein und aus, dann sieht man ihn wieder eine Zeit lang gar nicht. Die streiten sich öfter mal. Laut genug, damit man es hört. Ich würde ja nicht lauschen oder so.«
Nein, natürlich nicht. Ich verkniff mir jegliche mimische Regung. »Sie sind sicher, dass es ihr Freund war, der zu Besuch war?«
Der Zeuge nickte eifrig. »Ja, ja. Sein Auto stand vor dem Haus. Ein schwarzer BMW, ich kann Ihnen das Kennzeichen sagen. Zumindest …«, er zögerte einen Moment, »die Buchstaben. Bei den Zahlen bin ich mir nicht ganz sicher.«
Der Kollege vom KDD notierte das Kennzeichen und den Fahrzeugtyp.
»Gab es am vergangenen Abend auch wieder Streit?«, nahm ich den Faden wieder auf.
»Ja. Oh, ja. Streit und … Nun ja … anderweitige Geräusche. Den ganzen Abend über hat es immer mal wieder rumort, aber da das ja nichts so Außergewöhnliches ist, hab ich mich nicht weiter drum gekümmert. Ich bin dann irgendwann vor dem Fernseher eingeschlafen. Dürfte so gegen zehn gewesen sein. Jedenfalls war ihr Freund die Nacht über hier. Als ich vorhin den Müll rausbringen wollte, kam er aus ihrer Wohnung und hat sich an mir vorbei die Treppe runter gedrängt.«
»War irgendetwas Auffälliges an ihm?«
»Na ja, das ist ja ohnehin ein zwielichtiger Typ. Trägt oft solche Kapuzenpullover. Heute auch wieder. Einen dunklen, blau oder so. Regelrecht vermummt war der.«
»Aber Sie sind sich sicher, dass es der Freund war?«
»Ja. Nein. Ich meine, schon ziemlich.«
Doch so überzeugend …
»Haben Sie ihn eindeutig erkannt?«
»Ich habe sein Gesicht in dem Moment nicht gesehen. Er kam ja hinter mir die Treppe runter. Aber er kam ganz sicher aus ihrer Wohnung, über uns gibt’s ja kein Stockwerk mehr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es war.«
»Stand denn sein Auto noch vor dem Haus?«
»Als ich aus dem Haus gekommen bin, nicht. Er muss es ziemlich eilig gehabt haben.«
»Und in der Nacht? Haben Sie da noch einmal nach draußen gesehen?«
»Nein.«
Was bedeutete, dass rein theoretisch auch jemand anderes bei Maria Koch gewesen sein könnte. Auch wenn erst mal alles darauf hindeutete, dass es nicht so war. Gedanklich machte ich mir dennoch eine Notiz. »Okay. Kennen Sie den Namen dieses Mannes?«
»Breuer. Hmm … Adrian. Oder Adam. Etwas mit A oder … Ach ja, Andre Breuer, ganz sicher.«
»Wissen Sie, wo er wohnt?«
»Oh, nein. Ich meine, die Maria … also Frau Koch, hätte mal was von Weilimdorf gesagt, aber das würde ich nicht beschwören.«
»Überprüfst du das?«, wandte ich mich an den Kollegen vom KDD und fing sein Nicken ein. An Herrn Lindner gewandt fuhr ich fort: »Erzählen Sie mir bitte, was dann passiert ist.«
»Mhm, ja, mir kam das alles komisch vor. Also wie gesagt, es gibt da ja öfter mal Streit, aber ich hatte so ein merkwürdiges Gefühl im Bauch. Da dachte ich, ich klingle mal bei der Frau Koch. Als sie nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen nicht aufgemacht hat, hab ich dann die Polizei gerufen.«
»Gut. Haben Sie heute oder gestern Abend außer diesem Andre Breuer sonst jemanden bei Frau Koch gesehen?«, hakte ich nach, obwohl ich mir sicher war, wie die Antwort ausfallen würde.
»Nein.« Er zögerte einen Moment. »Ich hab natürlich auch nicht die ganze Zeit aufmerksam hingehört. Wie gesagt, der Fernseher … Aber das meiste bekomme ich schon mit.«
»Sie waren jedenfalls die Nacht über und heute Morgen zu Hause?«
»Ja. Ich bin in Frührente, daher bin ich meist daheim.«
»Und Frau Koch?«
»Sie arbeitet oft von zu Hause, ist aber auch oft unterwegs. Meines Wissens ist sie Journalistin.«
»Wissen Sie, für welche Zeitung Sie schreibt? Oder sonst etwas zu ihrer Arbeit?«
»Nein. Nicht wirklich. Ich lese nicht so viel Zeitung.«
Ich nahm mir einen Moment, um die gesammelten Informationen in meinem Kopf zu sortieren, ungeachtet des abwartenden Blickes, den der Zeuge mir zuwarf. Die vielfachen Stichverletzungen legten einen aus dem Ruder gelaufenen Streit nahe, eine Beziehungstat erschien mir nach dieser ersten Aussage durchaus im Bereich des Möglichen. Fraglich war, ob wir eine Tatwaffe hatten, aber das würde Isabell mittlerweile mit Sicherheit überprüft haben.
»Eine Frage noch: Hatte der Herr Breuer irgendetwas bei sich, als er an Ihnen vorbei die Treppe runter ist?«
»Kann ich nicht sagen. Es ging so schnell. Aber er war auf jeden Fall in Eile und wie gesagt, dieser Kapuzenpullover … als wollte er nicht erkannt werden.«
Was ja letztlich zumindest insofern funktioniert hatte, dass unser Zeuge ihn nicht mit Sicherheit identifizieren konnte.
»Gut, ich danke Ihnen erst mal, Herr Lindner. Meine Kollegen und ich würden gegebenenfalls noch mal auf Sie zukommen.« Ich sah zu dem Kollegen vom KDD, der soeben die Treppenstufen wieder hinaufstieg. »Kontaktdaten haben wir?«
Sowohl Herr Lindner als auch der Kollege nickten. Ich dankte noch einmal für die Mithilfe, ehe ich mich wieder der Wohnung der Toten zuwandte.
»Ich habe besagten Andre Breuer im Melderegister überprüft.« Der Kriminaldauerdienstler reichte mir einen Zettel. Tatsächlich, eine Adresse in Stuttgart Weilimdorf.
»Okay, danke. Ihr bleibt noch und hört euch in der Nachbarschaft um?«
Es war mehr eine routinemäßige Feststellung, auch wenn ich es als Frage formulierte. Der Kollege nickte.
Zurück in der Wohnung war der zweite KDDler gerade dabei, Fotos von der Leiche und vom Tatort zu machen. Die Kollegen von der SpuSi nahmen Proben. Die Tote selbst schien bereit für den Abtransport in die Rechtsmedizin.
Ich ging zu Isabell in die Küche, stets darauf bedacht, wohin ich trat, um nicht aus Versehen mögliche Spuren zu verwischen. Kaum etwas war ätzender für die Spurensicherung, als Leute, die fröhlich am Tatort herumspazierten. »Haben wir eine Tatwaffe?«
»Nein.« Sie wies auf den Messerblock, der neben dem Herd stand. »Fehlt keines.«
Also hatte der Täter – oder die Täterin, noch schien alles möglich, nur manches wahrscheinlicher als anderes – entweder ein Messer aus einer der Schubladen gezogen oder eines bei sich getragen. Insofern es sich bei den zahlreichen Verletzungen an der Toten tatsächlich um Messerstiche handelte.
»Aber das hier«, Isabell wies auf eine leicht schmierige und mit bloßem Auge kaum auffallende Spur an der Küchenzeile, »sieht aus, als hätte jemand versucht, etwas wegzuwischen. Könnte Blut gewesen sein oder natürlich auch einfach nur irgendein Rückstand vom Kochen. Was meinst du, fordern wir eine Tatortgruppe vom LKA an.«
»Würde ich sagen, ja. Die sollen zumindest die Küche, Eingangsbereich und Wohnzimmer einmal mit Luminol einsprühen. Vielleicht bekommen wir so noch die eine oder andere Spur. Sonst irgendetwas Auffälliges?«
»Nicht wirklich.«
Gemeinsam verließen wir die Küche, schoben uns vorsichtig an der Toten und den Kollegen von der SpuSi vorbei und weiter ins Wohnzimmer. Ich durchmaß den Raum mit einem eingehenden Blick. Schickes, kühl wirkendes Interieur, bei dem Glas und weißer Lack dominierten. Kuschelige Decken auf dem Sofa, zahlreiche Fotografien an den Wänden, die jedoch wenig Personen zeigten. Über dem ausladenden, ebenfalls weißen Sofa eine Skyline bei Nacht. Die auffallenden Kuppeln, die augenscheinlich zu Kirchen oder Kathedralen gehörten, erinnerten mich an St. Petersburg.
Auf dem Fenstersims standen einige Orchideen, dazwischen allerlei Kleinkram. Ich trat näher heran, sah aus dem Fenster hinab auf die Straße. Auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig tigerte ein junger Mann auf und ab, sein Handy ans Ohr gepresst.
»Was hat der Zeuge gesagt?«
Rasch wandte ich mich wieder Isabell zu. »Anscheinend gab es in der vergangenen Nacht einen Streit mit dem Freund der Toten und der soll aus der Wohnung gekommen sein, kurz bevor der Zeuge die Polizei verständigt hat. Ich würde sagen, ich fahre dort direkt mal hin.«
»Soll ich mitkommen?«
Im Grunde wäre das sinnvoll gewesen, aber Personalknappheit machte eben auch vor der Kripo nicht Halt. »Bleib du hier. Ich fordere eine oder zwei Streifen zur Unterstützung an.« Bei einer stationären Lage, wenn ich mir sicher gewesen wäre, dass Andre Breuer tatsächlich zu Hause anzutreffen war, hätte ich auch das SEK hinzuziehen können. Aber auch wenn Breuer potenziell bewaffnet sein könnte, erschien mir die Schutzpolizei ausreichend. »Vielleicht bekomme ich noch einen Hundeführer.« Noch während ich das sagte, schweifte mein Blick zurück auf die Straße. Dieser Kerl … sah gerade zum Fenster hoch. Flüchtig nur. Seine Lippen bewegten sich, als murmelte er irgendetwas. Sichtlich fahrig tippte er auf dem Handy herum, presste es sich wieder ans Ohr. Er hatte etwas an sich … Breite Schultern unter schlichten Klamotten – Pullover und Jeans, dazu derbe Boots. Dunkle Haare, ein markantes und doch irgendwie weich wirkendes Gesicht, auch wenn sich gerade eindeutig Aufruhr darin abzeichnete. Die Art, wie er sich in einer gehetzten Geste durchs Haar fuhr, könnte …
Das Klingeln eines Telefons riss meinen Blick von ihm los. Auch Isabells huschte durch den Raum. Hinüber zu dem kleinen Tischchen neben dem Sofa. Das Display des Festnetzanschlusses blinkte. War das …?
Die Hände auf dem Fenstersims abgestützt sah ich hinaus. Der junge Mann schüttelte den Kopf, raufte sich die Haare – und machte auf dem Absatz seiner Boots kehrt.
»Jascha mobil.«
Ich fuhr zu Isabell herum. Sie stand neben dem klingelnden Telefon, die Hand ausgestreckt, als überlegte sie gerade, ob sie abnehmen sollte, ihre Aufmerksamkeit auf die Schrift auf dem Display gerichtet.
Wieder der Blick hinaus – der Kerl entfernte sich eiligen Schrittes, zog das Handy von seinem Ohr fort. Das Klingeln in meinem Rücken erstarb.
»Verflucht!« Ich stieß mich vom Fenstersims ab. Der Kerl hatte zu laufen begonnen. Nur mühsam widerstand ich dem Reflex, aus der Wohnung zu stürmen. Bis ich unten ankam, würde er verschwunden sein. Er bog bereits in eine Seitenstraße ab.
»Was ist?«
»Da unten stand gerade ein Typ auf der Straße, mit Handy am Ohr. Ich könnte schwören, der hat eben hier angerufen.« Keine Frage, dass es überzogen wäre, eine Fahndung herauszugeben. »Notier dir die Nummer, die angerufen hat. Wir kriegen raus, auf wen der dazugehörige Mobilfunkvertrag läuft. Ich fahr jetzt zu diesem ominösen Freund.«
Über die Distanz weniger Meter hinweg fing ich Isabells Nicken ein. Noch einmal schweifte mein Blick aus dem Fenster und hinab auf die Straße, ehe ich mich endgültig abwandte.
~~~~~
»Ja, bi– Heilige Scheiße!«
Zugegeben, etwas Ähnliches hätte ich möglicherweise auch gesagt, hätte ich die Tür geöffnet und mich einem knurrenden Diensthund gegenübergesehen.
Während der Hundeführer seinem Tier ein kleines bisschen mehr Leine gab und der Malinois daraufhin kläffend einen Satz nach vorn tat, taumelte der Mann rückwärts in den Hausflur zurück. Augenscheinlich unbewaffnet und sichtlich schockiert, wirkte er absolut nicht, als habe er damit gerechnet, Polizei bei sich vor dem Haus zu haben. Und um sein Haus herum, was er vermutlich noch gar nicht registriert hatte. Das von einem kleinen Garten umrahmte Einfamilienhaus hatte es uns erfreulich leicht gemacht, sämtliche potenziellen Fluchtwege zu sichern und vorab abzuklären, ob Bewegung im Haus und Breuer dem Anschein nach dort war. Der auf ihn zugelassene BMW parkte vor der Garage, außer ihm waren keine Personen an dieser Anschrift gemeldet.
Zwischen den beiden Kollegen vom Streifendienst, die aufgrund der unklaren Lage zur Sicherheit ihre schwere Schutzausstattung trugen, trat ich einen Schritt vor, an die Seite des Hundeführers.
»Oberkommissar Cordeiro Pires, Kripo Stuttgart. Sind Sie Andre Breuer?«
»Shit, ja.« Aus aufgerissenen Augen sah der Kerl zwischen dem noch immer knurrenden Mali und mir hin und her, stützte sich dabei halb auf einer Kommode im Hausflur ab. »Was …?«
»Nehmen Sie die Hände nach vorne.«
»Was zur …? Was geht hier ab?« Trotz seines Ausrufs tat er, wie ich ihn angewiesen hatte. Sekundenlang lieferte er sich ein verbissenes Blickduell mit mir und meinen Kollegen. Die Anspannung in jedem Muskel ließ ihn noch breiter wirken, als er tatsächlich war. Dazu der rote Hoodie mit dem Logo eines Boxvereins auf der Brust. Rot, nicht dunkelblau. Was nichts heißen musste. Zeit genug sich umzuziehen hatte er definitiv gehabt.
»Herr Breuer, in welcher Beziehung stehen Sie zu Maria Koch?«
»Maria? Das … ist meine Freundin. Warum, was …?«
»Sie stehen unter Tatverdacht, Maria Koch getötet zu haben. Sie kommen jetzt mit erhobenen Hä–«
»Was? Shit! Was zur … Maria ist …« Statt auf mich und den Hundeführer zu, taumelte Breuer weiter in den Hausflur zurück. Das kantige Gesicht dabei eine Maske aus Schrecken und Unglauben. Eine Maske, die wenigstens im ersten Moment real auf mich wirkte.
»Herr Breuer, noch mal: Nehmen Sie die Hände hoch und kommen Sie langsam zu mir.« Schräg vor mir duckte sich der Malinois knurrend neben seinem Hundeführer ab.
»Aber ich … Maria … Was ist denn passiert, verdammt?«
»Ihre Freundin wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden und Sie wurden zuletzt dort gesehen. Mehr sage ich Ihnen bei der Vernehmung. Sie begleiten uns zur Dienststelle. Jetzt Hände hoch und herkommen, aber langsam.«
Ich war mir fast sicher, dass es ehrlicher Schock und Unglauben waren, die den Kerl dazu veranlassten, in Zeitlupentempo die Arme zu heben. Sein Blick dabei starr auf mich gerichtet.
»Jetzt herkommen.« Das Knurren des Malis schwoll an, der Hundeführer zog ihn am Halsband zurück, während Breuer sich schrittchenweise durch die Haustür schob.
»Mit dem Gesicht zur Wand und Hände oben lassen.« Mit Bedacht trat ich an den Kerl heran, zog meine Hand zurück, die vage auf meinem Holster geruht hatte.
»Aber ich hab sie nicht … Maria ist … Wann? Ich meine, wann wurde sie …?«
»Rechte Hand auf den Rücken.« Mit festem Griff um sein Handgelenk half ich nach, die Handschließen kühl zwischen meinen Fingern.
Wie aus Reflex, als sich das kantige Material um sein Handgelenk wand, bäumte Breuer sich auf. Mit vollem Körpergewicht presste ich ihn gegen die Hauswand, der Hundeführer und sein Malinois waren sofort wieder neben mir.
»Shit!« Breuer keuchte in das anschwellende Knurren des Hundes hinein. Keine Frage, dass mein eigener Puls gerade raste. Ich mochte Tiere ja wirklich, nichtsdestotrotz hatte ich vor unseren Diensthunden einen Heidenrespekt.
Das Klicken der Handschließen erschien mir wie ein nahezu erleichternder Ton in meinen Ohren.
»Ich hab sie nicht umgebracht, verdammt! Ich hab sie … Ich würd ihr nie was antun, auch wenn wir … Shit, Mann, das ist eine große Scheiße! Ich war die ganzen letzten Stunden hier!«
Angesichts seines Aufzugs in Hoodie und Jogginghose hätte ich ihm das beinahe glauben wollen. »Das können Sie alles nachher bei der Vernehmung erzählen. Sie sind hiermit vorläufig festgenommen und werden uns …«
»SCHEISSE!« Noch einmal bäumte Breuer sich in seiner Fesselung auf, erschlaffte jedoch aufgrund meines festen Griffs und dem rauen Bellen des Malis.
»Sparen Sie sich den Aufstand. Tut nur weh.«
Breuer fluchte unterdrückt.
Eine Hand an den Schließen dirigierte ich ihn durch den Flur Richtung Wohnzimmer. »Ist noch jemand im Haus?«
»Shit, nein.«
Hinter uns legten Geräusche nahe, dass die beiden Schutzpolizisten ebenfalls ins Haus kamen, um einen Blick in die übrigen Räumlichkeiten zu werfen und sicherzustellen, dass Breuer in dieser Hinsicht die Wahrheit sagte.
»Hinsetzen.« Ich deutete zu dem Sofa.
»Dürfen Sie mich überhaupt festnehmen?«
»Allerdings darf ich das. Ich darf auch Ihr Haus durchsuchen.« Dank mündlicher richterlicher Anordnung, die ich mir auf dem Weg hierhin eingeholt hatte.
Breuer fluchte erneut. In Trauer um Maria Koch schien er nicht gerade zu versinken, den Schock über seine vorläufige Festnahme und damit einhergehend auch den über den Tod seiner Freundin nahm ich ihm allerdings ab. Zumindest zu neunzig Prozent. Nichtsdestotrotz war er gerade unser einziger Tatverdächtiger und Überraschung allein vermochten die Zeugenaussage gewiss nicht zu entkräften.