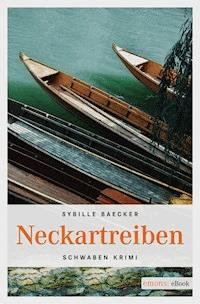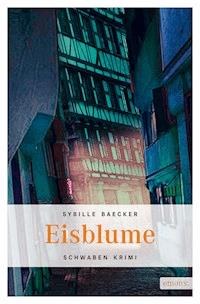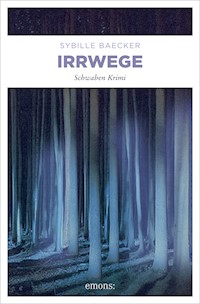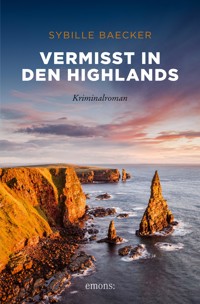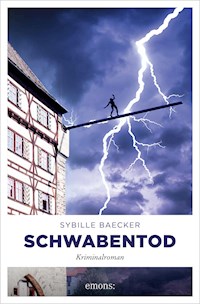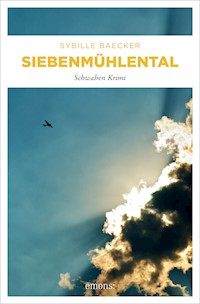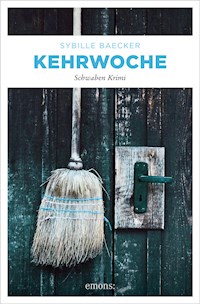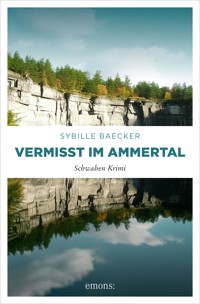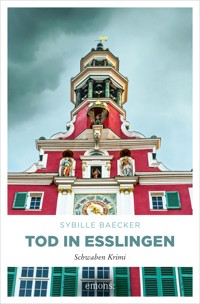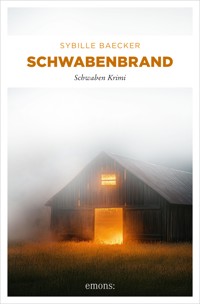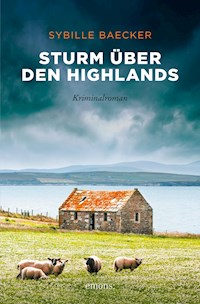Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kommissar Brander
- Sprache: Deutsch
Ein packender Krimi über den Umgang mit Vorurteilen und Fake News. Mitten im Idyll des Naturparks Schönbuch wird auf einer Kanzel zur Wildbeobachtung die Leiche eines Mannes gefunden – getötet durch einen Kopfschuss aus nächster Nähe. Alles deutet auf Suizid hin. Doch was trieb den Mann zu der Verzweiflungstat? In dem Dorf, in dem er lebte, wurde er angefeindet und ausgegrenzt. Kommissar Brander und sein Team ermitteln und decken eine fatale Spirale aus Lügen, Hass und Mordlust auf. Können sie ein weiteres Verbrechen verhindern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sybille Baecker ist gebürtige Niedersächsin und Wahlschwäbin. Sie liebt das Ländle, ihr Herz schlägt aber auch für die Highlands und die rauen Küsten Schottlands, die sie immer wieder gern und ausgiebig bereist. Ebenso hegt sie ein Faible für den Scotch Whisky. Die Fachfrau für »Whisky & Crime« ist Autorin der erfolgreichen Krimiserie um den Kommissar und Whiskyfreund Andreas Brander. 2020 wurde sie mit dem Arbeitsstipendium des Autorinnennetzwerkes Mörderische Schwestern ausgezeichnet.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: photocase.de/Mr.Nico
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-205-5
Schwaben Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Er mochte die Nacht. Das war schon immer so. Es fiel ihm leichter, sich im Schutz der Dunkelheit davonzustehlen, statt im grellen Licht des Tages der Welt gegenübertreten zu müssen. Menschen mochte er nicht.
Er hob den Riegel des Wildschutzgatters, öffnete das Tor zum Naturpark Schönbuch und schob sein Fahrrad hindurch. Es war ein altmodisches Trekkingrad, ohne elektrischen Antrieb. Es ging ihm nicht darum, schnell zu fahren. Es war das stetige Treten, die Gleichmäßigkeit der Bewegung, die ihm guttat und ein klein wenig Sicherheit gab. Die Anstrengung, wenn es mal bergan ging, half ihm, seinen Stress abzubauen.
Er hatte mal von einer Frau gelesen, die einfach loslief, wenn ein depressiver Schub sie überwältigen wollte. Sie lief und lief, so lange, bis es wieder besser wurde. Einmal war sie in den Norden bis nach Stockholm gelaufen. Doch für solche Strapazen fehlte ihm die Kraft. Zudem hätte es bedeutet, auch bei Tage unter Menschen sein zu müssen. Menschen, die ihm nicht glaubten. Die ihn verurteilten.
Der Wald um ihn herum lag in Finsternis. Der abnehmende Mond spendete kaum Licht, und der Frontstrahler seines Rades beleuchtete nur matt den breiten Weg, als er seine Tour fortsetzte. Er hätte auch ohne Licht durch den Wald radeln können, er kannte jeden einzelnen Meter, so oft war er diese Strecke schon gefahren.
Als sich der Pfad bei der Forstlagerhütte mit dem großen Mammutbaum in drei Wege gabelte, wählte er den mittleren. Jede der drei Möglichkeiten führte zu seinem Ziel. Aber dieser Weg war ihm der liebste. Er verlief in Kurven stetig leicht bergab.
Eine Windböe rauschte durch die Zweige, die wenigen vertrockneten Blätter, die noch daran hingen, raschelten leise. Dann war wieder nur das Knirschen seiner Spike-Reifen zu hören, die über den gefrorenen Boden, über Schotter, Sand und verrottendes Laub rollten.
Am Ende bog er rechts auf die Kirnbachstraße ab. Es war keine Straße, sondern ein breiter Waldweg. Der namensgebende Bach schlängelte sich zwischen den Bäumen mal links, mal rechts entlang.
Es ging nun leicht bergauf, minimal nur, aber er kam trotz der winterlichen Temperaturen ins Schwitzen. Sein warmer Atem verfing sich bei der eisigen Kälte in seinem Schal. Der Weg führte an einer Grillstelle mit Schutzhütte vorbei, die in der Dunkelheit nur zu erahnen war. Das leise Plätschern des Baches erklang hier und da. Es war kurz vor Mitternacht. Am Wegesrand sah er flüchtig ein paar Augen aufblitzen. Ein Fuchs? Ein Marder? Oder gar ein Wildschwein?
Er fuhr weiter, stetig trampelnd, nicht schnell, nicht langsam. Eine Fledermaus kreuzte lautlos seinen Weg, ein Käuzchen rief. Er spürte, wie er ruhiger wurde. Hier war er allein mit sich und der Natur. Niemand, der ihn bedrohte, der ihn verletzte, der ihm ins Gesicht spuckte. Nur er, der Wald und die Tiere. Hier lauerte keine Gefahr.
Schließlich erreichte er sein Ziel. Er schob das Fahrrad über den schmalen Pfad, der links abzweigte und zur Wildbeobachtungskanzel führte. Mit Hilfe von Rundhölzern waren an der kleinen Steigung ein paar Stufen in den Boden eingebracht worden. Er schob das Rad neben den Stufen hinauf und kettete es an einen der dicken Pfähle, auf denen die Kanzel stand. Er zog die Radtasche vom Gepäckträger, hängte sich den Riemen über die Schulter und stieg die steile Holztreppe zur Kanzel hinauf. Die ersten Stufen waren leicht überfroren. Er hielt sich zur Sicherheit am Geländer fest.
Zu dieser Jahreszeit war er der Einzige, der nachts hierherkam. Im Herbst, zur Brunftzeit der Hirsche, war es ein Gräuel. Da kamen die Menschen zuhauf, hatten Fotoapparate bei sich mit riesigen Stativen, drängelten sich auf die vorderste Bank in der Kanzel, um ein Foto zu schießen. In der Zeit konnte er nicht herkommen, da musste er woandershin. Diese Gier nach einem perfekten Foto stieß ihn ab.
Aber jetzt, in den letzten Tagen zwischen den Jahren, in den Raunächten, da kam niemand. Es war zu kalt und zu feucht, es gab kaum etwas zu hören oder zu sehen – zumindest für die, die den Wald nicht kannten. Er kannte den Wald. Die Tiere, die Geräusche, er wusste, wie Frühling, Sommer, Herbst oder Winter rochen. Er räumte die Radtasche aus, legte das Thermositzpad auf die Bank und breitete die Wolldecke aus. Dann setzte er sich und klappte die Seiten der Decke über seine Oberschenkel.
Er nahm das Nachtsichtfernglas und ließ den Blick über die Waldwiese gleiten. Er entdeckte einen Fuchs, der geduckt durchs trockene Gras huschte. Vielleicht auf der Suche nach einer paarungsbereiten Fähe? In den Wintermonaten erreichte die Ranz der Füchse ihren Höhepunkt. Er kannte ihre Rufe, die sich wie menschliche Schreie oder hohes Hundegebell anhören konnten. Jasmin fand es immer gruselig, wenn sie ihn begleitet hatte. Damals noch. Als die Welt für kurze Zeit ein guter Ort zum Leben war.
Er wollte nicht an Jasmin denken. Zu sehr schmerzte ihre Abwesenheit. Und heute hatte schon den ganzen Tag eine tiefschwarze Wolke sein Leben so verfinstert, dass er kaum in der Lage gewesen war zu atmen.
Er konzentrierte sich auf den Fuchs, verfolgte seinen Weg, bis er am Ende der Wiese aus seinem Sichtfeld verschwand. Er legte das Fernglas zur Seite, starrte auf die dunkle Wiese, spürte die kalte Luft in seine Lungen ein- und ausströmen. Nasenspitze und Lippen waren eisig kalt. Wie lange würde er es noch durchhalten? Er sollte sich auf sein Fahrrad setzen. Fahren, bis er einfach umfiel. Seine Augen füllten sich schon wieder mit Tränen.
»Verrecke!«
Er zuckte zusammen. Was war das? Sein Blick huschte nervös umher. Da war niemand. Spielte seine Einbildung ihm einen Streich? Hörte er nun auch noch Stimmen? Nein, in seinem Kopf war Stille.
Dann plötzlich wieder: »Verrecke!« Ein kaltes, blechernes Wispern.
Er zog die Schultern hoch, sah sich um. Sein Herz wummerte in seiner Brust. Er war allein. Außer ihm war niemand in der Kanzel. Die Bänke waren leer.
»Verrecke!« Jetzt kam es von der anderen Seite.
War ihm jemand gefolgt? Wieder suchten seine Augen die Umgebung ab. Er spürte jeden bebenden Pulsschlag in seinen Adern, keuchte schwer. Kalter Schweiß brach ihm aus, ließ ihn frösteln.
Aber er war allein hier oben. Es war Einbildung. Es musste Einbildung sein. Er zwang sich, sein Nachtsichtgerät zu nehmen, beugte sich vor und schaute vorsichtig über den Rand der Kanzel nach unten. Er scannte die Umgebung nach allen Seiten. Aber da war nur Waldboden, Büsche, Gestrüpp.
»Verrecke! Drecksau! Verrecke!«, erschallte es ganz nah hinter ihm. Er meinte einen Lufthauch im Nacken zu spüren, schaute sich um. Aber es war doch niemand da! Sein Kopf spielte verrückt.
»Verrecke!« Von links. Da war nur die Holzwand.
Er musste weg. Er schnappte seine Tasche, schlich gebeugt zur Treppe.
»Verrecke!« Direkt vor ihm.
Er zuckte zurück. Er konnte nicht hinuntergehen. Jemand war da unten. Er sah ihn nicht. Er spürte es. Er wusste es. Es würde nie aufhören. Nie!
»Verrecke!«
Er zog sich zurück in die hinterste Ecke, machte sich ganz klein.
»Verrecke! Verrecke! Verrecke!«
Im Stakkato zischte es von links, von rechts, hinter ihm, unter ihm, vor ihm. Es war überall. Er zitterte, presste die Hände auf die Ohren, wiegte sich, weinte, wimmerte. »Aufhören! Aufhören!«
»Verrecke!«
»Bitte!«, flehte er. »Bitte aufhören.«
»Verrecke! Verrecke!«, schallte es weiter von allen Seiten, immer drängender.
Es hörte nicht auf und würde nicht aufhören. Niemals. Er musste fort von hier. Runter von der Kanzel. Zurück in den sicheren Schutz seiner Wohnung. Sein Herz raste wild. Er hörte das Knarren einer Stufe. Er hob ängstlich den Kopf, das Gesicht nass von Rotz und Tränen. Dann sah er das Gewehr.
Mittwoch
In den ersten Tagen des Jahres waren die Straßen erfreulich staufrei. Wenig Berufsverkehr, die Familienbesuche oder Winterreisen waren entweder beendet, oder man dehnte sie bis zum Wochenende aus. Weder Schnee noch Blitzeis blockierte die Fahrbahn. Diejenigen, die unterwegs sein mussten, fuhren entspannter – vielleicht weil sie von den Feiertagen erholt waren oder der gute Vorsatz zum neuen Jahr, stressfreier zu leben, noch anhielt.
Kriminalhauptkommissar Andreas Brander mochte diese ersten Tage des Jahres. Sie hatten etwas von Neubeginn, bargen ein klein wenig die Hoffnung, dass nun besser werden würde, was im vorangegangenen Jahr nicht so rundgelaufen war. Beklagen konnte er sich allerdings nicht. Er war gesund – außer seiner lichten Haarpracht, die er damit kaschierte, dass er sich seit Jahren eine Glatze rasierte, hatte er trotz seiner fünfzig Jahre kaum über Wehwehchen zu klagen. Das Zwicken hin und wieder im Rücken bekam er mit einer Runde Joggen gut in den Griff. Diesen Winter war er bislang sogar ohne Erkältung durchgekommen, was seine Frau Cecilia darauf schob, dass sie jeden Abend einen Tee mit Ingwer und Zitrone für sie beide zubereitete, den Nathalie, seine inzwischen zwanzig Jahre alte Adoptivtochter, standhaft verweigerte.
Ein kleiner Wermutstropfen war, dass sich seine Dienststelle seit einigen Jahren nicht mehr in Tübingen, sondern in Esslingen befand, ging es ihm durch den Kopf, als er den Ortseingang Tübingen erreichte. Auf der Tafel der Gärtnerei am rechten Straßenrand las er »Winterschlaf«, dazu eine Skizze von Mond und Sternen und einem Bett.
Die tägliche Radtour von seinem Heimatdorf Entringen durchs Ammertal zur Arbeit fehlte ihm. Aber immerhin konnte er weiter mit Peppi zusammenarbeiten – Persephone Pachatourides, seine Kollegin mit griechischen Wurzeln und hin und wieder auch südländischem Temperament.
Vor dem Tunnel bog er links ab, um Peppi zu Hause abzuholen. Sie hatte viele Jahre im französischen Viertel gewohnt, wo sie wunderbar hineingepasst hatte. Nun lebte sie mit ihrem Mann Marco Schmid am Österberg. Brander fuhr in die schmale Straße, die sich den Hang hinaufschlängelte, und hielt vor dem eingeschossigen Haus in luxuriöser Halbhöhenlage.
Peppi kam eingehüllt in einen weinroten Mantel und dunklen Schal aus dem Haus zu seinem Wagen geeilt. Eine Mütze brauchte sie trotz der morgendlichen Minustemperaturen nicht – ihre lange dunkle Lockenpracht wärmte ihren Kopf zur Genüge.
»Guten Morgen, Andi.« Mit seiner Kollegin rauschte kalte Luft ins Innere seines so angenehm aufgewärmten Wagens. »Was grinst du so vor dich hin?«
»Ich freue mich, dich zu sehen.«
»Okay.« Peppi quittierte es mit einem Lächeln und schnallte sich an.
Brander lenkte den Wagen zurück Richtung Wilhelmstraße.
»Sieht irgendwie nach Regen aus, oder?« Peppi sah zum grauen Himmel.
»Und wenn schon – wir sitzen im Trockenen. Und wenn du nicht wieder den halben Tag lang das Fenster aufreißt, weil du frische Luft zum Denken brauchst, sitzen wir sogar im Warmen.« Brander hatte zur Sicherheit einen dicken Strickpulli angezogen. Am Tag zuvor hatte er zum Teil in seiner Winterjacke am Schreibtisch gesessen.
»Ich vertrage diese trockene Heizungsluft einfach nicht.«
»Letzten Winter hattest du damit noch keine Probleme.«
»Kannst du nicht einfach wieder zufrieden vor dich hin grinsen?«
Brander tat ihr den Gefallen und lenkte den Wagen auf die B27. »Habt ihr Pläne fürs Wochenende?«
»Nichts Konkretes. Ihr?«
»Am sechsten gehen wir mit Nathalie zum Neckarabschwimmen.«
»Macht sie da mit?«, fragte Peppi.
»Nein, sie hält nur das Handtuch für Marvin bereit.«
Das Neckarabschwimmen der Feuerwehrtaucher am Dreikönigstag hatte eine mehr als fünfzigjährige Tradition in Tübingen. Mittlerweile trafen sich Ehrenamtliche zahlreicher Feuerwehren aus der Umgebung zu diesem frostigen Event. Nathalie war zwar Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Ammerbuch, aber sie war keine Taucherin. Allerdings war sie seit über einem Jahr mit dem Tübinger Feuerwehrtaucher Marvin Feldkamp befreundet.
»Sind die zwei jetzt endlich zusammen?«
»Nein.« Brander seufzte resigniert. Er kannte den Grund für Nathalies Zurückhaltung: Sie hatte Angst, dass es schiefging und sie dann einen guten Freund verlor.
Peppi gähnte herzhaft. »Mal schauen, vielleicht kann ich Marco überreden, dass wir auch hingehen. Wann geht das los?«
»Ich glaube, um zehn.«
»Dann rechne eher nicht mit Marco und mir. Ich dachte, das wäre nachmittags.«
»Tja, Leben retten ist nichts für Langschläfer.«
»Die einen retten morgens, die anderen in der Nacht«, erwiderte Peppi lapidar. Sie drehte den Sitz ein Stück zurück und schloss die Augen.
»Jetzt sind wir heute schon eine Stunde später dran als sonst, und du bist trotzdem nicht ausgeschlafen«, kommentierte Brander.
»Dein Fahrstil ist so einschläfernd. Da kann ich die Augen einfach nicht offen halten.«
Er überließ Peppi ihren Träumen und zockelte gemütlich über die B27. Sie hatten keine Eile. Inspektionsleiter Hans Ulrich Clewer hatte die morgendliche Teambesprechung auf den späten Vormittag verlegt, da zum einen ohnehin die Hälfte der Kollegen im Urlaub war und er zum anderen einen Arzttermin hatte.
Kurz vor der Ausfahrt nach Walddorfhäslach wurde er von einem Rettungswagen mit Lichtsignal und Sirene überholt, der dann halsbrecherisch wieder nach rechts zog, um die Ausfahrt zu erwischen.
»Oje, was ist da los?« Peppi hatte die Augen wieder geöffnet und sah dem Wagen hinterher.
Eine gute halbe Stunde später parkte Brander in der Tiefgarage unter dem Dienstgebäude in der Agnespromenade. Auf dem Weg zu ihrem Büro begegnete ihnen kaum jemand, und in den Zimmern auf dem Flur der Kriminalinspektion 1 herrschte gähnende Leere. Fabio Esposito und die neue Kollegin Emilia Gorsky hatten bis zum Ende der Woche Urlaub. Peter Sänger war krank. Stephan Klein kam ohnehin ins Büro, wann er wollte, und Clewer war noch beim Arzt.
Brander und Peppi gingen in ihr Büro, hängten die Jacken auf und schalteten die Computer ein. Brander öffnete ein Vernehmungsprotokoll vom Vortag. In der Silvesternacht hatte es am Esslinger Bahnhof eine Schlägerei gegeben, in deren Folge eine Person mit einer Messerstichverletzung im Krankenhaus landete. Natürlich konnte sich niemand der Anwesenden erinnern, wer den Streit begonnen und wer das Messer gezückt hatte. Es gab Überwachungskameras. Die Aufnahmen sollten sie heute zur Auswertung bekommen.
Nach wenigen Minuten riss Peppi, wie am Tag zuvor, das Fenster sperrangelweit auf. Vorbei war es mit der kuscheligen Wärme. Brander war froh, dass er sich für den dicken Pulli entschieden hatte, und setzte seine Strickmütze wieder auf.
»Jetzt übertreibst du aber ein bisschen«, kommentierte Peppi.
»Tut mir leid, werte Kollegin, aber ich habe keine Hitzewallungen. Da draußen hat es minus sechs Grad.« Brander kannte seine Kollegin gut genug, dass er sich diese Stichelei erlauben durfte.
»Das Zimmer ist völlig überheizt und die Luft staubtrocken.«
Dem konnte Brander nicht widersprechen; er mochte es dennoch gern mollig warm und wollte die Computermaus nicht mit Handschuhen bedienen. Er rief ein zweites Dokument auf und nieste. »Jetzt werde ich auch noch krank!«
»Männerschnupfen von ein bisschen frischer Luft?« Peppi zog die Nase kraus. »Soll ich dir einen Kamillentee aus der Kaffeeküche mitbringen?«
»So hast du dir das gedacht: Ich sitze hier im Eissalon und friere mir den Allerwertesten ab, während du gemütlich drüben deinen Kaffee schlürfst.«
Peppis Antwort war ein breites Grinsen.
Brander hatte sich mit Tee und Strickmütze in der Eishöhle seines Büros eingerichtet und vergnügte sich mit den ersten Videoaufzeichnungen. Sechs Männer zwischen fünfzehn und einundzwanzig Jahren waren in der Silvesternacht aneinandergeraten. Sie kannten sich untereinander. Drei von ihnen waren bereits aktenkundig. Doch die Eskalation mit einem Messer, das sein Ziel im Bauchraum eines Sechzehnjährigen gefunden hatte, war eine neue Dimension der Gewalt.
Angeblich hatte keiner von ihnen das Messer gezückt, und die Tatwaffe war bisher nicht gefunden worden. Brander vermutete, dass es im nahen Neckar gelandet war. Sie hatten über das Öffentlichkeitsreferat eine Pressemeldung herausgeben lassen mit der Bitte, dass sich Zeugen melden sollten. Heutzutage wurde alles Mögliche gefilmt, da war die Chance groß, dass auch jemand seine Kamera auf die Schlägerei oder das Geschehen danach gerichtet hatte.
Branders Telefon klingelte und zeigte die Handynummer des Inspektionsleiters an.
»Hallo, Andreas«, meldete Clewer sich atemlos. »Wie ist die Lage?«
»Gut so weit. Was schnaufst du so?«
»Bin beim Doc, Ergometer, Belastungs-EKG.«
»Und das ist so langweilig, dass du Unterhaltung brauchst?«, flachste Brander.
»Spannend ist anders. Aber deswegen rufe ich nicht an. Folgendes: Es gab einen Leichenfund im Schönbuch, mutmaßlich ein Suizid. Beim KDD ist gerade niemand verfügbar. Sie haben das an die Tübinger weitergegeben. Da sind sie zurzeit komplett Land unter. Die eine Hälfte der Belegschaft ist im Urlaub, den Großteil der anderen hat ein Virus außer Gefecht gesetzt. Jetzt haben die vom Präsidium angefragt, ob wir jemanden vorbeischicken können. Kannst du das mit Persephone übernehmen?«
»Ja.« Brander warf einen Blick auf den Monitor seines PCs, auf dem ein Video vom Busbahnhof gerade im Pausenmodus ruhte. Er würde Stephan bitten, mit der Sichtung der Aufzeichnungen weiterzumachen.
»Wo genau im Schönbuch?«, wandte er sich wieder an den Inspektionsleiter. Der Naturpark erstreckte sich über ein Gebiet von fünfzehntausendsechshundert Hektar südwestlich von Stuttgart zwischen Aichtal, Tübingen und Herrenberg.
»Momentchen … Zwischen Dettenhausen und Pfrondorf. In dem Waldstück gibt es eine Wildbeobachtungskanzel. Fahrt zum Wanderparkplatz … Oje, was hab ich da geschrieben? Eichenfluss? Nein, Eichenfirst heißt das. Da ist ein Kollege, der kann euch einweisen.«
»Okay. Hast du noch weitere Informationen?«
»Nein, ich muss jetzt auch Schluss machen. Ich krieg hier schon tadelnde Blicke, weil ich nebenbei arbeite.«
Verständlich. Brander wünschte, sein Chef wäre nicht immer so diensteifrig. Aber so war Kriminaloberrat Hans Ulrich Clewer. Immer für alle erreichbar.
***
Auf den ersten Blick deutete kaum etwas am Wanderparkplatz Eichenfirst auf den Leichenfund hin. Lediglich ein Einsatzfahrzeug stand auf der großen Fläche, und ein uniformierter Kollege regelte am Wildgatter den Zutritt zum Naturpark. Ein Leichenwagen parkte diskret im Abseits, als würden die Insassen eine Mittagspause machen, statt darauf zu warten, dass eine Leiche zur Abholung freigegeben wurde. Ansonsten stand nur noch ein roter Kleinwagen mit Böblinger Kennzeichen auf dem Parkplatz.
»Wie weit ist es?«, erkundigte Brander sich bei dem Beamten am Gatter.
Der bewegte abwägend den Kopf. »Drei, vier Kilometer. Sie können mit dem Wagen reinfahren. Ein kleines Stück geradeaus, bei dem Mammutbaum links ab«, instruierte der Kollege. »Wo sich der Weg wieder gabelt, müssen Sie sich rechts halten, dann nächste wieder rechts, das ist die Kirnbachstraße. Der folgen, und dann stehen da schon die Kollegen.«
»Okay, danke.«
Peppi lenkte den Wagen über den geschotterten Waldweg in den Naturpark. »Dann halt mal Ausschau nach einem Mammutbaum zwischen all den Bäumen.«
»Ich denke, er meint den da vorn.« Brander deutete auf einen riesigen Baum, der autark auf dem Dreieck zwischen den sich gabelnden Waldwegen stand. Die Äste des Nadelbaums gingen unten ausladend in die Breite, während sich die Spitze nach oben hin verjüngte. Er überragte die umstehenden Laub- und Nadelbäume um einige Meter. Eine hölzerne Bank umrundete den mächtigen Stamm.
Peppi bog wie geheißen links ab. Der Weg war gesäumt von kahlen Eichen und Buchen, zwischendrin sorgten ein paar kleine Nadelgehölze für einen mattgrünen Farbtupfer, den Boden bedeckte verrottendes Laub.
»Warst du schon mal hier?«, fragte Brander.
»Kann mich nicht erinnern. Aber ich bin auch nicht so die Waldläuferin.«
»Da vorn musst du rechts.« Brander deutete auf die Abzweigung vor ihnen.
Es ging ein Stück bergab, dann kamen sie an eine Kreuzung. Peppi hielt an. »Ist das jetzt die Kirnbachstraße?«
Die »Straße« unterschied sich nicht von dem Waldweg, über den sie gekommen waren. »Wir haben zumindest gerade einen Bach überquert«, bemerkte Brander. »Das könnte der Kirnbach gewesen sein.«
Peppi bog auf den Schotterweg ab, der durch eine Wildruhezone führte. Nachdem der Weg einen leichten Bogen gemacht hatte, sahen sie die Rücklichter der anderen Einsatzfahrzeuge.
Sie reihten sich in die Schlange der parkenden Autos ein. Die kalte Luft, die sie draußen empfing, ließ Brander den Kragen seiner Jacke hochschlagen. Ein Stück entfernt unterhielten sich eine Kollegin und ein Kollege in Uniform miteinander. Brander und Peppi gingen zu ihnen.
Die beiden standen vor einem Trampelpfad, der vom Hauptweg abging und über einen schmalen Graben führte. Dahinter befand sich auf einer kleinen Erhebung eine Wildbeobachtungskanzel. Der große viereckige Unterstand war auf dicken Pfosten errichtet worden. Eine steile Holztreppe führte an der rechten Seite hinauf. Die Kriminaltechniker waren bereits im Einsatz. Polizeiabsperrband beschränkte den Zutritt.
Brander stellte sich und Peppi den beiden Uniformierten vor.
»Winkler, Polizeiposten Aichheim«, erwiderte der ranghöhere der beiden Beamten. Ein schlanker Mann mit leicht verhärmten Zügen um die Mundwinkel, graubraunem kurzem Haar, Dreitagebart. Er war Polizeioberkommissar, entnahm Brander den Schulterlitzen. Er schätzte den Mann auf Mitte vierzig. Seine Kollegin, »P. Vessler« stand auf der Uniform, war wesentlich jünger und einen Kopf kleiner.
»Den Weg hätten Sie sich sparen können.« Winklers Miene zeigte deutlich, dass er die Anwesenheit zweier Kripo-Leute für überflüssig hielt.
»Setzen Sie uns bitte ins Bild«, bat Brander. »Außer dass es sich um einen mutmaßlichen Suizid handelt, haben wir bisher keine Informationen erhalten.«
»Der Tote heißt Karl Lederer, sechsundvierzig Jahre, wohnhaft in Aichheim. Verheiratet, eine Tochter. Er hat sich mit einer Schrotflinte in den Schädel geschossen.«
»Waren Sie dabei?«, fragte Peppi.
Winkler sah sie irritiert an. »Was ist denn das für eine Frage?«
»Woher wissen Sie, dass der Mann sich tatsächlich selbst erschossen hat? Mit einem Gewehr ist das gar nicht so einfach.«
Peppis Hinweis ging Winkler gegen den Strich. Sein Blick verfinsterte sich. »Ich bin lange genug im Dienst, dass ich einen Suizid erkenne.«
»Wo ist denn der Tote?«, hakte Brander nach.
Winkler deutete mit dem Kopf zu dem Wildbeobachtungsstand. »Da oben in der Kanzel. Ich weiß gar nicht, wie wir den da runterkriegen sollen. Hab die Feuerwehr angefordert, damit die bei der Bergung helfen. Verflucht, warum schießt der sich nicht zu Hause in den Kopf, statt uns solche Scherereien zu bereiten?«
»Ein bisschen mehr Respekt, Herr Winkler. Ein Mensch ist tot«, wies Brander den Mann zurecht. Pietätlosigkeit gegen einen Toten ging ihm gegen den Strich.
Der Kollege schnaubte abfällig.
»Sie kannten Herrn Lederer?«, hakte Brander nach.
Winkler sah flüchtig zu seiner Kollegin, die bisher noch keinen Mucks von sich gegeben hatte, bevor er die Frage beantwortete. »Aichheim ist ein Dorf. Da kennt jeder jeden.«
»Das heißt also, Sie kannten ihn?«
»Das sagte ich gerade.«
Nicht so wörtlich, dachte Brander und bedauerte, dass sich die Fronten zwischen ihnen so schnell verhärtet hatten. Das war ungewöhnlich, normalerweise kam er mit den Kollegen vor Ort gut aus. »Wie gut kannten Sie Herrn Lederer?«
»Wie man die Leute halt kennt.«
»Was war er für ein Mensch?«
Winkler zuckte die Achseln. »Er war ein Eigenbrötler, lebte zurückgezogen, blieb lieber für sich.«
»War er suizidgefährdet?«
Der Mann hob erneut die Schultern. »Man schaut den Leuten immer nur vor den Kopf.«
»Was ist mit Ihnen? Kannten Sie den Toten?«, wandte Brander sich an die schweigende Polizeikommissarin.
»Frau Vessler ist erst seit Kurzem in Aichheim«, kam Winkler ihr mit einer Antwort zuvor.
»Seit wann sind Sie beim Polizeiposten Aichheim?«, sprach Peppi die Kollegin direkt an.
Vessler grinste schwach. »Seit vorgestern.«
Sie hatte ihren Dienst zum Jahresbeginn angetreten. Da kannte sie mit Sicherheit kaum einen der Dorfbewohner.
»Wo waren Sie vorher?«, erkundigte Peppi sich.
»In Nürtingen.«
Brander sah zu der Wildbeobachtungskanzel. Unterhalb, an einen der Balken gelehnt, entdeckte er ein Trekkingbike. »Wem gehört das Fahrrad?«
»Herrn Lederer«, antwortete Winkler.
»Das heißt, er ist mit dem Fahrrad hergefahren?«
»Davon gehen wir aus. Er hat kein Auto.«
»Ist bekannt, wann er hergefahren ist?«
»Nein.«
Jetzt im Winter besuchten sicher nicht besonders viele Leute die Wildbeobachtungskanzel, mutmaßte Brander. Auch wenn der Unterstand durch die Holzwände windgeschützt war, musste es einem da oben auf längere Zeit ziemlich kalt werden. Außerdem gab es im Winter nicht allzu viel zu sehen – im Herbst war ein Besuch interessanter. Zur Hirschbrunft herrschte in den Kanzeln des Naturparks dichtes Gedränge, und ein versehentliches Husten konnte dem Verursacher tödliche Blicke der anderen Wildtierbeobachter einbringen.
»Wer hat ihn gefunden?«, wandte Brander sich den Kollegen wieder zu.
»Seine Frau«, erwiderte der Polizeioberkommissar.
»Seine Frau?«, echote Brander überrascht. »Wo ist sie?«
»Im Krankenhaus.«
»Ist sie verletzt?«
»Nein, die Sanitäter haben sie zur Beobachtung mitgenommen. Sie stand unter Schock. Der Arzt hat ihr ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht.«
Brander nickte verständnisvoll. Ein Mensch, der sich mit einer Schrotflinte in den Schädel schoss, bot keinen angenehmen Anblick. Umso grauenvoller, wenn der Tote eine geliebte Person war. »War sie bei ihm, als er –«
Winkler unterbrach ihn mit einem Kopfschütteln. »Nein, sie sagte, sie habe ihn heute Vormittag hier gefunden. So steif, wie er da schon war, muss er sich irgendwann in der Nacht erschossen haben.«
Brander musterte sein Gegenüber grübelnd. Warum sprach er so gefühlskalt über den Toten? War das ein Schutzmechanismus, um das Geschehen nicht zu sehr an sich heranzulassen, oder gab es einen anderen Grund? »Warum ist seine Frau hergekommen?«
»Das müssen Sie Frau Lederer selbst fragen. Ich habe keine Ahnung, warum sie hier war. Sie hat sich vor einem halben Jahr von ihm getrennt, lebt jetzt mit ihrer Tochter in Herrenberg.«
»Weiß die Tochter schon, was geschehen ist?«
»Nicht von uns. Ich weiß aber nicht, ob Frau Lederer mit ihr gesprochen hat.«
»Wie alt ist das Mädchen?«
»Sechzehn.«
Es waren noch Weihnachtsferien. Brander fragte sich, ob die Tochter allein zu Hause war. »Informieren Sie bitte die Kollegen in Herrenberg. Jemand muss sich um sie kümmern.«
»Frau Vessler, übernehmen Sie das bitte«, delegierte Winkler.
»Ja.« Die junge Polizeikommissarin eilte zu einem der Dienstwagen.
Winkler sah ihr mit kritischer Miene hinterher, als traue er der jungen Frau diese Aufgabe nicht zu.
»Ich habe das Gefühl, dass Sie keine besonders gute Meinung von Herrn Lederer haben«, lenkte Brander die Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Was hat der Mann sich zuschulden kommen lassen?«
Der Polizeioberkommissar hob die Schultern. »Er ist nicht aktenkundig.«
»Aber?«
»Kein Aber. Er ist nicht aktenkundig. Punkt.«
»Peppi?«, erklang eine weibliche Stimme von der anderen Seite der Absperrung. Kurz darauf gesellte sich eine der Kriminaltechnikerinnen im Schutzanzug zu ihnen.
»Mensch, Greta, in dem schicken Outfit habe ich dich gar nicht erkannt.« Peppi lächelte erfreut. »Was machst du hier? Ich dachte, du bist in Balingen?«
»War ich auch, bin aber seit einem halben Jahr in Tübingen. Die haben ja wieder etwas aufgestockt, und ich brauchte einen Tapetenwechsel. Und du? Bist du nicht in Esslingen?«
»Wir helfen aus. Kannst du uns schon was sagen?« Peppi nickte Richtung Kanzel.
»Wir versuchen, an Spuren zu sichern, was möglich ist, aber es wird schwierig, davon etwas in einen eindeutigen Tatzusammenhang zu bringen. Hier kann jeder herumspazieren, wie er will. Und dass etliche Personen vor uns am Leichenfundort waren, macht die Sache nicht leichter.« Bei ihrem letzten Satz glitt ihr Blick flüchtig zu Winkler.
»Die Frau saß da oben auf den Stufen. Was hätte ich denn machen sollen?«, fuhr Winkler auf. »Sie da sitzen lassen, bis sie erfroren ist?«
»Wo genau hat Frau Lederer gesessen?«, fragte Brander.
»Auf dem obersten Treppenabsatz. Sie stand unter Schock. Sie war nicht in der Lage, die steile Treppe allein herunterzukommen. Ich bin hinauf und habe sie runtergebracht, damit sie den Anblick ihres toten Mannes nicht länger als notwendig ertragen muss.«
Endlich mal ein menschlicher Zug an Winkler in dieser Angelegenheit. »Niemand macht Ihnen einen Vorwurf«, beschwichtigte Brander ihn. »Wir benötigen nur jegliche Information zu dem, was hier vorgegangen ist. Sie kennen das Prozedere. Konnten Sie irgendetwas von seiner Frau erfahren?«
»Nein, sie war nicht vernehmungsfähig.«
Brander wandte sich an die Kriminaltechnikerin. »Können wir uns den Toten anschauen?«
»Ja. Leichenschau da oben wird allerdings schwierig. Ist ziemlich eng, und abgesehen von der Kälte ist auch der Rigor Mortis mittlerweile voll ausgeprägt.«
Brander und Peppi zogen Schutzkleidung an und folgten dem gekennzeichneten Pfad zur Wildbeobachtungskanzel. Die unteren Holzstufen der steilen Treppe, die nicht unter dem Schutz des Daches lagen, waren feucht und rutschig. Winkler hatte recht. Einen Toten mit voll ausgeprägter Leichenstarre hier herunterzubringen war kein leichtes Unterfangen.
Oben angekommen, blieb Brander stehen und sah ins Innere der Kanzel. Zwei durchgehende Bänke waren hintereinander eingebaut worden, Holzwände schirmten die Sicht an den Seiten und nach hinten ab, nach vorn hin war ein ungefähr einen halben Meter breiter Schlitz offen gelassen worden, der den Blick auf eine Waldwiese freigab. Mehrere Reihen junger Bäume waren dort mit großzügigem Abstand gepflanzt.
Brander wandte sich wieder dem Inneren der Kanzel zu. Er musste ein paar Schritte hineingehen, um den toten Mann sehen zu können. Er war am anderen Ende der Kanzel von der Bank gerutscht, hing dort eingeklemmt zwischen der Rückenlehne der vorderen Sitzbank und der Sitzfläche der hinteren Bank. Da er ihnen den Rücken zukehrte, war das Gesicht nicht zu erkennen. Die Schrotflinte lag halb bedeckt unter seinem Körper am Boden.
Karl Lederer trug Outdoorhose und Winterjacke, die dicke Wollmütze hing nur noch halblebig an seinem Hinterkopf. Es war ein trostloses Bild. Ein Eigenbrötler, hatte Winkler gesagt. Der Anblick wirkte auf Brander, als wollte der Mann sich auch im Tod noch vor der Welt verstecken. Er schluckte trocken. Um die Emotionen nicht überhandnehmen zu lassen, ließ er den Blick weiterschweifen.
In der vorderen Sitzreihe entdeckte er auf dem Boden eine zusammengeknüllte Wolldecke, daneben eine umgekippte Radgepäcktasche. Auf der Sitzfläche der Bank lag ein silberfarbenes Thermositzpad. Gehörte es dem Toten? Warum befand es sich in der ersten Reihe, während Lederer sich in die zweite, ins hinterste Eck verkrochen hatte?
Brander wandte sich um und wäre fast mit Peppi zusammengestoßen, die ihm gefolgt war. Er fasste eilig ihren Arm, damit sie nicht rücklings hinunterstürzte. Auf dem Absatz vor der Treppe war es verflucht eng. »Wo ist deine Bekannte?«
»Steht unten.«
Brander beugte sich vor. »Greta?«
»Bei der Arbeit.« Die Frau sah zu ihnen herauf.
»Habt ihr hier oben irgendetwas verändert?«
»Nein.«
»Das heißt, die Radtasche, die Decke und das Sitzpad lagen vorn in der ersten Reihe?«, vergewisserte Brander sich.
»Ja.«
»Danke.« Er wandte sich wieder dem Raum zu, ging ein paar Schritte vor der ersten Bank entlang. Bei der Radtasche kniete er nieder und schaute sich den Inhalt an: eine Thermoskanne, dem Gewicht nach zu urteilen noch voll, ein Nachtsichtfernglas, eine Lunchbox mit belegten Broten, anscheinend unberührt, zwei Packungen Taschentücher, eine Tüte Gummibärchen.
Brander richtete sich wieder auf und sah ratlos zu Peppi. »Warum nimmt er Verpflegung für die halbe Nacht mit, wenn er vorhat, sich umzubringen? Und warum stellt er die Sachen hier ab und hockt sich dann in die hinterste Ecke?«
»Gute Frage.« Peppi verschränkte die Arme vor der Brust. »Wie kann der Kollege Winkler so sicher sein, dass es ein Suizid war?«
Brander sah zum Opfer. »Er liegt auf der Waffe. Der Täter wird das Gewehr vermutlich nicht unter seinen Körper geschoben haben.«
»Warum nicht?«
Ja, warum nicht? Darauf wusste Brander keine Antwort. Er schnaufte unschlüssig. »Der Mann kommt her, steigt auf die Kanzel und richtet sich in der ersten Reihe ein.« Er ließ erneut den Blick schweifen. »Wie hat er das Gewehr transportiert? Ich sehe keine Waffentasche, und in die Radtasche passt das Ding nicht.«
»Vielleicht hat er die Flinte auf den Gepäckträger geschnallt.«
Für den Kommentar erntete Peppi ein zweifelndes Stirnrunzeln ihres Kollegen. Sie zuckte die Achseln. »Wir können im Dorf nachfragen. Vielleicht hat ihn jemand gesehen, als er hergefahren ist.«
»Und es wundert sich niemand, warum der Mann nachts mit einem Gewehr durch die Gegend radelt?«
»Vielleicht hat er das öfter gemacht.«
»Das sollte doch dann zumindest der Kollege Winkler wissen.«
»Fragen wir ihn.«
Branders Blick fiel erneut auf den toten Mann. Was war an diesem Ort in der Nacht geschehen? Was hatte Karl Lederer dazu getrieben, sich in die hinterste Ecke zu verkriechen und zu erschießen? Wofür das Essen, ein Thermopad und eine Decke? »Für mich sind das alles zu viele Ungereimtheiten.«
Die Feuerwehr hatte den Leichnam mit einiger Mühe von der Kanzel herunterbefördert. Am Boden hatte Brander mit Peppi und der Kriminaltechnikerin Greta Mack die erste Leichenschau durchgeführt, bevor der Mann von den Bestattern abgeholt wurde.
Karl Lederer war eins dreiundsiebzig groß, hatte, dem Bauchansatz nach zu urteilen, etwas Übergewicht, lichtes Haar und blasse Haut. Das Gesicht war von der Schussverletzung entstellt. Schmauchhöhle und Stanzmarke auf der Haut zeigten an, dass Lederer sich die Mündung der Flinte direkt unter das Kinn gepresst und dann abgedrückt haben musste.
In den Taschen seiner Jacke fanden sie Ausweispapiere, ein Smartphone und einen Schlüsselbund. Einen Abschiedsbrief entdeckten sie nicht.
Nachdem die erste Leichenschau beendet war, wandte Brander sich noch einmal an Polizeioberkommissar Winkler, der weiter die Absperrung bewachte. »War Herr Lederer öfter nachts mit seinem Jagdgewehr unterwegs?«
Winkler hob die Augenbrauen. »Ich wusste gar nicht, dass er eines besaß. Er hat weder einen Jagd- noch Waffenschein.«
»Und seine Frau?«
»Soll das ein Witz sein?«, fragte Winkler empört.
»Woher hat er dann das Gewehr?«
»Schwarzmarkt?«
»Ernsthaft?« Brander hob zweifelnd die Augenbrauen.
»Was weiß ich, woher er das Gewehr hat. Sicher nicht von Monika«, erwiderte Winkler unwirsch. »Vielleicht ist das ’ne alte Flinte von seinem Großvater.«
Das war eine Option. Dem Zustand der Waffe nach zu urteilen, war diese älteren Datums. Genaueres mussten die Schusswaffenexperten herausfinden, wenn die Flinte nicht offiziell registriert war. »Hat seine Frau hier einen Abschiedsbrief bei ihm gefunden?«
»Nein.«
Vielleicht hatte Lederer zu Hause etwas für seine Familie hinterlassen, überlegte Brander.
»Was ist mit seiner Tochter?«, wandte Peppi sich an die Kollegin Vessler.
»Die Kollegen aus Herrenberg waren mehrfach bei ihr zu Hause«, berichtete die Polizeikommissarin. »Aber sie haben das Mädchen bisher nicht angetroffen, wobei sich die Kollegen nicht sicher waren, ob sie tatsächlich nicht zu Hause war oder einfach nur nicht aufgemacht hat. Monika Lederer wohnt mit ihrer Tochter in einer Einliegerwohnung. Die Vermieter waren leider auch nicht daheim.«
»Gibt es andere Orte, wo man sie finden könnte?«
Vessler sah fragend zu POK Winkler. Der hob die Schultern. »Da können wir nicht weiterhelfen. Das Mädchen hat meines Wissens keine Freundinnen in Aichheim.«
***
Es dämmerte bereits, als Brander sich mit Peppi auf den Weg zum Haus des Toten machte. Er drehte die Heizung im Wagen hoch. Nachdem sie stundenlang in der Kälte gearbeitet hatten, war er ordentlich durchgefroren.
Unterwegs telefonierte er mit Kriminaloberrat Hans Ulrich Clewer. Obwohl es keine Anzeichen für Fremdeinwirkung gab, wurde Brander das Gefühl nicht los, dass an dem Suizid irgendetwas nicht stimmte. Bereits die Auffindesituation hatte Fragen aufgeworfen. Die Unwilligkeit von Polizeioberkommissar Christian Winkler, ihnen detaillierte Auskunft über Karl Lederer zu geben, machte ihn zusätzlich misstrauisch. Polizeikommissarin Paula Vessler hielt sich ebenfalls auffällig zurück. Aber sie war neu in der Dienststelle und wollte es sich vermutlich nicht gleich in der ersten Woche mit ihrem Kollegen verscherzen.
Aichheim lag wenige Kilometer von dem Wanderparkplatz entfernt. Von der Kreisstraße Richtung Tübingen führte eine schmale Straße in das Dorf, das kaum tausend Einwohner zählte. Am Ortseingang verkündete eine Infotafel die Gottesdienstzeiten, an der nächsten Querstraße wies ein Schild zum Fußballplatz.
Sie fuhren geradeaus weiter, passierten den Dorfplatz, an dessen Rand ein Brunnen vor einer Kirche stand. Ein paar Jugendliche hatten sich dort versammelt und sahen neugierig zu ihnen, als sie vorüberfuhren.
Peppi bog links in die Alemannenstraße und parkte vor dem Einfamilienhaus, in dem Karl Lederer gewohnt hatte. Es war ein kleines Haus mit Spitzdach aus den fünfziger oder frühen sechziger Jahren, schätzte Brander. Vermooste rote Schindeln, der einst helle Putz fleckig und grau. Die Rollläden waren an sämtlichen Fenstern heruntergelassen.
Ein Zaun aus breiten Eichenbohlen verlief um das Grundstück herum. Dahinter wucherten Sträucher und Hecken, die einen Schnitt gut vertragen könnten. Da das Laub an den winterlichen Zweigen fehlte, hatte man gute Sicht auf Haus und Grundstück. Der löchrige Rasen links und rechts des geplättelten Weges, der zum Hauseingang führte, lag noch im Winterschlaf.
Brander bemerkte einen jungen Mann, der im Hof des Nachbargebäudes stand und ihre Ankunft beobachtete. Als Brander den Blick erwiderte, wandte er sich ab und verschwand im Haus. Ein Dachdeckerbetrieb war dort ansässig, verriet ein Firmenschild an einer Werkstatthalle, die an Lederers Grundstück grenzte.
»Herrje, hier möchte ich auch nicht tot überm Zaun hängen«, seufzte Peppi.
Brander bedachte ihren Kommentar mit einem tadelnden Seitenblick.
»Ist doch wahr: In diesem Dorf gibt’s ja gar nichts. Hier bellt nicht mal ein Hund.«
Da hatte Peppi allerdings recht. Es war ungewöhnlich still. Außer der Kirche im Zentrum, dazu ein kleines Rathaus, in dem sich auch der Polizeiposten befand, hatte Brander keine öffentlichen Gebäude oder Geschäfte gesehen. Keine Bäckerei, kein Metzger, nicht einmal eine Kneipe.
Die Straßen waren leer gefegt, lediglich die paar Jugendlichen auf dem Dorfplatz hatten angezeigt, dass es Leben in diesem Ort gab. Allerdings war das kalte Wetter nicht unbedingt einladend, um sich ohne Not längere Zeit im Freien aufzuhalten.
Sie gingen zur Eingangstür und ließen sich mit Lederers Schlüssel selbst herein. In dem stockfinsteren Haus empfing sie muffige Luft. Brander schaltete das Flurlicht ein. Abgetragene Lederschuhe und ein altes Paar Turnschuhe standen unordentlich unter einer Garderobe, an der einsam eine Strickjacke hing.
Der Fußboden hatte seit Längerem keinen Wischmopp mehr gesehen, verrieten die Schuhabdrücke, die feuchte Sohlen auf den braunen Fliesen hinterlassen hatten. Auch der lange Teppichläufer, der mittig auf den Fliesen lag, wies Schmutzflecken auf, und die kleine Anrichte aus dunkel lackiertem Pressholz zierte eine leichte Staubschicht. Eine schmale Treppe führte in die obere Etage. Braungrüne Teppichfliesen lagen auf den steinernen Stufen.
»Wo fangen wir an?« Peppi zog ihren Schal über die Nase. Sie hatte einen empfindlichen Geruchssinn.
»Du unten, ich oben?«
»Okay.«
Während Peppi an der Treppe vorbei durch den schmalen Flur ging, stieg Brander die Stufen hinauf. Es gab drei Türen. Eine führte ins Bad – dunkelgrüne Kacheln, beiges Waschbecken, beige Duschwanne mit einem Plastikvorhang, der am Saum Schimmelränder aufwies. Brander sah in den Spiegelschrank, entdeckte einen Rasierapparat und mehrere Medikamentenschachteln: Schmerztabletten, Antidepressiva, ein Schlafmittel.
Die nächste Tür führte in ein fast leeres Zimmer. Auf dem Teppichboden zeichneten sich die Abdrücke der Möbel ab, die einst hier gestanden hatten. Bett, Schrank und Schreibtisch. An der Wand hing ein Poster, das eine futuristische, dystopisch anmutende Landschaft zeigte. Brander vermutete, dass es das Zimmer von Lederers Tochter gewesen war.
Die letzte Tür führte ins Schlafzimmer. Auch hier war die Luft kalt und abgestanden. Eine Hälfte des Doppelbetts war nicht gemacht, die andere leer. Ein gestreifter Pyjama lag achtlos auf dem zerwühlten Laken. Die Dachschräge war mit dunklem Holz vertäfelt, die Vorhänge vor dem kleinen Fenster hatten einen Grauschleier.
Auf dem Nachttisch stand ein silberfarbener Bilderrahmen mit dem Foto einer Frau und eines Mädchens – Lederers Frau und seine Tochter, vermutete Brander. Verstreut auf dem Boden vor dem Bett lagen benutzte Taschentücher. In die einzige gerade Wand des Dachgeschosszimmers war ein großer Einbauschrank eingelassen.
Brander schaute in die Schubladen des Nachttisches: Taschentücher, auch hier eine Packung Antidepressiva und Schlaftabletten, daneben eine Taschenlampe. Er schloss die Schublade wieder, ließ den Blick umherschweifen. Dieser Raum war so trostlos wie der Anblick des Toten in der Wildbeobachtungskanzel.
»Andi, komm mal bitte«, durchbrach Peppis Stimme die Stille.
Er ging hinunter und fand seine Kollegin in der Küche. Die Beschreibung des Mobiliars als »Vintagelook« wäre geschmeichelt gewesen. Die Küchenzeile mit grünem Frontdekor schien ähnlich alt wie das Haus zu sein. Lediglich die Spülmaschine und der Kühlschrank waren neueren Datums.
Auf dem Gasherd stand ein Topf mit Resten eines Doseneintopfs. In der Mitte des Raums befand sich ein schlichter Holztisch mit drei klassischen Diner-Küchenstühlen: verchromtes Rohrgestell, Sitzfläche und Rückenlehne waren mit blaugrünem Kunstleder bezogen. Gebrauchtes Geschirr stand auf der einen Seite des Tisches, auf der anderen lagen Zeitungen und lose Zettel unordentlich übereinandergestapelt.
»Und?«, fragte Brander.
Peppi deutete auf die Zettelwirtschaft auf dem Küchentisch. »Schau dir das mal an.«
Brander trat näher an den Tisch, warf einen Blick auf die Papiere. Sein Puls beschleunigte sich. »Oh mein Gott.«
***
Jasmin hatte sich in ihr Zimmer verzogen, während Monika Lederer im Wohnzimmer saß, dessen Sofa gleichzeitig als Schlafstätte diente. In der Zwei-Raum-Wohnung hatte sie kein eigenes Zimmer, in das sie sich zurückziehen konnte. Doch sie war damals einfach nur dankbar gewesen, dass sie diese Wohnung zu einer für sie erschwinglichen Miete bekommen hatte. Es war eine Einliegerwohnung in einem Haus, das den Eltern einer ehemaligen Kollegin gehörte. Sie hatten ihr die Räume zu einem Freundschaftspreis überlassen.
Die Wohnung lag im Souterrain. Dichte Sträucher im Vorgarten verhinderten, dass Spaziergänger in ihre Fenster schauen konnten. Allerdings ließen sie auch nur wenig Tageslicht hinein. Es war egal. Hauptsache, man ließ sie in Ruhe.
Monika hatte am Nachmittag auf eigenen Wunsch und eigenes Risiko das Krankenhaus in Tübingen verlassen. Sie konnte ihre Tochter in dieser Situation nicht alleinlassen. Mit der Bahn war sie von Tübingen nach Herrenberg gefahren und von dort nach Hause geeilt. Sie würde eine Kollegin bitten müssen, sie zum Eichenfirst-Parkplatz zu bringen, damit sie ihren Wagen dort abholen konnte. Am Nachmittag hatte ihr die Kraft gefehlt, noch einmal dorthin zurückzukehren.
Jasmin war zu Hause gewesen. Zwei Polizeibeamte hatten geklingelt, als Monika noch nicht wieder da gewesen war. Jasmin hatte ihnen nicht geöffnet und wusste nicht, was geschehen war.
Monika war froh, dass nicht fremde Polizisten ihr vom Tod ihres Vaters berichtet hatten. Sie hatte versucht, ihrer Tochter die Nachricht so schonend wie möglich beizubringen. Sie war sich nicht sicher gewesen, wie Jasmin reagieren würde. Das Mädchen hatte ihre Worte mit regloser Miene zur Kenntnis genommen. Weder Schock noch Trauer zeichneten sich in ihrem Gesicht ab, ja nicht einmal Erleichterung. Diese Gleichgültigkeit schmerzte Monika.
Sie musste ihrer Tochter Zeit geben, erklärte sie sich selbst. Die letzten anderthalb Jahre waren die Hölle gewesen. Es war gut, dass sie mit Jasmin aus Aichheim fortgegangen war. Raus aus dem Haus, aus der Enge des Dorfes. Ein Neuanfang an einem neuen Ort, wo sie niemand kannte. Dennoch war Monika innerlich zerrissen. Hatte sie das Richtige getan?
Das Bild hatte sich auf ihre Netzhaut gebrannt: Karl, wie er zusammengekrümmt in der Ecke dieser Kanzel lag. Allein. Schwach. Tot. Wie sollte sie mit dieser Schuld leben?
Monika stand auf, ging zum Zimmer ihrer Tochter, klopfte an. Von drinnen drang kein Geräusch zu ihr. Sie legte das Ohr ans Türblatt, lauschte der Stille. Vermutlich hatte Jasmin die Kopfhörer aufgesetzt, schaute auf ihrem Smartphone irgendwelche Videos an. Ein Onlinespiel spielte sie nicht, sonst würden Rufe aus dem Zimmer schallen – Schreie und Flüche, von denen Monika hoffte, dass ihre Vermieter, die über ihr im Haus wohnten, nichts mitbekamen.
»Jasmin?«, wisperte sie zaghaft. Sie wagte nicht, lauter zu rufen oder zu klopfen. Sie erhielt keine Antwort.
Wenn sich das Mädchen doch wenigstens ihr gegenüber ein wenig öffnen würde. Nur ein kleines bisschen wieder ihre kleine, süße Jasmin werden würde. Das Baby, das sie in ihren Armen gehalten, an ihrer Brust gestillt, das ihr blind vertraut hatte. Nichts schien von diesem unschuldigen Kind mehr zu existieren. Nicht zum ersten Mal wünschte sie sich, sie könnte die Zeit zurückdrehen.
Ihre Kehle wurde eng. Die Nase kribbelte. Das Beruhigungsmittel, das ihr der Arzt am Morgen verabreicht hatte, wirkte längst nicht mehr. Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Wand, rutschte zu Boden. Sie zog die Knie zur Brust, vergrub das Gesicht in den Händen. Sie weinte. Leise, mühsam das Schluchzen unterdrückend, damit Jasmin es nicht hörte. Sie wollte ihre Tochter nicht mit ihrer Pein belasten.
Die Tränen liefen über ihre Wangen, ein schier unaufhörlicher Strom. Ihr Kopf schmerzte, die Augen brannten. Sie konnte kaum atmen, weil die Nasenschleimhäute geschwollen waren. Sie rang nach Luft. In ihr war alles leer. So unendlich leer.
Mühsam kam sie auf die Beine, schleppte sich ins Wohnzimmer, legte sich auf das Sofa. Sie hatte nicht die Kraft, vorher das Laken auszubreiten, Kopfkissen und Bettdecke aus dem Kasten zu holen. Sie bettete den Kopf auf das Sofakissen, zog die Wolldecke über ihren Körper, starrte stumpf in den Raum. Sie hatte kein Licht eingeschaltet, und die Dämmerung tauchte allmählich alles in Dunkelheit.
Ihr Magen knurrte. Sie hatte seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Aber wie sollte sie auch nur einen Bissen runterkriegen? Allein der Gedanke daran verursachte ihr Übelkeit.
Die Melodie ihres Smartphones durchdrang die Stille. Es lag auf dem niedrigen Couchtisch vor ihr. Sie hob den Kopf, schaute auf das Display. Sie kannte die Nummer.
»Warum rufst du jetzt an?«, wisperte sie in den Raum. »Vor anderthalb Jahren hätte ich deine Hilfe gebraucht. Jetzt ist es zu spät.«
Sie ließ den Anruf unerwidert.
***
Die meisten Büros in der Dienststelle waren verwaist, als Brander mit Peppi am späten Abend aus Aichheim zurückkehrte. Auf dem Weg zum Büro des Inspektionsleiters Hans Ulrich Clewer kam ihnen Stephan Klein im Flur entgegen.
»Wo habt ihr euch den ganzen Tag rumgetrieben?«, grüßte er sie. »Wäre Hans nicht nachmittags noch aufgetaucht, wäre ich völlig vereinsamt.« Der knapp zwei Meter große Hüne zog ein bedauernswertes Gesicht, was ihm den Ausdruck einer traurigen Bulldogge gab.
»Du Ärmster.« Peppi tätschelte spöttisch seine Schulter.
»Wir haben einen mutmaßlichen Suizid im Schönbuch.« Brander gab ihm einen kurzen Überblick. »Wir wollen gerade zu Käpten Huc, um zu besprechen, wie wir weiter vorgehen.«
»Das heißt, ich kann mich jetzt allein um die Silvesterschlägerei kümmern?«
»Was ist mit Peter? Ist der noch krank?«
»Bis Ende der Woche.«
»Können wir Fabio aus dem Urlaub holen?«
Stephan bewegte abwägend den Kopf. »Seine Mädels haben Ferien.«
Fabio Esposito war stolzer Vater von drei kleinen Töchtern.
»Was ist mit Emilia?«, fragte Peppi. »Vielleicht bricht sie ihren Urlaub ab, um sich mit dir einen schönen Videoabend zu machen.«
»Die Filmchen vom Busbahnhof kann ich auch allein anschauen, da soll die Emilia ihren Urlaub mal zu Ende genießen. Ich kauf mir ’ne Tüte Chips, dazu ein kühles Blondes, und der Abend ist gerettet«, erwiderte Stephan mit Galgenhumor. Er trottete zurück in sein Büro, während Brander und Peppi Clewers Domizil aufsuchten.
Der Inspektionsleiter deutete auf seine Besprechungsecke, die er sich aus seinem privaten Fundus zusammengestellt hatte, als Brander und Peppi hereinkamen. Sie setzten sich auf die bunten Retrosessel, die um einen niedrigen Nierentisch arrangiert waren. Gipfelbilder der Seven Summits zierten die Bürowände. Clewer war passionierter Bergsteiger, musste dieses Hobby jedoch vor einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.
Brander gab ihm eine Zusammenfassung des Tages. »Wir müssen klären, ob Lederer psychisch erkrankt war. Medikamente, die wir in seinem Nachttisch und im Bad gefunden haben, deuten darauf hin, dass er depressiv war«, kam er zum Ende seines Berichts. »Einen Abschiedsbrief gibt es anscheinend nicht.«
»Und was ist da Schönes drin?« Clewer deutete auf einen großen Umschlag, den Brander und Peppi mitgebracht hatten.
»Nichts Schönes.« Brander reichte seinem Vorgesetzten das Kuvert.
Clewer zog Schutzhandschuhe an und nahm den Inhalt heraus. Stirnrunzelnd betrachtete er das erste Blatt. »Der Mann ist unser Toter?«
»Mutmaßlich, ja. Wir haben das Bild mit dem Foto in seinem Personalausweis abgeglichen.«
»Wer ist das Mädchen?«
»Dem Gesicht nach zu urteilen seine Tochter«, erwiderte Peppi. »Im Wohnzimmer des Hauses standen ein paar Familienfotos in einer Schrankwand, die wir zum Vergleich herangezogen haben.«
Das Bild zeigte ein Mädchen, das den Oberkörper nach vorn gebeugt hatte und in die Kamera schaute. Das Gesicht war tränenverschmiert. Sie war mit einem Fußballtrikot bekleidet, die Shorts waren zu ihren Knöcheln heruntergezogen. Ihr Vater stand hinter ihr, mit heruntergelassener Hose, und hielt sie an den Hüften. Es war eines der »harmloseren« Bilder, die Brander und Peppi auf dem Küchentisch zwischen den Zeitungen gefunden hatten.
Clewer blätterte schweigend durch die restlichen Ausdrucke und steckte sie dann zurück in den Umschlag. Er rieb sich mit Daumen und Zeigefinger über den Nasenrücken. »Hat der Vater die Bilder gemacht?«
»Das wissen wir nicht«, erwiderte Brander. »Wir wissen kaum etwas über ihn. Der Kollege vom Polizeiposten hat ihn als Eigenbrötler beschrieben. Er wusste, dass seine Frau ihn vor gut einem halben Jahr mit der gemeinsamen Tochter verlassen hat. Sie leben in Herrenberg. Wir konnten leider noch mit keiner von beiden sprechen.«
»Und darüber?«, Clewer deutete auf den Umschlag. »Was weiß der Kollege darüber?«
»Laut POK Winkler ist Lederer zumindest polizeilich bisher nicht in Erscheinung getreten. Heute Mittag hat er nichts in der Richtung angedeutet. Seit wir die Bilder entdeckt hatten, haben wir noch nicht wieder mit den Kollegen vom Polizeiposten gesprochen.«
»Herr Winkler hatte allerdings ganz offensichtlich keine gute Meinung von Karl Lederer«, ergänzte Peppi. »Seine Kollegin Paula Vessler ist erst seit diesem Monat dort. Die weiß vermutlich gar nichts über unseren Toten.«
Clewer zeigte erneut auf den Umschlag. »Das könnte zumindest ein Motiv für den Suizid sein.«
»Ja«, stimmte Brander zögernd zu.
»Ich höre da ein ›Aber‹ in deiner Antwort.«
»Es gibt Ungereimtheiten.« Brander beschrieb ihm die Auffindesituation. »Wir haben bisher keinen Abschiedsbrief gefunden. Er hatte Proviant dabei, als wollte er die Nacht dort verbringen. Doch stattdessen legt er alles in der ersten Reihe ab und verkriecht sich in die hinterste Ecke der Kanzel, um sich zu erschießen. Und wie hat Lederer das Gewehr zur Kanzel transportiert? Woher hatte er es überhaupt? Der Mann besitzt offiziell weder ein Gewehr, noch hat er einen Waffenschein.«
»Ein Gewehr kann man sich auch auf anderem Wege besorgen«, gab Clewer zu bedenken.
»Meinem ersten Eindruck nach scheint er mir nicht der Typ gewesen zu sein, sich auf dem Schwarzmarkt eine alte Schrotflinte zu besorgen.« Brander hob die Schultern. »Nenn es Intuition. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendetwas nicht stimmt.«
»Gibt es Zeugen, die etwas beobachtet haben?«
»Die Wildbeobachtungskanzel steht mitten im Wald, Lederer starb vermutlich irgendwann in den Stunden zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens.« Den Todeszeitpunkt hatten sie anhand der fortgeschrittenen Leichenstarre kalkuliert. »Zu der Zeit treibt sich jetzt im Winter kein Mensch im Wald herum. Die nächsten Wohnhäuser sind kilometerweit entfernt. Wir können froh sein, wenn wir jemanden finden, der den Schuss gehört hat.«
»Forstarbeiter?«
»Von denen ist erst jemand aufgetaucht, als sie über den Leichenfund informiert wurden.«
Clewer starrte eine Weile grübelnd vor sich hin. Er war ebenso geschockt von dem Foto, wie Brander und Peppi es gewesen waren. Man konnte noch so lange im Dienst sein – es gab Vorfälle, da fiel es schwer, berufliche Distanz zu wahren. »Gibt es diese Bilder nur ausgedruckt oder auch digital?«, wandte er sich Brander wieder zu.
»Das wissen wir nicht. Aktuell haben wir lediglich sein Smartphone gefunden, das jedoch mit einer PIN gesperrt ist. In seinem Haus gab es weder Laptop noch einen PC.«
»Unsere IT-Forensiker sollen sich das Gerät anschauen und prüfen, auf welchen Seiten der Mann im Netz unterwegs war. Wir müssen wissen, ob noch andere Personen Zugriff auf diese Bilder haben.«
»Ich bringe das Smartphone gleich rüber zu den Kollegen«, erwiderte Brander. Heute würde er dort sicher niemanden mehr antreffen, aber so könnten sich die IT-Experten gleich am nächsten Morgen an die Arbeit machen.
»Was ist mit seiner Frau?«, fuhr Clewer fort. »Hat sie einen Waffenschein?«
»Nein.«
»Aber sie hat ihren Mann heute Morgen gefunden?«
»Ja, da war Lederer allerdings bereits einige Stunden tot.«
»Das besagt nichts. Auch wenn der Notruf erst vormittags kam, kann sie schon vorher dort gewesen sein. Wir müssen beide befragen, Mutter und Tochter.« Clewer seufzte schwer. »Ich spreche mit der Staatsanwaltschaft. Vielleicht kann eine Obduktion uns genauere Hinweise zum Geschehen geben.«
***
Cecilia lag im Bett und schlief, als Brander nach Hause kam. Er hatte nicht die Ruhe, sich hinzulegen, obwohl es das Beste gewesen wäre. Er musste am nächsten Tag erholt sein. Das Gespräch mit der Witwe würde nicht leicht werden. Er bekam die Bilder nicht aus seinem Kopf. Er war schon so viele Jahre Polizist, aber Fälle, bei denen es um Gewalt gegen Kinder oder sexuellen Missbrauch ging, nahmen ihn mehr mit als andere.
Wie konnte ein Vater seinem Kind so etwas antun? Es mochte eine Krankheit sein, er würde es dennoch nie verstehen. Hatte Monika Lederer ihren Mann deswegen verlassen? Wollte sie ihre Tochter vor weiteren Übergriffen schützen? Was hatte sie gewusst?
Um auf andere Gedanken zu kommen, ging Brander ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein. Er scrollte durch die Mediathek und fand eine Reportage über Schottlands Ostküste. Das war genau das richtige Kontrastprogramm, das er jetzt brauchte.
Hatte er nicht vor Kurzem einen Scotch bekommen, aus einer Brennerei, die im Osten Schottlands lag? Er stand noch einmal auf, ging an seine Minibar und studierte die Etiketten der Flaschen. Da war er: Glen Garioch, zwölf Jahre, Single Malt Scotch Whisky. Die Brennerei befand sich wenige Meilen nördlich von Aberdeen und galt als eine der ältesten Destillerien Schottlands mit einer Lizenz seit 1785.
Er füllte sich ein Dram in das hochstielige Whiskyglas, das Cecilia ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. Fruchtig-süße Noten gepaart mit einem leicht malzigen Aroma stiegen ihm in die Nase. Ja, die Entscheidung für diesen Whisky war goldrichtig. Nicht zu aufdringlich, nicht zu extrem in den Aromen, ausgewogen und doch durch das relativ hohe Alkoholvolumen von achtundvierzig Prozent sehr gehaltvoll.
Er kehrte zum Sofa zurück, startete die Dokumentation und träumte sich in die Highlands. Der erste Schluck war scharf am Gaumen, entfaltete aber dann im Geschmack angenehme Zitrusfruchtaromen – Orange vielleicht? Dazu gesellte sich eine dezente Eichennote. Während er dem Whisky nachspürte, hörte er einen Wagen vor dem Haus halten. Der Motor erstarb.
Brander wartete, dass die Tür geöffnet wurde und seine Adoptivtochter hereinkam. Als nichts geschah, stoppte er die Dokumentation und ging in die Küche, um aus dem Fenster zu schauen und zu prüfen, wer so spät in die Sackgasse fuhr, in der er mit seiner Familie wohnte.
Er erkannte den Wagen von Marvin Feldkamp. Nathalie saß auf dem Beifahrersitz. Zu viel Abstand, ging es Brander durch den Kopf. Marvin war so ein feiner Kerl. Warum konnte Nathalie nicht über ihren Schatten springen und dem Werben des Feuerwehrtauchers endlich nachgeben?
Er ließ den beiden ihre Privatsphäre, ging ins Wohnzimmer zurück und widmete sich wieder der Dokumentation. Nach wenigen Minuten kam Nathalie zur Haustür herein.
»Hey, Paps«, grüßte sie vom Flur aus. Sie entdeckte das Glas auf dem Tisch. »Gibt’s was zu feiern?«
»Dass ich diesen Tag hinter mir hab.«
»Oh, oh.« Sie hängte ihre Jacke an die Garderobe, kam ins Wohnzimmer und kuschelte sich neben ihn. »Der Suizid?«
»Woher weißt du schon wieder davon?«
»Du weißt doch: Wir Feuerwehrleute tratschen untereinander.«
»Und wo kommst du so spät her?«, lenkte Brander das Gespräch in eine andere Richtung. Abgesehen davon, dass er mit seiner Adoptivtochter nicht über den Fall reden durfte, wollte er es auch nicht. Sie hatte in ihrer Kindheit und Jugend selbst genug zu ertragen gehabt.
»War mit Marvin Billard spielen.«
Sie bemühte sich, unbefangen zu klingen, aber Brander hörte einen deprimierten Unterton heraus. Worüber hatten die beiden im Auto gesprochen? »Alles in Ordnung?«
»Mhm.«
Er kannte sie lange genug, um zu wissen, dass das nicht stimmte. Aber er wusste auch, dass es nichts bringen würde nachzuhaken. Manche Dinge musste sie erst eine Weile mit sich herumtragen, bevor sie bereit war zu reden.
»Ich muss ins Bett. Bin müde.« Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Du trinkst aber nur diesen einen Whisky, versprochen?«
Er hob die Finger zum Schwur. Das schlechte Gewissen machte sich in ihm breit. Er wollte ein gutes Vorbild für Nathalie sein, deren Mutter sich quasi in den Tod gesoffen hatte, und auch in Nathalies Leben hatte es eine Phase gegeben, in der sie für ihr junges Alter viel zu viel Alkohol getrunken hatte.
Sich nach Feierabend allein ins Wohnzimmer zu setzen und Whisky zu trinken, um abzuschalten, war nicht gut.
Donnerstag
In der Nacht hatte es wieder Frost gegeben, und die Welt zeigte sich am Morgen mit einer Eiskristallschicht überzogen. Ein märchenhafter Anblick, aber Brander hatte keine Augen dafür. Am Abend zuvor hatte er mit dem Inspektionsleiter ausgemacht, dass Peppi und er morgens direkt nach Aichheim fahren würden, um mit Polizeioberkommissar Christian Winkler über die neuesten Entdeckungen zu sprechen.
Wie sollte er vorgehen? Missbrauch war ein sensibles Thema, und er fragte sich, was Lederers Ehefrau, Winkler oder sonst jemand im Dorf wusste. Der Polizeioberkommissar war auffällig zurückhaltend gewesen, was die Informationen über Karl Lederer betraf. Brander war sich sicher, dass er, wenn vielleicht nicht gewusst, zumindest geahnt hatte, dass in dem Haus in der Alemannenstraße etwas nicht stimmte.