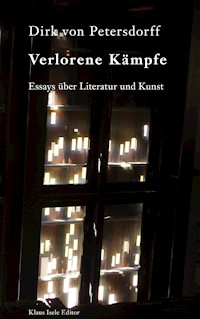Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Dirk von Petersdorff zeigt, wie modern und vielfältig sich Goethe in seiner Lyrik zu den Lebensthemen »Liebe« und »Glaube« erweist und bringt uns Goethes Dichtung erneut nah. Goethes Werke sind uns auch heute noch nah, weil sie verschiedene Positionen einnehmen und verbinden, statt nur eine einzige Weltanschauung zu vertreten. Goethe lebte bereits in einer Welt voller politischer, kultureller und religiöser Widersprüche, und er gehörte mit seinem ständigen Reflexions- und Abstimmungsbedarf schon zum Typus des modernen Menschen. Insbesondere seine Gedichte bilden das Nebeneinander einer modernen Gesellschaft ab, in der ganz selbstverständlich mehrere Modelle von Liebe und Glaube existieren. Dirk von Petersdorff zeigt dies einfühlsam und sehr genau an einer Auswahl bekannter und nicht ganz so bekannter Gedichte aus allen Lebensphasen Goethes. So wird deutlich, wie sehr Goethes Dichtung uns und unsere heutige Lebenswelt immer noch berührt. »Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dasjenige, was mich erfreute oder quälte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußeren Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl niemand nötiger als mir, den seine Natur immerfort aus einem Extreme in das andere warf. Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Konfession.« Johann Wolfgang Goethe in »Dichtung und Wahrheit«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dirk von Petersdorff
»Und lieben, Götterwelch ein Glück«
Glaube und Liebein Goethes Gedichten
Inhalt
Einleitung
»Was bin denn ich selbst?Was habe ich denn gemacht?«
Goethes Stimmen
»Wie so bunt der Kram gewesen«: Die Gedichtsammlungen
Liebe
Glück und Gewalt: »Maifest«, »Mir schlug das Herz«, »Heidenröslein«
Eine Affäre in Rom: »Elegien«
Die stabile Zweierbeziehung: »Nähe des Geliebten«, »Die Metamorphose der Pflanzen«
Ein glücklich gescheiterter Seitensprung: »Das Tagebuch. 1810«
Das Liebeschaos des alten Mannes: »Elegie. September 1823«
Glaube
Paukenschlag gegen die Religion: »Prometheus«
Im Lebenssturm seine Götter entdecken: »Seefahrt«
Die Weisheit der Natur: »Gesang der Geister über den Wassern«
Woran man glauben soll: »Das Göttliche«
Reisen zwischen den Religionen: »West-östlicher Divan«
Die Lebensspur eines toten Freundes: »Im ernsten Beinhaus war’s«
Ein Goethe für die Gegenwart
Dank
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichenis
Einleitung
Goethes Reisemantel (Abb. 1) steht am Eingang der Ausstellung im Goethe-Nationalmuseum in Weimar. Er besteht aus gerautem Wolltuch sowie aus Seidensamt und ist 140 cm lang; Goethe war etwa 1,70 Meter groß. Ein solcher Mantel, benannt nach dem berühmten englischen Schauspieler David Garrick, der ihn sich angeblich als Erster anfertigen ließ, war um 1800 modern. Der Schulterumhang, die sogenannte Pelerine, hielt Regen ab. Der »Garrick« oder »Carrick« hieß auch Kutschermantel, weil er bei dieser Berufsgruppe besonders beliebt war. Hoch auf dem Kutschbock, dem Wetter ausgesetzt, bot er Schutz. Klassisch-schlichte Mäntel dieser Art werden übrigens auch heute noch gefertigt.
Abb. 1: Goethes Reisemantel
Goethe war viel unterwegs – »Lebensfluten – Tatensturm« ist der dazu passende Titel der Weimarer Ausstellung. Die weiteste und bekannteste Reise führte ihn durch Italien, über Rom und Neapel bis nach Sizilien. Aber er kannte auch die Schweizer Gebirgswelt, besuchte gerne die böhmischen Bäder, hatte in Leipzig und Straßburg studiert und Stadterfahrung gesammelt. Er ließ sich auf langen Postkutschenfahrten durchrütteln, war auch ein guter Reiter und legte weite Strecken zu Fuß zurück. Er bestieg den Vesuv und erkundete die Gegend rund um den Brocken, er kümmerte sich um die Bergwerke im thüringischen Ilmenau, und in Gedanken und Bildern folgte er auch Alexander von Humboldt nach Südamerika. Im Alter dehnten sich seine Interessen, angeregt durch internationale Besucher und durch die Lektüre europäischer Zeitschriften wie »Le Temps« und »Le Globe«, immer weiter aus.
Durch seine politische Tätigkeit im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach kannte er verschiedene gesellschaftliche Bereiche von innen. Er war unter anderem Mitglied der Bergwerkskommission, Direktor der Wegebaudirektion und Vorsitzender der Kriegskommission. Nach der Italienreise, die auch eine Flucht aus der Enge seiner Pflichten war, konnte er sich von einigen Ämtern befreien, aber dafür musste er nun das Weimarer Hoftheater managen. Er war für die herzoglichen Bibliotheken zuständig, kümmerte sich um die naturwissenschaftlichen Sammlungen der Universität Jena, um den dortigen Botanischen Garten und die Sternwarte. In diesem letzten Bereich, in dem er mit Naturwissenschaftlern zusammentraf und ihre Objekte kennenlernte, verfolgte er auch eigene Interessen und war als Forscher tätig.
So kam er mit ganz unterschiedlichen Menschen in Berührung, lernte ihre Verhaltens- und Redeweisen kennen. Er sprach mit Bergarbeitern und mit Wissenschaftlern, mit Schauspielern und mit Juristen, mit Soldaten und emanzipierten Frauen, Hofbeamten und Malern. Er begegnete Napoleon und machte Konversation mit ihm.[1] Goethe kannte den Frieden und den Krieg, denn seine ersten Lebensjahrzehnte waren (mit Ausnahme des Siebenjährigen Kriegs, den er noch nicht bewusst wahrnahm) Friedensjahrzehnte. Dann erlebte er die lange Kriegsphase im Anschluss an die Französische Revolution mit. Er war Beobachter der Belagerung und Beschießung von Mainz durch preußische Truppen 1793. Bei der Belagerung Weimars nach der Schlacht von Jena und Auerstedt 1806 geriet er selbst in Gefahr, aus der ihn seine Frau mit beherztem Einsatz rettete. Angesichts dieser reichhaltigen Erfahrungen könnte man fast vergessen, dass es eigentlich die Welt der Kunst und vor allem der Literatur war, in der und für die er lebte; alles andere hätte auch schon für ein Leben gereicht.
Dieses Leben ist ein Beispiel für die Steigerung der räumlichen und der sozialen Mobilität seit dem späten 18. Jahrhundert. In einem Vergleich der Lebensläufe von Goethes Großvater, seinem Vater und von Goethe selbst hat Karl Eibl erklärt, wie innerhalb einer Gesellschaft, die noch ständisch stabil ist, schon ein neuer Bewegungsraum entsteht: »Wenn wir vom Bürgertum dieser Zeit sprechen, dann bezeichnen wir damit zunächst keinen Stand, sondern diesen Bewegungsraum. Bildlich gesprochen: Der Idealtyp des Bürgers sitzt in der Kutsche oder im Gasthaus. Hier kommt es immer wieder zu unvorhergesehenen, schwer zu planenden Interaktionen von Individuen unterschiedlicher Herkunft, von Normensystemen unterschiedlicher Struktur und Tradition, hier finden Lebensläufe nach aufsteigender Linie, doch auch nach absteigender, statt. Hier entsteht ein großer Reflexions-, Abstimmungs- und Selbstdeutungsbedarf.«[2] In einem solchen Bewegungsraum benötigt man einen Mantel aus festem und gleichzeitig leichtem Tuch. Dieser sollte zeigen, dass sein Träger weiß, wie man sich kleidet, also auf der Höhe der Zeit ist, und er sollte vor Staub, Regen und Kälte schützen.
»Was bin denn ich selbst? Was habe ich denn gemacht?«
Beim Anblick des Mantels, der leer ist und wie eine Hülle wirkt, kann man fragen: Wer steckte eigentlich im Inneren? Was machte den Träger dieses Mantels aus? Gibt es einen Kern der Person Goethe? Man gelangt dann schnell zum Begriff der Identität, den manche für überstrapaziert und ausgelaugt halten, oder zu einem vermeintlich postmodernen Identitätsgebastel unter dem Motto »Wer bin ich – und wenn ja, wie viele«.[3] Aber genau über diese Frage nach der Einheit und Vielheit eines Menschen hat Goethe nachgedacht! In einem Gespräch, das er in seinem Todesjahr 1832 mit dem Physiker und Weimarer Prinzenerzieher Frédéric Soret führte, sagte er (FA 38, S. 521 f.):
Was bin denn ich selbst? Was habe ich denn gemacht? Ich sammelte und benutzte alles was mir vor Augen, vor Ohren, vor die Sinne kam. Zu meinen Werken haben Tausende von Einzelwesen das ihrige beigetragen, Toren und Weise, geistreiche Leute und Dummköpfe, Kinder, Männer und Greise, sie alle kamen und brachten mir ihre Gedanken, ihr Können, ihre Erfahrungen, ihr Leben und ihr Sein; so erntete ich oft, was andere gesäet; mein Lebenswerk ist das eines Kollektivwesens, und dies Werk trägt den Namen Goethe.[4]
Das ist eine grandiose Äußerung, die erkennbar aus einem langen Leben und jenen unzähligen Weltkontakten hervorgeht. Dieses Ich zeichnet sich durch eine große Offenheit gegenüber seiner Umwelt aus und verhält sich nicht selektiv. »Alles«, was vor Augen und zu Ohren kommt, wird geprüft und kann behalten werden: sowohl das Ernste wie auch das Komische, das Tiefe und das scheinbar Nebensächliche. Der Umgang mit Menschen ist vom Willen zur Beobachtung, zum Kennenlernen des Fremden und von Neugier bestimmt. Generationen werden nicht mit Urteilen belegt, Lebensansichten stehen nebeneinander, ohne dass sie sofort bewertet werden müssten, und auch die »Dummheit« gehört zum Menschen. Aber besteht hier nicht auch eine Gefahr, löst sich ein solches weites und offenes Ich nicht in eine Fülle von Wahrnehmungen und fremden Redeweisen auf? Ist es erstrebenswert, ein »Kollektivwesen« zu werden, gerät der Mantel zu einer Hülle, in der sich alles Mögliche ansammelt?
Aber gleichzeitig spricht auch ein starkes Ich. Die Menschen, kann Goethe sagen, »haben mir ihre Gedanken entgegengebracht«, als sei es vom Schicksal so vorgesehen, dass sie zu ihm kommen und ihre Ideen abliefern. Daraus sind dann seine höchstpersönlichen »Werke« hervorgegangen, auf die er natürlich stolz ist. Die Besonderheit dieses Menschen, die er ausnutzt, besteht also in seiner Aufnahmekapazität und in der Fähigkeit zur Weiterverarbeitung – die Ernte bringt er ein. So wird das Ungeordnete und Chaotische in »mein Werk« verwandelt. Es stammt von einem »Kollektivwesen« (schwaches Ich), das aber einen besonderen Namen trägt (starkes Ich). Aus der Offenheit und Schwäche dieser Person gehen ihr Reichtum und ihre Stärke hervor.
Die Selbstbeschreibung als Kollektivwesen stammt vom Lebensende, aber sie passt zu Äußerungen an vorhergehenden Lebensstationen. Solche Stationen, an denen Goethe Halt machte, zurückblickte und über seinen bisherigen Weg nachdachte, ergaben sich zum Beispiel, wenn er seine Gedichte sammelte und ordnete. Das muss erklärt werden: Von der Jugend bis in die letzte Lebensphase hinein hat Goethe Gedichte geschrieben. Erhalten ist zum Beispiel ein Gedicht des Zwölfjährigen zum Neujahr 1762, und um seinen 79. Geburtstag herum entsteht auf Schloss Dornburg mit »Dem aufgehenden Vollmonde« noch eines seiner ganz großen Gedichte. Mehrmals im Leben hat er die vielen einzelnen Gedichte zusammengeführt: 1778 kommt es zu einer ersten handschriftlichen Zusammenstellung in einem Heft, 1789 erscheint in der ersten Werkausgabe ein Band mit Gedichten, in der Ausgabe von 1815 sind es zwei, in der sogenannten Ausgabe letzter Hand von 1827 sind es vier Gedichtbände.
Die Arbeit des Sammelns und Ordnens von Gedichten hat er auch als Rückschau verstanden, denn die Gedichte stammten aus verschiedenen Lebensphasen, waren an Orte und Menschen gebunden, erinnerten ihn an freudige oder schwierige Situationen, oder sie enthielten Auseinandersetzungen mit bedrängenden Fragen. Sie lagen auch in unterschiedlicher Form vor: als Handschriften, so dass auch die wechselnde Schrift und das unterschiedliche Papier zur Erscheinung gehörten, oder in gedruckter Form, in Zeitschriften oder anderen Sammlungen, die wiederum an Zeitabschnitte, an Freundschaften oder Auseinandersetzungen erinnerten. Die Gedichte wurden also auch als Lebenszeugnisse zusammengetragen, und ihre Zahl erhöhte sich dank dieses langen Lebens. Bei der Zusammenstellung der letzten Ausgabe erhielt Goethe Hilfe von Johann Peter Eckermann, die er liebevoll-spöttisch kommentierte: »Eckermann schleppt, wie eine Ameise, meine einzelnen Gedichte zusammen; ohne ihn wäre ich nie dazu gekommen; es wird aber gar artig werden; er sammelt, sondert, ordnet und weiß den Dingen mit großer Liebe etwas abzugewinnen.« (FA 37, S. 146)
Als Goethe die recht schmale Zusammenstellung für die erste Werkausgabe unternahm, hatte er noch keine Helfer und war gerade aus Weimar nach Italien geflohen. Er schreibt darüber in einem Brief an seine Freundin Charlotte von Stein (Rom, 1. Februar 1788). Er beklagt, dass er in den vergangenen Jahren so vieles unfertig liegengelassen hat, was nun abzuschließen sei oder gründlich überarbeitet werden müsse. Das gilt für das Drama »Torquato Tasso«, denn »was da steht ist zu nichts zu brauchen, ich kann weder so endigen noch alles wegwerfen«. Dann kommt er auf seine Gedichte zu sprechen, die er durchgesehen und geordnet hat: »Es ist ein wunderlich Ding so ein Summa Summarum seines Lebens zu ziehen. Wie wenig Spur bleibt doch von einer Existenz zurück!« (FA 15.1, S. 553)
Was für eine erstaunliche Selbsteinschätzung! Wie kann man sie erklären? Die Bedeutung des Begriffs »Summe, summa«, zu dem auch die Wendung »summa summarum« gehört, erklärt »Das deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm« so: »auf eine gegebene einheit abzielend, also eine totalität betreffend«, »›inbegriff‹, ›das höchste‹, meist von eigenschaften, gefühlen u.ä.«.[5] Auch an dieser viel früheren Stelle des Lebenswegs fragt Goethe also nach der Einheit seiner Person und danach, was ihm das Höchste und Wichtigste ist. Diese Frage müsste sich doch beantworten lassen, wenn man die eigenen Gedichte als Lebenszeugnisse zusammensucht und in einen Zusammenhang bringt? Aber das Ergebnis lautet: Die eigene Existenz hat nur eine schwache Spur hinterlassen. Er ist knapp vierzig, als er diese Feststellung trifft, und man könnte ironisch einwenden: Es hätte noch schlechter kommen, man hätte eine noch schwächere Spur hinterlassen können. Immerhin spricht der Dichter des »Werther«, der im gleichen Brief berichten kann, wie er in Rom mit Übersetzungen dieses Romans belästigt wird: Die »zeigen mir sie und fragen, welches die beste sei und ob auch alles wahr sei! Das ist nun ein Unheil, was mich bis nach Indien verfolgen würde.« Von mangelnder Anerkennung kann also nicht die Rede sein, und die Wendung »Summa Summarum« muss auf etwas anderes zielen: auf den nur schwach gesicherten Kern und die unscharfe Kontur dieser Person. Wer seine Gedichte liest, so denkt Goethe, wird danach nicht sagen können, dass er den Menschen kennt, der sie geschrieben hat, dass er um dessen Lebensgefühl weiß oder dessen Prinzipien verstanden hat. Der Lebensweg hat nur »wenig Spur« hinterlassen, der man hinterhergehen könnte.
Bekräftigt wird diese Selbsteinschätzung durch eine Passage aus der autobiographischen Schrift »Dichtung und Wahrheit«. Aus der Rückschau berichtet Goethe von seiner Studienzeit in Leipzig (1765 – 1768), die eine starke Verunsicherung mit sich brachte. Leipzig stand damals (wie auch heute wieder) mit an der Spitze der deutschen Städte, und in der dortigen Coolness kam Goethe sich schon kleidungstechnisch abgehängt vor, wusste nicht, wie man auf der Straße redet, wie man sich richtig bewegt, wohin man geht und wen man kennen muss. Nicht einmal in der Welt der Gegenwartsliteratur besaß er einen klaren Standpunkt. Und natürlich geriet er auch in Liebesverwirrungen (FA 14, S. 309 f.):
Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dasjenige was mich erfreute oder quälte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußeren Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl Niemand nötiger als mir, den seine Natur immerfort aus einem Extreme in das andere warf. Alles was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Konfession.
Gedichte gehen also aus psychischen Dynamiken hervor, wenn etwas »erfreut«, wenn etwas »quält« oder sonst »beschäftigt«. Diese beglückenden oder belastenden Gefühle werden in ein »Bild« verwandelt, also anschaulich gemacht und vor Augen geführt und damit gleichzeitig auch in Distanz gerückt. So gewinnt der unsichere und unruhige Mensch Stabilität, kann mit einer Sache abschließen. Dabei werden Gedichte nicht auf Gefühle reduziert, sondern dienen der Erkenntnis, helfen dabei, die »Begriffe von den äußeren Dingen zu berichtigen«. Man könnte an Begriffe über die Natur oder die Politik denken. All das läuft hinaus auf die berühmte Formel, Goethes Gedichte seien »Bruchstücke einer großen Konfession«.
Eine Konfession ist ein Bekenntnis, aber nicht ein Alltagsbekenntnis, sondern eins, das auf die letzten Überzeugungen eines Menschen zielt, also wiederum auf ›Einheit‹ und ›Totalität‹ wie das »Summa Summarum«. Für die europäische Geschichte wegweisend waren die »Confessiones« des Bischofs Augustinus (um 400 n. Chr.). Darin sind die Lebensgeschichte und das göttliche Du verbunden, bis ins Kleinste, so wenn Augustinus erwähnt, wie er als Säugling von seiner Mutter und einer Amme gestillt wurde:
So empfing mich also das Wohlbehagen der Mutterbrust. Meine Mutter und meine Ammen füllten sich nicht selbst die Brüste, sondern du warst es, der mir durch sie die Nahrung des Säuglings gab, wie es deiner Weltordnung entspricht und der bis ins letzte reichenden Verteilung deiner Schätze. Deine Gabe war es auch, dass ich nicht mehr wollte, als du gabst, und dass die, die mich stillten, mir geben wollten, was du ihnen gegeben hast.[6]
Die Einrichtung des Stillens bis hin zur Abgestimmtheit der Milchmenge ist Teil und Beweis einer göttlichen Ordnung. Das große »Du«, mit dem das Ich über Hunderte von Seiten redet, gibt dem Leben einen Ursprung und ein Ziel. Selbst wenn wir »Unmengen eitler Nichtigkeiten« mit uns herumtragen,[7] wie auch Augustinus weiß, so bleibt Gott der Ort, in dem die Seele Halt findet: »Bei dir sammelt sich alles, was bei mir zerstreut ist.«[8]
Im 18. Jahrhundert und im oben so genannten Bewegungsraum des Bürgers hatte die Gattung der Bekenntnisschrift neue Vitalität erhalten. So schrieb Jean-Jacques Rousseau in seiner Selbstdarstellung »Les Confessions«: »Ich lese in meinem Herzen und kenne die Menschen. Ich bin nicht wie einer von denen geschaffen, die ich gesehen habe; ich wage sogar zu glauben, daß ich nicht wie einer der Lebenden gebildet bin.«[9] Schonungslose Naturwahrheit wird versprochen (und das Versprechen wird gehalten), während ein fester Gegenhalt für die eigene wilde Subjektivität nicht mehr existiert. Zwar kann Rousseau noch Gott ansprechen – »Ewiges Wesen, versammle um mich die unzählbare Schar meiner Mitmenschen; sie sollen meine Bekenntnisse hören, über meine Nichtswürdigkeit seufzen und über meine Nöte erröten«[10] – , aber da schlägt auch ein charakteristischer Größenwahn durch, denn Rousseau stellt sich vor, dass er beim Jüngsten Gericht sein Buch vorlesen wird und dass die »unzählbare Schar« seiner Mitmenschen dann zuhören muss. Rousseaus Bekenntnisse sind uneinheitlich, schwanken im Ton zwischen Selbstmitleid und Aggression, sind manchmal einfühlend und nachdenklich, dann zynisch und pathetisch, und sie sind voller Abschweifungen.
Wenn Goethe von den »Bruchstücken einer Konfession« spricht, dann geht er noch einen Schritt weiter. Ein Bekenntnis in einem Stück wird gar nicht mehr geboten. Das Ganze ist zerbrochen, nur noch Teile sind vorhanden, aber ob sie vollständig sind und ob es gelingen kann, sie wie ein Puzzle zusammenzusetzen, bleibt offen. Man weiß nicht mehr sicher, was und wozu man sich bekennen soll. Ein schützendes großes Du, an das man sich wenden kann, existiert nicht mehr, und auch solche felsenfesten Überzeugungen, wie Rousseau sie noch besaß – zum Beispiel die, dass die moderne Zivilisation ein einziges Übel sei – , sind Goethe nicht mehr ohne weiteres gegeben.
Goethes Stimmen
Was Goethe meint, wenn er beim Sammeln und Ordnen seiner Gedichte über die schwache Spur seines Lebens und die Bruchstücke seiner Überzeugungen nachdachte, kann man selbst beim Lesen seiner Gedichte überprüfen: Reden in seinem Werk wirklich so verschiedene Stimmen? Tatsächlich ist schon der ganz junge Autor schwer festzulegen und zu fassen. Man muss nur zwei der bekanntesten Gedichte aus seiner Frühphase, den 1770er-Jahren, nebeneinanderhalten, »Maifest« (FA 1, S. 129 f.) oder »Mailied« (FA 1, S. 287 f.) und »Prometheus« (FA 1, S. 203 f.). Zuerst ein Auszug aus dem Lied (V. 1 – 12):
Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!
Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig,
Und tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch,
Und Freud und Wonne
Aus jeder Brust.
O Erd o Sonne!
O Glück o Lust!
Dann aus dem »Prometheus« (V. 1 – 28):
Bedecke deinen Himmel Zeus
Mit Wolkendunst!
Und übe Knabengleich
Der Disteln köpft
An Eichen dich und Bergeshöhn!
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehn,
Und meine Hütte
Die du nicht gebaut,
Und meinen Herd
Um dessen Glut
Du mich beneidest.
Ich kenne nichts ärmers
Unter der Sonn als euch Götter.
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.
Da ich ein Kind war
Nicht wußt wo aus wo ein
Kehrt mein verirrtes Aug
Zur Sonne als wenn drüber wär
Ein Ohr zu hören meine Klage
Ein Herz wie meins
Sich des Bedrängten zu erbarmen.
Einmal wird gesungen, einmal wird gesprochen. Einmal gibt es keine Probleme, einmal gibt es erhebliche. Das Ich im »Maifest« ist einig mit der Welt, das Ich des »Prometheus« kämpft mit der Welt und ihrer Einrichtung. Im »Maifest« sind »Morgenwolken« und »Blütendampfe« die kompliziertesten Ausdrücke, während der Leser des »Prometheus« religionskritische Argumente nachvollziehen muss. Das Ich des »Maifestes« sieht man förmlich durch die Landschaft tänzeln, Prometheus sitzt, denkt nach, klagt und wirft eine Frage nach der nächsten auf. Die innere Unruhe der Prometheus-Figur findet ihren Ausdruck in den ungleichen Versen, die zwar einen Rhythmus besitzen, der sich aber ständig verändert, während das »Maifest« dem gleichmäßigen Wechsel von Senkung und Hebung folgt. Prometheus spricht langsam, auch sperrig, stockt und schreitet wieder voran. Reime würde dieses Gedicht nicht vertragen, denn eine Ordnung wird gerade zerschlagen. Der Maisänger aber fühlt sich allem zugehörig, entdeckt überall verwandte Kräfte, findet seine Liebe auch in der Natur wieder, und dazu passen die allesverbindenden Reime.
Aber wer ist nun Goethe mit Anfang bzw. Mitte zwanzig: Der nachdenkliche, zerrissene, seine Besonderheit herausmeißelnde, auch machtbewusste Prometheus? Oder der heitere, die Welt feiernde, selig verliebte Sänger, der lobt, was ihm vor Augen und zu Ohren kommt? Es ist zwar auch eine Frage des technischen Könnens, wenn Goethe wie selbstverständlich zwei große Linien der Lyrik aufgreift und fortführt: jene aus dem Mittelalter stammende des Lieds und die in die Antike zurückweisende der freien Rhythmen, die fließend-leichte und die gestaut-komplexe Rede. Aber vor allem ist es eine Frage des Menschen, der sich nicht festlegen kann und will, des Künstlers, der sich mit Fragen und Zweifeln herumschlägt, aber auch Momente der glücklichen Übereinstimmung mit der Welt kennt und darstellt.
Dieser erste Eindruck, den man aus den Gedichten des jungen Goethe gewinnt, verstärkt sich, wenn man auf die späteren Sammlungen schaut. 1815 sind es zwei Bände, in denen Goethe seine Gedichte versammelt, und man muss nur den vielen Stimmen zuhören, die dort sprechen oder singen. In einem »Wechsellied zum Tanze« (FA 2, S. 21 f.), das eventuell für eine Festivität in Weimar gedichtet wurde, treten zwei Gruppen auf. Während »Die Gleichgültigen« das folgenlose Vergnügen und die schnelle Liebe loben (»Bist du mein Schatz nicht, so kannst du es werden«), glauben »Die Zärtlichen« an eine feste Zweierbeziehung, aus der allein wirkliche Erfüllung hervorgeht (V. 1 – 12):
Die Gleichgültigen
Komm mit, o Schöne, komm mit mir zum Tanze;
Tanzen gehöret zum festlichen Tag.
Bist du mein Schatz nicht, so kannst du es werden;
Wirst du es nimmer, so tanzen wir doch.
Komm mit, o Schöne, komm mit mir zum Tanze;
Tanzen verherrlicht den festlichen Tag.
Die Zärtlichen
Ohne dich, Liebste, was wären die Feste?
Ohne dich, Süße, was wäre der Tanz?
Wärst du mein Schatz nicht, so möcht’ ich nicht tanzen;
Bleibst du es immer, ist Leben ein Fest.
Ohne dich, Liebste, was wären die Feste?
Ohne dich, Süße, was wäre der Tanz?
Keine der beiden Gruppen wird vom Autor ins Recht gesetzt. Er lässt sie nebeneinander auftreten, gegeneinander singen und daraus entsteht das »Wechsellied« der Gesellschaft. Aber dieser kühl beobachtende und arrangierende Autor konnte sich auch mit größter Hingabe und aller Intensität zu einem geliebten Du bekennen. So im Gedicht »Nähe des Geliebten«: In allen Situationen denkt ein Mensch an den geliebten anderen, hört und sieht ihn auch, wenn er abwesend ist, und dann womöglich sogar noch intensiver (FA 2, S. 39 f.):
Nähe des Geliebten
Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer
Vom Meere strahlt;
Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer
In Quellen malt.
Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege
Der Staub sich hebt;
In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege
Der Wandrer bebt.
Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen
Die Welle steigt.
Im stillen Haine geh’ ich oft zu lauschen,
Wenn alles schweigt.
Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,
Du bist mir nah!
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.
O wärst du da!
Würde man dieses Gedicht vielleicht als tief und ergreifend bezeichnen und den Versen so nachlauschen wie das Ich »im stillen Haine«, dann trifft man etwas später auf den komischen, ja geradezu blödelnden Goethe. Das Gedicht »Epiphanias« (FA 2, S. 98 f.) parodiert das Erscheinen der drei Weisen aus dem Morgenland, indem es die drei als wenig intelligente Schlemmer und Genießer darstellt. Witzelnde Einfälle werden dabei hemmungslos wiederholt (V. 1 – 4):
Die heilgen drei König’ mit ihrem Stern,
Sie essen, sie trinken, und bezahlen nicht gern;
Sie essen gern, sie trinken gern,
Sie essen, trinken, und bezahlen nicht gern.
Amüsieren wir uns hier nicht etwas unter Niveau? Das sei schon in Ordnung, fand Goethe offenbar, denn er nahm das Lied in seine Werkausgabe auf. Und es ist auch wirklich ganz wunderbar albern (V. 25 – 28):
Wir bringen Myrrhen, wir bringen Gold,
Dem Weihrauch sind die Damen hold;
Und haben wir Wein von gutem Gewächs,
So trinken wir drei so gut als ihrer sechs.
Direkt darauf folgt ein Gedicht mit dem Titel »Die Lustigen von Weimar« (FA 2, S. 99 f.), das keinen größeren Anspruch erhebt, als die Freizeitgestaltung einer Gruppe gutgelaunter, man könnte auch sagen vergnügungssüchtiger Damen in der Umgebung Weimars nachzuzeichnen (V. 1 – 8):
Donnerstag nach Belvedere,
Freitag geht’s nach Jena fort:
Denn das ist, bei meiner Ehre,
Doch ein allerliebster Ort!
Samstag ist’s worauf wir zielen.
Sonntag rutscht man auf das Land;
Zwäzen, Burgau, Schneidemühlen
Sind uns alle wohlbekannt.
Wie kann jemand, der solche Lappalien für literaturwürdig ansieht, mit heiligem Schauer die Stadt Rom betreten, sie ansprechen, demütig und erwartungsvoll (FA 2, S. 154, V. 1 f.):
Saget, Steine, mir an, o! sprecht, ihr hohen Paläste!
Straßen, redet ein Wort! Genius, regst du dich nicht?
Diese erste »Römische Elegie« endet mit einer rhetorisch zugespitzten, fast schon überfließenden Verbindung von »Rom«, »Welt« und »Liebe« (V. 13 – 14):
Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe
Wäre die Welt nicht die Welt, wäre denn Rom auch nicht Rom.
Aber derjenige, der in Italien den Sinn seines Lebens zu finden scheint, kann auch wie ein x-beliebiger schlechtgelaunter deutscher Tourist auftreten. Die bekanntesten Nationalklischees über Deutsche und Italiener werden wiedergekäut. In den »Epigrammen. Venedig 1790« (FA 2, S. 209, Nr. 4, V. 3 – 6) mault er herum:
Deutsche Redlichkeit suchst du in allen Winkeln vergebens;
Leben und Weben ist hier, aber nicht Ordnung und Zucht;
Jeder sorgt nur für sich, mißtraut dem Andern, ist eitel,
Und die Meister des Staats sorgen nur wieder für sich.
Gedichte Goethes können so tief in die Niederungen des Alltags sinken, aber sie können sich auch bis zu den »Grenzen der Menschheit« (FA 2, S. 301 f.) erheben, uns von einem Vater berichten, der die Erde segnet und dem man mit »kindlichem Schauer« entgegentritt (V. 1 – 10):
Wenn der uralte,
Heilige Vater
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Wolken
Segnende Blitze
Über die Erde sä’t,
Küss’ ich den letzten
Saum seines Kleides,
Kindliche Schauer
Treu in der Brust.
Blättert man weiter, geht auch die Achterbahnfahrt weiter, denn nach der Metaphysik wird (im Gedicht »Liebebedürfnis«) die Herausforderung einer im Winter aufgesprungenen Lippe dargestellt und erörtert (FA 2, S. 309, V. 3 – 12):
Ach! die Lippe, die so manche Freude
Sonst genossen hat und sonst gegeben,
Ist gespalten und sie schmerzt erbärmlich.
Und sie ist nicht etwa wund geworden,
Weil die Liebste mich zu wild ergriffen,
Hold mich angebissen, daß sie fester
Sich des Freunds versichernd ihn genösse:
Nein, das zarte Lippchen ist gesprungen,
Weil nun über Reif und Frost die Winde
Spitz und scharf und lieblos mir begegnen.
Labello-Stifte gab es noch nicht, und deshalb wird in einer zweiten Strophe warmer Traubensaft mit Honig zubereitet, der aber nur mit einem Tröpfchen Liebe als Zugabe hilft (FA 2, S. 310).
Auch ansonsten gibt es in Goethes Gedichten eine Fülle von praktischen Ratschlägen, zum Beispiel für den Künstler, der sich in unproduktiven Zeiten, wenn die Stimmung schlecht ist, nicht quälen soll. In der »bösen Stund’«, wenn man weder »sich noch andre leiden mag«, soll man lieber die Arbeit ruhen lassen, um dann in der guten Stunde, die unweigerlich kommt, mit doppelter Produktivität entschädigt zu werden (»Guter Rat«; FA 1, S. 356).
Den Schluss dieser Beispielreihe soll ein Gedicht in Form eines Sprichworts bilden. Es weist noch einmal auf den Reisemantel zurück, denn es spricht über die Bewegung des Reisens, die notwendig sei, und warnt vor einer Verfestigung der eigenen Person. Man muss sich nicht selbst bis ins Letzte kennen, das eigene Leben darf einem wie ein Traum vorkommen. Wieder klingt auch die Idee einer Öffnung des Menschen zur Welt an (FA 2, S. 405):
Verweile nicht und sei dir selbst ein Traum,
Und wie du reisest, danke jedem Raum,
Bequeme dich dem Heißen wie dem Kalten;
Dir wird die Welt, du wirst ihr nie veralten.
Vergleicht man die Weite der Themen, der Haltungen zur Welt und der Tonfälle mit dem Spektrum anderer Autoren, dann ist Goethe tatsächlich ein »Kollektivwesen«. Hält man die besten Autoren dieser Zeit daneben, zum Beispiel Hölderlin, Eichendorff oder Heine, dann sind ihre Gedichte wiedererkennbarer: an einem charakteristischen Temperament und einer Tonlage. Hölderlin – »Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse, / Und, mit Fackeln geschmückt, rauschen die Wagen hinweg«[11] – oder Eichendorff – »Es schienen so golden die Sterne, / Am Fenster ich einsam stand / Und hörte aus weiter Ferne / Ein Posthorn im stillen Land«[12] – sie hört man heraus – aber Goethe?
»Wie so bunt der Kram gewesen«: Die Gedichtsammlungen
Die eben zitierten Gedichte sind alle in der Werkausgabe von 1815 enthalten. Beim Zusammenstellen und Ordnen für diese Ausgabe bemerkte Goethe, dass sie sich nur schwer zu einem Ganzen verbinden ließen. Beim Nachdenken darüber schrieb er das Gedicht »Vorklage« (FA 2, S. 11) und stellte es an die erste Stelle der ersten Rubrik »Lieder«. Es steht also wie ein ›Vorwort‹ vor dem Buch, nur, dass es eben eine Klage enthält:
Wie nimmt ein leidenschaftlich Stammeln
Geschrieben sich so seltsam aus!
Nun soll ich gar von Haus zu Haus
Die losen Blätter alle sammeln.
Was eine lange weite Strecke
Im Leben von einander stand,
Das kommt nun unter Einer Decke
Dem guten Leser in die Hand.
Doch schäme dich nicht der Gebrechen,
Vollende schnell das kleine Buch;
Die Welt ist voller Widerspruch,
Und sollte sich’s nicht widersprechen?
Das Thema der »Vorklage« ist die Komposition einer Gedichtsammlung, offenbar derjenigen, die auf dieses Gedicht folgt. Sie wird »das kleine Buch« genannt. Dem Autor kommt dieses Buch »seltsam« vor, denn es enthält ein »leidenschaftlich Stammeln«, ist also aus starken Gefühlsaufwallungen hervorgegangen, die aber nun in geschriebener Form und in Distanz daliegen. Der erstaunte Blick erklärt sich auch daraus, dass für eine Buchveröffentlichung eine Reinschrift hergestellt wurde. So lagen vor Goethe auf dem Tisch sozusagen seine aneinandergereihten Gefühle, alle in gleichmäßiger, sauberer Schrift, akkurat geordnet.
Die Formulierung der »losen Blätter«, die von »Haus zu Haus« gesammelt werden, meint, dass die Gedichte an verschiedene Wohnorte, aber auch an Lebensabschnitte gebunden sind. Von dieser Herkunft werden sie nun gelöst. Goethe war zu diesem Zeitpunkt über 60 Jahre alt und konnte deshalb von einer langen Lebensstrecke sprechen. Was er auf dieser Strecke erlebt, gedacht und gefühlt hat, wird nun unter einer »Decke«, einem Buchdeckel, vereint. So kommt zusammen, was vielleicht gar nicht zusammengehört?
Die dritte Strophe bietet eine vorläufige Lösung an. Das Ich redet sich selber zu und macht sich Mut, die Mängel des Buchs nicht zu stark zu gewichten, sondern es zügig fertigzustellen. Die Widersprüche, die es enthalte, seien gerechtfertigt, denn es entstammt schließlich einer Welt, die ebenfalls »voller Widerspruch« ist. Ist das aber nicht vielleicht eine Allerweltsweisheit, könnte man einwenden, denn widerspruchsvoll ist die Welt doch immer gewesen? Das stimmt zwar, aber die Gegensätze und Spannungen können unterschiedlich stark ausfallen, und als Goethes Gedichtsammlung 1816, nicht wie geplant 1815, erschien, wussten die Leser genau, was gemeint war. Es zeigt sich schon am verspäteten Erscheinen: Der Verleger Johann Friedrich Cotta wollte die Gedichte nicht im Kriegsjahr 1815 veröffentlichen, sondern wartete das erste Friedensjahr, 1816, ab.
Mit dem Wiener Kongress war ein über 20-jähriger Aufruhr der europäischen Staatenwelt vorläufig zu Ende gegangen. Immer wieder flammten militärische Konflikte auf, die unter Napoleon zu Kriegen einer bis dahin unbekannten Dimension, Dynamik und vor allem Opferzahl hochschlugen. Teile Deutschlands waren Kriegsschauplatz, und gerade die Region, in der Goethe und viele seiner ersten Leser lebten, war betroffen. So gab es in der Schlacht von Jena und Auerstedt (1806) Tausende von Toten auf beiden Seiten, und in den Berichten von der Schlacht kann man erfahren, wie die Stadtkirche in Jena zu einem Lazarettraum umfunktioniert wurde, nachdem alle anderen großen Gebäude schon voll mit Verwundeten lagen. Das Kirchengestühl und anderes Mobiliar wurden in aller Eile herausgerissen und auf dem Kirchplatz sowie in den Straßen der Innenstadt zu Haufen aufgeschichtet, die in den folgenden Stunden als Wach- und Wärmefeuer brannten. Das Schmerzgeschrei der Verwundeten, so eine Augenzeugin, sei mehrere Tage lang kaum zu ertragen gewesen. Eine andere Bewohnerin berichtet von den Totenwagen, auf denen die aus dem Schloss und der Stadtkirche abtransportierten Leichen nur flüchtig mit Stroh bedeckt waren, so dass Köpfe, Arme, Beine hervorstachen. Pechpfannen mit Teer wurden angezündet, um die verpestete Luft zu reinigen und epidemische Krankheiten zu verhüten.[13]
Im Anschluss an die Schlacht kam es zu Plünderungen, die in Weimar auch Goethes Haus erfassten: »Abends um 5 Uhr flogen die Cannonenkugeln durch die Dächer um ½ 6 Einzug der Chasseurs. 7 Uhr Brand Plünderung schrekliche Nacht. Erhaltung unseres Hauses durch Standhaftigkeit u. Glück.«[14] Konkreter gesagt, kam es in der Nacht unter anderem dazu, dass betrunkene französische Soldaten mit gezückten Bajonetten in Goethes Schlafzimmer eindrangen. Während Christiane Vulpius tatkräftig Helfer organisierte, die die Soldaten abdrängten, ist Goethe nicht ganz frei von männlichem Selbstmitleid: »Wer, rief er aus, nimmt mir Haus und Hof ab, damit ich in die Ferne gehen kann?«[15] Aber statt in die Ferne zu gehen, heiratet er seine langjährige Lebensgefährtin Christiane: »Wenn alle Bande sich auflösen wird man zu den häuslichen zurückgewiesen.« (FA 33, S. 158; Brief Goethes an Herzog Carl August, 25.12.1806)[16]
Hinter den militärischen Auseinandersetzungen standen tiefergehende Widersprüche, die mit dem Frieden von 1815 keineswegs aus der Welt waren. Denn seit dem 18. Jahrhundert konkurrierten verschiedene Modelle der Gesellschaftsorganisation miteinander: auf der einen Seite die alteuropäische Ordnung mit ihrem Ständesystem, in dem die Individuen einen festen Platz besaßen und das von allgemein geteilten Ideen überwölbt wurde; auf der anderen Seite die bürgerliche Gesellschaft, die von den Grundrechten der Individuen ausgeht. Diese sollen sich Bildung und Besitz aneignen können und in der offenen Auseinandersetzung gemeinsame Normen ermitteln sowie in Gesetze fassen.[17] Diese prinzipiell offene Gesellschaft entwickelte eine erhebliche Anziehungskraft, weil sie die Spielräume und Lebensmöglichkeiten des Einzelnen erweiterte, aber sie rief auch Ängste hervor, weil sie Selbstverständlichkeiten permanent in Frage stellte und weil große Sinnerzählungen relativiert wurden.
Aber auch in anderer Hinsicht war die Welt zu Beginn des 19. Jahrhunderts »voller Widerspruch«. Leser von Gedichten wussten um den Gegensatz von Romantik und Weimarer Klassik, der in der Kunst herrschte. Romantik und Klassik waren parallele Strömungen, die auf die Herausforderungen der Epoche unterschiedliche Antworten gaben. Goethe beobachtete die romantische Literatur und Malerei genau, und er war gleichermaßen abgestoßen und angezogen von ihr. Er polemisierte gegen die »neukatholische Sentimentalität« der Romantiker[18] und nahm sich unter anderem Novalis vor. Dessen »Geistliche Lieder« entdeckte er in einem romantischen Almanach, den er spöttisch als »Art von Purgatorio«, also als Fegefeuer, bezeichnete: »Die Teilnehmer befinden sich weder auf Erden, noch im Himmel, noch in der Hölle, sondern in einem interessanten Mittelzustand, welcher teils peinlich, teils erfreulich ist.« (FA 32, S. 195; Brief Goethes an Schelling, 5.12.1801)
Aber er konnte auch Philipp Otto Runges romantischen »Jahreszeiten«-Zyklus bewundern, in dem Menschen, Pflanzen und Engel ineinander übergehen und die Welt von rätselhaften Arabesken durchzogen ist. Einem Freund zeigte er die Kupferstiche und sprach dabei auch über den frühen Tod Runges (FA 33, S. 663; Brief Boisserées an seinen Bruder Melchior, 4.4.1811):
Da sehen Sie einmal, was das für Zeug ist, zum Rasendwerden, schön und toll zugleich […] was für Teufelszeug […], was da der Kerl für Anmut und Herrlichkeit hervorgebracht, aber der arme Teufel hat’s auch nicht ausgehalten, er ist schon hin, es ist nicht anders möglich, was so auf der Kippe steht, muß sterben oder verrückt werden, da ist keine Gnade.
Schließlich machte sich Goethe die Innovationen der Romantiker und besonders ihre Neukombination bekannter Formen auch selbst zunutze. Mit dem zweiten Teil des »Faust« schrieb er, so hat man zu Recht gesagt, das erste konsequent romantische Drama.[19] Weitere Spannungsverhältnisse ließen sich nennen, im Bereich der Beschreibung und Deutung der Natur, in der sich eine idealistische Naturphilosophie, der Goethe anhing, und eine empirisch verfahrende Naturwissenschaft gegenüberstanden. Davon wird später die Rede sein, ebenso wie vom Streit darüber, ob man zur Erklärung der uns bekannten Welt auf eine höhere oder tiefere Ordnung zurückgreifen kann, ob man wie Goethes »Prometheus« den alten Göttern eine Absage erteilen und sein Leben aus eigenen Kräften führen soll oder wie der Sprecher der »Grenzen der Menschheit« in den »rollenden Wolken« einen ewigen »Vater« erkennen kann.
Diese (und andere) sind die Widersprüche der Welt, von denen die lyrische »Vorklage« spricht, aber sie erklärt auch, dass die Gedichte sich »widersprechen«. Deshalb muss knapp etwas zur Komposition von Gedichtsammlungen gesagt werden.[20] Welche Entscheidungen musste Goethe dabei treffen? Am Anfang steht die Auswahl aus allen vorhandenen Gedichten. Denn es gibt Gedichte, die Goethe nie in eine seiner Sammlungen aufgenommen hat. Dazu gehören etwa das erotisch-witzige »Das Tagebuch« (von dem noch die Rede sein wird) oder Gedichte aus dem Zyklus der »Römischen Elegien« (die ebenfalls behandelt werden). Gründe für diese Nicht-Berücksichtigung lassen sich dann nennen.
Im nächsten Schritt kommt es zur Anordnung der ausgewählten Gedichte und dabei zur Bildung von Kapiteln, Rubriken oder Zyklen. Hier werden Gedichte zusammengefügt, die meist getrennt entstanden sind und vorher oft einzeln oder in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel in einer Zeitschrift oder in einem Almanach, veröffentlicht worden waren. Sie erhalten nun einen gemeinsamen Obertitel wie »Lieder«, »Balladen«, »Elegien«, »Vermischte Gedichte«, »Antiker Form sich nähernd«, »Gott, Gemüt und Welt«, so einige Beispiele aus der Sammlung von 1815.[21] Auch innerhalb dieser Rubriken müssen die Gedichte dann in eine Reihenfolge gebracht werden, und eine solche Abfolge bringt immer auch einen inhaltlichen Zusammenhang hervor.[22]
Dass Goethe dies von Anfang an so gesehen und genutzt hat, zeigt ein Brief an den Verleger seiner ersten Gesamtausgabe, an Georg Joachim Göschen. Es ging ihm darum, dass sich bestimmte Gedichte, wenn man das Buch aufschlägt, auf einem Seitenpaar gegenüberstehen sollen, »wegen gewisser Verhältnisse« (FA 30, S. 437; Brief Goethes an Göschen, 9.10.1788),[23] wie er dem Verleger einschärft: »Sollte sich ein Hinderniß finden; so werden Sie mich sogleich davon benachrichtigen«. Mit einem einleitenden »Ich erkläre mich deutlicher« wird sodann der Seitenumfang des Gedichts »Das Göttliche« abgeschätzt, das, wenn es nicht auf fünf Druckseiten passe, eben auf sieben ausgedehnt werden müsse, damit das Epigramm »Herzog Leopold« dem Ende von »Das Göttliche« gegenüber zu stehen komme (FA 30, S. 440 f.; Brief Goethes an Göschen, 24.10.1788). Auch dazu später noch mehr. Als letzte Gestaltungsmöglichkeit einer Gedichtsammlung ist auf begleitende Texte, sogenannte Paratexte, hinzuweisen. Die Sammlung als ganze oder einzelne Kapitel können zum Beispiel mit einem vorangestellten Motto versehen werden.
Damit ins Konkrete: Eines der Kapitel der Sammlung von 1815 heißt »Vermischte Gedichte« (in der Werkausgabe von 1789 war dies noch der Gesamttitel der Gedichtsammlung). Im Vergleich mit anderen Rubriken, die »Elegien« oder »Balladen« enthalten oder auch thematisch benannt sind (»Kunst«, »Gott, Gemüt und Welt«), klingt »Vermischte Gedichte« diffus. Es wirkt so, als habe der Autor hier das abgeladen, was andernorts nicht passte, was übriggeblieben war. Normalerweise würde man in diesem Teil nicht besonders wichtige Gedichte vermuten, aber genau das Gegenteil ist der Fall, denn zu den »Vermischten Gedichten« gehören so bekannte und wichtige wie »Mahomets Gesang«, »Harzreise im Winter«, »Wandrers Sturmlied«, »Seefahrt«, »Prometheus«, »Grenzen der Menschheit« und »Das Göttliche«. Das sind Gedichte, die besonders starke Aussagen enthalten, die aufs Ganze gehen und die Welt deuten wollen. Warum aber stehen sie bei den »Vermischten Gedichten«? Vielleicht weil es gerade für diese Gedichte kein »Summa Summarum« gibt, keinen Titel, der Einheit herstellen könnte?
Diese These wird durch das Motto gestärkt, das Goethe dem Kapitel vorangestellt hat und das zunächst seltsam klingt (FA 2, S. 279):
Wie so bunt der Kram gewesen,
Musterkarte, gibs zu lesen!
»Kram« steht hier für Warenlager, denn die »Musterkarte« ist eine Karte, nach der ein Kunde Produkte auswählte. In Grimms Wörterbuch wird erklärt: »bei tuchhändlern, knopfmachern, seidenhändlern eine karte, worauf die proben von tuch, knöpfen und seidenen zeugen angeheftet sind, und woraus der käufer für seine bestellung wählt.«[24] Goethe wählt also für sein Motto ein Bild aus dem Bereich der Wirtschaftswelt: Gedichte soll man so auswählen wie Stoffe in einem Geschäft. Wenn man sich beim Einkaufen etwas aussucht, trifft man die Entscheidung danach, was einem gefällt oder was zu einem passt. Bei der Lektüre von Gedichten würde man aber andere, tiefere Urteile erwarten, derart, dass man sich in einem Gedicht wiederfindet, dass man ein Gedicht als wahre Darstellung einer Situation empfindet. Gedichte sollen doch etwas mit unserem Inneren zu tun haben, uns vielleicht erfreuen und beruhigen oder verunsichern, verstören, jedenfalls nicht nur gefallen wie ein neues Kleidungsstück. Aber Goethes Motto führt Gedichte in alltagspraktische Entscheidungen zurück, macht sie zu Angeboten, die einem Kunden passen oder nicht passen können.
Weiterhin sagt er: Die Gedichte sind verschieden, »bunt«, und so wie man im Geschäft nicht alle Stoffe aussucht, sondern einen oder auch mehrere, so soll man auch mit den vermischten Gedichten umgehen. Man kann sich etwas heraussuchen und mitnehmen, anderes liegenlassen, ist nicht verpflichtet, aufs Ganze zu sehen, nach einem Zusammenhang der »Vermischten Gedichte« zu forschen. Mit dem Titel und dem Motto setzt Goethe also die Einheit des Kapitels stark herab. Und man kann weiter fragen: Da es sich um weltanschauliche Gedichte handelt – bildet dieses Kapitel nicht auch den Zustand einer Gesellschaft ab, in der »vermischte« Überzeugungen und Vorstellungen vom richtigen Leben nebeneinanderstehen und wählbar sind?
Darum soll es in diesem Buch gehen, und zwar in den Bereichen der Liebe und des Glaubens. Goethe, so möchte ich zeigen, vertritt nicht die Vorstellung, dass es den wahren Glauben oder die richtige Liebe gibt. Er lebt vielmehr in seinen Gedichten Möglichkeiten aus, auch wenn diese sich logisch gesehen ausschließen. So kann er eine scharfe Religionskritik vertreten und gleichzeitig Gottvertrauen empfinden, so kann er in der Natur ein höheres Wesen erfahren und gleichzeitig erklären, dass die Natur gefühllos und kalt sei. Das meinte er, wenn er seine Überzeugungen als bunten Kram bezeichnete. So auch in der Liebe: Er kennt die Liebe als Naturkraft, die sich mit allem eins weiß und keine klare Grenze zur Gewalt zieht. Er kann eine Affäre auskosten, die bewusst auf eine bestimmte Zeit hin angelegt ist, aber er kann auch eine stabile Beziehung loben, die auf gemeinsamen Überzeugungen beruht. Weiterhin kennt das »Kollektivwesen« Goethe auch die Versuchung des Seitensprungs und schließlich das peinliche Liebeschaos, wie es das Alter anrichten kann.
Ich möchte zeigen, dass dieser Autor nicht eine Weltanschauung vertritt, sondern dass er die Welt aus verschiedenen Positionen anschaut. Er gehört schon zum Typ des modernen Menschen mit ständigem Reflexions- und Abstimmungsbedarf. Seine Gedichte bilden jene Uneindeutigkeit ab, die viele heutige Leser gut kennen, wenn sie danach gefragt werden, woran sie glauben, und sie bilden das Nebeneinander einer Gesellschaft ab, in der ganz selbstverständlich verschiedene Modelle von Liebe existieren. Denn schon Goethe ist, wie er es genannt hat, »von Haus zu Haus« gezogen, sah seine Lebensstrecke nicht als geraden Weg an und hinterließ Bruchstücke. Ob man sie so zusammensetzen kann, dass sich daraus ein großes Ganzes ergibt?
Liebe
Für Goethes Liebesgedichte hat man sich immer schon interessiert, zuerst und oft, weil man etwas über die Frauen erfahren wollte, die in seinen Gedichten ›vorkommen‹. Über diese biographische Neugier hat Goethe gespottet: »Wir sind emsig nachzuspüren, / Wir, die Anecdotenjäger, / Wer dein Liebchen sey« (Gedicht »Geheimstes« im »West-östlichen Divan«, FA 3.1, S. 41). Später hat man nach dem ›Erlebnis‹ gefragt, das Goethes Liebesgedichten zugrunde liegt, hat sich intensiv mit seiner Psyche beschäftigt oder über das ›Wesen der Liebe‹, ausgehend von seinen Gedichten, nachgedacht. In den vergangenen Jahrzehnten folgte ein Umschlag weg vom Biographischen, ebenso von der Idealisierung, von der ›Größe‹ Goethes, und generell interessierte man sich weniger für die Liebeslyrik.[25]
Im Folgenden werden Gedichte aus über 50 Jahren vorgestellt, von den frühen Liebesliedern aus dem ›Sturm und Drang‹ bis zur späten Katastrophe, die in der Marienbader »Elegie« dokumentiert ist. Dort, wo man etwas über die biographischen Zusammenhänge weiß, werden sie benannt, denn Goethes Liebesgedichte besitzen ihre Intensität auch deshalb, weil sein Leben turbulent und spannungsvoll war. So versuchte er das Erlebte mit Gedichten zu verarbeiten und zu bewältigen. Aber interessant sind diese Gedichte auch deshalb, weil sie Formen der Liebe darstellen, die in modernen Gesellschaften und also bis heute vorkommen und die oft auch in einem Lebenslauf nacheinander- oder nebeneinanderstehen können. Wer Goethes Liebesgedichte liest, erfährt also viel darüber, wie geliebt werden kann, und dies deshalb, weil Goethe nicht eine einzige Form der Liebe zur wahren erklärt hat. Auch lässt sich keine Entwicklungsgeschichte aus den Liebeserfahrungen ablesen: Die »Sturm und Drang«-Gedichte, die oft als innigster und kraftvollster Ausdruck von Liebe angesehen wurden, ergreifen in der Tat, aber zu ihnen gehört auch das »Heidenröslein« mit seiner sexuellen Übergriffigkeit. Die später geschriebenen »Römischen Elegien« stellen das lustvolle, aber auch anstrengende Management einer Affäre dar. Neben Gedichten, die eine ideale Zweierbeziehung als geistig-körperliche Übereinstimmung feiern, steht die komische Darstellung eines gescheiterten Seitensprungs. Und das Ende bildet die genannte Marienbader »Elegie«, die Liebeserschütterung eines Menschen bezeugend, der darüber zu Grunde gehen will.
Diese höchst unterschiedlichen Formen der Liebe konnte Goethe darstellen, und zwar lyrisch, das heißt so, dass die Leser sie von innen miterleben können. Dem Ich dieser Liebesgedichte kann man folgen, mag dies identifizierend, distanziert oder einfach nur neugierig geschehen. Goethe gelingt im Vergleich mit allen Autoren vor ihm eine erhebliche Ausdehnung des Sprechens über Liebe, er zeigt, was möglich ist, und macht es erfahrbar. Und so kann man, wenn man will, auch wieder von literarischer Größe sprechen.
Glück und Gewalt: »Maifest«, »Mir schlug das Herz«, »Heidenröslein«
Die in der Kapitelüberschrift genannten Gedichte sind in den Jahren 1770 und 1771 entstanden. Sie gehören aber nicht nur zeitlich eng zusammen, sondern auch räumlich. Goethe schrieb sie in seiner Straßburger Lebensphase, in der er sein Jura-Studium abschloss, aber auch seine Fähigkeiten im Tanzen und Reiten erheblich verbesserte. Er lernte das Straßburger Münster kennen, zunächst als »sportliche Herausforderung«, wie Rüdiger Safranski in seiner Goethe-Biographie schreibt,[26] denn hoch oben auf dem Turm trainierte er sich seine Schwindelgefühle ab, und dann in seiner grandiosen Architektur. Er berichtet, wie der Anblick des Münsters sich mit den Tageszeiten und der Beleuchtung verändert, wie in der Abenddämmerung »die unzähligen Teile, zu ganzen Massen schmolzen, und nun diese, einfach und groß, vor meiner Seele standen, und meine Kraft sich wonnevoll entfaltete, zugleich zu genießen und zu erkennen« (FA 18, S. 114). Das Münster sei »bis in den kleinsten Teil notwendig schön, wie Bäume Gottes« (FA 18, S. 110).
Solche Aussagen sind Teil eines neuen Kunstprogramms, das Goethe in dieser Zeit, angeregt durch seinen älteren Freund Johann Gottfried Herder, entwickelte. Dieses Programm, oft »Sturm und Drang« genannt, steht im Zeichen der Natur: Das Münster wird mit »Bäumen Gottes« verglichen, und wer es ansieht, spürt »Kraft« in sich. Dazu passt das Interesse an einer literarischen Form, der des Lieds oder des Volkslieds: »Es ist wohl nicht zu zweifeln, daß Poesie und insonderheit Lied im Anfang ganz Volksartig, d.i. leicht, einfach, aus Gegenständen und in der Sprache der Menge, so wie der reichen und für alle fühlbaren Natur gewesen«,[27] schreibt Herder. In Liedern spricht nicht der bequem gewordene, rational abwägende Mensch der Zivilisation, sie sind nicht »für Leser auf dem Polster« geschrieben.[28]