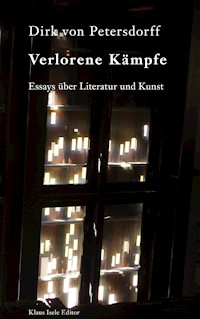
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dirk von Petersdorffs Essays setzen sich heiter und angriffslustig, witzig und provozierend mit der Literatur der Moderne, vor allem der Lyrik dieses Jahrhunderts auseinander. Er hat ein Buch geschrieben, bei dem mit Gegenwind gerechnet werden muss, denn nach wie vor findet das Denken über Kunst im Bannkreis der ästhetischen Moderne statt. Die Wirkung der leitenden Ideen allerdings hat nachgelassen. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kann man von einer erschöpften Moderne sprechen. Dieser Zustand einer erschöpften Moderne hemmt die Entstehung von Neuem und verhindert Antworten auf die Welt, also auf die Gegenwart - und das ist es doch, was wir eigentlich von der Literatur und Kunst verlangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
200 Jahre deutsche Kunstreligion!
Der neue und der alte Mensch bei Wieland, Henscheid, Enzensberger
Woher hat Adorno den Zaubertrank?
Wie modern ist die ästhetische Moderne?
Kurzer Gang durch die Neue Nationalgalerie
Was die Achtundsechziger mit dem »Tod der Literatur« eigentlich gemeint haben
Kann man denn Trauben lesen von den Dornen?
Reim und Kleid
Einleitung
Das Jahr 1989, das für den Untergang der letzten politischen Religion steht, zwingt die ästhetische Moderne zum Überdenken ihrer Grundlagen. Seitdem ist offenkundig, was man schon vorher hätte sehen können: Eine ästhetische Theorie, die von der offenen Gesellschaft ausgeht, von ihrem Wahrheitsbegriff, ihrem Zeitverständnis, ihrem Begriff von Individualität, existiert nicht. Das ist die Situation, mit der sich die folgenden Essays beschäftigen.
Nach wie vor findet das Denken über Kunst im Bannkreis der ästhetischen Moderne statt. Allerdings hat die Wirkung der leitenden Ideen nachgelassen. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kann man von einer erschöpften Moderne sprechen. Der Glaube ist schwach geworden und lebt als Anhänglichkeit weiter, an Vorstellungen, mit denen man groß geworden ist. Der Kunstbetrieb funktioniert irgendwie schon. Dieser Zustand einer erschöpften Moderne hemmt die Entstehung von Neuem, von Antworten auf die Gegenwart.
Die Epoche der ästhetischen Moderne beginnt, wie in einigen Essays gezeigt werden soll, im späten 18. Jahrhundert und weist, gerade in Deutschland, eine erstaunliche Langlebigkeit auf. Denn erstaunlich ist es schon, wenn Gottfried Benn in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit großer Geste die französische Lyrik des 19. Jahrhunderts als Entdeckung und als Maßstab gegenwärtiger Literatur präsentiert. Und noch erstaunlicher ist die dominierende Stellung Theodor W. Adornos im Bereich der Theorie. Man kann auf den Entwicklungsbruch durch den Nationalsozialismus verweisen, aber wichtiger zur Erklärung ist die Macht der Tradition. Denn Adornos Schriften enthielten das, was deutsche Künstler und Intellektuelle seit dem späten 18. Jahrhundert kannten. Verändert hatte sich die Zukunftsperspektive: Adorno bot eine pessimistisch eingefärbte Restform der Tradition. Und neu war das Sprachgewand, das offensichtlich in der Lage war, über das Missverhältnis dieser Ideen zur geschichtlichen Entwicklung hinwegzutäuschen. Adorno schrieb mit veränderten Begriffen auf, was schon Schiller aufgeschrieben hatte.
Seit dem 18. Jahrhundert ist im philosophischen Denken und im politischen Handeln das Modell der offenen Gesellschaft präsent. In diesem Modell gilt Wahrheit als Ergebnis einer Auseinandersetzung, in der sich Wahrheitsansprüche befinden. Da diese Situation am schärfsten im amerikanischen Pragmatismus beschrieben worden ist und da Schärfe zur Klärung zwingt, greife ich an mehreren Stellen auf Vertreter dieser Theorie zurück. Hilary Putnam formuliert die Einsicht, »dass unsere Beschreibungen von irgendetwas in der Welt immer durch unsere eigene Begriffswahl vorgeformt sind«; dass wir »die Welt für verschiedene Zwecke beschreiben«; dass deshalb verschiedene »Sprachen« nebeneinander bestehen. Damit befindet sich Wahrheit in einem Prozess der Fluktuation und Veränderung, sie driftet auseinander. Wahrheiten müssen sich rechtfertigen, sind ergänzungsbedürftig, endlich. Was wir vertreten, ist unser Glaube, von uns beschränkt.
In dieser Welt wird Individualität vor allem als Autonomie verstanden. Das Individuum wird über Grundrechte und einen weiten Freiheitsbereich definiert, in Form einer negativen Abgrenzung also. Die positive Festlegung wird ihm selbst überlassen. Die Umwelt gibt keine Häuser und Heimaten mehr vor, oder nur vorläufige Häuser und Teil-Heimaten. Man lebt in verschiedenen Bereichen, kann diese Bereiche wechseln, erfährt die Veränderbarkeit und Beweglichkeit der Welt an sich selbst, ist nicht Teil einer Totalität.
Deshalb lebt man nicht autistisch. Es gibt Rechtsgemeinschaften, Argumentationsprozesse, Formen von Intersubjektivität. Aber schon diese Begriffe markieren den Unterschied: Intersubjektivität ist keine Heimat. Hier werden Formen des Miteinander vorgegeben, aber keine Inhalte, die ein Ich sich einverleiben könnte.
Das Zeitverständnis einer solchen Ordnung ist weder an die Heilsgeschichte noch an ihre missratene Tochter, die Geschichtsphilosophie, gebunden. Die Zeit läuft nicht auf ein Ziel der Gattung hinaus, und sie kennt keinen Ursprung, kein goldenes Zeitalter, keinen Urschlamm. Die Stellung der Gegenwart lässt sich nicht auf einem Zeitpfeil markieren, als Verfallszeit bestimmen oder als Teil einer Aufwärtsbewegung, von einer alles durchwirkenden Vernunft oder irgendwelchen Großsubjekten gesteuert. Geschichte wird als Entwicklung von Lebensformen verstanden, als Veränderung von Formen der Weltdeutung. Zeit wird als reißende Zeit wahrgenommen, und der Einzelne bildet darin einen Moment. Dieses unemphatische Zeitverhältnis schließt nicht aus, dass man seine Gegenwart höher einschätzt als andere Zeiten und ihre Errungenschaften verteidigt.
Um diesen Zustand zu beschreiben, hat Richard Rorty den Ironiker entworfen: eine Person, die der Tatsache ins Gesicht sieht, dass ihre zentralen Überzeugungen und Bedürfnisse kontingent sind. Ironiker akzeptieren die Wandelbarkeit des Vokabulars, mit dem sie ihre Hoffnungen formulieren. Überall nehmen sie Konstruktionen wahr. Sie haben den Versuch aufgegeben, die verschiedenen Seiten ihres Lebens in einer Vision zu verbinden, denn eine Sprache dafür ist nicht denkbar. Ebenso verzichten sie auf den Glauben, dass es in der modernen Gesellschaft einen Ersatz der Religion geben müsse, mit entsprechender Bindungskraft. Vorm Fenster spielt sich das Ja und Nein der Menschen ab. Es gibt Verfahren, die verhindern sollen, dass es dabei zur Gewaltanwendung kommt.
Die ästhetische Moderne ist im späten 18. Jahrhundert in Auseinandersetzung mit dieser Deutung und Ordnung der Welt entstanden und hat sich in ihrer Mehrheit und vor allem in ihrer Theoriebildung gegen diesen Weg entschieden, hat diese Ordnung bekämpft, sich an Versuchen ihrer Überwindung beteiligt.
Auf den Verlust einer verbindlichen Wahrheit hat die Ästhetik mit der Idee geantwortet, dass eine solche Wahrheit, die von der Religion nicht mehr zu stiften sei, aus der Kunst hervorgehen solle. In der Gesellschaft der Zukunft wird Kunst damit zur Mythologie. Die Kunst soll den Wahrheitskern der auseinander driftenden Bezirke bilden, soll sie verbinden. So entstehen Werke, die religiöse Gesten nachahmen. Jene Begriffe, mit denen Karl Heinz Bohrer die Kunst der Moderne beschreibt, Gewalt und Plötzlichkeit, stellen Äquivalente für Donner und Blitz des sich offenbarenden Gottes dar. Damit wird das Gerangel der Interpretationen beendet. Und das absolute Schöne, das sich allen Kategorien, der Kausalität und der Zeit entzieht, entspricht dem Unbedingten der Religion.
Auf die Trennung von Zeit und Heilsgeschichte reagiert die Kunst mit einem Anschluss an die Geschichtsphilosophie, mit der Zeit zum Kampf von Wahrheit und Unwahrheit gerät. Vorstellungen der Metaphysik werden auf die Geschichte übertragen, und nun präsentiert sich eine kleine Gruppe von Menschen, die dazu ausersehen ist, den Fortgang der Zeit in die Hand zu nehmen; bis zu einem Zustand, in dem das Kommen und Gehen der Meinungen beendet ist. In einem »Athenäums«-Fragment bezeichnet Friedrich Schlegel den »revolutionären Versuch, das Reich Gottes zu realisieren«, als den »elastischen Punkt der progressiven Bildung«. Von diesem Versuch ist die ästhetische Moderne als Teil dieser progressiven Bildung durchdrungen, daran hat sie offensiv mitgearbeitet. Die reißende Zeit sollte zur gerichteten Zeit werden.
Auf die Individualität, das Freiwerden des Menschen reagiert die ästhetische Moderne mit Dauerklagen über Entwurzelung, Entfremdung und Substanzlosigkeit. Sie verheißt ihm eine Befreiung von sich selbst, ein Aufgehen in einem größeren »Ganzen« oder einem diffusen »Anderen« der Vernunft. Die Zukunftskunst, die neue Mythologie soll dem Ich wieder ein Selbstverständnis verschaffen, das es nicht bezweifeln muss. Der Kunstgenuss soll im Rausch der Gläubigen verbinden, die Grenzen der Individualität sprengen. Die Freisetzung des Ich wird in der Moderne fast immer als Leiden angesehen, nur selten als Möglichkeit der Selbsterweiterung.
Das Jahr 1989, das für den Untergang der letzten politischen Religion steht, zwingt die ästhetische Moderne zum Überdenken ihrer Grundlagen. Denn wenn das letzte Gegenmodell zur Ordnung westlichen Typs gescheitert ist, dann wird eine Ästhetik ortlos, die sich als Fundamentalkritik dieser Welt und ihrer Ideen verstanden hat. Beim Rückblick auf das 20. Jahrhundert liegen die katastrophalen Folgen gegenmoderner Herrschaftsformen offen. Ebenso deutlich ist, dass die realisierten Versuche, Religion und Politik zu verbinden, die Geschichte metaphysisch aufzuladen und das Subjekt in eine größere Einheit aufgehen zu lassen, in Zwang, Gewalt, Vernichtung umgeschlagen sind.
Es existiert keine ästhetische Theorie, die von der offenen Gesellschaft ausgeht, von ihrem Wahrheitsbegriff, ihrem Zeitverständnis, ihrem Begriff von Individualität. Das ist ein Mangel, weil die offene Gesellschaft die Gesellschaft der nächsten Zeit sein wird. Man kann natürlich fragen, ob die Kunst überhaupt eine Theorie benötigt. Aber der Blick zurück zeigt, dass Zeiten, deren Werke wir bewundern, auch Zeiten lebendiger Auseinandersetzungen waren. Zuerst geht es darum, das Denken freizusetzen, denn die Moderne hat durch ihre Festlegungen die Kunst eingeschränkt, hinsichtlich ihrer Formensprache und ihres Weltzugriffs. Mehr und mehr hat sich eine negative Ästhetik entwickelt. Eine neue Ästhetik soll deshalb die Grenzen des Vorstellbaren erweitern, sich nicht umgehend wieder festlegen; auch nicht auf die Affirmation einer ironischen Gesellschaft und eines bestimmten Menschentyps. Ebenso gut kann sie die Gesellschaft links liegen lassen; wobei es allerdings nicht schaden kann zu wissen, was man links liegen lässt. Fixierungen sind abzustreifen: die Idee, eine Welt negieren zu müssen, der man angeblich gegenübersteht. Und schließlich haben wir genug von einer Haltung, die Jürgen Habermas »Attitüde des Schlüsselhalters« genannt hat.
In einer solchen Situation ist es nahe liegend, und diese Tendenz ist an vielen Stellen zu beobachten, sich zurückzuziehen, um in der Vergangenheit Hilfe und Anstoß zu finden. Zu dieser Vergangenheit gehören auch das 19. und 20. Jahrhundert, denn die ästhetische Moderne besteht natürlich nicht aus einem Block, nur aus den kritisierten Bewegungen. Natürlich gibt es andere Wege durch diese Zeit, auf die ich in den Essays eingehen werde. Aber wichtiger ist die Weite der Vergangenheit, Jahrhunderte, die einer auf die Zukunft fixierten Gegenwart versunken waren, jetzt wieder auftauchen. Einer Gegenwart, die nicht in eine feste Zeitordnung eingebunden ist, steht vieles offen. Aber noch ist der Geist damit beschäftigt, sich zu entfesseln, die Glieder zu reiben. Erst dann kann er seine Schein-Heimat, die Moderne, verlassen. So wie Plotin sagt: »Wir werden in See stechen wie Odysseus von der Zauberin Kirke oder von Kalypso. Denn er war’s nicht zufrieden zu bleiben.« Und er fuhr auf das Meer der Kontingenzen hinaus.
200 Jahre deutsche Kunstreligion!
Wird über Literatur in Deutschland noch gestritten? Viele, und zumal die Wortführer von gestern, klagen über Stillstand und Ermüdung. Doch das betrifft vor allem sie selbst. Der Epochenbruch 1989 hat die Kunst und ihre Theorie in Bewegung gesetzt. Die letzte jener gegenmodernen Welten ist verschwunden, die mit der bürgerlichen Gesellschaft seit dem späten 18. Jahrhundert verwachsen waren; die als Teile der Moderne von ihr geprägt waren, ihre Bedingungen aber bekämpften und überwinden wollten. Im Laufe ihrer Geschichte hat die offene Gesellschaft, so sagt es François Furet, wie keine andere Menschen hervorgebracht, »die das soziale und politische System verabscheuen, in das sie hineingeboren sind; die Luft hassen, die sie atmen, obwohl sie Grundlage ihres Lebens ist«. Warum – das ist heute die Frage – gehörten die meisten deutschen Kunsttheoretiker und viele der größten Künstler zu diesen Menschen – warum waren sie Feinde jener Gesellschaftsform, in der wir vorläufig leben? Wie oft haben sie die Gefahren zu großer Freiheit gepredigt, wie selten Angst vor zu wenig Freiheit empfunden? Welch merkwürdiger Hass auf den Alltag der Menschen durchzieht so viele ihrer Werke und zersetzt den Bann, den Zauber der Kunstreligion?
Ein Gang …
Station 1. In einem Buch über den George-Kreis, über Borchardt und Hofmannsthal hat Stefan Breuer beschrieben, wie Kunst die Moderne bannen sollte. Die soziale Mobilität, das kreisende Rad des Kapitalismus, die flackernden Bilder der Kulturindustrie, die Entpersönlichung, das Verlachen von Autoritäten – bilden das Panorama einer Welt aus den Fugen. Die Kunst soll Rettung bringen. Sie wird zur Wahrheit ohne Zeit. Zur Wahrheit im Singular. Zur Wahrheit für alle. So die Gruppenphantasie. Breuer analysiert die damit zusammenhängenden politischen Annahmen, den antiwestlichen Affekt und die Kritik der Demokratie. Auch weist er auf die Überforderung der Kunst hin, die charismatisch aufgeladen wird, sich selbst bespricht, schwerelos wird, der Leere entflieht, Macht und Gewalt will. Ein »Ringen um wahren Zwang« nannte es Hofmannsthal.
Merkwürdig sind aber zwei Einschränkungen in Breuers Buch. Der ästhetische Fundamentalismus wird zeitlich begrenzt, im 18. und 19. Jahrhundert habe es derartige Vorstellungen nur ansatzweise gegeben. Ebenso wird die Angelegenheit politisch kanalisiert, nämlich rechts. Zur Begründung heißt es, dass die »universalistische Ethik« sozialistischer Künstler nicht mit dem Elitarismus und den Führer-Phantasien einer Kunstreligion zu verbinden sei. »Er hat Vorschläge gemacht, wir haben sie angenommen« – schon ein harmloses Beispiel wie dieser von Bertolt Brecht für sich selbst erdachte Grabspruch kann zeigen, dass ästhetische Egomanie politisch gut verteilt ist. Auch auf den Begriff »Ethik« könnte man verzichten, zum Beispiel nach der Lektüre sozialistischer Lehrstücke, in denen auf dem Weg zur Sonne, zur Freiheit seitenweise Leute liquidiert werden, die noch nicht verlernt haben, ›Ich‹ zu sagen. Wichtiger ist aber ein systematischer Aspekt. Denn wo Kunst gegen die offene Gesellschaft steht, gerät sie in Versuchung, sich Bewegungen anzuschließen, die scheinbar ähnliche Ziele mit sehr viel mächtigeren Waffen verfolgen – sie gerät in den Bannkreis totalitärer Politik. In dieser Versuchung treffen sich rechte und linke Künstler. Auch der George-Kreis will nicht der George-Kreis bleiben. Man sieht sich, wie es der Titel eines Gedichtbandes sagt, als Wegbereiter eines »Neuen Reiches«, das esoterisch und im Kreis bereits gelebt wird.
Station 2. Gleich nebenan. Auf zahlreichen Avantgarde-Konferenzen der letzten Jahre wird erstaunt nach der Begeisterung gefragt, die europäische Avantgardisten angesichts von Massenaufmärschen, Sturzkampfbombern und politischer Tabula-rasa-Beschallung überfiel. Aus der Distanz wird sichtbar, dass ›Entgrenzung‹ gewaltbereit ist, wie ›Reinheit‹ politisch wurde und ›Wahrheit‹ mit den Meinungen Schluss machte. Auf Deutschland bezogen, ist das Verhältnis der Kunst zur Weimarer Republik von Interesse. Mit großem Erstaunen entdeckt man unheimliche Nachbarschaften politisch geschiedener Autoren: die Sehnsucht nach ultimativen Gegensätzen, nach der großen Krise, der Zerstörung der Oberfläche – woraus dann das Neue blühen sollte, das »Leben«, das »Andere«, das »Reich«. Weiterhin gab es ein Verlangen nach Pistolen-Duellen, Letztbegründungen und einer Dichter-Priester-Krieger-Kaste. Die entsprechenden Darbietungen waren raunend, beschwörend, die Literaturwissenschaft raunt mit, und so ist es erfrischend, in der »Deutschen Geschichte« Gordon Craigs (1978) ein Urteil aus der Distanz zu finden: »Ein hervorstechendes Kennzeichen des Weimarer Kulturlebens war die Abneigung seiner führenden Vertreter gegen die republikanische Verfassung und gegen deren Organe in Regierung und Parlament.« Craig belegt das mit antidemokratischen Platitüden Kurt Tucholskys, und auch das ist erhellend, bricht es doch mit der Annahme, dass Intellektuelle, die gegen die aufmarschierende Rechte kämpften, sich zwangsläufig um Freiheit sorgten oder die Demokratie verteidigten. Im Jahr 1931 hielt der russische Literaturtheoretiker Tretjakow einen Vortrag in Berlin. Er stellte, so berichtet ein zeitgenössischer Beobachter, die neue sowjetische »Kollektivliteratur« vor, schilderte, wie durch gewisse Zwangsmaßnahmen jede »individualpsychologische Literatur« verschwunden sei, und präsentierte den neuen Menschen einer neuen Kunst, »ohne Dämon und Triebe«; danach pries er die Rote Armee. Das literarische Berlin, das in großer Zahl versammelt war, klatschte, so der Beobachter, »begeistert und enthusiasmiert«. Dieser Beobachter, der scharf die Nähe von utopistischen Kunstkonzepten und politischer Gleichschaltung sieht, ist Gottfried Benn, 1931. Zwei Jahre später wird er vom »Verlust des Ich an das Totale« schwärmen, »Geistesfreiheit« mit »Zersetzungsfreiheit« gleichsetzen und ins »mythische Kollektiv« eintreten – das stärker war als der Wille zur Freiheit.
Station 3. Wer Lichtreinbringer sein will, braucht Dunkelheit, schwarz und tief. Die Generation der Acht- undsechziger hat die fünfziger Jahre der Bundesrepublik mit der Finstervokabel »Restauration« belegt. Zwar spricht einiges dagegen, die Verfassung, die Westbindung, doch gab es zweifellos Kontinuitäten und alte Mächte, welche auch die neuen waren. Das belegt die offizielle Quellensammlung deutscher Dichter, die unter dem Titel »Vaterland, Muttersprache« erscheint. Das Buch enthält unzählige Erklärungen, offene Briefe, Forderungen, Deutsche Dichter über alles sollte es eigentlich heißen. In einer Äußerung unter dem Titel »Dämonokratie« stellt Peter Rühmkorf sich und die Kollegen als »befugte Minderheit« (Weltgeist?) der »machtmissbrauchenden Partei« (45,2%) gegenüber; am Horizont schaut er eine »Revolution der Intellektuellen«. Allerdings stehen dem gewisse Hindernisse im Wege, zum Beispiel das Wahlrecht: »Vier Wahlstimmen für vier Nobelpreise, vier für ein Kaffeekränzchen, wo solche Rechnung aufgeht, ist etwas faul im Staat Democracy.« Ebenfalls aus den fünfziger Jahren stammt eine Äußerung von Alfred Andersch unter dem Titel »Skandal der deutschen Reklame«. Hier ereifert sich der durch sein Eintreten für Ernst Jünger bekannt gewordene Autor über den Anblick »reichlich dekolletierter Damen«, über junge Herren mit Clark-Gable-Image, über die zahlreichen englischen Einsprengsel in der deutschen Sprache und erklärt schließlich die Nachkriegsgesellschaft zu einer »in Permanenz tagenden Cocktail-Party«. Besser als Polen-Überfallen, möchte man sagen, aber Andersch will Haltung! Schon in einem Leitartikel des später verbotenen Ruf hatte er dem neuen Europa die Hitlerjugend sowie die jungen deutschen Soldaten ans Herz gelegt. Denn die hätten sich in den letzten Jahren des Dritten Reiches unter »rücksichtsloser Hingabe ihrer ganzen Person« eingesetzt. Zwar stand Deutschland für eine falsche Sache, »aber es stand«. Und eben diese »Gemeinsamkeit der Haltung und des Erlebens« ermögliche nun den Brückenschlag zu den Existentialisten und Wahrheitsvertretern anderer Nationen, z. B. zu Sartre und seinen »französischen Kameraden«. Alles, was deutsche Intellektuelle des 19. und 20. Jahrhunderts ausgezeichnet hatte, ist wieder da: die Selbstermächtigung, Massenverachtung, die Ablehnung demokratischer Institutionen und tiefer Ausschnitte sowie eine merkwürdige Aversion gegen Partys von Leuten, die einem nichts getan haben. Wo ist die Restauration, wenn nicht hier?
Station 4. Play it again. Als die DDR verschwand, zeigte sich erneut die Hartnäckigkeit bestimmter Muster der Moderne-Kritik. Als die Leute aufbrachen, demonstrierten und einkaufen gingen, ließen die Dichter die Vorhänge runter und verfassten Aufrufe unter Titeln wie »Bleiben Sie bei uns!« oder »Für unser Land«. Diese Texte sind stilistisch ergiebig. Noch immer ist der eigentümliche »Wir«-Sound erhalten – 19-mal ›wir‹ auf einer guten Seite – der den Leuten eine Einheit vorredete, die es längst nicht mehr gab. Christa Wolf sprach im DDR-Fernsehen, geißelte, protestantisch-idealistisch, das vergnügungssüchtige Treiben im Westen, sie sprach von Utopien, verkündete ein »nützliches und interessantes Leben« … da ging die Quote in den Keller. Stilistisch bemerkenswert ist auch das hartnäckige Festhalten an eingeübtem Politvokabular. Als die Welt aus den Bahnen ging, sahen die Worte alt aus. Ungebrochen ist von der »revolutionären Erneuerung«, vom »Volk«, von »einflussreichen Kreisen aus Wirtschaft und Politik in der Bundesrepublik« und von der »sozialistischen Alternative« die Rede. Ebenso charakteristisch ist die Ausweitung des Begriffes »demokratische Gesellschaft« zu »wahrhaft demokratische Gesellschaft«, denn derartige attributive Ergänzungen sind aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts zur Genüge bekannt. Wer den Leuten statt Freiheit »wahre Freiheit« versprach, meinte damit in der Regel, dass hier und heute zunächst gewisse Einschränkungen zu ergreifen seien, die aber später! – dann! – in lichter Zukunft! – einst! verschwinden würden. Und dialektisch füllten sich die Kerker. Die spezifische Melange dieser Aufrufe ergibt sich allerdings erst durch die Verbindung der Politformeln mit der Tradition deutscher Innerlichkeit: »Fassen Sie zu sich selbst und zu uns, die wir hier bleiben wollen, Vertrauen.« Grass und Frisch schickten aus dem Westen eine Solidaritätsadresse.
… zu den Wurzeln der Moderne und Gegenmoderne …
Theorien und Traktate – was hat das alles miteinander zu tun? Die These ist: Solche Stationen sind Punkte einer Fluchtlinie – wenn man sie auf jene Kunstreligion bezieht, die sich Ende des 18. Jahrhunderts als Reaktion auf die politische, soziale und denkgeschichtliche Moderne herausbildet und bis ins späte 20. Jahrhundert als (deutsches) Oppositionsmodell zu den Grund lagen der westlichen Welt versteht. Die Mythen dieser Glaubenslehre sind konzentriert in ihren Anfängen zu finden – zum Beispiel bei Friedrich von Hardenberg (1772-1801), der sich Novalis nannte. Ein Gang zu den Wurzeln hat Vorzüge. 1. Gedankenfiguren, die später starr werden und verkümmern, lassen sich hier im Zustand der Entstehung beobachten. 2. Den Anfängen ist noch jene Hoffnungslosigkeit fremd, die George und Adorno die Feder verbiegt. 3. Welt und Gegenwelt sind noch nicht geschieden, Dichtung und Alltagssprache durchspülen sich noch in den Werken Friedrich von Hardenbergs.
Das Zeitalter der Französischen Revolution gilt als Einbruch der Moderne; das ist eine Verkürzung. Zweifellos – viele Entwicklungen, die vom ästhetischen Denken der Goethezeit reflektiert und angetrieben, betrauert und bekämpft werden, sind älter, haben in den Jahrhunderten zuvor ihre Anfänge. Zweifellos – Erfindungen der Kunst, die lange als epochal neu galten, sind älter, lassen sich zumindest bis zur Renaissance zurückverfolgen. Dennoch ist der Bezug auf die Französische Revolution begründbar. Denn hier liegt erstmals im europäischen Rahmen die Realisation einer bürgerlichen Gesellschaft vor. Aus diesen Anfängen heraus hat sie sich in den folgenden zwei Jahrhunderten in Wandlungen, Unterbrechungen und langen Kämpfen gegen ihre Feinde behauptet. In dieser Welt leben wir noch heute. Und alles, was der ästhetische Modernismus als Teil dieser Geschichte und im Widerspruch zu ihr hervorgebracht hat, ist in der Zeit um 1800 schon gedacht worden, danach kommen, bis hin zu Adorno, die Variationen. Mit ihnen leben wir noch. Zurück zu Novalis. Auch für ihn hat die Moderne ihre Wurzeln, in der Reformation, der Aufklärung, dem Absolutismus. Doch er schreibt im Bann der Französischen Revolution, als die Moderne kulminiert, zur Anarchie gerät. Das Zeitalter der Trennungen ist vollendet, die Fliehkräfte haben gesiegt.
Der Begriff Revolution ist erklärungsbedürftig. Mit Robespierre und der Guillotine haben die Romantiker nur begrenzte Probleme. »Die Hinrichtung des Königs von Frankreich hat ganz Berlin von der Sache der Franzosen zurückgeschreckt; aber mich gerade nicht«, teilt Friedrich Heinrich Wackenroder unbekümmert mit. Und auch Novalis ist versucht, die »eiserne Maske« Robespierre zu romantisieren, denn die Jakobiner vertreten eine – wenn auch dunkle – politische Religion. Das Unglück beginnt erst, als die Revolution auf eine bürgerliche Ordnung hinausläuft. Jetzt spricht Novalis von »revolutionairen Philistern«, und damit sind nicht die Schreiber von Todeslisten gemeint, sondern Demokraten und Kapitalisten. Woran krankt deren Welt? Wie soll die Moderne geheilt werden?
Wer heute die Alte Nationalgalerie in Berlin betritt, verharrt – unter jenem lichten Standbild Johann Gottfried Schadows – vor Prinzessin (später Königin) Luise von Preußen und ihrer Schwester Friederike, die sich lächelnd umfassen. Novalis wollte um diese Skulptur eine »Loge« gründen und mit ihr die preußische Jugend erziehen. »Jede gebildete Frau und jede sorgfältige Mutter« soll ein Bildnis Luises in ihrem oder ihrer Töchter Wohnzimmer haben. »Ähnlichkeit mit der Königin« ist das Lernziel. Den Hof seines neuen Staates entwirft Novalis als Gesamtkunstwerk, als Mischung aus althergebrachten Zeremonien und romantischem Happening. »Innige Berührung« soll dort herrschen, veranstaltet vom König, dem »Direktor der Künstler«. Die Staatsbürger werden »Abzeichen und Uniformen« tragen, Schönheit und Sittlichkeit werden neu erstehen, denn Luise ist nicht nur Berlins Sex, sondern auch Preußens Moral. Und dieses romantische Preußen ist ein Modell gegen den Absolutismus und die Revolution; ein Staat, der seine Bürger über ästhetische Symbole, in denen sich Vernunft und Sinnlichkeit inkarnieren, zusammenführt und vereint.
Das Reich der Kunst scheint ohne politischen Zwang zu leben. Novalis erklärt, dass es ihm um die »freiwillige Annahme« eines Herrschers gehe und dass sein anderes Preußen als »Dichtung« zu betrachten sei. Gleichwohl war es ihm Ernst – denn die Dichtung »Glauben und Liebe«, in der dies alles steht, wurde in ihrem ersten Teil 1798 in den »Jahrbüchern der preußischen Monarchie« veröffentlicht, einer Hofzeitschrift. Sie war also politisch gemeint, hatte Politiker als Adressaten, und daher darf politisch zurückgefragt werden: Was passiert, wenn sich Bürger »freiwillig« entschließen, Luises Bildnis nicht in ihrem Wohnzimmer aufzuhängen? Romantiker reagieren auf solche Fragen in der Regel empört bis blasiert, so auch Novalis: »Wer hier mit seinen historischen Erfahrungen angezogen kömmt, weiß gar nicht, wovon ich rede.« Aber kommt nicht immer dort, wo es um das Innere der Häuser und Menschen geht, zuletzt die Geheimpolizei? Wer utopisch denkt, stellt solche Fragen nicht.
Doch die in »Glauben und Liebe« verbrämten Konflikte brechen an anderer Stelle auf. In seiner





























