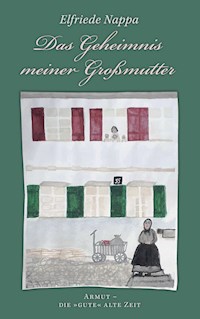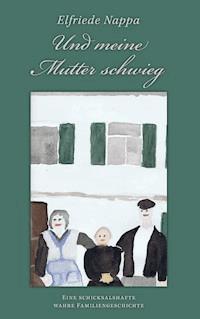
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine schicksalshafte wahre, Familiengeschichte. Nachdem Katharina und Johannes 1846 innerhalb von drei Monaten an Schleimfieber verstarben, kam ihr einziges Kind, die 4-jährige Tochter Barbara, zu der Herkunftsfamilie ihres Vaters nach Schietingen. Als 27-jährige lernte diese dort den Schäfer Heinrich aus Kirchheim-Notzingen kennen und lieben. Am 9. August 1870 wurde ihre Tochter Christine geboren. Die Verwandtschaft der verwaisten Barbara war gegen eine Ehe mit dem Schäfer. Sie wurde dann innerhalb der Familie in ihrem Geburtsort im Schwarzwald verheiratet. Die kleine Christine wuchs ohne die Mutter in Schietingen auf. Als uneheliches Kind, ohne Mitgift, ebenfalls mit einem unehelich geborenen Kind, heiratete Christine mit 28 Jahren im Waldachtal einen Witwer mit sechs Kindern. Nach zehn Ehejahren und drei gemeinsamen Kindern verstarb ihr Ehemann. Den Bauernhof führte sie mit diesen neun Kindern weiter. Als Witwe begann für sie eine schicksalshafte, schöne Liebesbeziehung. Frida, das Kind dieser Liebe, hatte ihr Leben lang an ihrer Herkunft gelitten, und geschwiegen. Am 10. Januar 1996 ist Frida in der Klinik Nordschwarzwald in Freudenstadt verstorben. Die letzten vier Jahre ihres Lebens musste sie, nach einer Kehlkopfentfernung, schweigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Glaube, Liebe, Hoffnung!
Ich habe geglaubt, so innig geglaubt, doch die Welt hat mir das liebste geraubt.
Ich habe geliebt, so innig geliebt, / doch die Welt hat mich zu Tode betrübt.
Ich habe gehofft, so innig gehofft, / doch die Welt hat mich betrogen so oft, drum sag ich noch einmal; / warum, warum, ’s gibt keine Antwort, Schicksal bleibt stumm.
Zum Andenken! deine Mutter. / Haiterbach, 5. 3. 1961
Inhaltsverzeichnis
Juni 1910
Mai 1898
Februar 1899
März 1900
Juli 1901
1902
August 1903
Sommer 1904
1. April 1906
1909
1910
1911
1914
1915
1920
1923
1924
1933
Nach 1945
Danksagung
Die Autorin
Begriffe, Erklärungen
Nachtrag zum Buch »Und meine Mutter schwieg«
Das Waldachtal!
Juni 1910
Sie schrie, der erste Schrei von Frida!
Als die Hebamme sie mit einer Hand an beiden Füßen nach oben hielt, mit der anderen Hand auf das kleine Hinterteil klopfte, einmal und noch einmal, kam der erste Schrei!
Sicher konnte man es bis in den Hof hinunter hören, diesen ersten Schrei!
Die Hebamme schaute zufrieden zu dem kleinen Mädchen; die Kleine hatte es mit ihrer Hilfe und der Tapferkeit ihrer Mutter geschafft.
Das rote Gesichtchen mit dem weit aufgerissenen kleinen Mund, den zusammengekniffenen Augen: sie schrie aus Leibeskräften! Wollte fast nicht mehr aufhören, schnappte nach Luft und wedelte mit den Ärmchen.
Sie war da, in dieser Welt angekommen! Nicht still und leise, wie es üblich ist.
Nein, soviel war ihrer Ankunft vorausgegangen!
Lotte, die Hebamme, wollte gar nicht mehr daran denken, wie schwer Christine an ihrer Schuld getragen hatte.
Diese war nun sehr erschöpft, jetzt nach der Geburt ihrer kleinen Frida. So schwer war es gewesen dieses Kind auszutragen, den neugierigen Blicken von überall, ringsherum standzuhalten.
Christine war nass, überall am ganzen Körper. Draußen war es sehr warm, hier in der Schlafkammer(1) auch durch die Wärme des heißen Junitages. Ein Gewitter lag in der Luft; man spürte es auch hier im Hause, es war drückend schwül.
Christine lag in Gedanken versunken, auf dem dicken, verschwitzten Federkissen.
Heute, am Johannestag, den 24. Juni 1910, ausgerechnet an diesem Tag hatte sie ihr Kind geboren! Warum wohl?
Johannes, Johannes, am Johannestag, welch eine Fügung, oder Zufall ...?
Oh, Johannes, wärst du doch hier bei uns, dann könntest du deine kleine Tochter sehen, mir den Schweiß von der Stirne abwischen. Sie sieht dir ähnlich, ein schönes Mädchen, rund und fest, alles ist gut geraten. Sie schläft in meinem Arm, schmiegt sich an mich, so wie du es auch gerne getan hast. Ich denke an das Lied:
»Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb, sie konnten zusammen nicht kommen, denn das Wasser war viel zu tief, denn das Wasser war viel zu tief!«
Bei uns war es nicht das Wasser! Es war das Leben, die Gesetze, die Umstände!
Mein Leben hatte wohl mit dieser schönen, sanften Liebesbeziehung erst begonnen. Zuvor hatte ich einfach nur gelebt, gearbeitet, gegessen und geschlafen. Meinem Mann bin ich als Frau zu Willen gewesen, fast immer, wenn er es wollte. Dann habe ich die Kinder bekommen, diese Tag und Nacht gestillt, gewickelt und getröstet. Nun liege ich hier mit dem Kind meiner späten Liebe. Der Vater dazu ist nicht hier! Er musste gehen, den Hof von heute auf morgen verlassen!
Wer bestimmte einfach so herzlos, wohl die Männer. Diese, die doch von klein auf abhängig von einer Frau sind, erst von der Mutter, die ihnen die Brust reichte wenn sie schrien, dann von ihrer Partnerin, die ihnen Zugang oder Verweigerung für ihre Wünsche gewährt.
Oh, Nachdenken, nein, das geht nicht, es bringt nur Unruhe und Wut in ihr hoch! Alles ist ganz anders gekommen als sie es sich gewünscht hatte.
Gut, die Heuernte war eingebracht, alles auf dem Heuboden aufgestapelt. Das Wetter war günstig gewesen, sie konnten zügig die vollen Heuwagen nach Hause fahren.
Die großen Buben hatten fleißig gearbeitet, obwohl sie in den letzten Wochen etwas wortkarg, sehr nachdenklich in sich gekehrt waren.
Immer wieder sah man sie mit abwesendem Blick still stehen, alles um sie herum schien vergessen zu sein.
... Ohne den Johannes, den Zweitgeborenen, sie vermissten ihn, den Bruder.
Wie hatte sich das ganze Leben der Geschwister so total verändert, er war nicht mehr da, nach so vielen Jahren des gemeinsamen Lebens. Immer noch unfassbar für sie alle.
Christine seufzte!
Die Hebamme versorgte nun erst einmal die Wöchnerin, wusch sie, zog ihr ein frisches Hemd an, kämmte die vollen langen Haare. Eine schöne Frau war Christine, dass sie sich so vergessen konnte, wer hätte das gedacht, keiner wollte das glauben.
Oh Christine, wie konnte das in dem kleinen Weiler geschehen?
Christine hatte keinen Ausweg aus den Wirren, den Verstrickungen gefunden.
In dem Hause, wo Anfang letzten Jahres der Ehemann Georg verstorben war?
Es war so unerwartet gewesen, ein Schock für alle, für die Kinder, für seine alten Eltern, und natürlich auch für Christine. Hatte sie doch hier hereingeheiratet, jetzt war sie die Bäuerin die das Sagen hatte, sie musste nun die Richtung angeben, wie es weiter gehen sollte.
Der Hausstand, die große Kinderschar, sie hatten es wohl verhindert, dass sie sich etwas angetan hatte. Der kleine Fluss, die Waldach, fließt ja nahe genug am Hause vorbei, bis da jemand etwas bemerkt hätte. Da wäre sicher jede Hilfe zu spät gekommen.
Die Nachbarin Berta, von der Sägemühle war auch da, sie sah nach dem Rechten, soweit sie es konnte. Selbst erwartete sie in wenigen Wochen auch ein Kind, und ihr machte die schwüle Junihitze zu schaffen, ihre Beine waren am Abend immer sehr angeschwollen. Wenn es bei ihr doch auch schon vorüber wäre, ihr Kind auch neben ihr liegen würde, das dachte Berta so im Stillen.
Sie sorgte nun für frische Bettwäsche, holte ein Leinentuch, Bett- und Kissenbezüge von den Wäschestapeln.
Ordentlich hatte es Christine in ihren Schrankfächern, alles war leicht zu finden. Trotz der großen Familie, mit den nun wieder neun Kindern. Manche waren inzwischen fast erwachsen, halfen im Haus und Hof mit, die großen Burschen und die tüchtige Anna.
Wie sie sich hier so umsah: es war eigentlich alles in Ordnung. Nur kein Vater war da, für das neugeborene, unschuldige Kind!
Christine lag nun in der frischen, duftenden Wäsche, erschöpft und in Gedanken.
Diese ließen sich nicht ausschalten, nicht wie beim elektrischen Licht an der Zimmerdecke.
Jetzt wurde langsam die Kammertüre geöffnet und vorsichtig schaute ein blondes Mädchen herein, die Barbara, Bärbele genannt! Sie war noch so klein. Mit ihren fast 7 Jahren sah sie aus wie eine 5-jährige, mit dem runden Gesichtchen und den blonden Löckchen.
Ganz vorsichtig ging sie zum Bett der Mutter, dort lag doch tatsächlich das kleine Kind, von dem immer geredet worden war. Es war nun doch so, da lag ein kleines Kind mit schwarzen Haaren, und zusammengekniffenen Augen, die Ärmchen oben neben dem Kopf, den Mund öffnete es zu einem Gähnen.
Schön sah das Kind nicht aus, das Gesichtchen war rot und zerknittert, es sah fast so aus wie Tines Ehemann am Abend, immer wenn er von seiner Arbeit im Walde heimkam. Ja und beim Gähnen hatte sie gesehen, dass das kleine Kind gar keine Zähne hatte, so wie der Johann Frieder vom oberen Berg. Das war doch ein ganz neues Kind, warum es keine Zähne hatte, das verstand sie gar nicht.
Mit der fremden Frau, die jetzt da war und so bestimmend Anweisungen gab, war es wohl mitgekommen, irgendwie unbemerkt, in der Tasche ... wohl die Stiege(2) herauf in die Kammer, zur Mutter ins Bett.
Die Brüder hatten das mit dem Kind schon vorher gewusst, wer ihnen das wohl gesagt hatte? Sie wollte es fast nicht glauben, da ja nur junge Mütter Kinder bekommen und dazu war dann auch ein Vater da, aber hier war das nicht so. Kein Vater war da, wo denn?
Die Mutter sagte nun nichts, sie sah sehr müde aus und hatte die Augen geschlossen, Tränen liefen an ihren Wangen herunter.
Ein bisschen dunkel war es in der Schlafkammer, die Fensterläden waren an beiden Fenstern geschlossen.
Die Frau mit der großen Tasche, die Brüder sagten, es wäre die Hebamme, sagte nun: »Die Mutter möchte sicher schlafen, sie braucht Ruhe.«
Christine schüttelte schwach den Kopf, wie sollte sie nur schlafen können?
Die Gedanken waren einfach da, kreisten im Kopf hin und her, ohne einen Ausweg, eine Lösung zu finden.
In der abgedunkelten Kammer konnte sie nun gut ruhen, während draußen im Hofe die Stimmen der Buben und von einigen Frauen zu hören waren.
Christine ist allein ... sehr allein, obwohl das Haus voller Leben ist.
Oh, wie ist das alles nur so gekommen?
Unfassbar ist es immer noch für sie, obwohl sie viele Monate Zeit hatte sich an diesen Zustand zu gewöhnen.
Neben ihr das unschuldige Kind, das Kind der späten Leidenschaft, der Liebe, des Vergessens.
Ja, diesmal war es ein Kind der Liebe.
Frida soll sie heißen, hatte sie entschieden.
Nach all den vielen Aufregungen der letzten Monate, möchte sie jetzt einfach zur Ruhe kommen.
Nichts mehr denken, gar nichts mehr! Das Leben, ging oft so steinige, unübersichtliche Wege, sie musste nun weitermachen, da sein, mit der großen Familie und dem kleinen Kind, ohne einen Mann, der einmal mit der Faust auf den Tisch schlägt und sagt, wo es langgeht.
Sie ist jetzt 39 Jahre alt, hatte den Witwer mit sechs Kindern geheiratet. In den zehn Ehejahren noch drei weitere dazu bekommen. Dann, als Witwe noch der krönende Abschluss, ein ungeplanter Nachkömmling!
Im Februar letzten Jahres war ihr Mann Georg hier im Ehebett verstorben, still eingeschlafen, einfach so, mit erst 48 Jahren. Als sie den schon erkalteten Körper neben sich im Bett anfasste, hätte sie fast laut aufgeschrien, so sehr hatte sie sich erschreckt. Neun unmündige Kinder waren zu Halbwaisen geworden, an diesem frühen Februarmorgen.
Schlimm für alle! Die Nachbarn hatten ihre Hilfe angeboten, mit den Arbeiten des Hofes, mit dem Vieh, obwohl sie sicher alle genug in ihren eigenen Häusern und Höfen zu tun hatten.
Mai 1898
Ein schöner Sommertag war der 31. Mai 1898 gewesen.
Die Bäuerin Käthe hatte noch für alle die Morgensuppe gekocht, trotz ihres vollen Leibesumfanges. Es war Zeit, dass das Kind nun kam. Sie bewegte sich immer schwerfälliger, hoffte jeden Tag, dass es nun endlich mit den Wehen losgehen würde, so wie zuvor bei den anderen Kindern auch. Wie lange sollte sie noch warten, das Kind müsste schon im Korb liegen. Sie hatte gedacht es wäre um den 18. Mai herum und nun ist dieser Monat schon bei seinem letzten Tag angelangt, sie immer noch rund und schwerfällig.
Bevor die Heuernte begann, hofften sie alle, dass dann Käthe, die Mutter sich wieder in der Stube aufhalten konnte, das Essen zubereiten und die kleinen Buben und das Neugeborene versorgen würde. Jetzt war nichts geschehen, schlimm diese Warterei.
Sie sagte nun zu Georg: »Hole die Hebamme, es ist mir nicht gut!«
Die kleinen Buben weinten und merkten, dass da etwas anderes die frühe Morgenstunde erfüllte.
Georg spannte die Rösser vor die Kutsche und fuhr eiligst davon. Schnell war er wieder mit der Hebamme vom Kirchdorf da.
Diese kam mit ihrer großen Tasche in das Haus herein, sagte fröhlich »Guten Morgen allerseits!«
Käthe war noch in der Stube und versuchte den kleinen Hans zu beruhigen.
Dann gingen sie zusammen die Stiege hoch. Oben in der Schlafkammer untersuchte die Hebamme Lotte sie, schaute dabei besorgt zu Georg hin.
Sie tastete den Bauch ab, versuchte die Herztöne zu erfassen, ruhig fühlte sich die Bauchdecke an, keine Bewegungen des Kindes.
Lotte sagte: »Das Kind ist sehr groß und liegt falsch herum, die Füße sind unten im Becken!«
»Georg, hole den Doktor, dieser sollte sich das einmal ansehen!«
Heute, vor genau 11 Jahren hatten Georg und Käthe geheiratet.
Jetzt ist die Geburt des 9. Kindes fällig, überfällig. Sehr viel für eine Bäuerin neben der vielen Arbeit mit dem Hofe und den Kindern, dazu noch die fast jährlichen Schwangerschaften und Geburten.
Wieder wurden die Pferde aus dem Stall geholt und vor die Kutsche gespannt.
Georg fuhr in die größere Stadt, oben auf den Berg, zu dem Doktor.
Er holte diesen aus seiner Sprechstunde, er drängte, die Hebamme hätte es so angeordnet, er dürfte nicht ohne den Arzt kommen.
Also, der Doktor ließ seine Patienten im Wartezimmer, sagte zu diesen noch, dass er gleich wieder zurück wäre.
Mürrisch saß der Doktor neben Georg auf dem Kutschbock. Dieser Bauer brachte seine ganze Tagesplanung durcheinander!
Auf dem Bauernhof kam der Doktor stürmische die Stiege heraufgehetzt. Lotte stellte ihm eine Schüssel mit heißem Wasser und Kernseife hin. Während er seine Hände und Arme bürstete und rieb, fragte er, ob denn die Gebärende Wehen hätte, wann der Geburtstermin eigentlich wäre, warum man ihn aus seiner Sprechstunde hole, wenn doch noch gar nichts los wäre, noch keine Wehen eingesetzt hätten.
Er tastete den Leib ab, hörte nach den Herztönen die nur schwach oder gar nicht vernehmbar waren, untersuchte den Muttermund. Irgendetwas stimmte da nicht, die Füße des Ungeborenen lagen quer.
Keine Wehen, die Frau erschöpft und müde, fast teilnahmslos.
Angeblich hatte sie die Zeit der Schwangerschaft bereits überschritten.
Das 9. Kind war es, da konnte die Frau sicher rechnen, wann die Zeit gekommen war.
Der Doktor sagte: »Es ist wohl am besten, ihr bringt sie in die Frauenklinik nach Tübingen, dort sind sie für Problemgeburten eingerichtet, auch um eventuell einen Kaiserschnitt durchzuführen!«
Er stellte einen Überweisungsschein für die Klinik aus, kratzte sich am Hinterkopf, sah zu Lotte hin, ja sie sollte unbedingt mitfahren. Alles mitnehmen, auch die Papiere, dabei sah er Georg an.
»Die wichtigen Papiere, und auch ein paar Mark, Tübingen ist weit weg!«
Georg spannte die Pferde an, die Hebamme richtete eifrig alles zusammen, viele Dinge die für die lange Reise notwendig waren. Kupferne Bettwärmeflaschen wurden gefüllt, trotz der Sommerwärme, man wusste ja nicht, womöglich kommt das Kind unterwegs doch noch zur Welt.
Decken, Tücher, Wasser zum Trinken, Brot, und gerauchte Wurst für Georg. So ein Mannsbild bekommt auf der langen Fahrt sicher großen Hunger.
Dann noch Getreide für die Pferde.
Die Kutsche wurde mit Stroh ausgelegt, auf der sie die kraftlose Schwangere betteten. Männer von dem nahen Sägewerk waren herbei geeilt und hatten die stöhnende Frau vorsichtig getragen und ganz sanft auf das Stroh gelegt.
Das hätte man den starken Männern nicht zugetraut so bedacht, fein zuzugreifen.
Georg lenkte die Pferde an der Waldach entlang, über Bösingen, Beihingen, Ober-und Unterschwandorf, Iselshausen Mötzingen und Unterjesingen, über viele unebene Wege.
Unendlich lange erschien auch Lotte diese Strecke. Mit einem in Wasser getränkten Tuch, benetzte sie die Lippen von Käthe. Sie war bei ihr auf dem Stroh, lag hinter der fast Leblosen, massierte ihr den Rücken, Bauch, die Beine, so gut es in der beengten Kutsche möglich war.
In Mötzingen hatten sie kurz Halt gemacht, etwas gegessen und die Pferde versorgt. Weiter ging es das Ammertal entlang. Endlich tauchten am Horizont die Türme der Tübinger Stiftskirche auf. Hilfe erschien nun nahe.
Es war schon früher Abend, als sie erhitzt und erschöpft vor der Tübinger Frauenklink vorfuhren.
Lotte hetzte in die Klinik hinein, konnte kaum sprechen so aufgeregt wie sie war. Eine Hochschwangere in der Kutsche, schnell, »Hilfe schnell, schnell«, brachte sie mühsam über die Lippen.
Helfer mit einer Tragbahre rannten herbei, ein Arzt im weißen, wehenden Kittel hinterher.
Sofort wurde veranlasst, dass die teilnahmslos wirkende Schwangere in den Untersuchungsraum gebracht wurde.
Das Stroh in der Kutsche war nass, blutgetränkt. Nichts Gutes bedeutete dieses.
Georg musste sich erst um die Pferde kümmern. Das Stroh drehte er einfach um, darüber breitete er eine Decke aus.
Hoffentlich ging alles gut mit seiner Frau und dem Kind.
Untersuchungen, die besorgten Gesichter der Ärzte, keine Wehen, keine Herztöne des ungeborenen Kindes. Sie berieten sich, wie sie Vorgehen sollten.
Georg musste für die Narkose und den Kaiserschnitt unterschreiben.
Er müsste auf alles gefasst sein, sie wüssten nicht ob das Kind zu retten wäre, wurde ihm gesagt. Eile war geboten. Wieso sie so spät gekommen wären, wenn doch die Geburt schon zwei Wochen überfällig sei?
Das Kind wurde an diesem Abend mit einen Kaiserschnitt geholt, es war vermutlich schon Stunden oder Tage zuvor tot.
Ein ausgereifter Knabe, gestorben im Leibe der Mutter. Die Nacht durften Georg und Lotte in der Klinik verbringen, an Schlaf war kaum zu denken.
Georg wurde in der Nacht zu seiner Frau gerufen, blass und regungslos lag sie da.
Die Blutungen konnten nicht gestillt werden. Zaghaft nahm er ihre Hand, sprach ihren Namen, versuchte sie zu umarmen. Er zitterte dabei, weinte, wischte sich verschämt die herabrollenden Tränen weg, ein Mann weinte doch nicht. Eine Schwester gab ihm ein Getränk und schob ihm einen Stuhl hin.
Georg war wie benommen, er konnte gar nichts denken und entscheiden. Lotte wurde auch geholt, sie erkannte sofort die bedrohliche Situation. Eine Stunde später setzte bei Käthe der Atem aus, es war kurz nach Mitternacht.
Die Schwestern nahmen die blutgetränkten Tücher weg, packten Zellstofflagen zwischen die Beine der toten Frau, um das noch nachfließende Blut aufzusaugen.
Das Pflegepersonal wusch die Verstorbene, legte das kleine tote Bübchen in ihre Armbeuge. Eine Ordensschwester sprach ein Gebet. Am frühen Morgen holte sie in dem Klinikgarten noch Blumen, legte diese auf die Brust der toten Mutter.
Lotte unterstützte Georg bei den anfallenden organisatorischen Dingen.
Zuhause hatte der Doktor ja gesagt, er sollte seine Papiere und Geld mitnehmen, dieser hatte wohl geahnt, wie es ausgehen würde.
Von der Klinik, dem Personal, wurde ihnen sehr geholfen, sie waren ja hier in Tübingen so fremd.
Auf dem Marktplatz, vor dem Rathaus stolperte Georg über die Pflastersteine, er wäre fast gestürzt, so erschöpft wie er war. Die Sorge des vorangegangenen Tages, den Schock in der Nacht mit dem tragischen Ende seiner Frau.
Das Kind brauchte standesamtlich nicht aufgeführt werden, wurde ihm gesagt, wenn es bereits im Mutterleib tot war.
Der Grund, warum seine Frau verstorben war? Lotte antwortete für ihn: »Sie ist verblutet, nach der Geburt, des toten Kindes!«
Am späten Vormittag reisten sie mit der Pferdekutsche zurück.
Schweigend, in Gedanken versunken. Hinten in der Kutsche lag nun kein Stroh mehr.
Dafür stand dort ein einfacher Holzsarg, darinnen gebettet die verstorbene Mutter, an ihrer Seite das tote Kind.
Sie reisten langsam zurück, Eile war nun nicht mehr geboten. In Mötzingen machten sie nochmals halt, tranken im Ochsen ein Bier und versuchten etwas zu essen.
Bedrückt fuhren sie am späten Abend im Waldachtal, in die Hofeinfahrt ein.
Im Nachbarhaus schaute der Hausherr zum Fenster heraus und hielt sich die flache Hand vor den Mund, als er den Sarg in der Kutsche entdeckte. Sofort trat er vom Fenster zurück, ging schnell zu seiner Frau in die Küche um ihr das soeben Gesehene mitzuteilen.
Erst vor einer Stunde hatten sie in Georgs Bauernhaus zusammen das Vieh versorgt, die kleineren Kinder zu Bett gebracht. Jetzt gingen sie nach unten, über die Straße zur Kutsche hin, halfen Georg mit den Pferden. Fritz nahm Georg in den Arm und sie weinten beide, die starken Männer weinten einfach nur.
Seine Frau Elisabeth, rief noch Männer von den Nachbarhäusern zur Hilfe, zusammen trugen diese den Sarg in die untere Stube hinein.
Die Großmutter, Georgs Mutter, saß wortlos am Tisch und schüttelte nur den Kopf, sie war verzweifelt, als sie die Nachricht über das tragische Ende, ihrer Schwiegertochter vernahm, fast nicht begreifen konnte sie es.
Nein, gestern Morgen hatte Käthe noch gelebt und die Kinder hier versorgt, nun bringen sie sie tot von Tübingen zurück, von der großen Klinik, Uniklinik, wo man doch immer helfen konnte, warum denn diesmal nicht, warum?
Ihr Georg, seine sechs unmündigen Kinder und der Hof!
Das geht doch nicht, einfach so, ohne die Mutter, die alles im Griff hatte, schaltete und waltete.
Sie selbst ist mit über 60 Jahren schon alt und kann da nicht helfen, sie hatte für sich zu tun.
Nachdem der Sarg in die Stube getragen wurde, taumelte Georg in das Haus, verlangte nach Wasser, nach Schnaps.
Gierig trank er alles und schaute ins Leere. Ohne Worte saß er da, schaute mit trüben Augen auf die Tischplatte vor sich hin. Jemand strich ihm über den Rücken, massierend in kreisenden Bewegungen, es war Lotte. Sie umarmte ihn von hinten, streichelte ihn am Hals und mit einer Hand über seinen Kopf. Widerstandslos ließ er alles mit sich geschehen, schien gar nicht anwesend zu sein, nur sein Körper saß fast regungslos da, einfach nur da.
Die kleinen schlafenden Buben, Hans und Georg, nahm eine Nachbarin mit zu sich nach Hause. Die anwesenden Frauen zündeten Kerzen an und beteten an dem inzwischen geöffneten Sarg.
Ganz weiß, blutleer lag die Tote da, neben ihr die verwelkten Blumen aus dem Tübinger Klinkgarten. Mit erst 38 Jahren ist ihr Lebenslicht erloschen, viel, viel zu früh.
In der rechten Armbeuge der Mutter lag der Knabe, unschuldig, klein und ohne Leben. Das Gesichtchen war zu sehen, auch bleich wie das der toten Mutter. Das Kind ohne Namen, Anonymus, ungetauft, weil es tot geboren wurde.
Am nächsten Vormittag fuhr der Nachbar Peter mit einer Kutsche nach Beuren bei Simmersfeld zu den Verwandten der Verstorbenen, um diese zu benachrichtigen und um Hilfe zu bitten, Hilfe zu holen.
Mit der Pferdekutsche kam der 75-jährige Vater von Käthe, Opa Michael aus Beuren. Seine Frau war leider schon vor vielen Jahren verstorben.
Inzwischen auch seine zweite Frau.
Nun so unerwartet, seine Tochter Käthe.
Schwerfällig und gebeugt, ließ sich der Opa aus der Kutsche helfen.
Tränen rannen ihm über die welke Gesichtshaut. Mit seinem Armrücken wischte er sich über sein tränennasses Gesicht. Immer, wenn er hier angekommen war, kam forschen Schrittes seine Käthe auf ihn zu, umarmte ihn.
Vadder, guater Vadder!
Nun war alles anders, schwarz gekleidet waren sie alle die da standen, die auf ihn zukamen. Georg ganz hinten, traute sich nicht so recht, fühlte sich wohl schuldig am Tode seiner Frau!
Andere Familienangehörige aus Beuren waren mit dabei, sie begleiteten den betagten Vater von Käthe.
Die junge Else sollte dann bleiben und den Haushalt versorgen, mit Hilfe ihres Bruders, Jakob.
Man musste Georg nun helfen, so gut es ging in dieser so traurigen Zeit.
Alfred war fast 10 Jahre, Johannes noch keine 9 Jahre.
Der Drittgeborene, Friedrich hatte nur einen Monat gelebt.
Anna, das einzige Mädchen, würde im Herbst 8 Jahre alt werden,
Willi, das fünfte Kind, war fast 6 Jahre.
Der an sechster Stelle geborene Johann wurde nur 4 Monate alt ...
Georg, der Fünfte, war fast 3 Jahre.
Hans, der Jüngste, noch keine 2 Jahre; dieser verstand noch nichts von dem, was um ihn herum vor sich ging.
Da war die Not sehr groß in diesem kleinen Bauernhaus.
Vater Georg war wie gelähmt, kaum in der Lage, irgendwelche Entscheidungen zu treffen.
Nachbarn halfen so gut es ging.
Die Hebamme Lotte kam und traf Georgs Entscheidungen, dicht neben ihm stehend, dieser schaute immer noch mit träumerischem Blick durch alle und durch alles hindurch.
Den ganzen Sommer über blieben die Verwandten, Else und Jakob auf dem Hofe.
Sie versorgten den Haushalt, die Kinder, den Hausgarten.
Keine Zeit blieb für Gespräche mit den Familienangehörigen. Dieses war auch unüblich, einfach zu reden, sich in den Arm zu nehmen.
Anderes gab es zu tun, viel Wichtigeres, die Dinge des täglichen Lebens.
Vor allem jetzt im Sommer, für den Winter gab es vieles vorzubereiten, damit genug Futter für die Tiere vorhanden war. Für die vielen Menschen des Hauses galt es, die Einweckgläser mit Gemüse und Obst zu befüllen. Gläser mit Marmelade für ein Gesälzbrot(3) am Morgen, oder auch mal zwischendurch, für den kleinen Hunger, zum Trösten der Kinder bei einem aufgeschlagenen Knie oder einer Beule am Kopf. Viele Möglichkeiten für ein süßes Zwischendurch.
Für die große Wäsche kam immer die junge Tine zur Hilfe, die Ehefrau von dem Holzhauer Großmann. Fleißig, wendig und mit ihrer ruhigen, freundlichen Art, war sie sehr beliebt und gerne in dem Bauernhaus gesehen. Die große Familie mit den entsprechenden Bergen von Schmutzwäsche, da wurde sie sehr benötigt.
Sie konnte ihre beiden kleinen Kinder bei ihrer Schwiegermutter lassen. Diese hatten es sicher auch genossen mehr umhertrollen zu dürfen, Schubladen zu öffnen den Inhalt aus- und einzuräumen. Tine merkte es danach immer, dann schimpfte sie mit ihrer Schwiegermutter, dass diese den Mädchen alles erlauben würde.
»Sie müssen es halt auch lernen, wie man das macht, sie machen es dir ja nach!« meinte die Schwiegermutter.
Zur Wäsche der großen Familie in dem Bauernhaus kamen zusätzlich noch die Bett-, Leibwäsche und die Handtücher von den Großeltern, Georgs Eltern dazu.
Diese wohnten in der kleinen Straße gegenüber, im Mühlenweg.
Tine kam immer schon am Vortag gegen Abend, um alles vorzubereiten. Die Wäsche wurde in eine starke Seifenlauge eingelegt, eingeweicht, sagte man dazu. Am Waschtag wurde dann in der Frühe der große Waschkessel angefeuert. Erst wurde die weiße Wäsche, in die noch kalte Seifenlauge gegeben, nach und nach erhitzt, bis das Wasser sprudelnd kochte.
Die heißen Wäschestücke wurden danach vorsichtig heraus genommen, in mit frischem Wasser gefüllte Holzwannen gegeben, hin und her geschwenkt um die Seife auszuspülen. Dieser Vorgang des »Seife-Ausspülens« wurde mehrmals wiederholt, bis das Wasser klar blieb.
Mit dem Wäscheteufel wurden die Teile kräftig bearbeitet, dabei lösten sich auch die Waschmittelreste aus den Geweben.
(Das war so eine Art Stampfer, ein Holzstiel mit einem Metallunterteil, und Innenteil, wie zwei umgedrehte Schüsseln die sich ineinander schoben und Druck ausübten.)
Anschließend kam die bunte Wäsche in die gleiche Lauge in den Waschkessel, immer wieder wurde Holz in der Feuerstelle nachgelegt, um das Wasser wieder zu erhitzen.
Die Frauen hatten dabei rote Gesichter, sie schwitzten, ihre Körper und die Kleidung waren nass, von dem spritzenden Wasser und der nassen Wäsche.
Es gab auch eine Wäschepresse. Durch zwei Walzen wurden die einzelnen Wäscheteile durchgeführt, dann von Hand an einem großen Hebel gedreht, um das Wasser aus den Geweben herauszupressen. Im Hinterhof und im oberen Garten wurden die Wäscheleinen aufgespannt. Um die stabilen Holzpfähle wurden die gedrehten Seile gewickelt, damit sie straff gespannt blieben.
Das machte immer Georg, das konnte er sicher besser, mit seiner Muskelkraft. Das wäre auch Männerarbeit, meinte er, das Waschen wäre etwas für die Frauen.
Nun wurden erst einmal die großen Teile der Bettwäsche gerade aufgehängt und mit Holzklammern befestigt.
Wenn der Wind wehte, dann trocknete alles sehr schnell, im Anschluss konnte die Buntwäsche aufgehängt werden.
Ein anstrengender Tag war so ein Waschtag.
Aber das war ja nur jede sechs Wochen fällig. Zwischendurch wurden einmal Socken gewaschen oder wenn kleine Kinder da waren, dann mussten Windeln und Höschen jeden zweiten Tag in einem großen Topf auf dem Küchenherd aufgekocht werden.
Dem nicht genug.
Am nächsten Tag wurden die großen Wäschestücke an den Schmalseiten straff gezogen. Dazu standen sich zwei Frauen gegenüber, fassten die kurzen Seiten etwas zusammen und zogen abwechselnd die Stücke gerade. Fein ordentlich auf dem großen Tisch in der unteren Stube wurden die Teile zusammengefaltet. Der Umbruch kam nach vorne, so wurden die Leintücher und die Damast Bettbezüge in die Wäschefächer im Schlafzimmerschrank gestapelt.
Die karierten Bezüge wurden mit derselben Sorgfalt für den nächsten Gebrauch vorbereitet.
Mit dem großen Holzkohle-Bügeleisen, wurden nur wenige Teile, wie Festtagshemden oder schöne Blusen, gebügelt.
Alles andere wurde nur sorgfältig glattgestrichen.
Tine und ihr Mann, der Tagelöhner war, waren arme Leute, mit zwei kleinen Kindern. Die alten Leute noch im Hause, die auch ernährt werden mussten.
Tine bekam für die Arbeit an den Waschtagen, Eier, Speck, Mehl, Kartoffeln.
Wenn Tiere geschlachtet wurden, erhielten sie reichlich Metzelsuppe, Kesselfleisch, Blut- und Leberwürste.
Später noch Geräuchertes, Rauchfleisch und Speck. So war allen geholfen!
Im Grunde waren zu dieser Zeit alle arm. Die Bauern hatten, wenn die Ernten gut ausgefallen waren, das Vieh im Stall gesund war, genügend zum Essen. Eier wurden auch benötigt. Dazu gehörte, dass der Zaun um den Hühnerstall unbeschädigt war, die Hühner am Abend rechtzeitig in den Hühnerstall zurück befördert, die kleine Türe des Hühnerstalles sorgsam verschlossen wurde.
Deswegen war es eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit der Buben, am Abend die Hühner zu versorgen ... wehe, wenn die kleine Schiebetüre nicht verschlossen war, der Fuchs sich unter dem Zaun einen Durchgang gegraben hatte, dann konnte er, wenn er rank und schlank war, sogar in den Hühnerstall hineinschlüpfen und sich bedienen. Für seine gesamte Fuchsfamilie und die Verwandtschaft gleich mit. So etwas durfte nicht vorkommen, aber ein »Nicht« gab es nicht. Es kam schon einmal vor, dass so etwas passierte, dann gab es lange keine Eier.
Neue Küken mussten gekauft werden und bis diese endlich Eier legten, verging viel Zeit.
Die 8-jährige Anna, ein ernstes Mädchen, kleidete täglich ihre beiden jüngeren Brüder an. Das war manchmal schwierig, weil diese so lebhaft waren und nicht stillhalten wollten, viel lieber wollten sie herumalbern, Anna an den Haaren ziehen, wenn diese sich in die Hocke begab um die Schuhe der Buben zu binden.
Dabei fiel den kleinen Burschen immer wieder etwas Neues ein, wie sie ihre große Schwester zur Verzweiflung bringen konnten. Sie lachten dann und Anna blieb oft nichts anderes übrig, als einfach auch zu lachen.
Das Lachen hatte sie fast schon verlernt seit dem Tod der geliebten Mutter.
Der Vater hatte nie mit ihr darüber gesprochen. Er sah sie nur manchmal etwas komisch an, er schaute dann schnell zur Seite, wenn Anna etwas bemerkte und zu ihm hinsah. Warum sagte er denn nichts zu ihr? Sie wartete so sehr darauf mit jemanden über den Verlust der Mutter zu sprechen. Es wurde damals mehr geschwiegen als geredet. Gesprochen wurde was getan werden musste, hole das und jenes; Kurz und bündig, ohne lange Umschweife.
Anna konnte auch schon Haferbrei kochen, ihn den Geschwistern mit einem kleinen Holzlöffel eingeben. Das gestaltete sich auch manchmal als nicht so einfach, wenn die Ärmchen da auch mithelfen wollten und sich unkontrolliert hin und her bewegten.
Dann konnte es vorkommen, dass der Löffel sein Ziel verfehlte, der Brei irgendwo anders ankam als dort, wo es vorgesehen war.
Anna entwickelte mit der Zeit sehr viel Geschick in diesen Dingen, mit Hilfe eines langen Schals. Sie befestigte die Ärmchen am Körper des lebhaften Buben, ein lautes Geschrei folgte, der Körper bäumte sich auf, Arme und die Beine versuchten ihre Freiheit wiederzuerlangen. Das war die fast tägliche Prozedur, die kleinen Buben zu bändigen, um sie satt zu bekommen.
Machte Anna bei der Essensgabe eine Pause, weil sie einmal wieder tief durchatmen wollte, dann ging das Geschrei los, weil der kleine Mann hungrig war. Guter Rat war teuer.
Oh, wäre nur die Mutter mit ihrer ruhigen, sanften Art da. Sie hätte es wohl besser geschafft, etwas Ruhe und Ordnung hinzubekommen, die Kleinen zu beruhigen. Anna war ja ihrer Mutter sehr ähnlich, auch ruhig und geduldig, aber sie war ja selbst noch ein Kind, ein Kind das auch dringend Zuwendung und Liebe gebraucht hätte.
Ja, das war so eine Sache mit kleinen Kindern, dachte sich Anna, ob sie wohl einmal selbst Kinder möchte, das würde sich ergeben. Es hatte ja noch Zeit.
Im Stall waren die Kühe, die gemolken werden mussten, das war Georgs Arbeit. Die Milch wurde teilweise zu süßer Butter verarbeitet, im Butterfass gerührt. Eine anstrengende Arbeit bis sich der Butterklos bildete, die Buttermilch sich absonderte.
Die Kinder wurden hauptsächlich mit eigener erzeugter Nahrung versorgt.
Die Kleidung war mehrfach geflickt und gestopft, von den größeren Geschwistern wurde sie an die Jüngeren weiter gegeben.
Bis alles fast auseinanderfiel, mehr Flicken auf dem Kleidungsstück genäht waren als noch von dem ursprünglichen Stück vorhanden war, dann erst kam es in den Lumpensack.
Dieser stand auf dem Dachboden, bis der Lumpenmann und Alteisensammler im Winter mit seinem Wagen in das kleine Dorf kam. Mit seiner nicht zu überhörenden Glocke klingelte er, dabei schrie er fast ebenso laut: »Lumpen, Alteisen, Leute, der Lumpenmann ist da, Lumpen, Alteisen!« Es waren jedes Jahr mehrere gefüllte Säcke mit alten Lumpen auf dem Dachboden gelagert, sie wurden dann das Scheunenloch hinunter geworfen, von der Scheune nach draußen gezogen und dem Lumpenmann übergeben. Dafür erhielt man je nach Menge der Abgabe, Porzellan- oder Blechschüsseln, auch Teller, Krüge und Becher.
Darum sammelte man gerne für den Lumpenmann.
Die einfachen Dinge des täglichen Lebens, für den Körper, das Essen, das Trinken, die Bekleidung, alles war sehr bescheiden. Dann die armen Kinder, sie hatten die Mutter verloren, das war halt so, es war alltäglich. Welche Frau konnte jedes Jahr ein Kind bekommen, dazu die harte Arbeit auf den Höfen verrichten, es war wenig Geld da und wenig Freude.
Die große Familie, es waren immer genug Menschen um einen herum, aber niemand hatte damals Zeit für ihre Trauer, den Verlust der Mutter zu verarbeiten, darüber zu sprechen.
Weinen, das konnte heimlich geschehen, am späten Abend im Bett in die grobkarierten wuchtigen Kopfkissen hinein. Diese verschluckten auch leise Wehlaute und Seufzer.
Die Kleinsten verstanden ja noch gar nichts!
Es war alles anders, ohne die Mutter, die sie manchmal in den Arm genommen hatte, wenn sie weinten, die Knie blutig geschlagen waren.
So oft kam es vor, dass die Mütter die Schwangerschaften, oder die Geburten nicht überlebten. Auch starben viele Babys bei der Geburt, oder im Kleinkindesalter, häufig nach einer kalten Winternacht, bei offen stehendem Fenster, eine Lungenentzündung stellte sich dann ein. Der Säugling verstarb. Bereits im nächsten Jahr lag wieder ein neues Kind in der Wiege.
Zu viele Esser und solche, die großgezogen werden mussten, um einmal etwas zu erben, sie alle wollten einen Platz auf dem Hofe. Das war oft einfach nicht möglich.
Das war die damalige Geburtenregelung!
Alfred und Johannes, die Ältesten, sie mussten mehr arbeiten als sie konnten, begriffen auch noch nicht so recht, warum die Mutter, fast jedes Jahr im Sommer, einen dicken Bauch bekam, sich beim Bücken schwer tat und manchmal stöhnte.
Dann legte sie sich sogar tagsüber in ihr Bett. Mit viel Hektik und Aufregungen war das alles verbunden. Heißes Wasser wurde zubereitet, Tücher bereitgelegt.
Die Hebamme wurde aus dem Nachbardorf geholt, diese kam mit einer großen Tasche, nahm den Weg nach oben zur Kammer, im Galopp, gleich zwei Stufen auf einmal, dabei gab sie mit lauter, energischer Stimme Anweisungen.
Mit den Jahren begriffen Alfred und Johannes so langsam was da vor sich ging. »Schon wieder!« sagte Alfred einmal zu Johannes: »Schon wieder, was denken die sich denn dabei?« Vater und Mutter waren damit gemeint! Die Kammern standen voll, mit eng aneinander gereihten Betten. Immer wieder kam ein neues Kind in der Kammer hinzu, welches dem Babyalter entwachsen war. Aus dem Kinderbett, in der Kammer der Eltern, musste es heraus, um dort wieder Platz zu schaffen für ein neues Kind.
Bei jeder Niederkunft der Mutter, wurden die kleineren Kinder aus dem Hause gebracht, zu den Nachbarn, zu den Großeltern, sie wurden vertröstet mit Marmelade- und Honigbrot, am Abend durften sie sicher wieder zurückkommen.
Manchmal war es schon dunkel, ja, oder sie schliefen bei den Nachbarn zusammen in den Betten bei den dortigen Kindern, sie wussten nicht warum. Sie waren sehr müde, bemerkten und fragten nichts. Fragen, das durften Kinder nicht, warum, Kinder hatten nichts zu fragen, sie sollten still sein und tun, was man ihnen sagte.
Beim Fortbringen schrien sie laut, wussten nicht, warum sie so ganz plötzlich vom Spielen weggezerrt wurden.
Warum machten die Großen das, sie einfach da wegzuholen, von den Bauklötzen, von dem Spielen auf dem Boden? Nichts wurde erklärt, einfach gehandelt, die Kinder wurden nicht gefragt, es wurde ihnen nichts gesagt.
Als sie wieder zurück in das Elternhaus kamen, herrschte ein geschäftiges Durcheinander, ein neues Kind war da, ganz klein und mit Runzeln, wie ein alter Apfel sah es aus.
Alles war anders, bei Tag und bei Nacht war es laut. Geschrien hatte das kleine Kind oft und sehr nachhaltig auch nachts.
Wie konnten die Kleinen das verstehen, niemand sagte etwas. Das einzige nur, ihr habt jetzt einen kleinen Bruder und er heißt Willi, Georg, Hans. Warum, wozu war das denn nötig, so ein kleiner Bruder, der nur schrie und nicht mithelfen konnte, sie waren doch schon genug, wer konnte das denn verstehen?
Der Großvater hatte nachdem Hans geboren war, zu Georg gesagt: »Mein Sohn, ich denke, du solltest deiner Frau einmal ein paar Jahre Ruhe gönnen mit dem Kinderkriegen. Die Kammern sind voll, die Schüsseln sind klein, die Felder geben nicht so viel ab für so viele Mäuler, reiß dich zusammen Georg!«
Georg war das sehr unangenehm, von seinem Vater so angesprochen zu werden.
Was wollte er, seine Frau hatte zwölf Kinder zur Welt gebracht. Warum hatte er sich denn nicht zusammengerissen?
Wenn da nachts eine Frau neben einem im Bett liegt, müde von der Tagesarbeit waren sie beide. Die Frau war rundlich, weich mit schöner glatter Haut, warm fühlte sie sich an, die Betten waren kalt. Beim Nebeneinander liegen wurde es gleich wärmer, und ein angenehmes Gefühl stieg dabei in die Lenden.
Das Blut ging in seine Männlichkeit, er bekam ein so großes Verlangen, ganz nahe bei der Frau zu liegen, noch näher und näher bei ihr zu sein, ganz in sie einzudringen.
Gesehen hat er ja nicht wie sie aussieht, da unten am Bauch, zwischen ihren Schenkeln, das mochte sie ihm nicht zeigen. Er fühlte es nur, es war weich, warm und feucht. Wenn er sie ein bisschen an sich drückte, ihre Brust rieb, wollte auch sie nahe bei ihm sein. Manchmal hörte er auch einen kleinen unterdrückten Laut von ihr. Das war aber nur in der ersten Zeit der Ehe.
Später tat sie oft so, als wenn sie schliefe. Oder sie rannte nach dem vollbrachten Beischlaf schnell aus der Kammer, nach unten in die Waschküche.
Was sie dort gemacht hatte, wollte er dann wissen. Sie sagte dann immer: »Gewaschen habe ich mich, mit dem kalten Wasser, damit ich nicht schon wieder ein Kind bekomme, wir haben doch schon genug davon!«
So war es halt! Wie konnte das verhindert werden, dass die Frauen gleich schwanger wurden? Warum gab es dafür keine Mittelchen?
Das tägliche Leben verlief weiter, im gleichen Trott, viel Arbeit, wenig Schlaf und noch weniger Geld. Die kleinen Kinder wurden in einen Korb gelegt, dieser wurde mit auf das Feld genommen. Ob bei Hitze, oder bei Kälte. Jede Arbeitskraft wurde gebraucht, also ging es hinaus auf das Feld.
Die Mutter machte während der Arbeit immer wieder eine Pause, reichte dem Säugling die Brust wenn die Zeit gekommen war ihn zu sättigen, er nicht mehr aufhörte zu schreien. Nach dieser Prozedur schlief das Kleine wieder, im Schatten unter einem Baum, satt und zufrieden.
Der Vater war oft ungeduldig, sagte immer: »Weib, schau, dass du schnell fertig wirst, mit dem Balg(4). Hinten am Himmel wird es immer dunkler, es zieht ein Wetter herauf und wir müssen die Garben noch nach Hause bringen, ins Trockene!« Schnell, wurde das Kind halbgesättigt wieder zurückgelegt, mit nassen Windeln, oder übel riechend, egal, der Himmel schaute dunkel aus.
Oh, ja, die Ernte musste ins Haus gebracht werden, das war das Wichtigste.
Essen für alle, das Jahr hatte schließlich zwölf Monate. Man musste froh sein, wenn Regen und Hagel das Getreide nicht zum Fallen brachte. Endlich konnte man ernten, dann war so ein kleiner Schreihals Nebensache, was sollte es?
Jetzt im Sommer 1898, es war kein kleines Kind da und auch keine Mutter. Die Getreideernte stand kurz bevor.
Hilfe wurde Georg zugesichert. Bei seinen Eltern lebte noch sein an zehnter Stelle geborener Bruder Ernst, dieser war jetzt 20 Jahre alt. Der junge Ernst packte eifrig mit an.
Es gelang ihnen, die Ernte gut heimzubringen. Gut war es, dass in der Nachbarschaft eine Dreschmaschine vorhanden war. Bis spät in die Nacht wurden dort die Getreidegarben aufgelegt und unten die Säcke befestigt, die die Getreidekörner aufnahmen. Die Strohballen wurden gleich auf den Dachboden gebracht, man brauchte sie, um die Ställe auszustreuen, und bei wenig Heuvorrat wurde das Stroh klein gehäckselt und dem Heu als Futter beigemischt. Ja, Not machte erfinderisch! Der Winter war lang und kalt.
Der Witwer Georg musste schnell wieder eine neue Frau finden.
Er war im gleichen Monat, als seine Frau verstorben war, 37 Jahre alt geworden.
Seine alten Eltern wohnten gegenüber, über dem kleinen Weg, im dazu gehörigen Altgedinghaus.(5) Ihr Sohn Ernst lebte auch noch bei ihnen. Die Mädchen schauten diesem bereits hinterher, das gefiel ihm sehr, er drehte sich dann lachend um. Wie lange würde er wohl noch bei seinen Eltern wohnen bleiben?
Nun konnte Anna mit ihren zwei jüngsten Brüdern in einer kleinen Kammer bei den Großeltern schlafen.
Somit waren im Elternhaus, am Abend bei der traurigen Stimmung diese drei nicht anwesend.
Die Großmutter Christee war als einzige der Familie in dem kleinen Bauernhaus im Waldachtal aufgewachsen.
Sie war ein Einzelkind. Ihr Vater Alois war im Nachbarort in der Mühle geboren, er arbeitete als Tagelöhner in dem kleinen Dorf und lernte dabei Anna Sofia, seine spätere Frau kennen, sie heirateten im April 1837.
Anfang Mai 1838 wurde ihre Tochter Christina geboren.