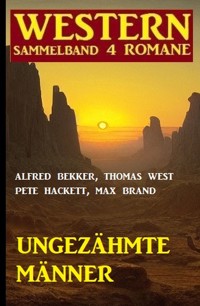
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Dieses Buch enthält folgende Western: Pete Hackett: Phil Jameson will Rache Alfred Bekker: Die Geier vom Lincoln County Max Brand: Dan Barry der Ungezähmte Thomas West: Tötet Shannon Phil Jameson atmete tief durch. Hinter ihm schloss sich das Gefängnistor. Er war frei. Sieben Jahre lang hatte er hinter dicken Mauern und Stacheldraht gelebt. Sieben lange Jahre war er lebendig begraben gewesen. Die harte Zeit hatte Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Jameson war achtunddreißig Jahre alt. Er sah aus wie fünfundvierzig. Tiefe Linien zogen sich von seinen Nasenflügeln bis zu seinen Mundwinkeln. Er war hager, fast knochig. Sein Gesicht war eingefallen, die Augen lagen tief in ihren Höhlen. Der ehemalige Sträfling schaute sich um. Es war ein warmer Spätsommertag. Der Himmel war blau. Die Sonne schien. In Jamesons Gemüt jedoch herrschte Düsternis. In seiner Seele brannte der Hass. Er wollte Rache.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 697
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett, Alfred Bekker, Max Brand, Thomas West
Ungezähmte Männer: Western Sammelband 4 Romane
Inhaltsverzeichnis
Ungezähmte Männer: Western Sammelband 4 Romane
Copyright
Phil Jameson will Rache
DIE GEIER VOM LINCOLN COUNTY
Dan Barry der Ungezähmte
Tötet Shannon!
Ungezähmte Männer: Western Sammelband 4 Romane
Pete Hackett, Alfred Bekker, Max Brand, Thomas West
Dieses Buch enthält folgende Western:
Pete Hackett: Phil Jameson will Rache
Alfred Bekker: Die Geier vom Lincoln County
Max Brand: Dan Barry der Ungezähmte
Thomas West: Tötet Shannon
Phil Jameson atmete tief durch. Hinter ihm schloss sich das Gefängnistor. Er war frei. Sieben Jahre lang hatte er hinter dicken Mauern und Stacheldraht gelebt. Sieben lange Jahre war er lebendig begraben gewesen. Die harte Zeit hatte Spuren in seinem Gesicht hinterlassen.
Jameson war achtunddreißig Jahre alt. Er sah aus wie fünfundvierzig. Tiefe Linien zogen sich von seinen Nasenflügeln bis zu seinen Mundwinkeln. Er war hager, fast knochig. Sein Gesicht war eingefallen, die Augen lagen tief in ihren Höhlen.
Der ehemalige Sträfling schaute sich um. Es war ein warmer Spätsommertag. Der Himmel war blau. Die Sonne schien. In Jamesons Gemüt jedoch herrschte Düsternis. In seiner Seele brannte der Hass. Er wollte Rache.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Phil Jameson will Rache
Western von Pete Hackett
U.S. Marshal Bill Logan – die neue Western-Romanserie von Bestseller-Autor Pete Hackett! Abgeschlossene Romane aus einer erbarmungslosen Zeit über einen einsamen Kämpfer für das Recht.
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G. F. Unger eigen war – eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G. F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-Book bei CassiopeiaPress.
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author www.Haberl-Peter.de
© der Digitalausgabe 2013 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Phil Jameson atmete tief durch. Hinter ihm schloss sich das Gefängnistor. Er war frei. Sieben Jahre lang hatte er hinter dicken Mauern und Stacheldraht gelebt. Sieben lange Jahre war er lebendig begraben gewesen. Die harte Zeit hatte Spuren in seinem Gesicht hinterlassen.
Jameson war achtunddreißig Jahre alt. Er sah aus wie fünfundvierzig. Tiefe Linien zogen sich von seinen Nasenflügeln bis zu seinen Mundwinkeln. Er war hager, fast knochig. Sein Gesicht war eingefallen, die Augen lagen tief in ihren Höhlen.
Der ehemalige Sträfling schaute sich um. Es war ein warmer Spätsommertag. Der Himmel war blau. Die Sonne schien. In Jamesons Gemüt jedoch herrschte Düsternis. In seiner Seele brannte der Hass. Er wollte Rache.
Jameson setzte sich in Bewegung. Er war abgerissen und stoppelbärtig, verfügte weder über ein Pferd noch über eine Waffe, und er besaß kein Geld. Er ging in die kleine Ansiedlung, die um das Fort herum entstanden war. Es war noch ziemlich früh am Morgen. Der kleine Ort war noch nicht so richtig zum Leben erwacht. Soeben wurde das Tor geöffnet, das in den Wagen- und Abstellhof des Mietstalles führte. Der Stallmann, ein bärtiger Bursche mit einem verbeulten Calgary-Hut auf dem Kopf, musterte Jameson.
»Guten Morgen«, grüßte Phil Jameson.
Der Stallmann nickte. »Sie kommen aus dem Straflager, nicht wahr?«
»Ja.«
»Gestern kamen zwei Gentlemen an. Sie erzählten mir, dass sie einen Mann namens Phil Jameson abholen wollen. Sind Sie Phil Jameson?«
Jamesons Brauen schoben sich zusammen. »Zwei Männer? Ich erwarte niemand.«
»Sie sind also Jameson?«
»Ja. Nannten die beiden ihre Namen?«
»Nein. Sie haben ihre Pferde bei mir untergestellt. Das Brandzeichen kenne ich nicht. Sahen ziemlich mitgenommen aus, als sie hier ankamen, was den Schluss zuließ, dass sie einen langen Ritt hinter sich hatten.«
»Zeigen Sie mir die Pferde.«
Es handelte sich um eine Fuchsstute und um einen Pinto. Beiden Tieren war ein W eingebrannt. Phil Jameson hatte keine Ahnung, was dieses Brandzeichen bedeutete. »Ich habe keine Freunde«, murmelte er versonnen. Dann zuckte er mit den Schultern. »Nun, es wird sich zeigen, was die beiden Kerle von mir wollen. Ich brauche einen Job. Gibt es in der Umgebung jemand, der einen wie mich einstellen würde?«
»Versuchen Sie es mal auf der Star Ranch. Sie gehört Slim Jordan. Vielleicht haben Sie Glück.«
»Wo finde ich die Ranch?«
»Folgen Sie dem Reit- und Fahrweg nach Nordosten. Sie müssen etwa fünf Meilen gehen.«
»Ist es eine große Ranch?«
»Kann man sagen. Auf den Weiden der Star Ranch stehen wohl an die zehntausend Rinder. Jordan ist mächtig, aber er ist kein Unmensch.«
»Vielen Dank.«
Phil Jameson verließ den Mietstall. Er schritt am Fahrbahnrand entlang. Aus dem Store trat der Besitzer und fixierte ihn argwöhnisch. Vor der Sattlerei stand ein Mann, und auch er beobachtete Jameson.
Jameson hielt an, als ein hochgewachsener Bursche hinter einem Haus hervorkam und bis zur Mitte der Main Street ging. In Phil Jameson schlugen die Alarmglocken an. Seine Augen verengten sich. »Was willst du von mir?«
»Ich werde dich erledigen.«
»Warum. Ich kenne dich nicht. Wer bist du?«
»Das erzählt dir sicher der Teufel in der Hölle.«
Jamesons Zähne mahlten. Als er hinter sich das Knirschen von Staub unter Stiefelsohlen und das leise Klirren von Sporen hörte, drehte er den Kopf. Der zweite der Kerle näherte sich ihm. Jameson presste die Lippen zusammen. In ihm entstand ein Verdacht, setzte sich in ihm fest und ließ sich nicht verdrängen.
»Wer schickt euch?«, fragte er.
Ein kaltes Lachen ertönte. Dann antwortete der Bursche, der vor ihm stand: »Jemand, der dich in der Hölle wissen will. Mein Freund wird dir jetzt seinen Revolver geben. Du bekommst jede erdenkliche Chance.«
»Wie viel zahlt er euch?«
»Du stellst viel zu viele Fragen. Los, Ben, gib ihm dein Schießeisen.«
Der andere der beiden Kerle trat neben Phil Jameson, zog seinen Sechsschüsser und hielt Jameson das Eisen hin. Seine Lippen waren zu einem hämischen Grinsen verzogen. »Sicher bist du etwas aus der Übung, Jameson. Aber darauf können wir keine Rücksicht nehmen.«
Jameson nahm die Waffe und schob sie hinter seinen Hosenbund.
Der Mann namens Ben ging zur Seite. »Ich zähle bis drei«, sagte er. »Eins – zwei …«
Bei drei zogen sie. Die Revolver donnerten. Die Detonationen wurden von den Häuserwänden zurückgeworfen. Pulverdampfwolken zerflatterten.
Der Mann, der Jameson herausgefordert hatte, brach zusammen. Phil Jameson lag im Staub. Der andere Kerl warf ein schweres Messer. Phil Jameson wälzte sich blitzschnell herum, dann bäumte sich der Revolver in seiner Faust auf. Aufbrüllend stieß der Knall durch die Ortschaft. Der Messerwerfer drehte sich halb um seine Achse, dann stürzte er.
Jameson erhob sich. Staub rieselte von seiner Kleidung. In seinem Gesicht zuckte kein Muskel. Den Revolver im Anschlag ging er mit kurzen, abgezirkelt anmutenden Schritten zu dem Burschen hin, der sich mit ihm geschossen hatte. Von ihm ging keine Gefahr mehr aus. Er hatte die Kugel in die Brust bekommen.
»Wo finde ich ihn?«
Der Sterbende röchelte. Mit erloschenem Blick schaute er zu Jameson in die Höhe. »Ich – habe – dich – unterschätzt.«
»Ein tödlicher Fehler«, murmelte Jameson. »Sag es mir. Wo finde ich Tucker?«
»Panhandle – Ochiltree County – Wolf Creek – Waycross Ranch.«
Die Augen des Mannes wurden starr. Die Leere des Todes senkte sich in sein Gesicht. Phil Jameson ging zu dem anderen Burschen hin. Er hatte die Kugel in die Schulter bekommen. Schweiß rann über sein schmerzverzerrtes Gesicht. »Dein Gefährte ist tot«, erklärte Jameson. »Wie war sein Name?«
»Cole Redcliff.«
»Wo hat er sein Gewehr?«
»Auf dem Hotelzimmer.«
»Gut. Ich werde sein Gewehr und sein Pferd nehmen. Wie heißt du?«
»Ben Saddler.«
»Wie viel hat euch Tucker gezahlt, damit ihr mich kalt macht?«
»Dreihundert Dollar. Jedem von uns.«
»Sollte sich dein Weg noch einmal mit dem meinen kreuzen, werde ich dich töten, Saddler.«
Phil Jameson bückte sich, öffnete die Schließe von Saddlers Revolvergurt und zog ihn unter dem Leib des Verwundeten hervor, legte ihn sich um und stieß den Revolver ins Holster. Dann schwang er herum und schritt davon.
*
Joe Hawk und ich folgten der Spur der Viehdiebe. Sie führte nach Norden. Wahrscheinlich wollten die Banditen die Herde, die sie von der Weide der Waycross Ranch gestohlen hatte, durch den schmalen Streifen des Oklahoma-Territoriums nach Kansas treiben, um sie dort zu verkaufen.
Wir hatten keine Ahnung, mit wie vielen Rustlern wir es zu tun hatten. Vorsicht war jedenfalls geboten.
Die Spur war schon einige Tage alt. Dennoch war sie gut zu erkennen. Vor uns erhoben sich die bewaldeten Anhöhen des Indianerlandes. Es war um die Mitte des Vormittags. Am Morgen hatten wir Perryton verlassen, wo wir die Nacht verbracht hatten.
Wir zügelten die Pferde. Ich ließ meinen Blick schweifen. Es war ein regnerischer Tag, grau, kalt – ein Tag, an dem man keinen Hund vor die Tür jagte.
»Hier endet unser Amtsbereich«, erklärte Joe.
»Die Herde wurde vor vier Tagen gestohlen«, sagte ich. »Wenn die Viehdiebe sie schnell treiben, kommen sie am Tag höchstens zehn Meilen weit. Die Herde ist vom Wolf Creek also allenfalls vierzig Meilen entfernt. Das heißt, sie dürfte gestern den North Canadian überschritten haben. Wir könnten sie einholen, ehe sie nach Kansas gelangt.«
»Vergeuden wir keine Zeit«, knurrte Joe und ruckte im Sattel. Sein Pferd ging an. Das Land, das uns umgab, war von einer wilden Schönheit. Hier und dort ragten hohe Felsen aus dem Boden. Es gab weitläufige Senken mit hüfthohem Büffelgras, die von langgezogenen Hügeln begrenzt wurden.
Wir ritten Stunde um Stunde. In diesem Landstrich trieben sich oftmals Gruppen von Comanchen herum. Jeder meiner Sinne war aktiviert. Ich sicherte ununterbrochen um mich. Die Gefahr konnte hinter jedem Strauch lauern.
Einige schwarze Punkte am wolkenverhangenen Himmel erregten meine Aufmerksamkeit. Es waren Aasgeier. Sie kreisten über einer bestimmten Stelle. Ich wies Joe darauf hin. Eine Viertelstunde später trafen wir auf ein totes Pferd. Einige Geier hatten bereits ihr schauerliches Mahl begonnen.
»Sieh dort«, stieß Joe hervor. Er wies in eine bestimmte Richtung. Dort war Wald. Am Waldrand hing an einer Buche ein Mann. Er war an den Füßen aufgehängt worden. Einige Pfeile steckten in seinem Körper.
Schlagartig trocknete mir der Hals aus. Eine unsichtbare Hand schien mich zu würgen. Ich ritt hin, holte mein Messer aus der Satteltasche und schnitt das Rohlederseil durch, an dem er aufgehängt worden war. Er fiel zu Boden. Sein Gesicht war blutverschmiert. Sein Skalp fehlte.
Etwa hundertfünfzig Yards entfernt hatten sich ebenfalls einige Geier niedergelassen. Joe trieb sein Pferd an. Ich blickte ihm hinterher. Die Geier schlugen mit den Flügeln und krächzten, flogen ein Stück und ließen sich wieder nieder. Joe zerrte sein Pferd in den Stand. Nach kurzer Zeit zog er es herum und kam zurück. Bei mir hielt er an, wies mit dem Daumen über die Schulter und sagte: »Dort liegt noch einer. Auch ihm haben sie den Skalp genommen. Diese verdammten Heiden.«
Auch ich verspürte Zorn. Wortlos trieb ich mein Pferd hin und her, und die Spuren, die ich fand, verrieten mir eine Menge. »Die Indianer haben den Rustlern die Herde abgejagt und fortgetrieben«, erklärte ich. »Die Rinder sind verloren. Begraben wir die beiden Toten und dann reiten wir zurück. Tucker wird zwar nicht erfreut sein, aber es ist eben nicht zu ändern.«
»Es war die dritte Herde in diesem Jahr, die ihm gestohlen wurde«, sagte Joe grollend.
Wir saßen ab. Da jeder von uns einen kurzen Klappspaten am Sattel mit sich führte, war es kein Problem, zwei Gräber auszuheben. Nachdem wir die Rustler begraben hatten, ritten wir zurück. Der Tag neigte sich seinem Ende zu. Mit der Abenddämmerung kam Nieselregen. Wir schlugen unsere Zelte auf und krochen hinein. Die Pferde hatten wir am Gebüsch angebunden und ihnen zusätzlich die Vorderbeine gehobbelt. Falls sie ein wildes Tier erschreckte und sie sich losrissen, sollten sie mit den gefesselten Beinen nicht weit kommen.
Wir hatten nicht viel gesprochen. Jeder von uns hatte damit zu tun, das grauenhafte Bild zu verarbeiten, das sich uns geboten hatte. Wahrscheinlich war es zu einem Kampf gekommen und die Viehdiebe hatten einige der Indianer getötet. Nur so war es zu erklären, dass zwei von ihnen so grausam abgeschlachtet worden waren.
In der Nacht regnete es stärker. Große Tropfen prasselten auf die Planen der Zelte. Der Wind heulte wie ein hungriger Wolf. Im Zelt war es finster wie in der Hölle. Dennoch schlief ich irgendwann ein. Als ich aufwachte, graute der Morgen. Der Wind hatte sich gelegt, es regnete nicht mehr. Ich verließ das Zelt, weckte Joe, dann aßen wir Dörrfleisch und trockenes Brot und tranken dazu Wasser. »Was meinst du?«, fragte Joe kauend. »Sind die anderen Viehdiebe den Indianern in die Hände gefallen?«
»Nein. Denn dann hätten sie auch mit Pfeilen gespickt an einem Baum gehangen und wir hätten vier oder fünf Gräber ausheben müssen.«
Wir brachen die Zelte ab, rollten Planen und Decken zusammen und schnallten sie an den Sätteln fest, dann ritten wir weiter. Am späten Nachmittag erreichten wir die Waycross Ranch. Am Haltebalken vor dem Haupthaus zügelten wir die Pferde und saßen ab. John Corner, der Vormann, trat aus dem flachen Gebäude, das an das Ranchhaus angebaut war und in dem sich das Ranch Office befand. Er schaute verkniffen drein. Als er heran war, ließ er seine tiefe Stimme erklingen: »Sie hatten keinen Erfolg, wie?«
»Die Viehdiebe wurden von Indianern überfallen. Zwei von ihnen wurden getötet. Wir haben sie begraben. Die Rothäute haben die Herde mitgenommen.«
Corner presste sekundenlang die Lippen zusammen. »Beim ersten Diebstahl waren es dreihundert Longhorns, beim zweiten zweihundertfünfzig. Dieses Mal haben die verdammten Rustler fast vierhundert Rinder abgetrieben. Das sind annähernd tausend Rinder, die der Ranch verloren gegangen sind.«
»Wir können es nicht ändern«, versetzte Joe. »Den Indianern zu folgen wäre sinnlos gewesen. Vielleicht sollten Sie einige zusätzliche Reiter einstellen, die die Herden der Waycross Ranch bewachen.«
»Sie haben doch nichts dagegen, dass wir auf der Ranch übernachten?«, fragte ich.
»Fühlen Sie sich hier wie zu Hause, Marshals«, ertönte eine Stimme. Von uns unbemerkt war Butch Tucker, der Ranchboss, auf den Balkon des Haupthauses getreten, von dem aus eine Außentreppe in den Ranchhof führte.
Tucker war ein Mann von etwa vierzig Jahren, seine dunklen Haare wiesen schon einen leichten Grauschimmer auf. Er war über sechs Fuß groß und schlank und verströmte natürliche Autorität. Ein freundliches Lächeln gab ein makelloses Gebiss frei. Langsam stieg er die Treppe hinunter. Auf halber Höhe der Stiege blieb er stehen. Seine Augen wurden schmal, sein Blick schweifte über uns hinweg, irgendetwas hatte seine Aufmerksamkeit erregt.
Ich drehte den Kopf und sah den Reiter, der auf dem Hügel südlich der Ranch – also jenseits des Wolf Creek – verharrte. Einzelheiten waren nicht zu erkennen.
Auch Joe und der Vormann schauten nach Süden. Deutlich hob sich der Reiter vor dem Bleigrau des Himmels ab. Jetzt trieb er sein Pferd an, lenkte es den Hügel hinunter und verschwand hinter hohen Büschen, tauchte wenig später wieder auf und ließ sein Pferd traben. Ich konnte sehen, dass der Reiter einen grauen Anzug trug. Auf seinem Kopf saß eine ebenfalls graue Melone. Das Wasser spritzte und gischtete, als er seinen Vierbeiner durch den Creek laufen ließ. Dann ritt er in den Hof. Seine rötlichen Koteletten reichten bis zu den Backenknochen, ein Schnurrbart von gleicher Farbe verdeckte seine Oberlippe.
Butch Tucker schritt weiter die Treppe hinunter und kam in den Hof.
Der fremde Reiter parierte das Pferd, legte seine Hände übereinander auf den Sattelknauf und schaute von einem zum anderen. Dann sagte er: »Guten Tag, Gentlemen. Mein Name ist Tom Bennett. Ich bin Detektiv von Wells & Fargo.«
»Was führt Sie denn in diesen Landstrich?«, fragte ich.
»Ich reite auf der Spur eines Mannes. Er heißt Phil Jameson. Seine Fährte führt in den Panhandle, genauer gesagt zum Wolf Creek.«
»Was hat er denn ausgefressen?«, fragte Joe.
»Jameson hat vor über sieben Jahren zusammen mit einem anderen Mann eine Postkutsche überfallen, die 20.000 Dollar für die Bank in Odessa beförderte. Sein Komplize verpasste Jameson eine Kugel, so dass er geschnappt wurde. Er saß sieben Jahre im Zuchthaus. Vor drei Wochen wurde er entlassen. Bei Wells & Fargo ist man der Meinung, dass er zu seinem Kumpan reitet, um sich seinen Anteil an dem damals geraubten Geld zu holen – und um seinem Kumpan eine blutige Rechnung zu präsentieren.«
»Also hat man Sie auf seine Fährte gesetzt, damit er Sie zu dem Geld führt«, sagte ich.
Bennett nickte.
Butch Tucker räusperte sich. »Sie sind sicher hungrig und durstig, Mister Bennett. Sie auch, Marshals. Natürlich sind Sie meine Gäste. John, sagen Sie dem Koch, dass die drei Gentlemen mit mir zu Abend essen. Er soll sich anstrengen.« Tucker schaute grinsend in die Runde.
John Corner nickte seinem Boss zu und entfernte sich.
»Darf ich Sie ins Haus bitten, Gentleman«, sagte Tucker. »Um Ihr Pferd wird sich einer meiner Angestellten kümmern, Mister Bennett.«
*
»Erzählen Sie uns die Geschichte von Phil Jameson«, forderte Butch Tucker, nachdem wir gegessen hatten. Er hatte eine kleine Kiste mit Zigarren herumgereicht und wir rauchten. In den Gläsern schimmerte wie flüssig gewordener Bernstein der Bourbon.
Tom Bennett lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Nun, es gibt nicht viel zu erzählen. Das Wichtigste wissen sie bereits. Jamesons Komplize entkam damals mit den 20.000 Dollar. Seinen Namen verriet Jameson nie. Darum sind wir fest davon überzeugt, dass er sich nach seiner Haftentlassung auf die Suche nach seinem ehemaligen Gefährten macht.«
»Wo haben Sie seine Spur verloren?«, fragte ich.
»Er war zuletzt in Canadian. Die Stadt hat er vor zwei Tagen verlassen. Jameson hat sich nach dem Wolf Creek erkundigt. Einige Stadtbewohner sahen ihn den Canadian überqueren und in nordwestliche Richtung reiten.«
»Das hört sich an, als wäre der Wolf Creek sein Ziel«, sagte Joe.
»Vielleicht will er hinauf nach Kansas«, gab Tucker zu bedenken. »Sein damaliger Komplize hat sicherlich seine Spuren verwischt. Nach sieben Jahren einen Mann zu finden, der allen Grund hat, sich zu verstecken, ist so gut wie unmöglich.«
»Ich weiß es nicht«, knurrte Bennett. »Jameson ist ziemlich zielstrebig in den Panhandle geritten. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass er Texas verlassen will. Aber das hätte er einfacher haben können, wenn er sich von Fort Davis aus westwärts gewandt hätte.«
»Vielleicht wollte er nicht nach New Mexiko«, sagte ich. »Wenn ein Mann einige hundert Meilen reitet, dann tut er das gewiss nicht grundlos.«
»Sie denken, dass er seinen ehemaligen Partner im Panhandle sucht?«, fragte Tucker.
»Ich schließe es zumindest nicht aus«, versetzte ich.
»Da ist noch etwas«, sagte Bennett. »Als Jameson aus dem Zuchthaus entlassen wurde, warteten zwei Kerle auf ihn. Es kam zu einem Kampf, bei dem einer der beiden ums Leben kam. Dem anderen hat Jameson eine Kugel in die Schulter geschossen. Er hatte Fort Davis allerdings schon verlassen, als ich dort ankam.«
»Gibt es irgendeinen Hinweis, um wen es sich bei den beiden Männern handelte?«, erkundigte sich Joe.
»Nein. Der Mann, der die Kugel in die Schulter bekam, ließ sich vom Stallmann verbinden und verschwand anschließend. Die Pferde der beiden trugen ein W als Brandzeichen.«
»W ist das Brandzeichen der Waycross Ranch!«, stieß Tucker hervor. »Aber das ist sicher Zufall.«
»Oder der Mann, den er sucht, reitet in Ihrer Mannschaft«, erwiderte Tom Bennett.
Fast entsetzt musterte ihn der Ranchboss. Plötzlich aber nickte er. »Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Wenn sich in meiner Mannschaft ein Postkutschenräuber befindet, dann hat er das bei der Einstellung sicher niemandem auf die Nase gebunden.«
»Einer, der 20.000 Dollar in petto hat, reitet nicht für dreißig Dollar im Monat hinter Kuhschwänzen her«, sagte ich im Brustton der Überzeugung.
»Aber er könnte in irgendeine Rolle geschlüpft sein und sich hier verstecken«, versetzte Tom Bennett.
Butch Tucker stieß hervor: »Das Gebiet am Wolf Creek wird seit einigen Monaten von Viehdieben unsicher gemacht. Vielleicht ist einer dieser Kerle der frühere Gefährte von Phil Jameson.«
Bennett zuckte mit den Schultern. »Es wird sich zeigen. Morgen werde ich nach Perryton reiten, und wenn Jameson tatsächlich auf dem Weg nach Kansas ist, dann hat er den Ort sicherlich angeritten.«
Damit war das Thema Jameson erledigt. Wir sprachen nur noch Belangloses. Draußen war es längst Nacht. Gegen zehn Uhr lösten wir die kleine Runde auf, um schlafen zu gehen. Wir begaben uns ins Bunkhouse. Auch Tom Bennett schlief auf der Ranch …
*
Phil Jameson ritt am Wolf Creek entlang. Es war dunkel. Dumpf pochten die Hufschläge. Im Ufergebüsch raschelten die Blätter. Als Jameson auf der anderen Seite des Flusses ein Licht sah, zügelte er. Es war ein kleiner, gelber Punkt, der den Blick des einsamen Mannes wie magisch anzog. Er schnalzte mit der Zunge. Das Pferd setzte sich wieder in Bewegung. Belaubte Zweige streiften sein Gesicht, als er durch das Ufergebüsch ritt. Äste zerrten wie Knochenhände an seiner Jacke. Das Pferd stapfte durch den Creek. Auf der anderen Seite trieb es Jameson die Uferböschung hinauf. Langsam rückte das Licht näher. Das Brüllen eines Stieres trieb heran.
Es war ein Weidecamp. Das Licht fiel aus dem Fenster der Hütte. Ein flacher Schuppen war angebaut. Es gab einen Corral, durch den ein Bach floss, der in den Wolf Creek mündete.
Jameson parierte das Pferd und saß ab. Das Tier schnaubte. Eines der Pferde im Corral erhob sich. Helles Wiehern erklang. Die Tür der Hütte öffnete sich knarrend. Licht fiel heraus und umriss scharf die Gestalt eines Mannes. Er hielt ein Gewehr in den Händen. Den Kolben hatte er sich unter die Achsel geklemmt. »Wer ist da?«
Die Stimme erreichte Phil Jameson und versank in der Stille. »Mein Name ist Jameson. Ist etwas dagegen einzuwenden, wenn ich die Nacht über hier bleibe?«
Der Mann kam aus der Hütte, ein zweiter folgte ihm. Auch er trug ein Gewehr. Er hielt es an der Hüfte im Anschlag.
»Du befindest dich auf dem Weidegebiet der Waycross Ranch, Jameson. Was hast du hier zu suchen?«
»Ich bin nur auf dem Durchritt. Komme von Süden herauf. Bin ein harmloser Pilger auf dem Weg nach Kansas.«
»Na schön. Nimm deinem Pferd den Sattel ab und stell es in den Corral. Dann komm herein. Wenn du Hunger hast, werden wir dir ein paar Eier in die Pfanne schlagen. Wo genau kommst du her, Jameson?«
»Aus der Gegend von Del Rio. Hab dort unten als Cowboy gearbeitet.«
Glatt kam die Lüge über Jamesons Lippen.
Die beiden Cowboys warteten, bis Jameson dem Pferd Sattel und Zaumzeug abgenommen und es in den Corral getrieben hatte. Er schloss das Gatter. Einer der Männer ging voraus in die Hütte, der andere folgte Jameson. Obwohl sie ihm die Gastfreundschaft nicht verwehrten, blieben sie argwöhnisch.
In der Hütte gab es einen Tisch, eine Bank und drei Stühle, einen Schrank, dessen Aufsatz zwei grüne Glastüren auswies, einen Spültisch und einen gemauerten Ofen. An der linken Wand standen zwei Hochbetten, grob aus Fichtenstämmen zusammengenagelt, mit einem Strohsack als Matratze. Einer der Cowboys forderte Jameson auf, sich zu setzen. Er lehnte sein Gewehr an den Tisch und ließ sich nieder.
»Wir sind zu viert hier draußen«, erklärte der Ältere der beiden Weidereiter. »Ich heiße Swift, das ist Mathew. Bud und Earl haben Herdenwache. Es kommt immer wieder Raubzeug auf die Waycross-Weiden. Vierbeiniges und zweibeiniges. In diesem Jahr wurden der Ranch schon an die tausend Rinder gestohlen.«
»Darum das Misstrauen, wie?« Jameson lächelte.
»Tucker hat an den Weidegrenzen Schilder aufstellen lassen. Danach ist Unbefugten das Betreten des Weidelandes untersagt.«
Das Lächeln Jamesons gerann. »Seit wann ist Tucker Boss auf der Waycross?«
»Seit ungefähr einem Jahr. Er war fremd, als er hierher kam. Sie müssen wissen, die Ranch gehört zur Panhandle Cattle Company. Sitz der Gesellschaft ist in Chicago. Ihr gehört fast das gesamte Weideland im Panhandle.«
Swift setzte sich. Mathew ging zum Ofen und legte Holz nach. Dann stellte er eine Pfanne auf die Herdplatte und schlug einen Löffel voll Schmalz hinein. »Du hast doch Hunger, Jameson?«
»Wie ein Wolf. – Ich habe keine Schilder gesehen. Da ihr euch mit dieser Rustlerplage herumschlagen müsst, befindet sich die Ranch sicher in Alarmzustand.«
»Sozusagen.«
Draußen pochten Hufe, leises Klirren war zu vernehmen. Nach kurzer Zeit schwang die Tür auf und ein Mann trat in den Raum. Er hatte die Jacke zugeknöpft und den Kragen hochgeschlagen. Den Hut hatte er sich weit in die Stirn gezogen. Er war höchstens zwanzig Jahre alt. »Verdammt frisch«, murmelte er und richtete den fragenden Blick auf Jameson.
»Er ist auf dem Durchritt«, erklärte Swift. Dann fügte er hinzu: »Das ist Earl.« Er schaute den jungen Cowboy an. »Deine Wache ist noch nicht zu Ende, Earl.«
»Ich will auch nur einen Schluck trinken, um mich innerlich ein wenig aufzuwärmen«, erwiderte Earl und ging zum Schrank, öffnete eine der Glastüren und nahm eine halbvolle Flasche Whisky heraus. Er entkorkte sie mit den Zähnen und trank einen Schluck. Die scharfe Flüssigkeit trieb ihm die Tränen in die Augen, er hüstelte und sagte ein wenig atemlos: »Noch eine knappe Stunde, Swift. Dann seid ihr dran.« Er schlug den Korken wieder in den Flaschenhals, stellte die Flasche zurück und ging zur Tür. Ehe er die Hütte verließ, nickte er Jameson zu, dann zog er die Tür hinter sich zu.
Mathew schlug ein halbes Dutzend Eier in die Pfanne, in der das Schmalz brutzelte, und rührte sie mit einem hölzernen Löffel durcheinander.
»Willst du auch einen Schluck Whisky?«, fragte Swift.
»Danke«, antwortete Jameson. »Nicht vor dem Essen. Ich …«
In dem Moment flog die Tür krachend auf. Earl stand im Türrechteck, das Gewehr hielt er auf Phil Jameson angeschlagen, sein Zeigefinger krümmte sich um den Abzug.
Verblüfft starrten ihn Swift und Mathew an.
Jamesons Rechte war zum Revolver gefahren, doch jetzt hielt er mitten in der Bewegung inne. Hart stieß er die verbrauchte Atemluft durch die Nase aus.
»Er reitet ein Pferd mit dem Waycross-Brand«, presste Earl hervor. »Da du fremd bist, Mister, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast das Pferd auf der Ranch gekauft, oder du hast es gestohlen. Wenn du es gekauft hast, verfügst du sicher über einen entsprechenden Kaufvertrag.«
Phil Jameson begriff, dass er einen Fehler gemacht hatte. Doch er gab sich gelassen. In seinem Gesicht zuckte kein Muskel, als er sagte: »Ich habe das Pferd beim Pokern gewonnen. Unten, in Midland. Der Bursche hieß Cole Redcliff. Er war mit einem Mann namens Ben Saddler unterwegs.«
»Redcliff und Saddler sind mal für die Waycross geritten«, mischte sich Swift ein. »Er könnte die Wahrheit sprechen.«
»Sicher«, antwortete Earl, »natürlich kann es die Wahrheit sein. Er kann uns aber auch eine Geschichte erzählen, die erstunken und erlogen ist. Ich bin dafür, dass wir ihn zur Ranch bringen. Und dort wird sich herausstellen, ob ein Gaul fehlt. Wenn ja, Jameson, dann hast du ein Problem am Hals. Im Panhandle hängen wir Viehdiebe noch immer an den nächsten Ast. – Steh auf und heb die Hände. Swift, nimm ihm die Kanone aus dem Holster. Keine falsche Bewegung, Jameson. Seit die Waycross-Weide immer wieder von Viehdieben aufgesucht wird, sind wir alle ziemlich nervös.«
Jameson stemmte sich am Tisch in die Höhe. Seine Gedanken wirbelten. Fieberhaft suchte er nach einem Ausweg. Wenn sie ihn auf die Ranch brachten, würde Butch Tucker kurzen Prozess mit ihm machen. »Die Eier brennen an!«, stieß er hervor.
Earl wurde abgelenkt – und dieser Moment der Unachtsamkeit genügte Phil Jameson, um den Revolver zu ziehen. Im selben Moment warf er sich zur Seite. Das Gewehr und der Sechsschüsser donnerten gleichzeitig. Während der Cowboy jedoch vorbeischoss, traf die Kugel Jamesons. Earl wurde von der Wucht des Geschosses halb herumgerissen, er schrie auf, das Gewehr entfiel seinen Händen. Es stank nach verbranntem Pulver. Earl war an die Wand neben der Tür getaumelt, lehnte mit dem Rücken dagegen und presste seine Linke auf die rechte Schulter. Blut sickerte zwischen seinen Fingern hervor. In den Mundwinkeln des jungen Cowboys zuckte es, in seinen Zügen tobte der Schmerz.
Jameson hatte mit der linken Hand sein Gewehr geschnappt und war bis zu den Bunks zurückgewichen. Seine Hand mit dem Revolver pendelte von einem der Cowboys zum anderen. »Ich habe das Pferd tatsächlich von Cole Redcliff«, knurrte er. »Und jetzt rate ich euch, in der Hütte zu bleiben. Es täte mir leid, wenn ich noch einmal auf einen von euch schießen müsste. Du junger Narr hast es dir selber zuzuschreiben.«
Er glitt zur Tür, zog sie hinter sich zu und rannte zu dem Pferd, auf dem Earl gekommen war und das am Holm vor der Hütte stand. Jameson band es los und schwang sich in den Sattel, zog das Tier herum, hämmerte ihm die Absätze in die Seiten und gab ihm den Kopf frei.
Im gestreckten Galopp stob er in die Finsternis hinein. Als die Cowboys ins Freie kamen, waren Pferd und Reiter nur noch ein verschwommener Schemen, der gleich darauf von der Dunkelheit aufgesaugt wurde.
*
Eine gute Stunde später zerrte Swift sein abgetriebenes Pferd auf dem Ranchhof in den Stand. Er schoss in die Luft. Der peitschende Knall trieb auseinander, wurde von den Echos vervielfältigt und verhallte raunend.
Männer kamen aus der Mannschaftsunterkunft. Einer trug eine Laterne. Sie schaukelte am Bügel. Licht- und Schattenreflexe huschten über den Hof. John Corner, der Vormann, verließ den Anbau, in dem er auch ein Zimmer bewohnte. Auf den Balkon, der so breit war wie die Front des Haupthauses und der zugleich die Veranda überdachte, trat Butch Tucker.
»Was ist los?«, erklang es rau.
»Im Camp auf der Ostweide erschien ein Mann namens Phil Jameson«, rief Swift. »Er ritt ein Pferd mit dem Waycross-Brand. Als ihn Earl zur Rede stellte, erzählte er, dass er das Tier beim Poker von Redcliff gewonnen hat, unten, in Midland. Doch dann überrumpelte er Earl und schoss ihm eine Kugel in die Schulter.«
»Und dann?«, fragte Corner.
»Er ist mit Earls Pferd abgehauen. Angeblich wollte er nach Kansas.«
»Zieht euch an und bewaffnet euch, Männer!«, rief Tucker. »Wir holen uns den Kerl. Wahrscheinlich gehört er zu den Viehdieben. In einer halben Stunde reiten wir.«
Die Männer drängten ins Bunkhouse zurück. Es wurden weitere Laternen angezündet, die Cowboys und Ranchhelfer schlüpften in ihre Kleidung. Gewehre wurden durchgeladen, nach und nach verschwanden die Burschen nach draußen.
*
Wir hatten uns bisher herausgehalten. Allerdings hatten auch wir uns angezogen und bewaffnet. Jetzt verließen wir die Mannschaftsunterkunft. Tom Bennett hatte sich uns angeschlossen. Die Reiter der Waycross Ranch sattelten und zäumten im Schein einiger Laternen ihre Pferde. John Corner schritt über den Hof.
»Corner!«, rief ich.
Er blieb stehen und wandte sich mir zu. »Was wollen Sie, Logan?«
»Wir kommen mit Ihnen.«
»Das ist nicht nötig. Wir werden Jameson, wenn wir ihn schnappen, ein paar Fragen stellen, die Herkunft des Pferdes betreffend, auf dem er ins Land gekommen ist. Und dann sehen wir weiter.«
»Wir reiten mit Ihnen«, beharrte ich. »Warten Sie, bis wir unsere Pferde gesattelt haben.«
»Ich kann Sie sicher nicht davon abhalten. Beeilen Sie sich.«
Eine Viertelstunde später ritten wir.
Joe und ich ritten am Ende des Pulks, der aus zehn Reitern bestand. Butch Tucker und John Corner führten die Kavalkade an. Swift musste ihnen den Weg nicht zeigen. Wir zogen am Wolf Creek entlang nach Osten.
»Was hältst du von der Sache?«, fragte Joe. »Zwei Männer, die offensichtlich Pferde mit dem Brandzeichen der Waycross Ranch ritten, warteten in Fort Davis auf Jameson, um ihn zu töten.«
»Jameson hat sich wahrscheinlich das Pferd des Mannes, den er erschossen hat, genommen und ist damit in den Panhandle gekommen. Er ist nicht von ungefähr hier, Joe.«
»Das sehe ich auch so.«
Von nun an hing jeder von uns seinen eigenen Gedanken nach. Die Geräusche, die die Pferde verursachten, rollten vor uns her durch die Nacht. Da wir die Tiere nicht verausgabten, benötigten wir anderthalb Stunden, um das Ostcamp zu erreichen. Aus dem Fenster der Hütte fiel Licht. Ein Mann kam ins Freie. Seine Gestalt hob sich schwarz gegen das Licht im Hintergrund ab und warf einen langen Schatten. Wir zügelten die Pferde. Tucker und Corner stiegen von den Pferden und gingen in die Hütte. Auch Joe und ich saßen ab und folgten ihnen. Auf einer der Bunks lag ein junger Bursche. Ich hörte den Cowboy, der uns vor der Tür erwartet hatte, sagen: »Ich habe Earl verbunden. Aber die Kugel steckt in der Schulter. Wenn sie nicht herausgeholt wird, wird sich Wundbrand hinzuziehen.«
»In welche Richtung ist dieser Jameson geflohen?«, fragte Butch Tucker.
»Nach Norden. Ob er die Richtung beibehalten hat, weiß ich jedoch nicht.«
Tom Bennett, der Detektiv von Wells & Fargo, kam in die Hütte. »Erzählte Jameson, was ihn in diese Gegend getrieben hat?«, fragte er. »Nannte er irgendwelche Namen?«
»Nein.«
»Ich schicke morgen einen Wagen«, sagte Tucker, »der Earl abholt und nach Perryton zum Arzt bringt.«
Wir gingen wieder hinaus. Draußen rief Tucker: »Wir bilden zwei Mannschaften. Eine führt Corner, die andere ich. John, Sie reiten mit Ihren Männern in nördliche Richtung. Ich folge mit meinen Leuten dem Creek nach Osten. Ich denke, dass Jameson entweder nach Perryton oder Lipscomb geritten ist.«
Joe und ich waren aufgesessen. Ich trieb mein Pferd vor Tucker hin. »Ich reite mit Ihrer Gruppe«, sagte ich. »Mein Kollege Hawk wird sich der Gruppe Ihres Vormannes anschließen.«
»Ich kann Sie nicht daran hindern«, grollte Tucker etwas unwirsch.
Eine Minute später ritten wir. Tom Bennett schloss sich der Gruppe an, die John Corner anführte und in der auch Joe ritt.
Als sich die Dunkelheit lichtete und sich im Osten der Himmel über dem Horizont schwefelgelb verfärbte, erreichten wir Lipscomb. Die Stadt schlief noch. Über dem Wolf Creek hingen Nebelbänke. Die Natur erwachte zum Leben. Im Ufergebüsch begannen die Vögel zu zwitschern.
Lipscomb war eine kleine Stadt, deren Bewohner im Schatten der Rainbow Ranch lebten, einer Hauptranch der Panhandle Cattle Company. Die Main Street war breit, zu beiden Seiten reihten sich Häuser mit oftmals falschen Fassaden wie die Perlen an einer Schnur. Irgendwo hinter den Häusern begann ein Hund zu bellen. Ein anderer stimmte ein. Das heisere Kläffen hallte durch den Ort.
Hier schien es schon seit mehreren Tagen nicht mehr geregnet zu haben, denn der Straßenstaub war trocken und wirbelte zwischen den Hufen der Pferde. Wir verhielten beim Mietstall. Die Pferde traten auf der Stelle, scharrten mit den Hufen und prusteten. Das Hoftor war geschlossen. Einer der Cowboys sprang vom Pferd, zog sein Gewehr aus dem Scabbard und hämmerte mit dem Kolben gegen das Tor. Die dumpfen Schläge weckten wahrscheinlich die halbe Stadt. Tatsächlich wurden in der Umgebung einige Fenster nach oben geschoben und wütende Stimmen bedachten uns mit wenig freundlichen Worten.
Wieder schlug der Cowboy mit dem Gewehrkolben gegen den Torflügel.
»Ja, ja, ich komme schon!«, erklang es, dann hörten wir, wie innen ein Riegel zurückgeschoben wurde, und im nächsten Moment schwang das Tor quietschend auf. Ein bärtiger Mann, dessen Hosenträger zu beiden Seiten seines Körpers nach unten baumelten, zeigte sich. Im ersten Licht des Tages konnte ich erkennen, dass er über die frühe Störung nicht gerade erbaut war. Seine Brauen waren finster zusammengeschoben, mit barscher Stimme rief er: »Der Mietstall öffnet erst um sieben Uhr. Wer seid ihr überhaupt, weil ihr euch gebärdet wie …«
»Halt die Luft an, Mister!«, so schnitt ihm Tucker grob das Wort ab. »Wir suchen einen Mann. Möglich, dass er in der Nacht in den Ort gekommen ist. Er reitet ein Pferd mit dem W-Brand. Sein Name ist Jameson.«
»Gestern kamen drei Reiter in der Stadt an«, versetzte der Stallmann. »Sie sahen ziemlich lädiert aus. Kamen aus dem Indianerland. Von ihnen ritt keiner ein Pferd mit dem W-Brand. Warum verfolgt ihr den Mann?«
»Er ist ein Pferdedieb«, antwortete Tucker. Dann rief er: »Wir rasten eine Stunde, dann reiten wir zurück. Sieht so aus, als hätten wir den Weg hierher umsonst gemacht.«
Die Männer saßen ab und führten ihre Pferde in den Hof des Mietstalles. Der Stallmann öffnete das Stalltor und zündete eine Laterne an. Die Winde des Brunnens quietschte durchdringend, als einer der Reiter einen Eimer voll Wasser in die Höhe hievte.
Ich machte mir meine Gedanken. Die Worte des Stallmannes gingen mir nicht aus dem Sinn. Drei Reiter waren aus dem Indianerland nach Lipscomb gekommen. Und sie hatten scheinbar Federn lassen müssen. Ich fragte mich, ob es sich um die Viehdiebe handelte, denen die Flucht vor den Indianern gelungen war. Mit Butch Tucker sprach ich nicht darüber.
Der Stallmann trug einige Eimer voll Hafer aus dem Stall. Einige der Reiter drehten sich Zigaretten und rauchten.
Als die Pferde versorgt waren, trat Tucker an den Stallmann heran. »Wo finden wir die drei Männer, die gestern in die Stadt gekommen sind?«
»Ich sagte Ihnen doch, dass …«
»Antworten Sie!«
»Im Hotel. Zwei von ihnen sind leicht verwundet. Sie entkamen mit Mühe und Not den Rothäuten, die auf ihre Skalps scharf waren.«
»Nehmt eure Gewehre, Männer, und folgt mir!«, kommandierte Tucker.
Ich trat vor ihn hin. »Was soll das werden, Tucker?«
»Ich denke, es handelt sich um drei der Viehdiebe. Ich will mir die Kerle ansehen. Sie können ja mitkommen, Logan.«
»Das werde ich.«
Ich holte mein Gewehr. Dann gingen wir zum Hotel. Der Tag war dabei, die Herrschaft über die Nacht zu ergreifen. Zwischen den Gebäuden wob das Morgengrauen.
Das Hotel hatte noch geschlossen. Tucker schlug mit der Faust einige Male gegen die Haustür. Es dauerte einige Zeit, dann wurde die Tür geöffnet. »Was …«
Tucker drückte die Haustür auf. Er und seine Männer drängten in die Hotelhalle. »Wir suchen die drei Kerle, die gestern hier ankamen«, stieß Tucker ungeduldig hervor. Die Reiter der Waycross stiegen bereits die Treppe empor.
»Zimmer zwei, drei und vier«, sagte der Hotelier eingeschüchtert. »Bitte, richten Sie keinen Schaden bei mir an. Ich …«
Tucker schob den Mann kurzerhand zur Seite und schritt zur Treppe.
Ich blieb unten in der Halle. Es war hier noch ziemlich finster. Dennoch schien der Hotelier meinen Stern wahrgenommen zu haben, denn er flüsterte: »Bitte, Marshal, verhindern Sie, dass diese Kerle hier im Hotel unnötigen Schaden anrichten. Sie befehligen doch sicher das Aufgebot.«
Oben war Gepolter zu vernehmen, dann erklangen Stimmen, ein scharfer Befehl ertönte.
»Machen Sie Licht«, bat ich.
Der Hotelier zündete eine Laterne an. Die Männer von der Waycross Ranch kamen wieder die Treppe herunter. Sie bugsierten die drei Männer, die sie aus den Betten geholt hatten, nach unten. Die drei trugen nur Unterwäsche. Es waren stoppelbärtige Kerle, einer von ihnen trug einen Verband um den Oberarm, der andere um den Oberschenkel. Der Bursche hinkte. »Was wollt ihr von uns, verdammt?«, erregte sich einer der Männer. »Wir …«
»Schnauze, Mister!«, fuhr ihm Tucker unduldsam ins Wort. »Wenn ihr die seid, für die wir euch halten, dann solltest du deinen Atem fürs Hängen sparen.«
*
Der Reiterpulk unter John Corners Führung erreichte Perryton. Es war noch finster. Fünf Meilen weiter nördlich begann das Oklahoma-Territorium. Sie lagerten am Stadtrand und warteten, dass es hell wurde. Dann ritten sie in die Stadt. Der Mietstall öffnete gerade. John Corner erkundigte sich bei dem Stallmann, ob in der Nacht ein Reiter nach Perryton gekommen war.
»Nicht, dass ich wüsste«, antwortete der Stallbursche. »Bei mir war er jedenfalls nicht. Versuchen Sie es mal beim Hotel. Meggie Gordon verfügt über einen eigenen Stall. Vielleicht ist der Mann dort abgestiegen.
Sie ritten weiter zum Hotel. Corner und Joe Hawk saßen ab und gingen hinein. Die Rezeption war verwaist. John Corner schlug mit der flachen Hand auf die Glocke, die auf dem Tresen stand. Es dauerte nicht lange, dann kam Meggie Gordon aus einem Nebenraum in die Halle. Sie war fix und fertig angezogen. In den Augen der schönen Frau blitzte es auf, als sie Joe erkannte.
»Guten Morgen, Meggie«, sagte Joe und lächelte. »Lange nicht gesehen.«
»Hallo, Joe. Wie geht es dir?«
»Ich kann nicht klagen und hoffe, du kannst von dir dasselbe behaupten.«
»In Perryton ist jeder Tag wie der andere. Das Leben hier verläuft in ziemlicher Eintönigkeit. Was führt euch so weit nach Norden?«
John Corner übernahm es, zu antworten. Er sagte: »Wir suchen einen Mann namens Phil Jameson. Er hat einen Reiter der Waycross Ranch angeschossen und dessen Pferd gestohlen. Ist dieser Mann gegebenenfalls in der Nacht hier angekommen?«
Fragend schaute die Frau Joe an. Dieser nickte. »Es ist so, wie der Vormann sagt. Wir haben einige Fragen an Jameson.«
»Ja«, sagte Meggie und nickte, »Jameson kam in den frühen Morgenstunden hier an. Sein Pferd steht im Stall. Ich habe ihm Zimmer drei gegeben. Zweite Tür oben rechts.«
Joe und Corner stiegen die Treppe hinauf. Corner pochte gegen die Tür mit der Nummer drei. Im Zimmer rührte sich nichts. »Jameson, öffnen Sie!«, rief Joe.
In dem Moment peitschte auf der Straße ein Schuss. Geschrei wurde laut, trommelnde Hufschläge erklangen. Und wieder dröhnte ein Revolver, dann donnerte eine ganze Serie von Schüssen.
Corner warf sich mit seinem gesamten Körpergewicht gegen die Tür. Krachend flog sie auf. Den Revolver in der Faust stürmte er in das Zimmer. Das Fenster stand offen. Der Durchzug bauschte die Gardine auf. »Verdammt!«, entfuhr es dem Vormann, dann war er beim Fenster und beugte sich hinaus. Vor seinem Blick lag der Hinterhof. Unter dem Fenster befand sich ein Schuppendach. Über dieses Dach war Phil Jameson in den Hof gelangt.
In die Stadt hatte sich lastende Stille gesenkt.
Joe Hawk rannte die Treppe hinunter und durchquerte die Halle, trat hinaus auf den Vorbau und sah den Pulk reiterloser Pferde vor dem Hotel. Die Männer der Waycross Ranch hatten sich zu beiden Seiten der Straße verteilt und irgendwelche Deckungen aufgesucht. Einer schrie: »Er kam plötzlich auf seinem Pferd aus dem Hof des Hotels. Ich glaube, wir haben ihn verwundet. Er ist in diese Richtung abgehauen.« Der Mann deutete nach Westen.
Die Männer kehrten auf die Straße zurück und senkten die Waffen. John Corner trat aus dem Hotel. »Er hat uns wahrscheinlich gehört, als wir in die Stadt kamen und die richtigen Schlüsse gezogen. Auf die Gäule, Männer. Wir jagen ihn, bis ihm die Zunge zum Hals heraushängt.«
Sie kletterten auf die Pferde und nahmen die von den Schüssen nervösen Tiere hart in die Kandare. Meggie Gordon trat auf den Vorbau. Joe winkte ihr zu. »Auf Wiedersehen, Meggie.«
»Wann, Joe?«
»Das liegt in Gottes Hand«, rief der Marshal, dann trieb er sein Pferd an. Er stob hinter der Waycross-Mannschaft her, die bereits dem westlichen Stadtausgang entgegenstrebte.
Meggie blickte den Reitern hinterher, bis sie aus ihrem Blickfeld verschwunden waren. Nur noch aufgewirbelter Staub markierte den Weg, den sie genommen hatten. Ein schmerzlicher Zug hatte sich in die Mundwinkel der schönen Frau gekerbt. Sie und Joe Hawk hatten sich geliebt. Doch Joe hatte ihre Liebe dem Job als Marshal geopfert. Mit seinem Erscheinen in der Stadt hatte er bei Meggie eine alte Wunde aufgerissen. Das Herz sagte ihr, dass sie Joe noch immer liebte. Ihr Verstand jedoch machte ihr klar, dass eine Verbindung zwischen ihnen keine Zukunft haben konnte. Ihr Lebensmittelpunkt war in Perryton, seiner in Amarillo. Dazwischen lagen hundertzwanzig Meilen Wildnis.
Meggie ging ins Hotel zurück. Erinnerungen stürmten wie mit tonnenschweren Gewichten auf sie ein …
*
»Nennt mir eure Namen!«, forderte Butch Tucker.
Die drei Männer saßen in den Sesseln in der Halle des Hotels. Das Zwielicht legte düstere Schatten in ihre Gesichter und ließ die Linien darin schärfer und tiefer erscheinen.
Einer der Kerle, ein blonder Bursche um die dreißig, sagte: »Mein Name ist Bruce Vanderbildt. Das sind Amos O'Donnel und Byram McBrady. Was wollt ihr von uns? Wir kommen von Kansas herunter und sind auf dem Weg nach Süden, genauer gesagt nach San Antonio.«
»Ihr hattet einen Zusammenstoß mit Indianern?«
»Mit Comanchen. Ein Jagdtrupp. Die Brüder haben es nicht so gerne, wenn verhasste Weiße durch ihre Jagdgründe ziehen. Unsere Skalps saßen verdammt locker.« Vanderbildt kratzte sich hinter dem Ohr.
Ich fixierte die drei Kerle. Ein unsteter Lebenswandel hatte unübersehbare Spuren in ihren Gesichtern hinterlassen. Ich schätzte sie ein und machte mir ein Bild. Es waren Sattelstrolche.
»Ich denke«, sagte Tucker, »dass ihr mit einer Herde Longhorns, die ihr der Waycross Ranch gestohlen habt, auf dem Weg nach Norden wart. Zwei eurer Kumpane sind bei dem Überfall durch die Comanchen vor die Hunde gegangen. Die Marshals Logan und Hawk haben sie gefunden und begraben. Ihr drei seid zurück nach Texas geflüchtet. So ist es doch?«
Die Augen der drei Kerle verrieten die innere Unruhe, der sie ausgesetzt waren. Jeder Zug ihrer Gesichter drückte Unrast aus. Vanderbildt schluckte, dann antwortete er: »Sie irren sich, Sir. Wir waren nie vorher in Texas. Zuletzt arbeiteten wir in Hays City. Wie kommen Sie darauf, dass wir Rinder gestohlen hätten? Wir …«
»Ich glaube dir kein Wort, Vanderbildt!« Tuckers Backenknochen mahlten. In seinen Mundwinkeln hatte sich ein brutaler Zug festgesetzt. »Na schön«, murmelte er plötzlich, wie jemand, der in Gedanken zu einem Ergebnis gekommen war. »Ich werde die Wahrheit aus euch herausprügeln. – Schafft sie hinaus auf die Straße, Leute. Vorwärts!«
Es war für mich an der Zeit, einzuschreiten. Laut und klar sagte ich: »Die Zeiten, in denen jemand eine peinliche Befragung durchführen durfte, sind vorbei, Tucker. Sie haben nicht den geringsten Hinweis, dass es sich bei Vanderbildt und seinen Gefährten um die Viehdiebe handelt, die die Weiden der Waycross unsicher machen. Ich lasse es nicht zu, dass Sie diesen Männern auch nur ein Haar krümmen.«
Butch Tucker hatte sich mir zugewandt. Er hatte die Augen zusammengekniffen. Zwischen den Lidschlitzen funkelte es unheilvoll. Sein Gesicht hatte einen entschlossenen Ausdruck angenommen. »Ich bin davon überzeugt, dass es sich um die Viehdiebe handelt, Logan. Ich kenne Mittel und Wege, um den Burschen die Würmer aus der Nase zu ziehen. Sie und Ihr Kollege Hawk waren ja nicht in der Lage, den Kerlen das Handwerk zu legen. Deshalb werde ich auf meine Weise herausfinden, ob es sich …«
»Das werden Sie nicht!«, fiel ich Tucker hart und ebenso entschieden ins Wort.
Wir starrten uns an. Es war ein Kräftemessen, eine stumme Auseinandersetzung, und der psychisch schwächere Mann musste unterliegen. Doch plötzlich mischte sich einer der Cowboys ein. »Wir hätten den großmäuligen Sternschlepper nicht mitnehmen dürfen. Ohne ihn würden wir das verkommene Trio schon zum Singen bringen. Sollen wir ihn samt seinem Stern aus Lipscomb hinausjagen, Boss?«
Der Blick Tuckers irrte ab. Er schüttelte den Kopf. »Es ist in Ordnung, Männer. Meine und Logans Vorstellungen von Recht und Ordnung gehen wohl ein wenig auseinander. Es ist gut. Wir reiten zurück zur Ranch.«
Unzufriedenes Gemurmel kam auf. Der Cowboy, der mich eben einen großmäuligen Sternschlepper genannt hatte, ergriff wieder das Wort und rief wild: »Seit wann gibt die Waycross Ranch vor den Handlangern des Distrikt-Gerichts klein bei? Auf den Stern Logans spucken wir. Vorwärts, Männer, packt die drei Sattelstrolche und bringt sie auf die Straße, damit wir mit der Peitsche die Wahrheit aus ihnen herausprügeln.«
Tatsächlich wollten sich einige der Waycross-Männer in Bewegung setzen. Ich zog den Remington und richtete ihn auf den Sprecher. »Willst du deinem Boss imponieren, Hombre? Rechnest du dir etwas aus, wenn du ihm nach dem Mund sprichst?« Mit zwei Schritten war ich bei dem Kerl. Und ehe er sich versah, schlug ich ihn mit dem Revolver nieder.
Das war die Sprache, die diese Burschen verstanden. Die Sprache der Gewalt. Ich musste mich durchsetzen. Worte allein würden nicht genügen, sie wären in den Wind gesprochen. Man musste dieser Sorte mit Härte und Kompromisslosigkeit gegenübertreten.
Ich glitt zurück und ließ den Revolver über die Kerle pendeln. »Raus mit euch!«
In den Gesichtern arbeitete es, in den Blicken, mit denen sie mich musterten, las ich eine böse Prophezeiung. Die Atmosphäre war angespannt und gefährlich, die Luft schien zu knistern wie vor einem schweren Gewitter. Und es sah ganz so aus, als wollten sie es darauf ankommen lassen.
Butch Tucker hielt sich heraus. Lauernd wartete er ab, gespannt harrte er der Entwicklung der Dinge. Es stand auf Spitz und Knopf, und jeden Moment drohte die Situation zu eskalieren.
Ich spannte den Hahn. Damit ließ ich keinen Zweifel aufkommen, dass ich notfalls von der Waffe Gebrauch machen würde. Das trockene, metallische Geräusch, als die Spannfeder einrastete, schien die Waycross-Männer in die Realität zurückzuholen. Sie entspannten sich, ihre Schultern sanken nach unten, die Gesichter erschlafften. Zwei von ihnen halfen dem Burschen, den ich niedergeschlagen hatte, auf die Beine. Aus einer Platzwunde an seiner Stirn sickerte Blut und lief über seinen Nasenrücken. Ein anderer Mann hob den Hut des Kerls auf. Dann bewegte sich der Pulk nach draußen. Zuletzt verließ Butch Tucker das Hotel.
Zurück blieb ein stummes Versprechen.
In Butch Tucker hatte ich mir eben einen Feind geschaffen.
Ich wandte mich den drei Männern zu. »Ich kann nicht auf euch aufpassen, und darum kann ich auch für nichts garantieren. Reitet so schnell wie möglich aus der Gegend. In diesem Landstrich wird noch das Recht der freien Weide praktiziert. Ich denke, wir verstehen uns.«
»Danke, Marshal«, murmelte Bruce Vanderbildt. »Himmel, wenn ich dran denke, was diese Schufte mit uns gemacht hätten, wenn Sie nicht dabei gewesen wären.«
Ich entspannte den Remington und versenkte ihn im Holster. Dann folgte ich Butch Tucker und seinen Reitern nach draußen. Sie waren bereits auf ihre Pferde gestiegen. Böse Blicke trafen mich. Die Feindschaft, die von ihnen ausging, berührte mich geradezu körperlich. Ich blieb auf dem Vorbau stehen.
»Reiten wir!«, gebot Tucker mit lauter Stimme und zog sein Pferd halb um die rechte Hand. Dann gab er dem Tier leicht die Sporen.
Der Pulk ritt zwischen zwei Häusern hindurch und entfernte sich in westliche Richtung. Die Hufschläge verklangen. Nur noch mein Pferd stand vor dem Hotel. Ich stieg vom Vorbau, nahm es am Zaumzeug und führte es zum Mietstall. Der Stallmann stand im Hoftor. »Bleiben Sie etwa in der Stadt?«
»Nein«, antwortete ich. »Zeigen Sie mir die Pferde der drei Burschen.«
»Folgen Sie mir.«
Ich ließ mein Pferd im Hof stehen und ging hinter dem bärtigen Burschen her in den Stall. Es war jetzt hell genug, so dass das Licht, das durch das Tor und die Fugen zwischen den Brettern fiel, ausreichte, um Einzelheiten zu erkennen. Stickiger Stallgeruch stieg mir in die Nase.
»Das sind ihre Pferde«, sagte der Stallmann und vollführte eine entsprechende Handbewegung. Die Tiere standen in drei nebeneinanderliegenden Boxen. Um das Brandzeichen besser erkennen zu können riss ich ein Streichholz an. Es war eine Raute, deren Umrisse ein S umschlossen.
»Auch die beiden anderen Pferde tragen den Diamant-S-Brand«, erklärte der Stallmann.
Ich schlenkerte die Hand und das Streichholz verlosch. »Das tote Pferd, das ich im Indianerland fand, trug auch dieses Brandzeichen«, knurrte ich.
Da erklang vom Tor her eine klirrende Stimme: »Es wäre klüger gewesen, wenn du mit den anderen die Stadt verlassen hättest, Marshal.«
Ich drehte mich um. Die drei Kerle standen nebeneinander und hoben sich deutlich gegen die Helligkeit im Hof ab. Sie waren jetzt angezogen, und sie hielten ihre Gewehre auf mich gerichtet.
Vom Stallmann kam ein erstickter Ton. Ich hörte ihn scharf die Luft ausstoßen. Es gelang mir, die jäh aufkommende Unruhe zu unterdrücken. Um den Kerlen keinen Grund zu geben, verschränkte ich voll scheinbarer Gelassenheit die Arme vor der Brust. In Wirklichkeit war ich angespannt wie eine Stahlfeder. »Ich habe es geahnt«, knurrte ich. »Aber ich wollte den Beweis nicht antreten, solange Tucker und seine Männer in der Stadt weilten. Ich hätte sie wohl kaum davon abhalten können, euch aufzuknüpfen, wenn sie sich sicher gewesen wären, dass ihr die Viehdiebe seid.«
»Wir sind dir zu Dank verpflichtet, Marshal«, antwortete Bruce Vanderbildt. »Darum würde es mir bis in die Seele Leid tun, wenn wir uns den Abgang erkämpfen müssten. Wir haben Rinder gestohlen. Aber wir haben nie einem der Cowboys auch nur einen Kratzer zugefügt. Leben und leben lassen, Marshal.«
»Werdet ihr aus der Gegend verschwinden, wenn ich euch laufen lasse?«
Vanderbildt lachte fast belustigt auf. »Wenn du uns laufen lässt?« Wieder lachte er. »Ich glaube, du verkennst hier etwas, Marshal.«
»Fesseln wir ihn und den Stallmann einfach und dann verschwinden wir«, schlug einer der beiden Begleiter Vanderbildts vor. »Es wird uns nicht schwer fallen, in der Wildnis unsere Spur zu verwischen.«
»Das ist nicht nötig«, sagte ich. »Ich wüsste im Moment sowieso mit euch nichts anzufangen. Ihr wärt mir nur ein Klotz am Bein. Schließen wir eine Art Waffenstillstand. Doch ich rate euch, aus dem Panhandle zu verschwinden.«
»Dagegen ist nichts einzuwenden«, erwiderte Vanderbildt. »Ich vertraue dir, Marshal. Sag mir deinen Namen.«
»Ich heiße Bill Logan.«
»Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, Logan«, sagte Vanderbildt lächelnd, senkte das Gewehr und deutete eine leichte Verbeugung an.
»Der Waffenstillstand gilt nicht mehr, sobald sich unsere Wege noch einmal kreuzen sollten«, erklärte ich. »Dann werde ich euch wie Viehdiebe behandeln.« Mit dem letzten Wort setzte ich mich in Bewegung, verließ den Stall, schwang mich aufs Pferd und ritt an.
*
Phil Jameson war auf den Rücken eines Hügels geritten, aus dem sich einige Felsen erhoben. Dazwischen wucherte Buschwerk. Eine Kugel hatte ihn an der Seite gestreift, eine andere hatte seinen Oberschenkel durchschlagen. Diese Wunde blutete stark. Er nahm sein Halstuch ab und band es um die Verletzung. Dann nahm er sein Gewehr und repetierte.
Der Tag hatte die Nacht endgültig besiegt. Der Himmel war grau. Die dicke Wolkendecke ließ kein Sonnenlicht durch. Ebenso düster wie der Tag war Phil Jamesons Stimmung. Alles hatte sich anders entwickelt, als er es sich ausgemalt hatte. Er war in den Panhandle gekommen, um Butch Tucker zu töten. Als Jäger also. Jetzt war er zum Gejagten geworden. Er gab sich keinen Illusionen hin. Tucker wollte ihn tot sehen. Bei den beiden Kerlen, die er nach Fort Davis geschickt hatte, handelte es sich um Stümper. Hier, im Panhandle, hatte Tucker eine große Mannschaft in der Hinterhand – Männer, die ihm gehorchten wie gut dressierte Hunde.
Fernes Rumoren war zu vernehmen. Schnell wurden die Geräusche deutlicher. Es war brandender Hufschlag, der sich näherte. Dann jagten die Reiter über eine Bodenwelle. Sie vermittelten einen unübersehbaren Eindruck von Stärke und Entschlossenheit und Phil Jameson verspürte ein jähes Würgen in der Kehle. Er hob das Gewehr an die Schulter, zielte ruhig und drückte ab. Eines der Pferde brach vorne ein, sein Reiter stürzte Hals über Kopf zu Boden und überschlug sich. Die Detonation wurde noch von den Echos wiederholt, als die anderen Reiter ihre Schrecksekunde überwanden und die Pferde auseinandertrieben. Dann sprangen sie ab und rannten in die Deckung von Sträuchern und Felsblöcken, die sporadisch aus der Erde ragten und oftmals an den Rücken eines Elefanten oder Nashorns erinnerten.
»Gib auf, Jameson!«, erklang es.
Phil Jameson konnte nicht ahnen, dass sich unter den Reitern ein U.S. Marshal befand und dass es dieser war, der ihn aufgefordert hatte, sich zu ergeben. Er jagte einen Schuss aus dem Lauf. Das Stück Blei wurde von einem Felsen abgefälscht und quarrte mit durchdringendem Heulen als Querschläger davon.
Phil Jameson zog sich zurück, lief zu seinem Pferd, saß auf und lenkte es den Abhang hinunter. Unten trieb er das Tier an, sprengte durch eine schmale Senke und an deren Ende zwischen die Anhöhen, die hier buckelten und ihn schützten.
Hinter ihm krachten Schüsse, als drei Waycross-Männer unter dem Feuerschutz ihrer Kameraden den Hügel erstürmten. Erst, als sie nach einiger Zeit oben bei den Felsen anlangten, wurden sie darüber belehrt, dass Jameson längst das Weite gesucht hatte.
Am Fuß des Hügels sammelte sich die Waycross-Mannschaft. John Corner war voll Wut. »Dieser dreckige Bastard!«, erregte er sich. »Er soll vom Gaul stürzen und sich den Hals brechen.«
Joe Hawk war auf sein Pferd geklettert. »Es hat keinen Sinn, kreuz und quer durchs Land zu reiten auf der Suche nach Jameson. Er wird uns immer eine Nasenlänge voraus sein und kann uns nach und nach die Pferde wegschießen. Kehren wir zur Ranch zurück. Ich werde zusammen mit Logan darüber nachdenken, was zu veranlassen ist.«
»Jameson hat ein Pferd gestohlen und einen unserer Reiter niedergeschossen!«, fauchte John Corner.
»Von Bennett wissen wir, dass zwei Kerle, die Pferde mit dem W-Brand ritten, in Fort Davis auf Jameson warteten, um ihn zu töten. Er hat sich das Pferd eines der Kerle genommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich dabei um einen Pferdediebstahl handelt. Was den Schuss in der Weidehütte betrifft, so kann Jameson in Notwehr gehandelt haben. Für das Pferd, das er sich nahm, ließ er ein anderes zurück.«
Tom Bennett ritt neben Joe hin. »Es sind eine Reihe von Fragen aufgetaucht«, erklärte er. »Die beiden Kerle, die in Fort Davis auf Jameson warteten, kamen offensichtlich von der Waycross Ranch. Die Ranch scheint auch das Ziel von Jameson zu sein. Und ich glaube, den Grund zu kennen. Jamesons damaliger Komplize befindet sich auf der Waycross.«
»Das ist doch Unsinn!«, knirschte John Corner. »Sie reimen sich etwas zusammen, Bennett, das jeglicher Grundlage entbehrt.«
»Reiten wir«, befahl Joe Hawk. »Überlassen wir Jameson den nächsten Schritt.«
Doch Corner schüttelte stur den Kopf. »Wir verfolgen Jameson. Sie und Bennett brauchen wir nicht, Hawk. Folgt mir, Männer.« Der Vormann saß auf und ritt an. Seine Männer folgten ihm. Joe blickte ihnen etwas unschlüssig hinterher. Tom Bennett beobachtete ihn von der Seite.
»Was denken Sie?«, fragte Joe plötzlich.
»Das habe ich bereits kund getan«, antwortete Bennett. »Jamesons damaliger Kumpan sitzt auf der Waycross Ranch. Es kann Tucker sein, ebenso gut aber auch Corner oder sonst einer der Männer, die für die Ranch den Sattel quetschen. Nun, ich werde es herausfinden.«
Der Pulk aus Waycross-Reitern war schon um den Hügel verschwunden. Joe und Bennett setzten ihre Pferde in Bewegung und folgten der Crew. Sie ließen ihre Pferde laufen und schon bald holten sie das Rudel ein. Die Spur führte nach Süden. Stunden später erreichten sie den Wolf Creek. Dort verloren sie die Fährte. Jetzt entschloss sich Corner, zur Ranch zu reiten. Reiter und Pferde waren erschöpft, Resignation machte sich breit, die Männer machten kein Hehl daraus, dass sie die Nase voll hatten.
Bennett und Joe Hawk schlossen sich ihnen an. Auch sie und ihre Pferde bedurften einiger Stunden der Ruhe.
*
Tucker und seine Männer hatten angehalten und tränkten die Pferde. Ich ritt am Flussufer entlang und näherte mich ihnen. Einer sah mich und machte die anderen auf mich aufmerksam. Sie wandten sich mir zu. Ich schaute in verkniffene Gesichter.
Zwei Pferdelängen vor ihnen hielt ich an. Butch Tucker stemmte die Fäuste in die Seiten und legte den Kopf schief. »Sie sollten mir besser nicht unter die Augen kommen, Logan«, grollte er drohend.
Ich legte die Hände auf das Sattelhorn und beugte mich etwas nach vorn. »Ich habe Sie vor einer Straftat bewahrt, Tucker. Sie sollten das endlich einsehen und Vernunft annehmen.«
»Nein.« Der Ranchboss schüttelte den Kopf. »Sie haben mich blamiert, Logan. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich habe in dieser Gegend ein Gesicht zu verlieren. Man wird über mich lachen.«
»Wie haben Sie es sich vorgestellt, Tucker? Sollen wir uns raufen wie ein paar Schulbuben? Über dieses Alter sind wir doch hinaus.«
»Warum sind Sie uns gefolgt?«
»Ich wollte sicher gehen, dass Sie auch tatsächlich zur Ranch reiten.«
»Bei Vanderbildt und seinen Kumpanen handelte es sich um die Viehdiebe, nicht wahr?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht«, log ich. »Nach amerikanischem Gesetz gilt ein Mann solange als unschuldig, solange er dessen, was ihm vorgeworfen wird, nicht überführt ist. Das gilt auch für Vanderbildt und sein Freunde.«
»Okay, Logan. Steigen Sie ab. Ich will Ihnen eine Tracht Prügel verabreichen. Mein Zorn braucht ein Ventil. Sie kommen mir gerade Recht. Und zu beklagen brauchen Sie sich auch nicht, denn Sie haben es herausgefordert.«
»Nein. Ich werde mich nicht mit Ihnen prügeln, Tucker. Schlucken Sie die Niederlage, die Sie in Lipscomb einstecken mussten. Akzeptieren Sie endlich, dass das geschriebene Gesetz über Ihrem Wort steht. Geben Sie die Rolle des selbstherrlichen, geltungssüchtigen Weidekönigs auf, und Sie werden sehen, jeder Mann im Land wird Ihnen mit Achtung und Respekt begegnen. So aber fürchtet man Sie allenfalls.«
Tucker stampfte auf mich zu. Er hatte die Hände zu Fäusten geballt. Seine Lippen waren fest zusammengepresst und bildeten nur noch einen dünnen, blutleeren Strich. Er wollte zerschlagen, zerbrechen, vielleicht sogar mit seinen Fäusten töten. Jeder Zug in seinem Gesicht verriet es.
O verdammt, wie ich das hasste!
Ich hob mein rechtes Bein über das Sattelhorn und ließ mich vom Pferd gleiten. Da war Tucker auch schon heran. Er schlug nach mir. Ich wich schnell einen halben Schritt zurück und prallte gegen mein Pferd. Das Tier wieherte und tänzelte einige Schritte zur Seite. Tucker hatte ein Luftloch geschlagen. Sofort setzte er nach. Seine Linke kam wie eine Dampframme. Ich schlug sie im letzten Moment mit dem Unterarm zur Seite. Und dann drosch ich Tucker meine andere Faust in den Leib. Der Schlag presste ihm die Luft aus den Lungen, seine Augen quollen aus den Höhlen. Er japste und war in diesen Augenblicken kampfunfähig.
Ich wollte es kurz machen und knallte ihm die geballte Rechte von der Seite gegen das Kinn. Sein Kopf wurde auf die Schulter gedrückt. Ein linker Schwinger in den Magen ließ ihn in der Mitte einknicken. Noch einmal hämmerte ich ihm von der Seite die Faust gegen den Kopf. Er brach auf das linke Knie nieder. Sein Kopf baumelte vor der Brust, Speichel tropfte von seinen Lippen.
Ich trat zurück und ließ die schmerzenden Fäuste sinken.
Tucker war ziemlich angeschlagen. Sein Atem ging rasselnd. Seine Hände öffneten und schlossen sich.
»Ich hoffe, das reicht«, knurrte ich.
Da knackte es hinter mir, und ich wusste das Geräusch augenblicklich zu deuten. Meine Wirbelsäule versteifte. Eine heisere Stimme rief: »Ich glaube nicht, dass der Boss genug hat, Logan. Er will dich zurechtstutzen, und er wird dich zurechtstutzen.«
Ich drehte mich langsam um. Einer der Cowboys hielt den Revolver auf mich gerichtet. Er grinste schief. Matt schimmerten die bleiernen Kugelköpfe in den Kammern der Trommel. Das kreisrunde, schwarzgähnende Mündungsloch starrte mich an wie das leere Auge in einem Totenschädel.
»Du solltest dir das gut überlegen, Hombre«, warnte ich. »Ein Schuss auf einen Staatenreiter kann dich Kopf und Kragen kosten.«
Das Grinsen im Gesicht des Burschen gerann. » Ein Mann kann in diesem Land so spurlos verschwinden wie ein Regentropfen im Ozean. Keiner der hier Anwesenden wird etwas gesehen haben, Logan. Bald wird hinter dir kein Hahn mehr herkrähen.«
In dem Moment legte sich mir von hinten ein Arm um den Hals. Ich wurde zurückgerissen, schlagartig wurde mir die Luft abgeschnürt, und dann bekam ich einen schmerzhaften Schlag auf die rechte Niere.
»Ich werde dich zertreten wie ein lästiges Insekt!«, zischte Tuckers Stimme neben meinem Ohr. Und dann hämmerte er mir wieder die Faust auf die Niere. Der Schmerz zuckte bis unter meine Schädeldecke.
Der Reiter, der mich mit dem Revolver in Schach gehalten hatte, stieß das Eisen ins Holster, kam heran und rieb seine geballte Rechte in der Handfläche seiner Linken. »Ich werde dem Boss helfen, dich fertig zu machen, Logan. Du wirst auf dem Bauch nach Amarillo kriechen, wenn wir mit dir fertig sind.«
Mit seinem letzten Wort rammte er mir die Faust in den Magen. Mir blieb die Luft weg. Vor meinen Augen verschwamm alles. Ich verspürte Schwindelgefühl. Der Arm des Ranchbosses hielt mich fest wie eine Stahlklammer. Die Angst, von ihnen tatsächlich fertig gemacht zu werden, stieg in mir hoch wie ein Schrei. Sie kam kalt und stürmisch wie ein Blizzard. Ich ließ mein rechtes Bein in die Höhe schnellen – und traf den Cowboy empfindlich. Er krümmte sich und brüllte seinen Schmerz und seine große Not hinaus. Seine Hände verkrampften sich über seinem Leib.
Sofort rammte ich den Ellenbogen nach hinten und knallte ihn Butch Tucker gegen die Rippen. Der Klammergriff um meinen Hals lockerte sich ein wenig, ich riss mich los und wirbelte herum. Tucker war viel zu überrascht, als dass er noch schnell genug reagiert hätte. Ich traf ihn am Kinnwinkel und sogleich knallte ich ihm die andere Faust mitten ins Gesicht. Blut schoss aus seiner Nase. Ein versiegendes Stöhnen brach aus seiner Kehle.
Doch jetzt kamen seine anderen Männer. Von ihren Mienen konnte ich den Vernichtungswillen ablesen, der sie beseelte. Ich wollte nach dem Revolver greifen, aber da sagte eine klirrende Stimme: »Das solltest du dir überlegen, Logan.« In das letzte Wort hinein mischte sich das Knacken, mit dem der Hahn eines Sechsschüssers gespannt wurde.
Doch da peitschte ein Schuss. Und dann trieben drei Reiter ihre Pferde aus einer Hügellücke. Im Trab kamen sie näher. Es waren Bruce Vanderbildt und seine beiden Gefährten. Sie hielten die Gewehre im Anschlag und lenkten die Pferde mit den Schenkeln. Drei Pferdelängen vor uns hielten sie an. Vanderbildt heftete seinen Blick auf Tucker. Mit heruntergezogenen Mundwinkeln sagte er: »Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Lösen Sie alle Ihre Probleme mit brachialer Gewalt?«
Tucker holte ein Taschentuch aus der Jacke und presste es unter seine blutende Nase. »Wir reiten«, sagte er laut. »Euch dreien rate ich nicht, auf das Gebiet der Waycross Ranch zu reiten. Sollten wir euch dennoch dort erwischen, ergeht es euch dreckig.«
Sie gingen zu ihren Pferden und saßen auf. Tucker schoss mir noch einen bösen Blick zu. Dann gab er seinem Pferd die Sporen und ließ die Zügel schießen. Der Pulk stob davon.
Vanderbildt und seine Gefährten ließen die Gewehre sinken und versenkten sie in den Scabbards. Ein kaum wahrnehmbares Lächeln umspielte Vanderbildts Lippen. »Eine Hand wäscht die andere, Logan. Ich denke, jetzt sind wir quitt.«
Ich stieg auf mein Pferd. »Nur noch wenige Meilen nach Westen«, sagte ich, »dann beginnt das Weidegebiet der Waycross Ranch. Ich rate euch, vorher nach Süden oder Norden abzubiegen.«





























