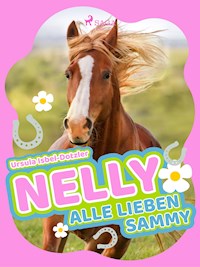Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält drei romantische Gruselgeschichten, die einen garantiert von der ersten bis zur letzten Seite mit schauererregenden Ereignissen in ihren Bann ziehen. So geht es unter anderem in ein altes schwedisches Pfarrhaus, in dem es zu spuken scheint; in ein irisches Landhaus, wo Valerie von ihren Träumen heimgesucht wird; und schließlich geht es nach Salzburg, wo es nachts unheimlich an Julies Zimmertür klopft..."Warte, bis es dunkel ist", "Das Haus der flüsternden Schatten" und "Nacht über Uhlenau" - drei schaurig schöne Geschichten von Ursula Isbel.Ursula Isbel wurde 1942 in München geboren und lebt heute als freie Schriftstellerin in Sulzburg. Sie schreibt hauptsächlich Jugendliteratur für ein überwiegend weibliches Publikum, darunter mehrere Reihen über Reiterhöfe und das Leben mit Pferden. Unter dem Pseudonym Ursula Dotzler übersetzte sie außerdem viele Jugendbücher aus dem Englischen und dem Schwedischen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Isbel-Dotzler
Unheimlich
SAGA Egmont
Unheimlich
Copyright © 1994, 2018 Ursula Isbel-Dotzler und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711804612
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
Warte, bis es dunkel ist
1
„Du mußt mitkommen, Frankie“, sagte Kristin. „Ich fahre einfach nicht ohne dich!“
„Sag das lieber meiner Mutter“, erwiderte ich düster. „Du weißt doch, wie ängstlich sie ist. Jedesmal, wenn ich ohne sie nur ein paar Kilometer von zu Hause wegfahre, steht sie Todesängste aus. Sie denkt immer gleich, ich würde entführt oder in den Orient verschleppt oder so.“
Kristin lachte. „Aber von Schweden aus wird niemand in den Orient verschleppt! Wir werden ganz friedlich auf dem Land versauern, wo sich die Elche gute Nacht sagen.“
„Elche?“ wiederholte ich. „Das sind doch diese riesigen Tiere mit den Geweihschaufeln auf dem Kopf? Laufen die dort frei herum?“
Kristin nickte, daß ihr das lange blonde Haar wie ein Schleier vors Gesicht fiel. „Klar. In Schweden soll’s sogar noch Bären geben – oben im Norden, weißt du.“
„Wenn du noch lange weitererzählst, komme ich bestimmt nicht mit“, sagte ich.
„Ach was, das gilt doch nicht für Lilletorp. Da gibt’s nur blonde Bauern und rote Holzhäuser und Birkenwälder, Landluft und rosarote Schweinchen.“ Kristins blaue Augen sahen mich beschwörend an. „Wenn du nicht mitkommst, sterbe ich in den Ferien vor Langeweile, ich schwör’s dir! Dieses Lilletorp ist nicht mal auf der Landkarte eingezeichnet.“
Ich seufzte. „Ich möchte ja mitkommen; und mein Vater würde mich sicher auch fahren lassen. Aber ich weiß nicht, wie ich meine Mutter überreden soll. Vier Wochen von zu Hause fort… Noch dazu eine so weite Reise! Sie wird sicher ein furchtbares Theater machen.“
„Herrje, Frankie, in eineinhalb Jahren wirst du achtzehn. Deine Mutter muß sich daran gewöhnen, daß du bald erwachsen bist und deine eigenen Wege gehst“, sagte Kristin. „Verlaß dich nur auf mich, ich mach das schon. Sie weiß doch, daß mein Vater ein ernsthafter, achtbarer Mann ist, der den ganzen Tag über seinen Büchern sitzt. Zu einem Wissenschaftler hat sie bestimmt Vertrauen! Außerdem wohnt er jetzt in einem alten Pfarrhaus. Das ist doch ehrbar und anständig, dagegen kann sie nichts einzuwenden haben! Eine Haushälterin gibt’s da auch, und schließlich bin ich auch noch da. Komm jetzt, wir gehen gleich zu ihr und erledigen das.“
Und Kristin nahm mich an der Hand, energisch wie immer. Dann gingen wir ins Haus meiner Eltern, um die Schlacht gemeinsam zu schlagen.
2
Die Ferien hatten angefangen, und gewisse Unerfreulichkeiten wegen der Zeugnisse waren überstanden. Ich kniete vor der Kommode in meinem Zimmer und schichtete Unterwäsche in den Koffer.
„Nimm warme Sachen mit“, sagte meine Mutter von der Tür her. „In Schweden soll es schon früher als bei uns Herbst werden, die Leute machen dort ja auch eher Urlaub als wir. Ach Gott, wenn ich daran denke… Du vergißt doch nicht, mir jede Woche zu schreiben, Frankhild?“
Ich nickte automatisch. „Wenn nur Kristins Mutter mitfahren würde, dann wäre ich beruhigt!“ sagte meine Mutter zum wiederholten Mal.
„Aber das geht eben nicht“, erwiderte ich erschöpft. „Du weißt doch, daß Kristins Eltern schon seit ewigen Zeiten geschieden sind. Ihre Mutter lebt hier mit einem anderen Mann zusammen. Da kann sie doch nicht einfach Urlaub bei ihrem geschiedenen Mann machen! Außerdem fährt Kristin schon seit acht Jahren jedesmal allein in den Ferien zu ihrem Vater, und sie ist immer heil und gesund zurückgekommen.“
„Ja, aber bisher hat Professor Zetterlund in Stockholm gelebt! So eine Großstadt ist schließlich etwas anderes als ein einsames Dorf auf dem Land!“
Ich schob die Kommodenschublade zu und richtete mich auf. „Allerdings, das ist wirklich etwas anderes. In Großstädten gibt’s Mord und Totschlag, und auf dem Land passiert höchst selten etwas, das ist der Unterschied.“
Das wirkte. Meine Mutter sagte nichts mehr. Sie ging in die Küche, um Reiseproviant für mich vorzubereiten. Ich packte meinen Koffer und die Reisetasche in Ruhe fertig.
Dann rief Kristin an. „Du, wir sollten am besten morgen schon eine Stunde vor der Abfahrt am Bus sein“, sagte sie. „Dann können wir uns die Plätze noch aussuchen. Und geh früh ins Bett, damit du ausgeschlafen bist. Wir sind immerhin ungefähr zweiunddreißig Stunden unterwegs; schlafen kann man im Bus sowieso kaum.“
Wider Erwarten schliefen wir nach zehnstündiger Fahrt im Europa-Bus doch, wenn auch unruhig und unbequem. Es gab viel zuwenig Platz für unsere Knie und unsere Füße; ab und zu wachte ich davon auf, daß Kristin meine Schulter als Kopfkissen benutzte. Ich träumte von einem düsteren Haus inmitten eines riesigen Waldes, in dem Kristins Vater wie die Hexe im Märchen von Hänsel und Gretel hauste.
Gerade als der Traum richtig ungemütlich wurde, wachte ich auf und stellte erleichtert fest, daß wir in Hamburg waren. Hinter den Busfenstern war es schon dunkel. Kristin packte ihren Proviant aus.
Nachts auf der Fähre nach Malmö wurde ich seekrank, obwohl eigentlich kein besonders hoher Seegang war. Ich kauerte auf einem Stuhl im Gang und fühlte mich sterbenselend.
Kristin versuchte mich zu trösten. „In ein paar Stunden hast du’s überstanden“, sagte sie.
Ich murmelte, daß ein paar Stunden eine verdammt lange Zeit sein können, und schloß die Augen wieder. Gerade jetzt wünschte ich mir, ich wäre zu Hause geblieben, doch das sagte ich ihr natürlich nicht.
Als wir früh am nächsten Morgen endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatten und in den Bus zurückkehren konnten, war ich heilfroh und dankbar.
„Du siehst aus wie Entengrütze“, sagte Kristin aufmunternd.
Da mir nun schon einmal so elend war, vertrug ich auch das Busfahren nicht mehr. Den ganzen Tag kauerte ich wie ein Häufchen Elend auf dem Sitz, aß keinen Bissen und warf nur ab und zu einen gequälten Blick aus dem Busfenster. Kristins Begeisterung über die Wälder und Seen, das Meer und die schwedischen Dörfer konnte ich nicht teilen. Ich wäre am liebsten ausgestiegen und hätte mich in den Straßengraben gelegt.
Keiner konnte erleichterter sein als ich, als wir gegen Abend endlich Stockholm erreichten.
„Jetzt lege ich mich auf eine Bank im Bahnhof und rühre mich bis morgen früh nicht mehr von der Stelle!“ sagte ich zu Kristin.
„Du weißt genau, daß der nächste Zug nach Uppsala in zehn Minuten fährt“, sagte sie streng. „Den müssen wir erwischen, damit wir den letzten Bus nach Lilletorp noch kriegen. Vater hat mir alles genau geschrieben. Er erwartet uns doch und macht sich Sorgen, wenn wir nicht im Bus sind. Reiß dich zusammen, Frankie!“
Bus – ich hörte immer nur Bus! Ich stöhnte. Da ich mich jedoch zu schwach fühlte, um zu widersprechen, folgte ich Kristin gottergeben durch die Bahnhofshalle zum Schalter und dann zum Zug nach Uppsala.
Er stand schon bereit und war zum Glück ziemlich leer. Ich legte mich auf eine Sitzbank und war überglücklich, daß sich für eine Weile nichts mehr unter mir bewegte.
Doch dann fuhren wir wieder. Eine Stunde später waren wir in Uppsala und erreichten den Bus nach Lilletorp noch rechtzeitig. Mir kam es vor, als sollte mein armer Magen nie mehr zur Ruhe komme. Ich schwor mir, während der nächsten Wochen nie wieder einen Bus oder ein Schiff zu besteigen; an die Rückreise mochte ich gar nicht erst denken.
Als wir Lilletorp endlich erreichten, brach die Abenddämmerung schon herein, und Professor Zetterlund war nicht gekommen.
3
Wir standen allein im Zwielicht. „Er hat vergessen, daß wir heute kommen“, sagte Kristin. „Typisch!“
Ich sah mich um. Der Bus war wieder losgefahren. Wir standen mit unserem Gepäck an der Landstraße. Am Ende der Straße zeichneten sich Häuser gegen den dunkler werdenden Himmel ab. Irgenwo in der Nähe mußte ein Bauernhof sein, denn wir hörten eine Kuh muhen. Sonst war alles still und wie ausgestorben.
„Und was machen wir jetzt?“ fragte ich. „Weißt du, wo das Haus ist, in dem dein Vater wohnt?“
„Keine Ahnung. Er ist ja erst vor ein paar Monaten hierhergezogen. – Ich bin noch nie in Lilletorp gewesen. Pfarrhäuser sind aber meistens in der Nähe der Kirche, glaube ich. Wir können ja mal fragen.“
„Ja“, sagte ich. „Das könnten wir, wenn jemand da wäre.“
„Dazu müssen wir erst mal in den Ort gehen.“ Kristin nahm ihren Koffer und begann die Straße entlang zu wandern. Ich folgte ihr und dachte verbittert, daß diese Ankunft wirklich zu allem anderen paßte.
Der erste Mensch, der uns begegnete, war ein alter Mann mit einem Hund. Glücklicherweise kann Kristin ziemlich gut Schwedisch; sie ist ja Halbschwedin. Ich hörte, wie sie etwas von „Professor Zetterlund“ und „Prästgården“ sagte. Der Alte nickte freundlich, gab eine Antwort, die ich natürlich nicht verstand, und deutete in die Ferne.
Als ich seiner ausgestreckten Hand mit den Augen folgte, merkte ich, daß er durchaus nicht auf die rote Backsteinkirche zeigte, die die Häuser von Lilletorp überragte. Er deutete auf den Wald hinter dem Dorf. Mein Herz sank.
„Tack så mycket“, sagte Kristin höflich, aber mit niedergeschlagener Stimme. Daß das vielen Dank hieß, wußte ich wenigstens.
„Es ist nicht im Dorf, wie?“ murmelte ich, als der alte Mann mit seinem Hund weiterging.
„Nein“, erwiderte Kristin. „Du hast es erfaßt, Frankie. Wir müssen… hm, na ja, wir müssen mehr oder weniger durch Lilletorp durch und dann ein Stück in den Wald.“
Hänsel und Gretel! Ich hatte es ja geahnt. „Können wir nicht im Pfarrhaus anrufen, damit dein Vater uns hier abholt?“ fragte ich.
„Versuchen können wir’s ja.“ Kristin machte ein zweifelndes Gesicht. „Aber er hängt den Hörer oft aus, wenn er arbeitet, um nicht gestört zu werden.“
Lilletorp kam mir wie eine Geisterstadt in einem Wildwestfilm vor. Immerhin waren einige Fenster erleuchtet. Ich sah voller Sehnsucht auf die Lichtvierecke, denn ich war hungrig und todmüde und wollte nichts als essen und schlafen.
Auf dem Weg zur Telefonzelle begegneten uns nur zwei Leute, eine Frau und ein kleiner Junge, die uns freundlich grüßten. Mein Koffer schien von Schritt zu Schritt schwerer zu werden.
Zum Glück hatte Kristin ein paar Kronenstücke eingesteckt. Allerdings schien ihr Vater das Telefon tatsächlich ausgehängt zu haben, denn es erklang immer nur das Besetztzeichen, so oft wir es auch versuchten.
„Dann nehmen wir eben ein Taxi!“ sagte ich.
Kristin lachte. „Ein Taxi? So was gibt es hier nicht!“ erwiderte sie. „Aber dort drüben ist ein kleines Gasthaus. Da frage ich mal, ob wir unser Gepäck einstellen dürfen. Dann brauchen wir uns wenigstens nicht so abzuschleppen.“
Mir war schon alles egal. Ich nickte nur, setzte mich auf meinen Koffer und wartete vor der Telefonzelle, während Kristin im Gasthaus Krogen verschwand.
Nach einer Weile kam sie zurück. „Die Leute sind nett“, sagte sie. „Wir können unser Gepäck hierlassen. Sie haben mir sogar eine Taschenlampe geliehen und den Weg zum Pfarrhaus ganz genau beschrieben. So besonders weit ist es nicht.“
Das sollte tröstlich klingen, aber mich konnte nichts mehr trösten. Wir trugen unsere Koffer in die Wirtsstube, in der nur drei ältere Männer saßen und uns mit einer Art mitleidiger Neugier musterten. Die Wirtin stellte unser Gepäck in einer Ecke hinter der Theke ab. Auch auf ihrem Gesicht lag ein Ausdruck, der mir mitleidig vorkam. Sie sagte etwas auf schwedisch, Kristin nickte und gab Antwort. Dann gingen wir wieder in den Abend hinaus.
„Was hat sie gesagt?“ fragte ich. „Sie hat uns so mitleidig angesehen.“
„Sie hat gesagt, wir sollten auf uns aufpassen“, erwiderte Kristin. „Wahrscheinlich fürchtet sie, wir könnten uns im Wald verlaufen. Ich denke, du hast ihr leid getan, weil du so blaß und elend aussiehst.“ Sie warf mir einen Seitenblick zu. „Du bist ganz fertig, wie? Hör mal, du könntest doch eigentlich in der Gastwirtschaft bleiben. Dann gehe ich allein zum Pfarrhaus, und mein Vater soll dich dann mit dem Auto holen.“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein“, erwiderte ich standhaft. „Ich lasse dich nicht allein gehen, kommt nicht in Frage. Ich weiß doch genau, daß du dich allein im Wald fürchtest.“
„Ein bißchen schon“, gab sie zu. „Ehrlich gesagt ist’s mir bedeutend lieber, wenn du mitkommst.“
Als wir den Wald erreichten, war es noch dunkler geworden. Die Bäume ragten wie eine schwarze Mauer vor uns auf. Kein Stern war am Himmel, und der Mond hatte sich hinter Wolken versteckt, denn wir sahen ihn nicht. Kristin beleuchtete den steinigen Weg mit dem Strahl der Taschenlampe.
„Wir müßten jetzt bald an die Wegkreuzung kommen, von der die Wirtin gesprochen hat“, sagte sie. „Dann müssen wir nach links. Weit kann’s nicht mehr sein.“
Ziemlich ängstlich stolperten wir vorwärts. Ich dachte, wie gut es doch war, daß meine Mutter nichts von all dem wußte; sie hätte vor Schreck wahrscheinlich einen Herzanfall bekommen. Es genügte schon, daß Kristin und ich Angst hatten. Argwöhnisch lauschten wir auf die fremden Geräusche um uns her. Es knackte und knisterte, es säuselte und rauschte im Unterholz. Ich vergaß vor Anspannung ganz, wie müde ich war.
„Halt – was war das?“ flüsterte Kristin plötzlich.
Wir blieben stehen und horchten. Ein seltsames Surren erklang; dann knackte es laut. Und dann… Stille.
Kristin ließ den Strahl der Taschenlampe umherwandern. Er schwankte auf und nieder, weil ihre Hand so zitterte.
„Meine armen Nerven!“ sagte ich. „Gibt’s hier wirklich keine Bären mehr?“
„Unsinn, natürlich nicht.“ Es klang nicht besonders mutig. „Wahrscheinlich schleicht irgendwo eine Wildkatze herum.“
„Die sollen ziemlich angriffslustig sein, wenn sie Junge haben“, sagte ich.
„Hör jetzt auf damit, du machst mich ganz krank. Da vorn ist die Wegkreuzung!“
Der Strahl der Taschenlampe erhellte den Weg vor uns; er sah aus wie ein Tunnel. Und am Ende dieses Tunnels aus Licht und Dunkelheit stand etwas, was ein Wegweiser sein konnte.
Es war wirklich ein Wegweiser, doch er war so verwittert, daß die Schrift nicht mehr zu entziffern war. Wir wandten uns nach links, fielen um ein Haar über eine Wurzel, die wie eine Fußangel aus der Erde ragte, und sahen endlich zu unserer großen Erleichterung ein Licht zwischen den Bäumen schimmern.
„Wirklich genau wie in Hänsel und Gretel“, sagte ich. „Hoffentlich bleibt uns wenigstens die Hexe erspart.“
Kristin kicherte unsicher. Wieder raschelte es irgendwo in unserer Nähe, als würde sich ein Grizzlybär im Laub wälzen. Ich war richtig glücklich, als wir endlich ein schmiedeeisernes Tor erreichten und im Hintergrund das Pfarrhaus mit der überdachten Vortreppe sahen. Eine Lampe brannte über der Eingangstür, und im Erdgeschoß war ein Fenster erleuchtet.
Der schmiedeeiserne Torflügel quietschte jämmerlich in den Angeln, als wir ihn aufstießen. Etwas huschte vor uns über den Gartenpfad, ein schwarzes Tier mit glühenden Augen. Ich rettete mich mit einem Satz auf die Vortreppe.
„Eine Katze“, sagte Kristin. „Zieh mal an der Klingelschnur links von der Tür.“
Ich zog daran. Schrilles Gebimmel erklang, aber im Haus rührte sich nichts.
Ich setzte mich auf die oberste Treppenstufe. Kristin zerrte ihrerseits an der Klingelschnur. Die Glocke schepperte bösartig.
Dann hörten wir Schritte im Haus. Die Tür öffnete sich. Ein Mann mit gelockten grauen Haaren, einem Bart und runder Brille stand auf der Schwelle. Er sah uns fassungslos an.
„Hallo, Vater“, sagte Kristin. „Du hast natürlich vergessen, daß wir heute kommen wollten. Da sind wir jedenfalls.“
4
Trotz meiner Müdigkeit wachte ich mitten in der Nacht auf und konnte lange nicht wieder einschlafen. Doch vielleicht war es gerade die Übermüdung, die mich wachhielt. Jeder Muskel meines Körpers war angespannt. In meinen Armen und Beinen kribbelte es so, daß ich nicht stilliegen konnte.
Ich wälzte mich von einer Seite auf die andere. Im Bett nebenan schlief Kristin selig. Ich hörte ihre ruhigen, gleichmäßigen Atemzüge. Im Haus war es sehr still; fast zu still für ein Großstadtmädchen wie mich. Ich war an die vielfältigen Geräusche gewöhnt, die in der Stadt selbst nachts nie ganz verstummen – fernes Verkehrsrauschen, Geräusche aus Nachbarwohnungen, Funkstreifensirenen. Diese Laute waren mir von Kindheit an vertraut, und die ungewohnte Stille beunruhigte mich.
Ich lag im Bett und begann Schafe zu zählen. Als ich bei zweihundertsiebenundzwanzig angekommen war, gab ich es auf. Meine Beine waren so heiß; ich drehte die Bettdecke um, knüllte das Kopfkissen zusammen, legte mich auf die andere Seite. In meinem Kopf kreisten die Gedanken wie ein Mühlrad, das sich nicht anhalten läßt.
Ich konnte einfach nicht zur Ruhe kommen. Im Geist ging ich noch einmal den Weg durch den Wald zum Pfarrhaus, glaubte das Schlingern der Fähre zu spüren und das stundenlange, schier endlose Schaukeln des Busses. Dann dachte ich an Kristins Vater. Er war sehr freundlich zu mir gewesen. Vermutlich erleichterte es ihn, daß ich mitgekommen war und Kristin Gesellschaft leistete.
Ich fragte mich, wie er hier so einsam leben mochte. Freilich hatte er seine Arbeit als Archäologe, die ihm sehr wichtig war, wie ich von Kristin wußte. Doch warum hatte er sich entschlossen, aus Stockholm fort und hierher zu übersiedeln, in ein einsames altes Pfarrhaus im Wald?
Doch irgenwie paßte dieses Haus auch wieder zu Professor Zetterlunds weltfremder Art. Ich konnte mir gut vorstellen, wie er Abend für Abend über seinen Büchern im Studierzimmer saß und arbeitete. Kristin hatte mir erzählt, daß er auch oft unterwegs war, in Griechenland und Ägypten. Zuletzt hatte er Ausgrabungen in Gotland geleitet, bei denen man auf Wikingersiedlungen gestoßen war.
Professor Zetterlund war sicher ein interessanter Mann, aber irgendwie wirkte er auf mich auch fremd und unnahbar. Das Verhältnis zwischen ihm und Kristin war nicht besonders herzlich. Allerdings sahen sich die beiden ja nur selten, und vielleicht konnte Professor Zetterlund seine Gefühle für seine Tochter einfach nicht zeigen. Er und Kristins Mutter hatten sich scheiden lassen, als Kristin noch ein Baby war; damals war Zetterlund in seine Heimat Schweden zurückgekehrt, und er und Kristin hatten sich nie länger als ein paar Wochen im Jahr gesehen.
Ich wollte mich wieder auf die andere Seite wälzen, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne und lauschte.
Die Stille im Haus hatte mich beunruhigt. Jetzt wurde sie von einem Geräusch unterbrochen, und das beunruhigte mich noch mehr. Es war sehr leise oder sehr fern, ein Huschen und Tappen wie von bloßen Füßen.
Das Geräusch verstummte, noch ehe ich Zeit hatte, genauer hinzuhören. Eine Weile herrschte völlige Stille. Dann erklang ein sachtes Schleifen, als würde irgendwo tief im Haus ein Gegenstand über die Dielen gezerrt.
Ich hielt den Atem an. Das schleifende Geräusch wurde schwächer und verklang schließlich ganz. Es hörte nicht plötzlich auf; vielmehr war es so, als würde sich derjenige, der das Geräusch verursachte, immer weiter entfernen.
Mit klopfendem Herzen lag ich da und starrte zum Fenster. Hinter den dunklen Scheiben zeichneten sich die noch dunkleren Umrisse eines Baumes ab. Nun war alles wieder totenstill wie zuvor.
Nur langsam wich meine Erregung. Ich dachte, daß es wohl eine natürliche Erklärung für die Geräusche gab. Möglicherweise war Kristins Vater aufgestanden und hatte irgend etwas ganz Harmloses getan.
Ich stützte mich auf den Ellbogen und sah zu Kristin hinüber. Ihr Gesicht war im Dunkeln verborgen, doch ihre Atemzüge klangen unverändert gleichmäßig. Sie schlief friedlich und hatte nichts von allem gehört.
Ich sagte am nächsten Morgen kein Wort von den nächtlichen Geräuschen – weder zu Kristin noch zu Professor Zetterlund. Erstens fürchtete ich, mich lächerlich zu machen, und zweitens war ich bei hellem Tageslicht selbst überzeugt, daß alles eine ganz natürliche Ursache haben mußte. Vielleicht waren einfach Mäuse im Haus oder Siebenschläfer auf dem Dachboden. Schließlich stand das Pfarrhaus mitten im Wald, da gab es wohl allerhand heimliche Bewohner.
Kristins Vater hatte schon gefrühstückt und unsere Koffer aus dem Dorf geholt, als wir auftauchten. Er saß noch mit der Morgenzeitung am Tisch, begrüßte uns und fragte, wie wir geschlafen hätten.
Professor Zetterlund sprach ein überraschend akzentfreies Deutsch, was ich darauf zurückführte, daß er fast zehn Jahre in Deutschland gelebt hatte. Später stellte ich fest, daß es viele Schweden gibt, die sehr gut deutsch sprechen.
Die Haushälterin des Professors konnte jedoch kein Wort Deutsch. Sie war eine kräftige Frau mit dünnen blonden Haaren und wasserblauen Augen, sie hieß Märta. Zum Frühstück brachte sie uns Kaffee; sie hatte auch frisches Brot aus dem Dorf mitgebracht. Ihre Miene verriet nicht, ob sie sich über unseren Besuch freute oder ob sie uns für eine lästige Mehrbelastung hielt.
„Was hat sie eben gesagt?“ fragte ich Kristin, als Frau Märta und Professor Zetterlund das Zimmer verlassen hatten.
„Ach, das übliche. Daß sie hofft, daß wir uns hier wohl fühlen“, sagte Kristin mit vollem Mund.
„Wohnt sie auch im Pfarrhaus?“ fragte ich.
„Ich glaube nicht. Vermutlich lebt sie in Lilletorp. Als du im Bad warst, habe ich sie mit dem Fahrrad hier ankommen sehen.“
Frau Märta war also jedenfalls vergangene Nacht nicht durch die Gänge getappt. Ich dachte, daß Professor Zetterlund vielleicht eine in einen Teppich gewickelte Mumie durchs Haus geschleppt und in ein geheimes Untersuchungslabor gebracht hatte, und konnte mir nur mit Mühe das Lachen verbeißen.
„Was grinst du so?“ fragte Kristin mißtrauisch.
Ich sagte: „Ach, mir ist nur gerade etwas eingefallen.“ Und ehe Kristin weitere Fragen stellen konnte, fügte ich hinzu: „Was machen wir heute?“
Sie seufzte. „Du, das hab ich mir auch schon überlegt. Gibt’s hier überhaupt etwas zu tun?“
„Wir könnten einen Waldspaziergang machen und Pilze suchen“, schlug ich ohne große Begeisterung vor.
Kristin stieß ein Schnauben aus. Ich fuhr fort: „Oder wir könnten uns im Dorf noch ein bißchen umsehen.“
„Das können wir, aber es dauert bestimmt keine Stunde, dann kennen wir jedes Haus. Und was machen wir dann?“
„Keine Ahnung“, sagte ich. „Was macht man so in Schweden?“
„Oh, in den Städten gibt’s vieles, was interessant ist. In Stockholm zum Beispiel gibt’s einen Vergnügungspark, der Gröna Lund heißt, und…«
Ich unterbrach sie. „Wir sind aber nicht in Stockholm.“
„Dann fahren wir eben mal hin!“
„Nein, danke“, sagte ich. „Fürs erste hab ich genug von der Fahrerei. Mir wird jetzt noch ganz schlecht, wenn ich nur an einen Bus denke.“
„In ein paar Tagen“, prophezeite Kristin, „hast du schon alles wieder vergessen. Und Uppsala mußt du unbedingt auch kennenlernen. Das ist hübsch, sage ich dir! Ein schwedisches Heidelberg, sozusagen. Komm, sehen wir uns erst mal das Haus an.“
Ich war einverstanden. Alte Häuser hatten schon immer eine besondere Anziehung auf mich ausgeübt, und dieser Pfarrhof war bestimmt mehr als zweihundert Jahre alt. Wir brachten unser Kaffeegeschirr in die Küche, wo Frau Märta gerade die Fenster putzte.
Es war eine ziemlich kahle Küche, blitzsauber zwar, aber nicht besonders anheimelnd. Eine Wand war von oben bis unten weiß gekachelt, und über dem Holztisch hing eine Lampe, die wie ein Nachttopf ohne Henkel aussah.
Dafür gab es ein hübsches Wohnzimmer mit abgewetzten Ledermöbeln und einer Terrassentür, hinter der man ein Stück des verwilderten Gartens sah. Eine Steinfigur stand zwischen den Bäumen. Auf den Stufen, die zum Rasen führten, wuchs Moos.
Kristin schaltete den Fernseher ein, aber er ging nicht. „Typisch!“ murmelte sie.
Ich warf einen Blick auf die Schallplattensammlung im Schrank. Kristin beugte sich über meine Schulter.
„Nichts als klassische Musik“, sagte sie düster, ließ sich dann in den Ohrenbackensessel fallen, der am Fenster stand, und streckte die Beine aus. Der Wind trug den Duft von Tannen und Harz durch die offene Terrassentür. Die Bäume rauschten. Vielleicht, dachte ich, hatte Professor Zetterlund doch gewußt, was er tat, als er von Stockholm hierher übersiedelt war.
„Komisch, diese holzgetäfelten Wände!“ sagte Kristin in meine Gedanken hinein. „Hast du bemerkt, daß die Seitenwände im Eßzimmer und im Wohnzimmer ganz mit Holz verkleidet sind? Ob’s hier so was wie ein Priesterversteck gibt?“
Sie stand auf, ging zur Wand und klopfte mit dem Fingerknöchel gegen das dunkle Holz.
„Ein Priesterversteck?“ wiederholte ich und starrte sie an. „Was soll denn das sein?“
„Ach, ich weiß nicht, ob’s hier in Schweden Priesterverstecke gegeben hat. In England war das jedenfalls früher üblich. Zumindest hab ich’s gelesen. Ich glaube, es hat was mit Glaubensverfolgung zu tun. Irgendwann wurden bestimmte Religionen von der Regierung oder vom König nicht geduldet, und die Priester wurden verfolgt. Also mußten sie sich verstecken. Dazu gab’s Wandschränke mit Geheimtüren, Geheimgänge und kleine Räume hinter Wandvertäfelungen, in die sich die Priester verkrümeln konnten, wenn es brenzlig wurde. Interessant, wie?“
„Ja, sehr“, sagte ich. „Davon hab ich noch nie etwas gehört. Und du meinst, daß es hier im Haus so was geben könnte?“
„Warum nicht?“ Kristin klopfte gegen eine andere Stelle der Vertäfelung. „Immerhin sind die Wände paneeliert, oder wie man da sagt. Hinter einer dieser viereckigen Füllungen könnte vielleicht ein Hohlraum sein.“
Das leuchtete mir ein. Ich fing auch an zu klopfen, denn wie Kristin war ich der Meinung, daß man es am Klang hören mußte, falls es hinter der Vertäfelung irgendwo hohl war. Da wir im Augenblick sowieso nichts Besonderes vorhatten, war das eine angenehme Abwechslung.
Als wir eine Weile geklopft hatten, tat sich die Tür auf, und Märta erschien. Sie sagte etwas, und Kristin hörte auf zu klopfen und gab Antwort. Daraufhin machte die Haushälterin ein seltsames Gesicht, äußerte noch etwas und verschwand aus dem Wohnzimmer.
„Was hat sie gesagt?“ fragte ich.
„Daß wir mit dem Klopfen aufhören sollen, weil es meinen Vater bei der Arbeit stören könnte“, erwiderte Kristin. „Außerdem hat sie gefragt, warum wir das machen, und ich habe ihr erklärt, daß wir nach einem Priesterversteck suchen.“
„Deshalb hat sie so ein merkwürdiges Gesicht gemacht. Sie hält uns wahrscheinlich für verrückt.“
„Hm, ich weiß nicht. Jedenfalls hat sie dann noch gesagt, von einem Priesterversteck wüßte sie nichts, aber in diesem Haus wäre alles möglich.“
Das war eine ungewöhnliche Bemerkung. Wir zerbrachen uns eine Weile den Kopf, wie Märta das gemeint haben konnte.
„Klingt fast, als würde es hier spuken“, sagte ich nach einigem Hin und Her.
Kristins Gesicht hellte sich auf. „Spitze!“ sagte sie entzückt. „Dann wäre wenigstens etwas los. Ich dachte schon, wir verkümmern hier vor Langeweile.“
Nach so einer Art von Abwechslung sehnte ich mich keineswegs. „So darfst du nicht reden, Kristin!“ sagte ich streng. „Ich hab nichts gegen Horrorfilme, aber ich bin durchaus nicht wild darauf, meine Ferien in einem Spukhaus zu verbringen. Da hört für mich der Spaß auf, das kann ich dir sagen!“
Kristin lachte. „Unsinn, Frankie. Du weißt doch genau, daß es keine richtigen Gespenster gibt. Aber es könnte doch sein, daß hier irgend jemand aus der ländlichen Bevölkerung meinen Vater vergraulen will und im Pfarrhaus herumgeistert. Dann könnten wir die Sache aufklären und hätten ein Abenteuer.“
„Ich verzichte auf solche Abenteuer“, sagte ich. „Außerdem, wer sollte deinen Vater von hier vergraulen wollen? Er lebt doch ganz friedlich vor sich hin und tut keinem etwas zuleide.“
„Es gibt Bauern, die mögen keine Fremden in ihrer Gegend“, behauptete Kristin. „Also hör mal, Frankie, ich sage dir folgendes: Ich werde mich in den nächsten Tagen mal ganz harmlos an Märta heranmachen und sie ein bißchen aushorchen. Vielleicht kriege ich sie dazu, daß sie etwas ausplaudert.“
Ich hatte ganz das Gefühl, daß Kristins Phantasie wieder einmal mit ihr durchging. Doch die Sache hatte sie aufgemuntert, das sah ich an ihren rosigen Backen und ihren glänzenden Augen.
„Na gut. Aber wenn hier wirklich jemand herumgeistert, will ich nichts davon wissen!“ sagte ich.
Kristin erwiderte: „Wenn’s um Spuk geht, kann man sich nicht heraushalten.“
Ich sollte bald begreifen, daß sie recht hatte.
5
Zum Glück hatte Professor Zetterlund zwei Fahrräder für uns ausgeliehen, so daß wir etwas ungebundener waren und den Weg ins Dorf nicht jedesmal zu Fuß zurücklegen mußten. Ich hatte Kristins Vater gar nicht so viel Sinn fürs Praktische zugetraut; doch abgesehen von den Fahrrädern benahm er sich genau wie ein zerstreuter Professor in Romanen, vergrub sich in seine Arbeit, starrte während der Mahlzeiten geistesabwesend vor sich hin und wußte offenbar mit zwei so unwissenschaftlichen jungen Mädchen wie Kristin und mir nicht viel anzufangen.
Und doch hatte ich das Gefühl, daß Kristin ihm wichtig war. Die Art, wie er sie ansah, verriet, daß sie ihm viel bedeutete. Wahrscheinlich war sie sogar der einzige Mensch auf der Welt, der ihm wirklich nahestand. Kristin hatte Schwierigkeiten, ihn zu verstehen; auch das merkte ich. Nicht das, was er sagte, meine ich, sondern seine Lebensweise, seine Arbeitswut und seine weltfremde Art.
Sie selbst war so ganz anders als er. Wenn ich die beiden nebeneinander am Tisch im Pfarrhaus sitzen sah, wunderte ich mich immer wieder, wie zwei Menschen sich äußerlich so ähneln und doch so grundverschieden sein können. Sie hatten die gleichen hohen Backenknochen und etwas schräg gestellten blauen Augen, die gleiche feine, kurze Nase, die sich auf eine ganz besondere Weise zu kräuseln schien, wenn sie lachten. Nur kam es kaum jemals vor, daß Professor Zetterlund lachte, während Kristin keine Gelgenheit dazu versäumte. Ich kenne nur wenige Menschen, die so gern lachen wie Kristin – und nur wenige, die so ernst und verschlossen wirken wie Professor Zetterlund. Und doch waren sie Vater und Tochter, und ich glaube, sie gaben sich beide redliche Mühe, einander zu verstehen.
Was Kristin vor allem nicht begreifen konnte, war, warum ihr Vater seine Wohnung in Stockholm aufgegeben hatte und in dieses einsame Haus auf dem Land übersiedelt war. Auf meine Bemerkung hin, viele Leute würden doch jetzt aufs Land ziehen, sagte sie immer wieder, er wäre nicht einer von denen.
„Ein Land-Freak ist er nicht, Frankie“, sagte sie ernsthaft, und das Wort „Freak“ erschien mir in Verbindung mit dem Professor so komisch, daß ich lachen mußte.
„Vielleicht wollte er ganz einfach seine Ruhe haben, um ungestört arbeiten zu können“, meinte ich.
„Wenn du seine Wohnung in Stockholm gekannt hättest, würdest du das nicht sagen. Das Haus stand direkt neben einem Park; ruhiger geht’s nicht, ich schwör’s dir.“
Ich überlegte eine Weile. „Und wenn er aufs Land gezogen ist, weil hier das Leben billiger ist als in der Stadt?“
„Ha!“ sagte Kristin. „Geld hat er genug. Er weiß sowieso nicht, wie er alles ausgeben soll, was er verdient! Meine Mutter sagt immer, sie hätte nie einen Menschen gekannt, der so wenig mit seinem Geld anfangen kann wie er.“
Ich gab es auf. „Frag ihn doch einfach mal, weshalb er nach Lilletorp gezogen ist“, riet ich ihr.
Kristin warf mir einen überraschten Blick zu. „Ja, das ist eine Möglichkeit, Frankie. Aber ich weiß nicht, ob er’s mir sagen wird. Er ist so verschlossen. Ich weiß ja kaum etwas über ihn. Dabei ist er mein Vater!“ Sie seufzte. „Wie findest du ihn eigentlich?“
„Oh, ich glaube, er ist ein interessanter Mensch“, sagte ich vorsichtig. „Ungewöhnlich, meine ich…“
Sie unterbrach mich. „Mit einem Wort, du findest ihn ziemlich seltsam“, erwiderte sie und lachte. „Das ist er auch, aber ich mag ihn trotzdem.“
„Klar“, erwiderte ich. „Außerdem ist es kein Wunder, daß er seinen Beruf liebt. Es muß ja auch aufregend sein, alte Sachen auszugraben und Bücher darüber zu schreiben. Fast, als wäre man ein Schatzgräber oder so…“
Ich hatte es mir wirklich schon immer großartig vorgestellt, an „verdächtigen“ Stellen zu graben, auf Bauwerke oder Gräber zu stoßen, die seit Jahrhunderten verschüttet waren, oder ungeheuer alten, wertvollen Schmuck und Gebrauchsgegenstände zu finden.
Wir unterhielten uns auch später noch über dieses Thema, als wir mit den Fahrrädern nach Lilletorp fuhren. „Stell dir vor, jemand leitet eine Ausgrabung bei einem alten Pharaonengrab, und auf der Mumie liegt ein Fluch!“ schrie mir Kristin über die Schulter zu. „Das soll’s schon gegeben haben, du. Irgendwann ist mal ein ganzer Schwarm Wissenschaftler gestorben, die so eine Mumie ausgegraben hatten.“
„Blödsinn!“ schrie ich zurück. „Das war sicher alles nur Zufall. Die wären bestimmt auch ohne die Mumie gestorben.“
„Wer weiß? Sie sind nämlich alle eines gewaltsamen Todes gestorben – innerhalb von ein paar Jahren nach der Ausgrabung, glaube ich“, behauptete Kristin und fuhr eine wilde Linkskurve. Ein Vogel schreckte aus dem Gebüsch auf und flüchtete krächzend.
„Frag mal deinen Vater, was er von der Sache hält!“ rief ich.
„Hab ich schon, vor einem Jahr. Er findet’s natürlich Unsinn.“
Ich nickte zufrieden. Vor uns tauchte Lilletorp auf, eine kleine Ansiedlung im Sonnenschein, umgeben von ein paar roten Bauernhöfen. Ein Hahn krähte, die Kirchenglocke läutete, und ein Bauer fuhr mit dem Traktor übers Feld.
Wie erwartet, war in Lilletorp nichts los. Zwei Hausfrauen kamen mit vollen Einkaufstaschen aus dem Laden, ein Hund streunte über die Straße, vor dem Postamt unterhielten sich drei Männer. Wäsche hing in einem Vorgarten zum Trocknen, jemand mähte Gras, und eine alte Frau goß Blumen.
Kristin schnitt eine Grimasse. „Stinklangweilig!“ sagte sie und schleuderte ihre langen Haare mit einer Kopfbewegung zurück.
Auf dem Bürgersteig vor dem Krogen waren Tische und Stühle aufgestellt. Wir setzten uns in die Sonne, gaben die Taschenlampe zurück und bestellten Eis, was auf schwedisch „glass“ heißt, wie Kristin mir erklärte. Ich konnte auch schon „Goddag“ und „tack“ sagen und wußte, daß es in Schweden als wohlerzogen und höflich gilt, nach dem Essen „tack för maten“ zu sagen, was „Danke fürs Essen“ bedeutet.
Wir löffelten unser Eis und bestellten hinterher noch zwei Portionen, weil uns nichts Besseres einfiel. Ein paar Autos und ein Fuhrwerk tuckerten an uns vorbei die Hauptstraße entlang. Ein kleiner Junge starrte uns mit offenem Mund an.
Jemand bog auf einem Moped um die nächste Ecke, kam die Straße entlanggefahren und hielt vor dem Gasthaus. Es war ein großer Junge mit weißblonden, ziemlich langen Haaren und einem Sonnenbrand auf der Nase.
Kristin und ich beobachteten ihn aus den Augenwinkeln. Er stellte sein Moped ab, setzte sich an einen der Tische nicht weit von uns, streckte die langen Beine aus und starrte in die Luft.
Kristin und ich wechselten einen Blick. Nicht schlecht, sagte der ihre, und ich war sicher, daß sie sich bald etwas einfallen lassen würde, um mit dem blonden Schweden ins Gespräch zu kommen. Ich sah förmlich, wie es hinter ihrer Stirn arbeitete.
„Ich wollte dir doch von dem Fest in Stockholm erzählen, bei dem ich letztes Jahr mit meiner Cousine war“, sagte sie plötzlich sehr laut und vernehmlich auf deutsch. „Das hättest du erleben sollen, Frankie! Die schwedischen Jungen sind ganz nett, aber furchtbar schüchtern, das kannst du mir glauben. Meinst du, die fordern einen zum Tanzen auf? Nie im Leben! Das müssen die Mädchen tun. Es geht einem wirklich auf den Geist.“
Sie machte ein harmloses Gesicht. Ich spähte zu dem blonden Jungen hinüber. Man merkte genau, daß er zuhörte. Er war rot im Gesicht, aber nicht nur von der Sonne.
„Aber vielleicht“, fuhr Kristin nachdenklich und mit erhobener Stimme fort, „sind sie auch nur einfach faul und denken, die gebratenen Gänse müßten ihnen in den Mund fliegen.“
Ich wußte nicht, ob ich lachen oder verlegen werden sollte. Wieder schielte ich zu dem jungen Schweden hinüber. Er stand auf, reckte sich und ging zu seinem Moped, ohne noch etwas bestellt zu haben.
„Und manche“, fügte Kristin besonders laut hinzu, „sind so unheimlich feige, daß sie gleich die Flucht ergreifen, wenn sie irgendwo ein Mädchen sehen!“
Und sie machte ein triumphierendes Gesicht. „Kristin!“ zischte ich vorwurfsvoll. Da drehte sich der blonde Junge zu uns um und sagte in ziemlich gutem Deutsch: „Bei manchen Mädchen ist das auch kein Wunder, wenn man die Flucht ergreift!“
Das saß. Diesmal wurde Kristin rot. Ich hätte mich am liebsten verkrochen, aber Kristin faßte sich schnell wieder und brach in ihr ansteckendes Gelächter aus.
Da mußte der große Blonde auch lachen, und ich fing ebenfalls zu kichern an. Dann setzte er sich zu uns und sagte, daß sein Name Sten wäre, und wieso es uns ausgerechnet nach Lilletorp verschlagen hätte.
„Mein Vater wohnt hier“, erklärte Kristin. „Er ist Schwede, aber ich besuche ihn nur während der Ferien. Sonst lebe ich bei meiner Mutter. Ich heiße Kristin, und das ist meine beste Freundin Frankie.“
„Ja so“, sagte Sten überrascht. „Dein Vater wohnt hier! Wie heißt ihm? Ich kenne allen Leuten in Lilletorp.“
„Er wohnt nicht direkt in Lilletorp, sondern im Wald, im alten Pfarrhaus.“
„Ach, Professor Zetterlund ist dein Vater!“ Sten schien beeindruckt. „Ich wußte gar nicht, daß er ein deutschen Tochter hat. Ihr kommt doch aus Deutschland, nicht?“
Kristin nickte. „Ja, aus München. Meine Eltern sind geschieden, und ich verbringe meine Ferien immer in Schweden. Diesmal ist Frankie mitgekommen – zum Glück, denn es ist teuflisch langweilig hier, findest du nicht?“
„Ziemlich“, erwiderte er. „Aber man kann mindestens an die See fahren, zum Schwimmen.“ Die Wirtin kam, und er bestellte eine Cola.
„Oh, prima!“ sagte ich. „Das wär doch was, Kristin. Ist es weit von hier?“
„Das kommt darauf an“, sagte Sten und musterte mich. „Mit dem Moped braucht es ungefähr eine Stunde.“
Kristin stöhnte. „Dann ist man mit dem Fahrrad wahrscheinlich zwei Stunden unterwegs. Das gäbe hin und zurück vier Stunden Strampelei – nein, danke!“
„Vielleicht könnten wir euch mal am Moped mitnehmen, meine Freund und ich“, sagte Sten zögernd. „Natürlich nur, wenn ihr wollt.“
Kristin strahlte. Sie sah so zufrieden aus wie eine Katze, die Sahne geleckt hat. Sie hatte ihr Ziel erreicht.
„Klar fahren wir mit“, sagte sie. „Wann? Morgen?“
Sten nickte etwas verwirrt. Kristins direkte Art überwältigte ihn offenbar.
Ich schwankte zwischen Verlegenheit und Freude. „Gut“, sagte Kristin. „Dann treffen wir uns also morgen hier vor dem Gasthaus. Um welche Zeit?“
„Zehn Uhr, wenn ihr wollt“, meinte Sten nach kurzem Überlegen.
„Hoffentlich ist dein Freund einverstanden“, murmelte ich. „Wie heißt er?“
Sten trank seine Cola aus. „Magnus“, sagte er.
6
Natürlich radelten wir am nächsten Tag pünktlich nach Lilletorp; ich voller Aufregung, Kristin siegessicher und ausgelassen. Ich hatte so meine Zweifel, ob Sten und sein Freund wirklich auftauchen würden; vielleicht waren sie inzwischen gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, daß sie mit zwei so aufdringlichen Mädchen wie uns nichts zu tun haben wollten; oder sie standen hinter irgendeinem Fenster, wenn wir kamen und vor dem Krogen auf sie warteten, und machten sich über uns lustig.
„Ach was, du alte Unke“, meinte Kristin, als ich ihr meine Bedenken anvertraute. „Sten ist nicht so!“ Dabei kannte sie ihn doch noch gar nicht.
Doch als wir zur Dorfstraße kamen, sahen wir die beiden schon mit ihren Mopeds vor dem Krogen stehen und warten. Man hätte sie von weitem für Brüder halten können, denn sie waren beide gleich groß und gleich blond.
Ich hielt mich hinter Kristin. Am liebsten hätte ich mich irgendwo versteckt. Sie aber kannte wie immer keine Scheu. Sie sprang vom Fahrrad, schleuderte ihr Haar aus der Stirn und sagte: „Hallo, Sten. Und du bist Magnus, wie?“
Stens Freund nickte stumm. Ich glaube, er war genauso verlegen wie ich.
„Hallo“, sagte Sten und versuchte so zu tun, als würden wir uns schon lange kennen. „Gutes Badewetter, ja? Ihr könnt euren Fahrräder im Hof hinter dem Krogen einparken.“
Ich warf Magnus einen verstohlenen Seitenblick zu und merkte, daß er umgekehrt das gleiche tat. Rasch sahen wir beide wieder weg. Immerhin hatte ich bemerkt, daß er schöne graue Augen hatte, in denen ein leichtes Lächeln stand; oder bildete ich mir das nur ein?
„Na, wie gefallen sie dir?“ fragte Kristin, kaum daß wir richtig außer Hörweite waren.
„Pssst!“ zischte ich. Wir schoben unsere Fahrräder durch einen kleinen Torbogen in den Hof des Gasthauses. „Sie sehen gut aus, aber wir müssen erst mal abwarten, ob sie auch sympathisch sind.“
Nachdem wir die Räder an die Mauer eines Nebengebäudes gelehnt und abgesperrt hatten, gingen wir zu Sten und Magnus zurück. Kristin schwang sich sofort wie selbstverständlich hinter Sten aufs Moped, als hätte sie das schon hundertmal getan. So blieb mir nichts anderes übrig, als mit Magnus zu fahren.
Es war ein merkwürdiges Gefühl, die Arme um einen völlig fremden Jungen zu legen. Doch ich mußte mich ja irgendwo festhalten, wenn ich nicht vom Moped fallen wollte.
Sten und Magnus setzten ihre Motorradbrillen auf, und wir fuhren ratternd und knatternd aus Lilletorp hinaus über eine staubige Straße, die zwischen Feldern und einem Birkenwäldchen dahinführte.
Anfangs fühlte ich mich ziemlich verkrampft und angespannt. Meine Nase war dicht an Magnus’ Hemd; er roch angenehm nach Seife und frischer Luft. Seine blonden Haare flatterten im Fahrtwind und kitzelten mich im Gesicht. Staubkörnchen wehten mir in die Augen, da ich vergessen hatte, eine Sonnenbrille aufzusetzen. Ich schloß die Augen und entspannte mich ein wenig.
Die Fahrt kam mir lang vor. Ich dachte daran, daß ich mir geschworen hatte, eine Zeitlang kein Fahrzeug mehr zu besteigen – und jetzt schaukelte ich wieder durch die Gegend! Meine Arme waren schon ganz steif und mein Gesicht brannte, als wir endlich in der Ferne das Meer sahen. Das Wasser glitzerte grünlich hinter kahlen Klippen, Schwärme von Seevögeln kreisten am Himmel.
Wir fuhren an einer Reihe kleiner roter Holzhäuser vorbei. In das Knattern der Mopeds mischte sich das Geschrei badender Kinder und das Kreischen der Möwen. Zwischen den Klippen wuchs hohes Gras, es wehte im Seewind.
Wir bogen in eine kleine Parkbucht ein, in der etwa ein Dutzend Autos standen, und machten halt. Ich war heilfroh, endlich absteigen zu können. Mein Rücken schmerzte, und in den Armen hatte ich fast einen Krampf.
Magnus setzte seine Brille ab. Ich sah, daß er im linken Ohrläppchen einen kleinen goldenen Ring trug. Das gefiel mir. Irgendwie paßte es zu ihm.
Kristin sagte: „Herrje, ich komme mir ganz verstaubt vor. Nichts wie ins Wasser!“
Wir folgten Sten und Magnus zu einer windgeschützten Stelle zwischen Felsen und stellten unsere Umhängekörbe ab. Das Ufer war steinig, das Wasser so klar, daß man bis auf den Grund sehen konnte. In der Ferne fuhr ein Boot mit rosarotem Segel.
„Puh, eine Qualle!“ sagte Kristin und deutete aufs Wasser. „Gibt’s viele hier?“
„Ziemlich viele, aber sie sind nicht gefahrvoll. Sie stechen nicht, meine ich“, erwiderte Magnus. Es war das erstemal, daß er etwas sagte. Seine Stimme war dunkel, und sein Deutsch klang recht holprig, aber gerade das hatte einen besonderen Reiz.
„Sie geben keine ätzende Flüssigkeit ab, meinst du“, sagte Kristin und lachte. „Trotzdem sind sie irgendwie unheimlich. Ich mag nicht mit ihnen in Berührung kommen.“
„Sie sind hübsch“, sagte ich. „So zart, fast wie aus Glas. Wenn sie so im Wasser treiben, sehen sie wie seltsame Blüten aus.“
„Oder wie Raumschiffe“, meinte Magnus. „Wenn sie groß wären, könnte ich mich denken, wie sie als Raumschiffe durch den Universum schweben.“
„Ja, zu den Klängen von Walzermusik – wie im Film 2001!“ rief Kristin.
Wir lachten. Dann verschwanden Kristin und ich hinter einer Klippe, um uns umzuziehen.
„Vielleicht baden sie hier nackt?“ sagte Kristin, während wir in unsere Bikinis schlüpften. „Die Schweden baden gern nackt, weißt du.“
Ich starrte sie an. „Und das sagst du jetzt erst? Du, das wäre mir peinlich. Meinst du, daß die beiden auch…?“
„Hm“, sagte Kristin mit bedenklicher Miene. „Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Die sind aus einem Dorf, da geht’s wohl nicht so frei zu.“
Ich war sehr beruhigt, als wir wieder hinter der Klippe hervorkamen und feststellten, daß Sten und Magnus Badehosen trugen und daß auch sonst niemand nackt herumhüpfte. Die beiden waren braungebrannt und ziemlich knochig. Wir wateten ins seichte Wasser. Es war verteufelt kalt, und die Steine bohrten sich in meine Fußsohlen.
Kristin und Sten gingen voraus. Ich hörte, wie sie sich auf schwedisch unterhielten. Ich stakste in einigem Abstand hinter Magnus her und verbiß mir einen Aufschrei, als ich auf einen besonders spitzen Stein trat. Da wandte er sich zu mir um, sah mich ernst an und sagte: „Die Steiner machen weh, nicht?“
„Ja“, sagte ich. „Furchtbar.“ Und dann begannen wir beide zu lachen, ohne recht zu wissen, warum.
Kristin ließ sich platschend ins Wasser fallen. Sie schwamm mit ein paar Stößen weiter hinaus, ich sah ihre langen, schlanken Beine im klaren Wasser. Auch Sten stürzte sich in die Fluten. Er prustete wie ein Walroß.
„Verdammt mutig sind die!“ sagte Magnus.
Wir blieben nebeneinander stehen und zitterten. „Man muß sich hineinstürzen“, erklärte Magnus. „Sonst kehrt man um. Oder man verfriert.“
Er sagte das so komisch, daß ich wieder lachen mußte. Wie auf Kommando ließen wir uns vornüber ins Wasser fallen und begannen zu schwimmen.
„Saukalt!“ schrie ich, und Magnus sah mich an und fragte erstaunt: „Sagt man das? Saukalt?“
Kristin rief über die Schulter: „Ist das nicht phantastisch? Einsame Spitze – so ein klares Wasser! Igitt, eine Qualle!“
Sie warf sich herum und schwamm in wilder Flucht nach rechts. Sten kraulte hinterdrein. „Vorsicht! Die Quallen greifen an!“ brüllte er. „Ein ganzer Armee nähert sich von Dänemark!“
Kristin kreischte laut. Sie begann ihn mit Wasser zu bespritzen, und die beiden veranstalteten eine Wasserschlacht. Magnus und ich hielten uns in sicherer Entfernung von den beiden. Wir blinzelten in die Sonne, sahen den Segelschiffen zu, wechselten ab und zu einen Blick oder ein Lächeln. Es war, als würden wir uns schon seit Jahren kennen und nicht erst seit weniger als zwei Stunden.
Später lagen wir zu viert auf der Klippe und sonnten uns. Eine Weile schwiegen wir, doch es war kein unbehagliches Schweigen. Manchmal öffnete ich die Augen und sah träge aufs Meer hinaus oder verfolgte mit den Blicken die Möwen, die in wunderbarer Anmut über dem Wasser schwebten und sich vom Wind tragen ließen.
Plötzlich sagte Magnus: „Ihr wohnt in das alte Pfarrhaus, wie?“
Kristin nickte. „Ja, bei meinem Vater. Ich weiß wirklich nicht, warum er sich das Haus gekauft hat. Es ist so einsam da. Brrr!“ Und sie schüttelte sich.
Magnus machte ein nachdenkliches Gesicht. „In Lilletorp sagen die Menschen, daß es in das Pfarrhaus…“ Er stockte. „Wie heißt das doch, Sten? Spöker?“
„Spuken“, sagte Sten. „Sie sagen, daß es ins Pfarrhaus spukt. Die alte Frauen erzählen sich das, ja. Und die alte Männer. Das Haus hat deshalb auch viele Jahre leer gestanden, bis dein Vater es gekäuft hat.“
„Gekauft“, verbesserte Kristin. „So ist das also! Da siehst du’s mal, Frankie!“ Und sie warf mir einen triumphierenden Blick zu.
Ich hob den Kopf. Die friedliche Stimmung war zerstört. Spuk! Die Geräusche fielen mir ein, die ich in der ersten Nacht im Pfarrhaus gehört hatte. Dieses Schleifen…
Obwohl die Sonne so warm schien, lief mir ein Schauder über den Rücken.
„Du hast ja eine Gänsehaut!“ sagte Magnus. „Bist du ängstlich vor Spukerei?“
Ich erwiderte: „Nein.“ Aber es klang nicht sehr überzeugend.
„Was soll denn das für ein Spuk sein?“ fragte Kristin begierig. „Geht ein Gespenst um? Eine ruhelose Seele oder so?“
„Ich weiß selber nicht so genau“, sagte Magnus. „Du sollst meine Großmutter fragen. Die hat mich oft davon erzählt, als ich klein war. Da ist mal etwas geschehen, vor hundert oder zweihundert Jahr. Ein böser Pastor hat seine Frau geplagt, glaube ich.“
„Ja“, bestätigte Sten. „Jetzt weiß ich es auch wieder. Ein alte Tante von mir hat früher manchmal davon gesprochen. Da soll ein Pastor gewesen sein, wo war sehr grausam zu sein Ehefrau. Er hat sie so gequält, daß sie… Wie sagt man doch gleich? Sie hat Selbstmord gemacht. Ein kleines Kind hatte sie auch. Das soll sie vorher noch getötet haben, aber sein Leiche hat nie jemand gefunden.“
Ich starrte ihn an. Mir war jetzt richtig kalt. Ich griff nach meinem T-Shirt und deckte mich zu.
„Pfui Teufel!“ sagte Kristin. „Und so was soll ein Pastor gewesen sein. Aber die Kirche hat früher schließlich auch Frauen foltern und verbrennen lassen, die sie für Hexen hielt. Das müssen doch grausame, engstirnige Leute gewesen sein!“ Sie schüttelte voller Abscheu den Kopf. „Diese Frau soll also im Pfarrhaus herumspuken? Oder etwa der Pastor? Vielleicht läßt ihm sein Gewissen keine Ruhe!“
Ich stöhnte. „Hör bloß auf, Kristin! Wenn das so weitergeht, packe ich meine Sachen und laufe zu Fuß nach Hause.“
Magnus sagte: „Oh, das ist mir sehr unangenehm. Ich meine, ich wollte dir nicht ängstlich machen. Es gibt doch kein Spukerei, Frankie. Das ist nur, was die alten Menschen glauben.“
„Wer weiß“, warf Kristin ein. „Es könnte doch sein, daß solche armen Seelen, die im Leben furchtbar gelitten haben oder viel Böses getan haben, keine Ruhe finden und an dem Ort umgehen müssen, wo alles passiert ist.“
„Das glaube ich nicht“, sagte Sten. „Man hat doch kein Beweis dafür, daß irgendwo wirklich ein Gespenst war. Die Menschen wissen nur, wenn in ein Haus etwas Schlimmes passiert ist. Dann denken sie, daß es dort ungeheuerlich sein muß.“
„Nicht geheuer“, verbesserte Kristin. „Aber ich sage euch, ich habe mal in einer Zeitschrift einen Bericht gelesen…“
Und sie erzählte weitschweifig eine Geschichte von einem Spukhaus im Bayrischen Wald, doch ich hörte nicht richtig hin. Wieder dachte ich an die Geräusche. Ich war sicher, daß ich während der kommenden Wochen jede Nacht stundenlang wach liegen und horchen würde, ob sich die seltsamen Laute wiederholten; und das war keine angenehme Vorstellung.
„Ihr sollt mal mit mein Großmutter sprechen“, sagte Magnus. „Sie weiß viel über das alles Bescheid. Ihr eigenen Großmutter hat nämlich mal in das Pfarrhaus gearbeitet. Als Piga… Wie sagt man auf deutsch, Sten?“
„Als Hausmädchen“, erklärte Sten. Er machte ein interessiertes Gesicht. „Hat sie bei dem bösen Pastor und sein Frau gearbeitet?“
Magnus schüttelte den Kopf. „Nein, später erst. Das war wohl der nächste Pastor oder so. Jedenfalls sagt meine Großmutter, daß seine… nein, ihre Großmutter aus das Pfarrhaus entlaufen ist. Wegen der Spukerei.“
Ich stöhnte wieder, diesmal aber nur innerlich. Magnus fuhr fort: „Aber mein Großmutter kann nicht Deutsch.“
Ich dachte erleichtert, daß ich ja kein Schwedisch konnte und mir die Schauergeschichten deshalb auch nicht anzuhören brauchte. Doch Kristin erwiderte eifrig: „Ach, das macht nichts. Wir gehen zu ihr, und sie soll uns alles genau erzählen. Dann mache ich den Dolmetscher und übersetze für Frankie, was sie sagt.“
„Vielen Dank!“ murmelte ich schwach.
Glücklicherweise redeten wir an diesem Tag nicht weiter vom Pfarrhaus. Sten begann eine andere Spukgeschichte zu erzählen, die er in einem Buch gelesen hatte. Nicht, daß ich im Augenblick besonders wild auf Spukgeschichten gewesen wäre. Seine Erzählung klang jedoch eher komisch als schaurig, weil er gelegentlich ein falsches Wort benutzte und grammatikalische Fehler machte, die einfach keine gruselige Stimmung aufkommen ließen.
Dann gingen wir zu einer Würstchenbude hinter der Parkbucht, aßen „korv med senap“, was soviel wie Würstchen mit Senf bedeutet, badeten noch einmal, legten uns wieder in die Sonne und fuhren anschließend nach Lilletorp zurück.
„Das war prima!“ sagte Kristin, als wir vor dem Krogen abstiegen. „Nehmt ihr uns morgen wieder mit?“
„Sicher“, sagte Magnus. „Morgen fahren wir noch mal. Dann fängt der Schule bei uns wieder an, leider.“
„Oh!“ Kristin war enttäuscht.
„Aber am Wochenende können wir fahren und schwimmen“, sagte Sten. „Und ein bißchen Zeit gibt es schon noch.“
Wir verabredeten uns für den nächsten Tag um die gleiche Zeit. Dann holten Kristin und ich unsere Fahrräder aus dem Hof der Gastwirtschaft. Magnus und Sten warteten noch am Straßenrand.
„Und seid vorsichtig mit dem Spukerei!“ rief uns Sten nach, als wir losradelten. „Wenn der alte Schweinepastor um Mitternacht vor eure Tür steht und sein Kopf unter sein Arm trägt, müßt ihr ihm fotografieren. Dann haben wir ein Sensation in Lilletorp!“
Kristin wandte sich lachend um und winkte. Ich aber lachte nicht. Ich konnte es einfach nicht komisch finden.
7
Natürlich schlief ich in der folgenden Nacht ausgesprochen schlecht. Ich wälzte mich unruhig im Bett herum, wurde von ekelhaften Träumen geplagt und fuhr immer wieder erschrocken hoch, weil ich mir einbildete, ein Geräusch gehört zu haben. Dabei war es während der ersten Nachtstunden völlig still im Haus.
Kristin, die Glückliche, schlief selig wie immer. Nur einmal kicherte sie im Schlaf. Nicht zum erstenmal beneidete ich sie um ihre Unbekümmertheit.
Kurz nach Mitternacht begann es draußen leise und fern zu donnern. Der Wind seufzte in den Bäumen, nahm langsam an Stärke zu und ließ den Wald bald wie ein Meer rauschen. Blitze zuckten hinter den Fenstern auf und tauchten das Zimmer für Bruchteile von Sekunden in grelles Licht.
Ich war jetzt hellwach. Die ersten Regentropfen schlugen schwer gegen die Scheiben. Irgendwo klapperte ein Fensterladen. Das schmiedeeiserne Gartentor ächzte und quietschte in den Angeln wie eine arme Seele in höchster Pein.
Der Donner grollte und krachte immer lauter. Ich zog mir die Bettdecke über den Kopf und dachte: Wenn jetzt ein Blitz ins Pfarrhaus einschlägt, ist alles aus! Dann gab es einen ohrenbetäubenden Knall. Ich kniff die Augen fest zu und steckte mir die Finger in die Ohren.
Plötzlich spürte ich eine Bewegung über mir. Jemand zog mir die Bettdecke weg. Eine Hand berührte mein Gesicht.
Ich erschrak so, daß ich keinen Laut hervorbrachte. Immerhin schaffte ich es, die Finger aus den Ohren zu nehmen und die Hand in wilder Panik wegzustoßen.
„Frankie!“ flüsterte eine Stimme. Es war Kristin. „Hast du das Krachen gehört?“
Ich setzte mich im Bett auf. Mir war ganz schwach vor Erleichterung. „Und ob ich’s gehört habe!“ krächzte ich. „Steht das Haus noch?“
Kristin kicherte. „Ich denke schon“, sagte sie. Dann krachte es wieder.
„Hast du gesehen, ob ein Blitzableiter auf dem Haus ist?“ fragte ich nach einer Weile.
„Nein“, sagte Kristin. „Aber ich denke schon. So was hat doch heutzutage jeder.“
Ich legte mich zurück, und Kristin kroch wieder in ihr Bett. Eine Weile lagen wir still da. Es brauste und rauschte, krachte und johlte ums Haus wie in einem Hexenkessel. Das ist fast so schlimm wie Spuk! ging es mir durch den Sinn.
„In so einer Nacht haben sie früher bestimmt geglaubt, daß die Hexen los sind“, sagte Kristin wie ein Echo auf meine Gedanken. Ihre Stimme klang plötzlich nicht mehr so mutig und ausgelassen wie sonst.
„Sieh mal aus dem Fenster, vielleicht fliegt eine auf ihrem Besen vorbei!“ sagte ich mit einem schwachen Versuch, Galgenhumor zu zeigen.
Kristin lachte zitternd. Dann aber verstummte sie unvermittelt und zischte: „Pssst!“
Ich hob den Kopf und lauschte. Mitten in all dem Getöse vernahm ich ein Tappen und Schlurfen draußen auf dem Flur vor unserem Zimmer – und das Geräusch kam näher…
Ich dachte: Wenn das so weitergeht, überlebe ich diese Nacht nicht!
Dann klopfte jemand an unsere Tür. Ich hatte so ein Gefühl, als würde das Blut in meinen Adern stocken, so wie es immer in Romanen heißt. Kristin fuhr im Bett hoch. Im Licht eines aufzukkenden Blitzes sah ich sekundenlang ihr Gesicht und ihr wirres Haar. Ihre Augen waren weit aufgerissen.
„Hast du das gehört?“ wisperte sie.
„Ja“, zischte ich zurück. „Mach nicht auf!“
„Vielleicht ist’s der Schweinepastor“, flüsterte Kristin hysterisch. „Der Pastor mit dem Kopf unter dem Arm!“
Obwohl ich genau wußte, daß das Unsinn war, mußte ich mich doch zwingen, nicht aufzuschreien. Ich starrte in die Dunkelheit, die dem Blitz folgte, und dachte: Der Teufel soll mich holen, wenn ich noch mal freiwillig in so einem alten Haus Ferien mache. Der Teufel soll mich holen, wenn…
Wieder klopfte es, diesmal lauter. Dann rief eine Stimme: „Hallo, Mädchen! Ist alles in Ordnung mit euch?“
Es war Professor Zetterlund. Zum zweitenmal in dieser Nacht wurde mir ganz schwach vor Erleichterung. Kristin sprang aus dem Bett, machte Licht und öffnete die Tür.
Ihr Vater stand im Morgenmantel auf der Schwelle, mit zerzausten Haaren und Filzpantoffeln. Ohne seine Brille sah er seltsam jung und hilflos aus, gar nicht wie ein würdevoller Professor. Er blinzelte wie ein verirrter Vogel ins Licht und sagte: „Ihr habt doch sicher auch nicht schlafen können, wie?“
„Nein“, sagte Kristin. „Der Krach könnte Tote aufwecken.“
Manchmal wäre es mir wirklich lieber gewesen, sie hätte sich nicht so deutlich ausgedrückt.
Ihr Vater erwiderte: „Hoffentlich habt ihr euch nicht gefürchtet? Ich wollte mal nachsehen, ob ihr auch in Ordnung seid.“
„Natürlich haben wir uns nicht gefürchtet“, schwindelte Kristin. „Wir haben’s lustig gefunden, was, Frankie?“
„Sehr lustig“, sagte ich. „Haha!“
Professor Zetterlund warf mir einen verwirrten Blick zu. „Ein derartiges Unwetter habe ich hier noch nie erlebt“, sagte er. „Hoffentlich ist der Blitzableiter noch in Ordnung. Ich habe mich leider nie darum gekümmert. Mit solchen Sachen kenne ich mich nicht aus.“ Er fuhr sich mit den Fingerspitzen durch die Haare, daß sie noch wilder nach allen Seiten abstanden. „Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir in mein Arbeitszimmer kommen, dann trinken wir etwas auf den Schrecken. Einen Sherry vielleicht, das beruhigt.“
„Gute Idee“, sagte Kristin.
Auch ich war froh über Professor Zetterlunds Vorschlag. Wahrscheinlich mochte er ganz einfach in dieser schrecklichen Nacht nicht allein sein. Auch Erwachsene sind nicht immer so stark und mutig, wie man sie sich vorstellt oder wünscht.
Wir zogen unsere Bademäntel an und folgten Kristins Vater den Flur entlang und die Treppe hinunter. Der Regen prasselte gegen die Fensterscheiben. Die Zweige eines Baumes scharrten wie Finger über das Glas. Der Wind blies durch sämtliche Fugen, so daß die Flurlampe leicht im Luftzug schwankte.
Als wir an dem großen Spiegel in der Halle vorüberkamen, erhaschte ich einen Blick auf mein bleiches Gesicht. Meine braunen Augen starrten mich verängstigt aus dem fleckigen Glas an, und die dunklen Haare fielen mir ins Gesicht. Ich sah aus wie eine Zigeunerin.
„Ich glaube, das Schlimmste ist vorüber“, sagte Professor Zetterlund über die Schulter. „Wenn der Regen richtig einsetzt, gehen kaum noch Blitze nieder.“
Ich hoffte, daß er recht hatte; doch als wir ins Arbeitszimmer kamen, sahen wir hinter den Fenstern noch immer ferne Blitze zucken. Im Garten war ein junger Baum umgestürzt.
„Was für eine Nacht!“ sagte Kristins Vater. Wir setzten uns in die großen Ledersessel. Der milde Schein der Arbeitslampe auf dem Schreibtisch wirkte anheimelnd und beruhigend.
Professor Zetterlund brachte Decken, in die wir uns einwickelten, und ging dann in den Keller, um eine Flasche Sherry zu holen. Ich sah mich in seinem Arbeitszimmer um. Es war das erstemal, daß ich es betreten hatte. An den Wänden hingen große Fotos von Ausgrabungsstücken – alten Ringen und Spangen, Vasen und Münzen. Der Schreibtisch war unter einem Wust von Papier kaum noch zu sehen. Ich fragte mich, wie sich der Professor in dem Berg von Papieren, Büchern, Schriftstücken und Briefen zurechtfand.
„Immer noch die gleiche alte Schreibmaschine!“ sagte Kristin und deutete kopfschüttelnd auf ein Tischchen am Fenster. „Auf der hab ich schon herumgehackt, als ich noch ein Knirps war.“
Ihr Vater kam mit dem Sherry und drei Gläsern auf einem Tablett zurück, und sie fügte hinzu: „Daß du dir keine elektrische Schreibmaschine kaufst, Vater!“
Er suchte zwischen den Büchern und Papieren nach einem Platz, um das Tablett abzustellen. „Wieso? Das alte Ding da hilft mir beim Denken“, sagte er fast liebevoll.
„Was schreibst du denn gerade?“ fragte Kristin.
„Ein Buch über die Wikingerfunde in Gotland.“ Er ließ sich im Sessel hinter seinem Schreibtisch nieder, und wir tranken vom Sherry. „Das waren Ausgrabungen an einer uralten Siedlungsstätte. Wir haben bedeutende Funde gemacht.“ Er stockte. „Leider hatten wir Pech. Die kostbarsten Stücke sind gestohlen worden.“
„Gestohlen?“ wiederholte ich.
„Ja“, sagte der Professor. „Während der Ausgrabungsarbeiten hatten wir die wichtigsten Fundstücke im Raum einer Baubaracke verwahrt, der verschlossen und bewacht war. Eines Tages fanden wir den Wächter bewußtlos vor. Man hatte ihn niedergeschlagen, die Tür aufgebrochen und die Fundstücke gestohlen.“
„Toll! Was waren denn das für Sachen?“ fragte Kristin interessiert und goß sich ein zweites Glas Sherry ein.
„Oh, Spangen, Reife und Broschen aus Gold und Silber, mit farbigen Steinen und Perlen verziert, kleine Figuren, Amulette mit Runenzeichen, die man früher für zauberkräftig hielt – lauter wunderbare Dinge von unschätzbarem Wert.“ Professor Zetterlund seufzte. „Immerhin waren die Fundstücke schon fotografiert und registriert. Wir haben also wenigstens Bildmaterial davon. Der Raub ist damals durch alle skandinavischen Zeitungen gegangen.“
„Hat man den Dieb je gefunden?“ fragte Kristin.
Ihr Vater schüttelte den Kopf. „Nein, bis jetzt nicht. Vielleicht hat er im Auftrag eines leidenschaftlichen Sammlers gehandelt, wer weiß. Es wurde sogar vermutet, daß einer von uns – ich meine, ein Mitglied des Ausgrabungsteams – die Fundstücke an sich genommen hätte. Aber das ist natürlich barer Unsinn.“
„Hm“, sagte Kristin. „Archäologen sind auch bloß Menschen; was weiß man? Du hast das Zeug doch wohl nicht im Keller versteckt, wie?“
Sie grinste ihren Vater wie ein Kobold an. Der Professor fand wohl, daß seine Tochter manchmal einen etwas seltsamen Humor hatte, denn er lachte nicht.
„Was redest du da für dummes Zeug!“ sagte er ungewöhnlich scharf. „Laß mich das nie wieder hören, verstehst du! Natürlich weiß ich, daß du es nur im Spaß meinst, aber mit solchen Dingen scherzt man nicht, Kristin. Wenn jemand dich so reden hört! Du könntest mich in ernste Schwierigkeiten bringen!“
Kristin kicherte unbeeindruckt. „Ach, natürlich würde ich so was nie vor anderen Leuten sagen“, beteuerte sie. „Aber wer dich kennt, würde das von dir sowieso nie glauben, Vater. Trotzdem – ich finde, das Pfarrhaus wäre genau der richtige Ort, um einen Schatz zu verstecken. Mit dem Schweinepastor als Schatzwächter, das würde doch gut passen…“
„Was für ein Schweinepastor?“ fragte ihr armer Vater verdutzt.
„Der, der hier herumspukt“, sagte Kristin, als wäre das eine vollendete Tatsache.