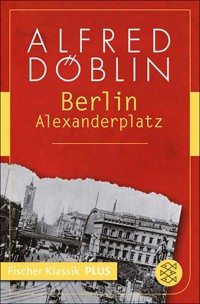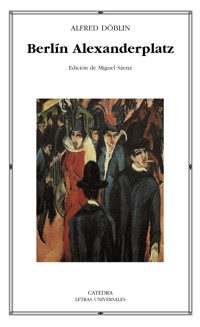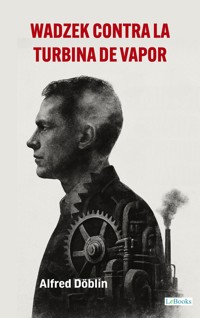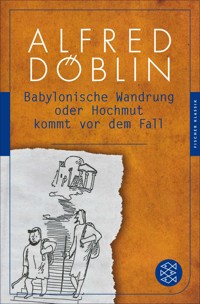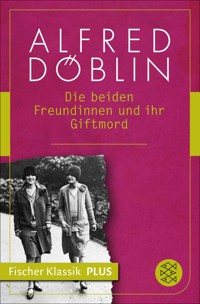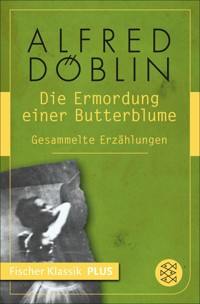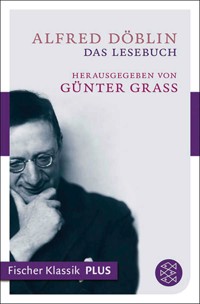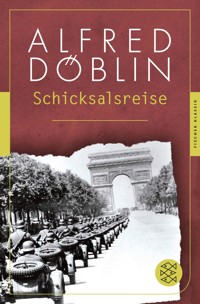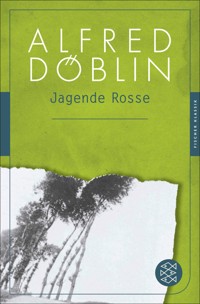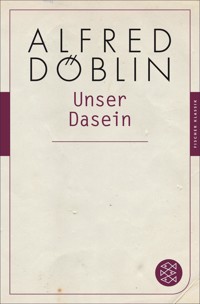
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Ein philosophischer Streifzug ›Unser Dasein‹, 1933 erschienen, war Döblins letztes in Deutschland publiziertes Buch vor dem Exil. Es wurde wie viele andere öffentlich verbrannt. Der leidenschaftliche Essay verbindet Anthropologie mit Naturphilosophie und Erkenntnistheorie und stellt die umfassende Frage nach dem menschlichen Leben im Ganzen: »Wie ich lebe, wer ich bin, was mit mir ist, was mit dem Leben ist, mit unserm Einzelleben, mit unserm Zusammenleben, mit unserm Zusammenleben mit der Erde und den Gestirnen und dem Weltall«. Mit einem Nachwort von Thomas Keil
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Alfred Döblin
Unser Dasein
Über dieses Buch
Döblins großer Essay über ›Unser Dasein‹ behauptet eine eigentümliche Stellung zwischen Philosophie, Naturwissenschaft, politischer Theorie und Literatur. In der Bewältigung ungeheurer Materialmengen schafft Döblin wie in seinen Romanen suggestive Bilder und stellt große anthropologische Fragen: Wie hängt der Mensch mit der Natur zusammen? Gibt es eine sich planmäßig entfaltende Ordnung oder ist alles dem Zufall überlassen? Gibt es für Leib und Seele eine einheitliche Basis? Wer bin ich? Was ist das Leben? Der Arzt Döblin weiß: Der Mensch hat einen Leib, er ist Organismus, und er ist bestimmt durch seine Lüste – aber der Mensch ist mehr als das: »Es ist das große wahre gestaltende Ich, von dem ich immer ausgehe, und dessen ganze Natur und Ausbreitung zu erkennen meine immer erneute Bemühung ist. Ich sehe immer klarer, daß ich und wie ich im Religiösen, und in welchem Religiösen, lagere, – mit der Welt und der Zeitlichkeit als einer Erscheinung.«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Alfred Döblin
Gesammelte Werke
Herausgegeben von Christina Althen
Bd. 11
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bilekjaeger
Unsere Adressen im Internet:
www.fischerverlage.de
www.fischer-klassik.de
www.alfreddoeblin.de
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403815-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorspruch
Erstes Buch Das ich und die Dingwelt
Auf der Wanderung
Die Ichsuche
Gesang des Spottvogels
Auf der Wanderung
Gesang des Spottvogels
Der Leib: irgendein Konzern
Lied, an den Fingern zu lutschen
Des Pudels Kern
Eine Hauptstation ist erreicht
Entzweiung
Blick hin, und du siehst Ich
Das Sprungbrett
Gesang des Spottvogels
Zwischenspiel Sommerliebe
Sommerliebe
Zweites Buch Das Gegenstück der NaturDie drei Eigentümlichkeiten des ich
Wie das Ich Gegenstück der Natur ist
Gotamo Buddhos andere Meinung
I.
Ich hat Sein
So ist mit dem Ich das Sein geboren
Hier geschieht Wahrheit
Trommeln des Zweifels
Ruhen im Ich?
Paukenschläge
Wir vergehen
II.
Es gibt nur ein einziges Ich
Die Zahl
Ich greife nach dem Spiegel und sehe – die Person
Ich, der Malermeister
Wer von uns beiden hat denn das Ich?
Drei Bittsteller
Im Namen aller Fehlgeburten
Ich, Seele, Leib
Principium individuationis
Die unvollständige Individuation
Der große Strom
Die eine Welt, der eine Leib, das eine Leben
Was bist du von Haus?
Das Individuum, ein Anlauf zur Ganzheit
Burleskes NachspielBrillenbestimmung am untauglichen Objekt
III.
Das Ich als Bauzentrum
Das Dasein als Handlung
Wovor das Fallgesetz zittert
Die Ding- oder Werkzeugwelt
Der Weckruf des Ich
Drittes Buch Aufschließung der WeltDie Natur
Die Person als offenes System
Erstes Hauptstück
Die Pflanze und der Nervmuskelmensch
Das Gehirn
Die Begrenzung der Tierflucht
Die Liebe bei den Pflanzen und Tieren
Die Pflanze als Boden der Tiere
Der Grashalm
Zweites Hauptstück
Die anorganische Welt
Zwischen Zelle und Kristall
Durchgriff des anorganischen Formprinzips im Organischen
Ergebnis für uns Menschen
Drittes Hauptstück
Von den Sternen
Größere Organismen?
Die großen Massengesetze in der Sternwelt
Die Gerinnung der Zeit
Viertes Hauptstück
Von den Elementarkräften
Die Wärme und die Gestalt der Körper
Ermittlungsverfahren gegen die Wärme
Nochmals Blick auf die Erde
Rolle der Wärme im Tier- und Pflanzenreich
Das Licht
Die Art des lichtgeborenen Lebens
Vom lebendigen Plasma und seiner Entstehung
Schöpfungstage
Die Entstehung der Arten in Naturkollektiven
Kein Summieren
Die Gliederung der Zeit
Von der Resonanz
Die Resonanz und das Du
Die Kräfte der Landschaft
Fortgang der Welt, aber wohin?
Viertes Buch Von Zeitlichkeit, Handeln und Leiden
Erster Teil
Was Handeln ist
Notiz über das Leiden
Menschliches, tierisches, pflanzliches, anorganisches Handeln
Die doppelte Bewegung in der Welt
Bewußtsein und Handeln
Der freie Wille
Instinkt und Bewußtsein
En-bloc-Denken
Der tierische und der menschliche Arbeitsprozeß
Kopfdenken und Realdenken
Das Realdenken und der Weltenbau
Der Geist kein Feind der Natur
Das Ich und der ›Geist‹
Das zweckvolle Handeln und die Kausalität
Zweiter Teil
Die Zeitlichkeit der Welt
Das wirkliche Dasein ist Gegenwart
Was steigt in das Becken des Jetzt?
Das Jetzt als Gericht
Jedes Ding hat seine Realzeit
Die Aufhebung der Zeit
Immer vor dem Gelobten Land
Der Fortschritt und die Unvollendung
Das ewig falsche ›Wozu‹ des Nervmuskelmenschen
Ablehnung eines buddhistischen Gedankens
Die Erbschaft und die Geschichte
Man soll nicht zuviel von Menschen verlangen
Der Tod, der rüstige Schläger
Von der Vollendung und Überhöhung
Fünftes Buch Von der Kunst
Die Kunst als Bewegung des unvollständigen Individuums
Die Förderung durch Kunst
Von den anorganischen Zeichen
Schönheit
Im Varieté
Die Saftströme
Kunst- und Naturwerk
Die Aufhebung der Zeit in der Kunst
Vom Spiel
Einzelnes zur Kunst
Die anorganischen Gesetze und die Musik
Von Musikgestalten
Von der Dichtung
Die Stoffe
Betrübliches Zwischenspiel
Erster Teil
Die Welt als Wahn und SchicksalBetrübliches über das Denken
Die Welt als Schicksal
Am Meer
In der Untergrundbahn
Der Riesenschatten
Als Ding unter Dingen
Die Welt als Wahn
Ein Rückfall!
Zweiter Teil
Die Wiederaufrichtung
Ich bin ein Etwas ohne Gewicht
Es ist ein Ich da, das hält alles zusammen
Geständnis
Gewaltig ist der Menschengeist
Das schlechte Ich ist ausgerottet
Nicht ›Ich‹, sondern ›dies begibt sich‹
Gesang des Spottvogels
Klage um das verlorene Ich
Das Ich dankt ab
Gesang des Spottvogels
Trauermarsch
NachrufFehlerhafter Fischzug oder die mißglückte Ichsuche
Fluch und Forderung
Aschenputtel
Weder Gott noch Welt, sondern der kleine Kerl
Die Person, Stück und Gegenstück der Natur
Sechstes Buch Von kleinen und großen Menschen
Die drei Zufluchten
Vom Glück des Nichtseins
Die Arten der Lüste und Schmerzen
Von allerhand Leuten
Die ›Natur‹ gibt es nicht
Dieses ist ein Café
Dämon oder Verstimmung?
War ihre Zeit erfüllt?
Vater und Sohn
Mißglückte MetamorphoseEin Schülerselbstmord
Das Mitgefühl als Resonanzerscheinung
Die Elemente in uns
Gotamo Buddho
Phantasien über Jesus
Übergang zum Kollektivum Von Herden und Individuen
Unstet und flüchtig
Organentwertung in der Herde
Der Herdenmensch
Vom Tierstaat und Menschenstaat
Paragenese beim Menschen
Siebentes Buch Wie lange noch, jüdisches Volk-Nichtvolk?
I.
Ihre GeschichteDie Not- und Dauerform des Übervolkes
Sie waren nicht immer wie heute
Vergeblicher Vorstoß von Jesus, Sieg des Talmud
Besitz und Kirche
Sie geben die Weltlichkeit auf
II.
Ihr ZustandDer simple Tatbestand
Geschichtliche Notizen
Die großen Aufbrüche
Ein ganzes Leben wird gefordert
Sie halten ihre Religion fest?
Die Rachitis des Exils
Inventuraufnahme
Achtes Buch Von abendländischen Völkern
I.
Laufe, mein Ich!
Moloch Öffentlichkeit
Das Ich ist kein Glassarg
Das Kollektivum ist kein Känguruh
Der Fluch der Arbeit
Öffentlichkeit
Menschliche Verarmung durch heutige Staatlichkeit
Einer liest Zeitung
Freiheit und Übersichtlichkeit in heutigen Staaten
Zur Freiheit
Grimm
Gewaltformen
Verfluchte Zeit
Krieg
Arbeiterlied
Tischlerlied
II.
Von der Diesseitigkeit
Realisieren und Irrealisieren
Roma aeterna
Der anthropologische Umschwung hinter der WirtschaftDer Kapitalist als Spieler mit Menschen
Auftreten eines Komikers
Rebellion der AtomeDer kommende anthropologische Umschwung
Die Maschine
Voller Weisheit, voller Weisheit
Nation und WirtschaftWie die Rebellion der menschlichen ›Atome‹ sich vorbereitet
Deutscher Kampf zwischen Staat und GesellschaftKampf der Atome im engeren Raum
Arbeiter, Angestellte, Intelligenzschicht
Nicht zuviel wollen!
Entscheidungen für heute
Sehr ferne Ziele
Von unserer Macht
Der Stern über dem Meer
Laßt mich den großen Himmel loben
Anhang
Editorische Notiz
Daten zu Leben und Werk
Nachwort
Entstehung und Veröffentlichung
Struktur und Inhalt
Quellen und Hintergründe
Eine philosophische Anthropologie
Literaturhinweise
1. Texte von Alfred Döblin
2. Texte über Alfred Döblin und sonstige Literatur
Gesammelte Werke im Taschenbuch
Vorspruch
Sie hören von Geschichten, aus den Zeitungen, Sie können nicht rasch genug ans Radio laufen, wenn es heißt: Achtung, Achtung, hier ist Berlin, wir bringen –
Wenn Sie Prozesse lesen, sind Sie glücklich: das ist die Wahrheit. Wenn Sie im Geographiebuch nachschlagen, falls es Ihnen in die Hand gerät, und Sie lesen von Städten oder Flüssen oder Meerestiefen und sehen die Linien der Festländer, so sind Sie befriedigt. Sie wissen, das ist die lautere Wahrheit und das stimmt.
Hier nun wird gedacht und betrachtet. Und da werden Sie sagen, was geht mich das an. Was ich denken muß, denke ich allein. Tatsachen sind nötig, Tatsachen, Berichte von der Realität, und weiter nichts, sonst kann uns nichts nützen.
Ich sage Ihnen, was vor Sie tritt, ist mehr Wahrheit als wenn Sie erfahren, ein Schiff ist untergegangen, und die Japaner rücken in der Mandschurei vor, oder der Kohlenpreis soll und wird, vielleicht, gewiß, möglich, unmöglich herab-, herauf-, herauf-, herabgesetzt werden.
Was Sie hier hören werden, hat größere Wahrheit als die Nachricht von der Trockenlegung der Zuidersee.
Es gibt geringe, größere und große Wahrheiten. Es gibt viertel, halbe und beinah ganze Wahrheiten. Denn ganze Wahrheiten – ob es die gibt – aber wir sprechen noch davon. Die Lampe brennt, das ist eine geringe Wahrheit. Daß ich lebe, eine größere. Wie ich lebe, wer ich bin, was mit mir ist, was mit dem Leben ist, mit unserm Einzelleben, mit unserm Zusammenleben, mit unserm Zusammenleben mit der Erde und den Gestirnen und dem Weltall, das sind größere und sehr große Fragen und, wenn es gute Antworten darauf gibt, größere und sehr große Wahrheiten.
Laßt uns die Lampe, den mandschurischen Krieg, den Kohlenpreis nicht vergessen und nicht geringschätzen, – es wird uns freuen, wenn der Krieg zu Ende ist und der Preis gefallen ist. Aber laßt uns über den unvollständigen kleinen Tatsachen nicht die großen umfassenden vergessen. Sie werden gefunden durch Denken.
Erstes BuchDas ich und die Dingwelt
Nur durch das Tor des Ich betritt man die Welt
Auf der Wanderung
Die Arbeit läßt einen los. Man geht allein durch sein Zimmer, blickt die Schränke an, die Bücher, den Tisch, die Stühle. Es ist sehr still im Haus. Da kann man sich am Tisch niederlassen. Der Blick irrt über die Tischplatte. Da ist nichts, was einen lockt. Briefe schiebt man beiseite. Auch keine Bücher. Es ist nicht ihre Zeit. Wessen Zeit ist eigentlich?
Die Dinge weichen von einem ab. Sie wollen angesehen sein. Man müßte nachdenken. Da ist auch ein Jemand, der will die Beine ausstrecken, will ausspannen – ich. Wofür ist eigentlich Zeit? Zu sich zu kommen. »Zu sich«, merkwürdiges Wort. Ja, ich will nachdenken. Da ist der Schreibtisch, die Tischlampe. Das Zimmer ist um mich. Die Dinge werden angerufen. Ein Fragen beginnt.
Unten fährt ein Lastwagen. Ein Auto tutet.
Ich. Ich. Ich denke nach, ich fühle nach. Was ist mit mir? Sonst sind Dinge und Handlungen um einen. Man muß sich herausziehen aus ihnen, um sie zu bemerken und um sich zu bemerken. Wer ist das, was hier fragt? Ich – ich bin ein Mann, von einem bestimmten Alter, dann und dann geboren, mit dieser Kindheit und dieser Schule. Diese Erfahrungen habe ich hinter mir, in allerhand Tätigkeiten habe ich mich getummelt, jetzt in dieser Stunde ist etwas Ruhe.
Aus diesen Tätigkeiten und Erfahrungen mußt du dich herausheben. Du tust dies, du tust das, in tausend Dinge wirst du zerrissen, es schmettert um dich ein Lärm, von Straßengeräuschen, von Schlagworten. Dieses Zimmer ist gut. Sitz ruhig und überdenke, wer du bist.
Ich? Ich bin vorhanden in all jenen Tätigkeiten, Arbeiten, Kämpfen, Auseinandersetzungen. Wer soll ich sein, wenn ich mich da heraushole? Du willst von mir mein Leben nehmen und fragst dann, wer ich bin. Eine Leiche, was sonst.
Du mußt mich nicht mißverstehen. Du weißt auch schon, was ich meine. Jetzt, wo es stille ist, weißt du gut, was ich meine. Du fühlst es. Du fühlst dich. Du willst dich fühlen. Du begehrst dich zu fühlen. Du merkst den Unterschied zwischen dir und jenen Tätigkeiten, Arbeiten, Kämpfen, Auseinandersetzungen. Du möchtest dich einmal von ihnen absetzen. Du sollst nicht abgelöst werden von ihnen. Aber damit du dich richtig siehst, damit du richtig gehst in den Tätigkeiten, Arbeiten, Auseinandersetzungen, darum bitte ich dich, setze dich und überdenke – dich. Bedenke, wer du bist, was du bist. Überdenke, was mit dir ist, mit diesem Menschen hier.
Nun gut. Ich kann es tun. Was soll ich sagen? Soll ich von meinem Leben erzählen, zu Gericht sitzen, wie man sagt?
Das wirst du eines Tages auch tun. Aber jetzt wollen wir von dir sprechen, von dir, so wie du bist. Ja, so wie du hier nun sitzest, endlich sitzest. Laß alle Vergangenheiten, was geleistet und verfehlt ist. Denk nur an dich, wer du bist. Vielleicht wird dann auch draußen vieles klarer. – Ja, wie denn? Wie soll ich mich ermitteln? – Du sitzt hier. Du sitzt auf dem Stuhl. Sag doch, wer bist du? – Ich? Ein Mensch, irgendein Mensch. Du siehst es ja.
Jetzt können wir anfangen.
Die Ichsuche
Ein erster Schritt ist jetzt getan, wir fangen eine Reise an. Wohin wir wandern, das weiß ich noch nicht. Wir werden an allen Ecken fragen, wohnt hier – Ich?
Drauf wird eine Frau zum Fenster heraussehen und sagen: »Wen meinen Sie damit? Ich kenne viele Leute, aber den Herrn kenne ich nicht. Können Sie vielleicht beschreiben, wie der Herr sieht aus? Gestern ist einer dagewesen, wie heißt er, vielleicht Stanislaus?« Bekümmert werden wir sagen: »Mit dem ist mir nicht gedient. Wir müssen weiterfahren. Bitte um Entschuldigung, wir haben Sie umsonst bemüht.«
An einem andern Orte steht der Schupo auf dem Platz, er ist von dem Magistrat da hingestellt, damit er auf die Wagen aufpaßt. Wir werden ihm uns nähern. »Guten Morgen, Herr Polizist, wir wollten von Ihnen hören, wohnt hier am Ort Ich?« »Ich? Na warten Sie mal, da drüben hat einer gewohnt, der hieß so ähnlich, jetzt ist der Mann aber tot.«Wir schütteln betrübt den Kopf: »Ach nein! Dann muß es eben woanders sein.«
Wir kaufen uns neue Stiefeln, der Schuster fragt, wohin es geht, und wie er erfährt, wir suchen das Ich, rät er, gleich noch sechs Paar zu kaufen, damit wir nicht barfuß laufen, denn er weiß, sagt er, seit langer Zeit, das Ich wohnt tausend Meilen weit. Wir sind darüber nicht sehr betroffen, wir sind noch tausend Meilen geloffen, wir fragten an allen Ecken die Menschen, in der Luft die Vögelein, an den Wagen die Eselein, die Uhus, die Katzen in der Nacht, wir haben uns keinen Weg erspart.
Und eines traurigen Sommerabends legen wir uns müde und hoffnungslos in den Graben. Wir klagen die Welt und das Schicksal an, bei dem Klagen wandelt der Schlaf uns an.
Und da im Schlafen kommt uns vor, es sagt uns einer die Wahrheit vor. Der weiß sie besser als Frau und Polizist, als Schuster und was da gewesen ist. Die Vöglein und Uhus, die sagen Geschwätz, aber die Wahrheit sagt man uns jetzt. Man sagt sie uns die ganze Nacht hindurch, wir liegen da, es wird uns nicht genug. Dann wachen wir auf und suchen und fragen, was der Mann im Schlaf uns denn bloß sagte. Eine ganze Nacht hat er es uns gesagt, weg war es, in die Luft gejagt. Die ganze Nacht war die Wahrheit erklungen, in Betrübnis sind wir hingesunken, wir weinten trostlos, und im Weinen wurde uns klar, was in der Nacht geheimnisvoll geredet war. Wir fühlten, die Tränen im Gesicht: in Träumen, im Weinen war Ich.
Gesang des Spottvogels
Ein Kerl, der spekuliert, ist wie ein Tier auf dürrer Heide, von einem bösen Geist herumgeführt, und ringsumher liegt schöne grüne Weide.
Auf der Wanderung
Man tummelt sich Jahrzehnt über Jahrzehnt unter den Menschen, in den Städten, durch die Landschaften. Immer sagt man ›Ich‹. Nun kann man wirklich einmal nachsehen, wer das ist. Ich – bin ein Mensch, ein zoologisches Exemplar, das ist deutlich. Ich – habe Hände, Finger mit Nägeln dran, die sind wie Klauen bei Tieren, habe Zähne im Mund. Ich – gehe zwar aufrecht, aber habe vier Gliedmaßen. Das ist genau wie bei einem Hund oder einer Katze. Ich – habe eine Stimme. Das ist wie bei den Vögeln. Auch die Löwen, Tiger und Affen haben Stimmen, damit brüllen sie und schreien, vielleicht verständigen sie sich auch damit. Ein Bauch, ein Darm – es stimmt, alles wie bei Tieren. Ich – bin ein Tier. Da ist weiter nichts zu sagen.
Weiter nichts? Doch. Es ist sonderbar. Ich wundere mich. Ich – wundere mich, daß ich – Tier bin.
Groß ist die Welt und voller Dinge, voller Tiere, Vögel und Menschen und Klänge, ich kann sie erleben und freue mich an ihr. Aber jetzt spreche ich nicht von ihr.
Ich sitze in einer geschlossenen Stube, vor mir ist ein Tisch, unter mir ein Stuhl. In diese Stube bin ich eingetreten. Die Welt, die habe ich draußen gelassen. Es ist etwas anderes da, damit muß ich mich befassen.
Was ist das andere? Wie sieht es aus? Ist es denn schön, hat es langes Haar, kann es lachen, lieb sein und umschlingen? Schließt du dich ein, um mit ihm die Zeit zu verbringen?
Ach, wenn du in dies Zimmer eintrittst, vernimmst du Liebesgeflüster nicht. Hier sitzt einer still auf dem Stuhl für sich. Hier könnte einer lachen und denkt an sich.
Er ist ein Narr, man kann nichts mit ihm machen. Er denkt und fragt und fragt und denkt, und während er denkt, wird die Welt weiterlaufen, und wenn er heraustritt, wird keiner von ihm etwas kaufen, und keiner nimmt von ihm etwas geschenkt.
Die draußen haben ja so vieles, was in keine Stube geht und was sich Tag um Tag bunt und lustig weiterdreht. Sie haben Berge, Täler, Ebenen und Seen, in der Stube kann man grade zehn Schritte gehen. Was kann in dieser Stube geschehen?
Ja, es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es gibt Morgen und Abend, Mittag und Nacht, es gibt Jugend und Alter, Musik und Geschrei. Der hier sitzt, denkt aber nur einerlei – wie er dies alles in der Welt liebt und verehrt, wie er glücklich ist, daß ihm dies ist beschert, wie er sich von keinem Ding abkehrt – wie er aber in seiner Stube ist einem Wesen begegnet, einem Tier mit Nägeln, Knochen und Zähnen, mit Augen und Ohren, Muskeln und Sehnen. Das sitzt auf einem Stuhl mit ihm, und wenn er es fragt, wie es heißt, sagt es dreist: Ich.
Von diesem Tier, diesem Untier, Übertier will er jetzt nicht lassen. Er will es nicht lassen, bis es ihn gesegnet und ihm gesagt hat, wie es wirklich heißt und wer es ist. Er fühlt, daß ihm nichts Wichtigeres gegeben ist.
Gesang des Spottvogels
Ein Kerl, der spekuliert, zwei Kerls, die spekulieren, drei Kerle, die spekulieren.
Der Leib: irgendein Konzern
Diese Hand, diese Finger. Ein Tier. Merkwürdig: daß man Tier ist, haben die Kirchenväter immer bejammert. Sie meinten damit die Sünde, Tier sei Sünde, Begierde, Kampf zwischen Engel und Satan. Das meine ich nicht.
Daß ich Finger, Hände, Arme habe, und was das ist, und wie ich dazu komme – das meine ich. Ich sitze hier und finde mich als Tier, als Eigentümer eines Tierkörpers. Geld muß man erwerben, dies aber kommt einem angeflogen, und man soll es verstehen. Man kommt für nichts und wieder nichts so an, aus der Pistole geschossen, hat Arme, Beine, einen Kopf und kann sprechen. Ebensogut hätte man auch bellen können und könnte Hund sein. Warum schließlich auch nicht. Es ist ein reiner Zufall, daß ich da bin, auf dem Stuhl sitze und schreibe, und der Hund läuft da unten an der Ecke neben seinem Frauchen. Ebensogut könnte er hier oben sitzen, auf dem Stuhl, und schreiben, und ich lauf an der Leine. Wär gar nicht so schlecht. Dem Hund gönne ich es jedenfalls, daß er auch mal hier sitzt und denkt.
Wie ist das kurios, in welchem Zustand ich bin. Wenn einer eben Bettler war und nachher wird er auf irgendwelche Weise, durch phantastische Siege oder Volksreden, Kaiser oder Volkskommissar oder Bankdirektor, so kann er sich damit, wenn auch verblüfft, abfinden. Was mit mir ist, ist beispiellos. Ich bin vor eine vollendete Tatsache gestellt.
Was hat man da alles bei sich. Was man so mit sich herumträgt. Man nimmt es kaum wahr. Man sieht in den Spiegel, rasiert sich, so und so sehe ›ich‹ aus, nicht grade schön, man muß es hinnehmen. Oben wachsen einem die Haare, als sei man ein Berg mit Bäumen, oder ein Grasfeld, das immer abgemäht werden muß – auf zum Barbier, ich bin reif zur Ernte, gern mein Herr, wir werden sofort landwirtschaftliche Hilfskräfte engagieren.
Was habe ich für einen Weggesellen. Ein ›Männchen‹ bin ich auch, ein Mann. Im zoologischen Garten stecke ich nicht. Noch nicht. Von meiner Tierart gibt’s zu viele.
Es ist fabelhaft, womit dieser Apparat versehen ist. Es ist eine ganze Fabrik, eine Überfabrik, ein Brutschrank, ein Automat, eine Serie von Automaten, ein Konzern. In was für eine Gesellschaft bin ich geraten. Gott weiß, was man hier mit mir vorhat. Es ist ja ungeheuer. Was reden die Heiligen und Moralen, was ich alles in diesem Leben tun und meiden soll? Man sehe an, in welche Gesellschaft ich gesteckt bin, lebenslänglich, und was einer da noch machen kann. Hier kann man überhaupt nichts mehr tun, hier ist man mit Sack und Pack verkauft.
Dies hier ist eine ganze Festung gegen einen einzelnen Mann. Wie ist das gemacht, Arme, Beine, Lungen, tausend Organe, für alle Zwischenfälle, das ist die schlaue raffinierte Arbeit von Jahrmillionen, und da bin nun ›ich‹ hineingesetzt, ich, sprich i, ceha, Gott weiß wozu, als Betriebsingenieur oder Zuschauer, vielleicht um die großartige Leistung zu bewundern und Besucher drin herumzuführen, oder um die Natur zu preisen, die das alles gekonnt hat.
Ja, solch phantastisches Tier ist da – und – sitzt mit mir hier auf dem Stuhl. Wir sitzen und gehen immer zusammen. Die siamesischen Zwillinge sind nichts gegen uns.
Aber ich bin kein siamesischer Zwilling! Ich erkenne dieses Tier hier, das mit mir so greulich nah auf einem Stuhl sitzt, nicht an. Was soll mir diese fremdartige, tolle, aus der Pistole geschossene, mir zugeschneite Einrichtung, welche ein zoologisches Einzelexemplar ist, dieses verzwickte Arrangement von Kopf, Brust, Armen, Beinen und Gelenken?
Fremd ist mir dieses wüste Durcheinander von Organen, von Augen, Ohren, Nase, Mund, Gehirnwindungen, Leberzellen, Bauchspeicheldrüse, zwischen Plattenepithel, Flimmerepithel, Hornhaut, Netzhaut, Ohrtrompete, zwischen Magensäure und Darmalkalien, Blutzucker, Knochenkalk, glatter und gestreifter Muskulatur, zwischen Arterien, Venen und Haargefäßen, zwischen Lymphräumen und Lymphdrüsen, bei wechselnder Temperatur an der Haut, unter der Haut, im Blut, bei den Verbrennungsprozessen in den Organen.
Lied, an den Fingern zu lutschen
Murr murr murr murr.
Da sitze ich im Stübele und stütze meinen Kopf, und grübele und grübele und bin ein armer Tropf.
Da sitz ich in mei’m Stübele und spiel mit runde Stein. Ich roll sie hin, ich roll sie her, das ist ein Spiel für mein.
Von einer Hand in andere Hand hin läuft das Kügelchen. Ich sitze immer stille da und mach mein Grübelchen.
Murr murr murr murr.
Des Pudels Kern
Ich weiß nichts von gelehrten Dingen! Ich weiß nichts von einer Fabrik, die mich produziert, nichts von glatter oder gestreifter Muskulatur, von Säuren und Alkalien im Darmkanal. Wenn die Natur oder wer sonst das alles produziert, so ist das ihre Sache. Ich habe immer gewußt, es ist etwas Großartiges um die Natur. Da kommt keiner mit. Wenn man ein Geographiebuch aufmacht, so ist es dasselbe. Es ist nicht durchzukommen zwischen den Bergen, Flüssen, Meeren, Höhen, Tiefen. Überall auf der Erde ist was, und nicht bloß geographisch, auch botanisch, zoologisch, physikalisch, chemisch, meteorologisch, dann soziologisch, biographisch, telegraphisch, telephonisch. Bald ist es laut, bald ist es leise, es ist ein phantastischer Rummel. Zum Überfluß verändert sich alles, wenn auch nicht geographisch, in jeder Minute. Ben Akiba meinte, es sei alles schon dagewesen. Ich finde: es ist in der Natur alles immer wieder anders. Es ist anderer Wind. Ein Mensch, der heute da war, ist morgen da. Ein Land ist heute Kaiserreich, morgen Republik – ein anderes ist Republik, morgen Kaiserreich – und eins wieder war Kaiserreich, wird dann Republik, bleibt aber doch Kaiserreich. Kurz, es ist so ungeheuer, was in der Natur vorgeht, so mannigfaltig, daß, wenn man leben will, man es am besten auf sich beruhen läßt. Ich jedenfalls, ich – sehe das alles nur an, erlebe es, aber bin es nicht.
Und wenn man mich fragt, wer bin ich denn, so antworte ich: ich bin der, der dies alles erlebt. Ich lebe und erlebe. Ich erlebe auch diesen Körper. Was ich antworte, ist so einfach, daß der Chor aller Menschen, der jungen und alten, schmalen, schlanken, dicken, frommen und gottlosen, schlauen und dummen, der Männer und Frauen aller Bildungs- und Steuerstufen mit einstimmt:
»Ich« – sehe, höre, schmecke, rieche, taste, ich fühle, will, denke.
So bin Ich, das ist alles.
Einfach. Erschütternd einfach. Vielleicht zu einfach? Mir fällt eine Geschichte ein, von einem Versicherungsbeamten, der an einer hohen Stelle in einer Versicherung saß, und es ging ihm schlecht, und er sollte abgebaut werden. Dem Mann liefen täglich hohe Versicherungen durch die Hände, gegen Feuer, Einbruch, Ausbruch, Durchbruch, Abbruch, gegen jede Art Bruch, auch können Sie Ihrem Sohn Studiengelder beschaffen, Ihrer Tochter eine Aussteuer, Ihrer Witwe können Sie schon zu Ihren Lebzeiten Ihren Tod wünschenswert erscheinen lassen, durch Sterbegeld. Wie aber, fragt der Mann, schütze ich – vom Abbau bedroht – mich selber, wo alles und sogar meine Frau gegen mich geschützt wird? Ich schütze, und wer mich? Wer kann von mir verlangen, daß ich andere schützte? Wer mutet mir das zu? Es achtet sich keiner miß, jeder hochachtet sich.
Úm sich zú legítimíeren vór sich sélbst und vór der Wélt/gríff Versícherúngsbeámter ín dem Géldschrank án das Géld.
Auf, líeber Versícherungsbeámter, nótwéhre dích/es géht um Seín und um Níchtsein. Greif zú und veréhre dich.
Und Versícherungsbeámter tát das Eínfachsté der Wélt/únd er büßte ím Gefängnis für das rásch erwórbene Géld.
Was lehrreich an dem Fall ist: Einfach war das Mittel, aber nur auf den ersten Blick. Wichtige Dinge fordern mindestens zwei Blicke.
Wie steht es um die einfache, so einfache Antwort: Ich bin da – im Empfinden, Fühlen, Denken, Wollen? Diese Antwort ist einfach, und – dennoch richtig! Und wenn der Chor der Jungen und Alten, Schlanken und Fetten, Reichen und Armen zustimmt, so bin ich und bleibe dabei.
Ja, ich bin nicht in der wüsten Natur da. Ich bin nicht in dem wüsten mannigfaltigen, verwickelten Körper, dieser tollen Fabrik, da.
Ich bin nicht in den höchst verwickelten Augen da. Die Augen empfinde ich wie andres. Da bin ich unmittelbar – im Sehen! Im einfachen glatten Sehen bin Ich, habe ich mich. Als Sehender bin ich da.
Ich bin nicht in der Apparatur der Ohren da – die Ohren empfinde und bestaune ich ob ihrer Kunstfertigkeit mit Außenohr, Trommelfell und Labyrinth. Da aber bin ich unmittelbar – im Hören! Als Hörender bin ich da.
Ich bin nicht im Gaumen, in der Zunge da, sondern – im Schmecken! Und nicht in den Fingern, in der Haut, sondern im Tasten.
Ich bin nicht im Herz, in den großen und kleinen Blutgefäßen, nicht in dem phantastischen Geflecht des Sympathikus, im Rückenmark, in der abenteuerlichen Architektonik der Gehirnwindungen und Nervenfasern –, ich bin – im Denken, Fühlen, Wollen! Als Denkender, Fühlender, Wollender bin ich da. Ich erlebe. Als Erlebender bin ich da.
Im Empfinden, Fühlen, Denken, Wollen – fühlend, wollend, denkend, empfindend –, so begibt sich das Ich.
Zuerst bin ich ein Mann gewesen, habe dies gesehn und das getan, ich habe vieles gehört und manches erfahren. Dann bin ich langsam die Treppe hinaufgegangen, habe die Tür hinter mir zugemacht. Und wie ich im Zimmer saß und mich nichts störte, wie kein Telephon ging und ich dasaß, da habe ich zu den Dingen um mich und zu mir gesagt: Macht die Augen auf, laßt euch anblicken, es ist eine stille Stunde, wer weiß, wann sie wiederkommt. Wir wollen uns freuen, daß wir uns treffen. Wir wollen uns die Hände geben und eine Weile sitzen. Eure Hände in meine gelegt, so wollen wir denken und uns besinnen. Viele Dinge bringen Freude und Genuß, und viele bringen uns Verdruß. Wir wollen sitzen in Ruhe und Klarheit. Wir sehn uns an. Wir wollen Wahrheit.
Eine Hauptstation ist erreicht
Diese Station, die sagt: »Ich bin der, der erlebt«, ist eine Hauptstation. Wir merken es an dem Wohlgefühl des Atmens. Es können höhere Gipfel kommen, aber hier ist ein Gipfel.
Entzweiung
Ich bin der, der erlebt – Ich bin das, was erlebt – Ich ist die Unmittelbarkeit des Erlebens, das haben wir jetzt und halten es fest. Ich frage mich aber: geschieht mir nicht da etwas Gräßliches, werde ich nicht so meiner Person beraubt, enthauptet, entleibt, von aller Welt abgetrennt, schwebe ich jetzt nicht wie eine ferne Wolke über dem Dasein, ich, weder Welt noch dieser Körper, sondern nur – welche leeren, dünnen Worte – das Erleben, die Unmittelbarkeit des Erlebens? Dann fällt ja die ganze große bunte Mannigfaltigkeit der Welt auf das, was ich von mir – wie leichtsinnig – abgewälzt habe, und ich bin nichts, ich ›erlebe‹, aber was ist das, das ist eine Kerze, ein Licht, das auf die Welt fällt, nicht mehr, aber ich will, ich muß mehr sein, ich bin doch mehr! Ich fühle, ich leide, ich bewege, ich handele! Wie komme ›ich‹ an diese große, bunte, mannigfaltige Welt heran?
Laß mich denken, alles ruhig überdenken. Es soll alles zu seinem Recht kommen, nichts will ich außer acht lassen. Ihr seid gute Dinge, ihr Dinge im Zimmer um mich, du Stuhl unter mir hältst ruhig und trägst mich geduldig, du Tisch trägst meine Arme und Hände. Ihr wartet alle und beschleunigt nichts, ich sehe gern auf euch, ich nehme von eurer tiefen inneren Geduld an.
Ich bin Erleben, ich bin der, der erlebt – aber wie ist das? Was erlebe ich denn? Die Welt, dies Zimmer, den Stuhl, den Schreibtisch, die Lampe und meinen Körper. Daß ich jetzt aufstehe, herumgehe und zum Beweis meines Daseins einen Stuhl hochhebe, erlebe ich. Daß ich die Arme strecke und beuge, zustoße und die Faust balle, erlebe ich. Außer diesem Erleben habe ich keins. Außerhalb dieses Erlebens aber weiß ich auch von keinem Ich.
Auch meinen Leib – muß ich hinzunehmen. Ob ich seine Zellen, Drüsen, Muskeln, Knochen kenne, macht nichts aus. Auch ihn muß ich wieder zu mir herziehen. Nur in dieser bestimmten Realität, in den festen starken Dingen und Vorgängen habe ich mich. Ich bin keine Form, bloß Zuschauer, Wolke über diesem Dasein, ich bin keine bloße Kerze und kein bloßes Licht zu den Vorgängen der Welt, ich stecke hier selbst drin in der dichten starken Mannigfaltigkeit des Daseins. Und dafür gibt es noch einen besonderen Beweis: ich fühle, leide und handle in diesem Dasein, ich erfahre und verändere es.
In den Muskelbewegungen, in den Hautgefühlen, im Luftholen der Lunge, im Kopf bewegen bin ich, – im Augenöffnen und Augenschließen, im Sitzen auf dem Stuhl, im Gehen durch das Zimmer, im Gegenüber zu den Büchern, zum Schrank, zum Fenster, zu den stillen Dingen hier im Raum. Ich bin etwas unter diesen Dingen. Ob ich mich auch bewege und sie ruhen, das macht nichts aus; ich gehöre zu ihnen, ich bewege sie, ich vernichte rauchend meine Zigarette, ich bin etwas wie sie.
Das wäre nun meine Wiedervereinung mit der Welt. Es ist aber eine Vereinung besonderer Art! Sie – vernichtet die erste Trennung nicht! Ich kann, obwohl so vereint, nicht abschwören und aus der Welt schaffen, was ich vorher gefunden habe: ich bin der, der erlebt. Was ist das, wie ist das möglich, welche Beängstigung befällt mich. Es kann doch nicht beides wahr sein: ich in den Dingen, Ding unter Dingen, und ich das Erleben über den Dingen?
Es muß wahr sein, das Unglaubliche muß wahr sein, beides muß zusammengehen.
Es gibt ein merkwürdiges, ausgezeichnetes Ding unter den Dingen dieser Welt. Dies Ding nun erlebe ich besonders.
Ein fleischernes, geformtes Ding mit diesem bestimmten bürgerlichen Namen, in diesem Zimmer hier, von dieser Größe, diesem Gewicht, das ist es, was erlebt. Der Körper, diese Person, selbst ein Stück der großen Dingwelt, sie bindet, ich weiß noch nicht wie, an sich jenes ›Erleben‹, von dem ich sprach und das grade die Eigentümlichkeit besaß, sich der Dingwelt entgegenzustellen, um sie zu erleben. Wie geschieht das? Und wenn es mir im ersten Augenblick unmöglich erscheint, diese Frage zu beantworten, es ist nur im ersten Augenblick. Im zweiten ahne ich etwas. Und im dritten fasse ich zu und habe beinah, vielleicht ganz, die Antwort.
Denn wenn ich hinblicke auf den Körper hier auf dem Stuhl – dann habe ich da wohl einen Körper vor mir, aber was für einen, sieh es doch an, den lebenden Organismus, den Leib, eine Gestalt. Wie der Organismus sich bewegt und dasteht, mit empfindender Haut, mit Augen, Ohren, mit Armen, Beinen, fühlfähig, erregbar, bewegungsfähig, angriffslustig, ist er, diese Gestalt, diese wunderbar zauberhafte Formung, fähig, das Unfaßbare, die Unglaublichkeit, einen Widerspruch zu verwirklichen. Denn dieser Körper ist Gestalt, kein bloßes Ding. Er ist geformt, aufs eigentümlichste, verwickeltste, ich nannte ihn eine Fabrik, einen Konzern. Er ißt und trinkt, das blickt, hört, geht, das steht, hungert, ja das fühlt auch, denkt – siehe, was das alles in eins ist. Du siehst es auch, du siehst Augen, Ohren, Hände, Füße. Dieses ist ein Organismus! Und dies bist – Du!
Was das bedeutet? Wir werden uns, solange wir denken, damit zu beschäftigen haben. Ich werde alle Bücher dieses Werks dazu gebrauchen, um die Spannung, die in dem Widerspruch steckt, auf vielen Stufen der Natur vorzustellen. Ich erkenne sofort eins: Das Erleben, das Ich ist jene Kraft, die hier im Leib ein Instrument hat und die sich des Leibes bedient. Das Erleben, das Ich ist ein Instrument oder Organ der Natur selber, ein allerwichtigster Konstruktionsteil an ihr. Auf diese Weise trägt sich die Natur, die Welt überhaupt weiter.
Die Welt ruht nicht, sie läuft ab, aber es findet sich eine lebendige Umschaltung, über die alles läuft. Diese Umschlagstelle heißt ›Erleben‹ und ›Ich‹.
Erleben und die Ding- und Gestaltungswelt sind nicht auseinanderzureißen. Wir kommen aber mit dem Ich zu keiner Überwelt. Wir bleiben im innerweltlichen Raum.
Daraus, daß man den Widerspruch, der die Spannung und die Kraft des Lebens stellt, das Unfaßbare, Unglaubliche, nicht beläßt, sondern aufzulösen versucht, kommt viel Mißverständnis und denkerische Qual. Bald von dem isolierten einen Punkt, bald von dem anderen isolierten glaubt man die Welt glatt und einwandfrei logisch verstehen zu können. In der Spannung des Widerspruchs läuft unser Leben ab.
Blick hin, und du siehst Ich
Nun enthüllt sich der Konzern, der wüste, die Überfabrik, ›Leib‹ genannt. Der Konzern ist entlarvt als – Organismus. Versteh es gut, verstehe die immer gesehene Klugheit, das Sinnvolle, Tiefsinnige des Leibs, verstehe Mensch, Tier, Pflanze, Kristall. ›Ich‹ stellt sich dar. Hier, mit Augen und Ohren und allen Organen, in allen Organen stellt sich Ich als Gegenstand unter die Gegenstände. Es hat keinen dicken Mantel um sich gezogen und bedient sich keiner fremden Stoffe – von dem Ich ist ja hier die Rede und wie hier das Gegenstück der Welt sich in einem Stück Welt zeigt, und das treibt keine Maskerade. Mit suchenden Augen und horchenden Ohren, greifenden Armen, laufenden Beinen ist es da. So stellt es sich hin – und zeigt klar, was es ist. Es ist auf sichtbare, tastbare, hörbare Weise Ich. Jetzt sehe ich den Körper, die Person und sehe die Person erst richtig und fasse, was sie, ist. Dieser Körper ist ein Organismus. Was habe ich im Beginn gelacht über den Konzern, die Überfabrik, das fremde schwere Ding aus Knochen, Muskeln, Nerven und Blutflüssigkeit, das da mit mir auf dem Stuhl sitzt. Jetzt sehe ich, was dieses Ding ist: etwas, das erleben, leiden und erfahren kann, das aber auch eine Formung, ein Gebilde ist, das von innen heraus dieser Welt sich entgegenstellt. Dies beides ist und dies beides heißt: Organismus – greifbare Leiblichkeit, dinglicher Widerstand, in einer Formung. Träger des Fühlens, Denkens, Wollens, Begehrens ist dieses Gebilde, der Leib; ein Werkzeugträger des Ich ist dieser Leib. Hier baut sich festlich ein Organismus auf und gibt einer Formung das Dasein, mit greifenden Händen und Fingern, mit begehrlichen Armen und Muskeln, die bewegen, beseitigen, zertrümmern und an sich reißen können. Es blickt um sich, es hört um sich, die Welt, ein Weltumkreis ist sein Feld, es beherrscht den Umkreis, will ihn beherrschen, und der Umkreis drängt auch auf ihn zu. Diese sind nicht zwei, das Zentrum, die Person, und ihr Umkreis. Du siehst, wie sie zusammengehören: an den greifenden Händen und Fingern der Person, an ihren begehrlichen Armen, den Muskeln, die bewegen, zertrümmern und an sich reißen können. Sie lassen sich nicht auseinanderschneiden, die Person und ihr Umkreis, das siehst du schon an der Person, denn was an ihr ist, ist für den Umkreis und mit dem Umkreis. Es gibt da keine Absonderung und Einsamkeit. Es sind nicht nur die Arme, Hände, Beine, die wie Wurzeln in diese Umgebung tauchen, die Augen, Ohren, die wie Saugnäpfe an ihr liegen – welche Enge der Verbindung ist das, was ist das für ein gefräßiges parasitäres Wesen, was ist das für eine rasende, schwingende, pumpende Verkoppelung, wie ist hier alles auf Aktion und Verwandlung eingestellt!
Ich erlebe mich eingesetzt, eingefügt in diese Welt. Es wird klar, warum alles perspektivisch um diese leibliche Person gelagert ist. Das Urfaktum der Leiblichkeit beginnt sich zu klären. Es soll ›erlebt‹ werden. Und das erfolgt durch die Verleiblichung. Leib und Leben, erleiben und erleben gehören zusammen.
In die ganze blutwarme, blutgetränkte, unkenntliche Realität dieser ›Umwelt‹ sind wir hineingeboren, nehmen sie mit unserem Ich an uns, suchen sie zu durchdringen, kämpfen dagegen, erliegen. Das ist unser Dasein, Dasein unseres Ich.
So – bin Ich real da, großartig und – nichtig, ein Stück der Welt und Motor-Gegenstück der Welt. Das ist ein Grundriß dieser Welt.
Ich kehre aufatmend zum Anfang zurück. Der Anfang bleibt wirklich, plötzlich, eigentümlich, wahr: »Wer bin ich, wo bin ich? – Diese Hand, diese Finger, diese Augen, das Ganze, was hier auf dem Stuhl sitzt und von dem ich jetzt nur die beiden Hände und die halben Arme sehe.« Es ist meine, meine, meine Hand: so sage ich jetzt und nehme es an. Wie es mich durchschauert. Ich atme, ich fühle dunkel, undeutlich mein Inneres, es geht eine kühlere Empfindung über meinen Rücken, meine Füße stehen auf dem Boden. Das bin Ich.
Zurückgeworfen, zurückgegangen also auf das Tier, wieder ein einzelner bestimmter Mensch zwischen Kämpfen, Arbeiten, Tätigkeiten, Auseinandersetzungen? Und weiter nichts, nach dem langen, langen Weg?
Also doch Mensch, Erdenwurm?
Und warum, liebes Ich, das dies denkt, warum erscheint das dir plötzlich nicht als Erbärmlichkeit, als Erfolg eines lächerlichen Weges? Warum hältst du plötzlich dies für ein Ding von der größten, allergrößten Wichtigkeit?
Vor mir steht die volle Wahrheit: Die Entzweiung in der Welt, sichtbar geworden in der zwiefachen Gestalt der Person als Stück und Gegenstück der Welt. Die Person zeigt deutlich diese Doppelnatur als Gebilde, das ganz aus der Natur hervorwächst, aus Tier- und Pflanzenwelt, und mit ihnen verbunden bleibt, und als Erlebnis-, Arbeits-, Einschmelzungs-, Umbildungsapparat.
Es findet eine Hin- und Herbewegung zwischen Person und Welt statt, so kann sie stattfinden. In dieser Hin- und Herbewegung wird die Welt gebaut. Diese Bautätigkeit kommt nicht zum Stillstand, solange die Person lebt. Ein Spannungsablauf erfolgt dauernd, und so geht Erlebtes, also Ich über das Medium und aus der Apparatur der Person in Welt, Natur, Geschichte über, und es schwingt Welt, Natur, Geschichte in die Person und das Ich zurück.
Das ist die ununterbrochene kämpferische, ringende Erschließung der ›Welt‹ durch die ›Person‹, den Fühl- und Aktionskörper, und die ständige Durchtränkung der ›Person‹ mit ›Welt‹.
Immer wieder wird der Mensch von Erde zu Erde, immer wieder wird die Erde von Mensch zu Mensch.
Das Sprungbrett
Die Formeln ›Ich und Dingwelt‹ und ›die Person ist Stück und Gegenstück der Natur‹ halten wir fest. Auf diesen beiden Pfeilern, Erleben und Gestalt, ruht unser Dasein. Wir blicken uns um und fragen:
Wie sieht dieser Spannungsaustausch, das Kraftfeld, das Forttreiben zwischen Person und Welt aus – was zeigt diese Welt, in der und mit der wir leben und die auch durch uns lebt? Tiere, Pflanzen, Steine, Sterne, Naturkräfte sind da, wir sind Stück der Natur: Wie sind wir und sie alle Stück der Natur, und wie Gegenstück?
Mit diesen Fragen begeben wir uns auf die wahrhafte, umfassende, vollständige Ichsuche, die eine Weltsuche wird.
(Wir haben nach dem fünften Buch ein ›Betrübliches Zwischenspiel‹, das noch einmal die Fragen des ersten Buches aufrollt. Man greife nach dem Teil ›Die Wiederaufrichtung‹.)
Gesang des Spottvogels
verliert sich.
ZwischenspielSommerliebe
Noch einmal:
Nur durch das Tor des Ich betritt man die Welt
Sommerliebe
Es wurde nun stille. Es lag völlig süße Verzückung im Raum. Die Musik sang, die Trompete sang, die Menschen sangen. Sie machten Bewegungen, gleitende, waren aneinandergepreßt, und die Musik ging mit ihnen, die Knie bogen sich, der Fuß setzte sich vor, zurück, der Leib kam nach. Die Klarinette blies, oben stand der Kapellmeister mit dem Saxophon, sah herunter in die Rundung, die drehende. Lautloses Drehen, lautloses Gleiten der Schatten. Jetzt Scharren, vorwärts, rückwärts, süße Kinder, ihr Kinn über seiner Schulter. Und jetzt schmetternder Jazz.
Schwarzes Wuschelhaar an dem Tisch, sie steht auf, Puderdose, Blick in den Spiegel, die Kaffeetasse steht allein, die Handtasche liegt auf dem Stuhl. Sie ist in das Flackerlicht eingetaucht, von der Rundung eingesogen, das Klavier rasselt, Arm über seiner Schulter, gezogen, gewogen, die Musik singt, die Trompete singt. Schluß, auseinander, schon, schon, eine kleine Sehnsucht, ein bißchen Sonnenschein.
Und schon sitzen sie wieder um den Tisch herum, Puderquaste auf der Nase, über die Stirn. Ein älteres Fräulein hat Überschuh im Ausverkauf gekauft, sie packt aus, sie debattieren, drehen die Schuh. Ein gemütlicher Herr liest die Mittagszeitung, Garderobenständer mit Hüten und Mänteln stehen herum, es gibt keine Musik, ist alles aufgelöst, rinnt auseinander. Die Kaffeekannen sind Silberersatz. Licht und Zigarettenrauch in der Luft.
Ein langer junger Herr mit Hornbrille, er geht an den Tisch, er senkt den Kopf ein bißchen vor dem schwarzen Wuschelhaar, sie ändert den Ausdruck nicht, steht auf, er geht hinter ihr, bedenkt sein Geschick, dann fragt er nicht mehr, sie sind im Kreis des Geschehens, des Drehens und Scharrens und Gehens. Gleiten der Schatten, lautlos Drehen. Die Musik dumpft, wühlt, befiehlt, das Tamtam schmettert, die Töne steigen und fallen, die langen schmachtenden Töne, Hand in Hand, warme Hand, du folgst, du fühlst die Schenkel, du bist gut aufgehoben, es tut dir keiner was, und alle tun ebenso wie du. Ein Raum mit trinkenden Menschen ist da, und sie blicken auf dich, und du kannst die Augen schließen, Äuglein schließen, Äuglein schließen, Schritt vor, Schritt zur Seite, was summt und summt das Saxophon.
Und dunkel singt ein Mann: »Eine kleine Sehnsucht, ein bißchen Sonnenschein, eine Sehnsucht, die sich niemals erfüllt.« Das Klavier dumpft, das Tamtam klirrt, und jetzt ist bloß noch das Klavier da, und ist aus. Die Hände lassen los, warme Hände, schwere Hände, allein, die Gesichter sind ganz sachlich. Sie geht an den Tisch, sie senken einmal kurz die Köpfe, sie ist so jung, dann spricht sie mit dem älteren Fräulein wieder über die Schuhe. Die Kavaliere zahlen schon. Der Kapellmeister trinkt Bier. Sie geht.
Sie hat ein schwarzes Käppchen auf, ihr dünnes Gesichtchen lächelt an der Tür zurück, sie sehen ihre hellen Strümpfe, ihre Rundungen, sie trägt ein viereckiges Köfferchen. Wo geht sie hin, denken die am Tisch vor der Speisekarte.
Es gibt merkwürdige Zufälle. Da ist mir das Bild in Erinnerung geblieben von dem Raum, in dem sie tanzten, die Musik sang, die Trompete sang, sie machten gleitende Bewegungen, und dann war da ein Wuschelhaar, sie hatte ein schwarzes Käppchen auf, ihr dünnes Gesichtchen lächelte manchmal zu meinem Tisch herüber, sie tanzte und puderte sich, zuletzt ging sie mit ihrem viereckigen Köfferchen. Ich sah sie heute im Amt. Sie war Zeugin. Ich erkannte sie gleich. Sie mich auch. Ein kleiner Zivilprozeß, Streitigkeiten wegen Möbelbeschädigung beim Umzug. Sie sagte aus, daß die Kommode nicht verschrammt war und noch nicht aus dem Leim. Wie ich um drei aus dem Gericht kam, steht sie unten an der großen Treppe und wartet, Gott weiß worauf. Sie hat mich wieder angelächelt, ich wußte nicht, ob ich lächeln durfte, aber wahrscheinlich habe ich es doch getan. Da ist sie zu mir gekommen und sagte mir, daß sie mich schon gestern gesehen habe, da oben bei dem Tanz. Kommen Sie öfter da rauf? Ja, was soll man tun, wenn man allein und in solche kleine Provinzstadt versetzt ist, viele Lokale wird’s hier ja nicht geben. Dann auf Wiedersehen.
Es regnet in Strömen. Alles ist grau, umgossen. Ich komme mir selbst wie ein Regen vor. So umgießt ein Gefühl alle Dinge und Menschen. Heut morgen war es noch ein leerer Ort und ich hatte schauerliches Heimweh. Ich dachte, hier verkomm ich. Jetzt –
Das ist ein merkwürdiger Zustand für einen ernsthaften Mann. Ich kann nicht leugnen, ich bin erregt. Es ist eine unglaubliche Spannung in meinen Gliedern. Ich gehe mit einemmal elastischer als sonst. Meine Wirtin sagt es auch. Sie freut sich über mich, ich bin jetzt allen Menschen wirklich mehr zugetan. Und warum? Ich bin allen Menschen dankbar, denn ich denke immerfort an sie und denke mir, sie geht unter ihnen allen. Ich habe dieses ganze graue Heimweh verloren und bin wie ersoffen in einem einzigen Meer von Spannung und Freude und Freudigkeit. Was tue ich? Meinen Dienst wie sonst, aber in der Pause vergesse ich zu essen, sitze an meinem Tisch im Beratungszimmer und träume. Das ist durchaus kein natürlicher Zustand, aber er hat seine Annehmlichkeiten, ich werde schon sehen, daß er mir nicht über den Kopf wächst.
Ich bin schon Mitte Dreißig und habe mir geschworen, nicht zu heiraten, meine Mutter hat es mir selbst geraten, obwohl ich der einzige Sohn bin, aber es ist zu viel Unglück und Krankheit in der Familie. Das hat mich allmählich, ich sehe es jetzt, in eine Feindschaft gegen das Weibliche überhaupt getrieben, ich bin ihnen aus dem Wege gegangen. Nun kommt das Feuer mir nachgelaufen. Aber es ist ein angenehmer Zustand. Ich war erst ein einziges Mal in meinem Leben verliebt, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben geliebt. Das war damals sie, die Rosa. Rosa hieß sie, beim Anblick jeder Rose hab ich noch heute Schmerz. Es ist mir eine schreckliche Erinnerung, ich brachte sie zu meiner Mutter, und die sagte nein. Es war ein wochenlanger Kampf, aber meine Mutter hatte schon recht, und ich weiß, daß man Pflichten hat und daß man seinem Gefühl nicht blind folgen darf. Es war ein schreckliches Ende, ein schreckliches langes Jahr. Ich bin aus dieser Sache nicht herausgekommen, wie ich hineingegangen war. Man muß verzichten. Und jetzt. Es ist ein angenehmes Gefühl. Man soll es nicht ablehnen. Man soll nicht gar zu streng mit sich sein.
Ich habe verschiedene Zeiten. Manchmal komme ich aus dem Lachen nicht heraus und sage, was ist mit mir, manchmal grübele ich, manchmal werde ich sehnsüchtig, ich tauche sehnsüchtig in jedes Gesicht, jeder Mund bringt meine Lippen in Bewegung zum Kuß, manchmal muß ich mich abwenden, so überwältigt bin ich, ich weiß nicht wovon. Ob das nicht ähnlich ist wie damals mit jener?
Ich war erst wie von einer Wand umstellt, viele Plätze und Straßen mußte ich vermeiden. Jetzt ist es ganz anders. Ich grüße alle Mädchen und Frauen in ihrem Namen. Sie sind Erinnerung an sie. Ich blicke auf ihre Schuh, ja sie haben auch Schuh, sie gehen in Strümpfen wie sie. Wenn sie in meinem Zimmer ist oder ich in ihrem, so ist alles voll Gespanntheit. Ich bringe nicht das Richtige heraus, ich habe schon zu lange auf sie gewartet, sie wundert sich über meine kalten Finger und daß ich so stumm bin. Dann sage ich, ich habe bei Gericht so viel zu sprechen gehabt. Und wenn sie weg ist, atme ich, atme auf, erhebe mich, wandere herum, denke nach, was gewesen ist, und schon fängt das Träumen wieder an, das Sinnen um sie, und im Inneren fange ich an mit ihr zu flüstern, und jetzt kommen die guten Worte mir über die Lippen, ich kann sie aussprechen, wo sie nicht da ist, nur wenn sie nicht da ist.
Ich denke manchmal, das ist eine Passion, eine Leidenschaft, die mich in Ketten schlägt. Soll ich mich nun hinwerfen vor sie und mich ganz von dieser Leidenschaft mitnehmen lassen? Ich will nicht, ich will nicht. Aber wie gerne schwimme ich mit dieser Gewalt! Wo ist denn Wahrheit als hier. Wo ist Leben, was ist Leben, wenn nicht hier. Und ob ich Unrecht tue, es ist wahr. Ich brenne, aber sie ist es, die das Feuer angezündet hat. Was hat sie aus mir gemacht. Was hat sie veranlaßt, auf mich zuzugehen und das Feuer auf mich zu werfen. Nun denke ich und glaube schon lange gewußt zu haben, wer ich bin, und da kommt sie und wirft das Feuer, und siehe da, jetzt erst zeigt sich, wer ich bin. Sie ist irgendeine kleine Person, aber meine große Lehrerin, die beste Lehrerin. So lehren keine Worte, und so viel erfahre ich nicht aus der Philosophie.
Erkenne dich selbst, sagt der Philosoph. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und wenn ich mich erkenne, was ist mir geholfen. Sie aber hat dort oben an dem Tisch gesessen, es war schon gleich solche Verzückung in dem Raum, die Musik klang, die Trompete sang, die Menschen machten gleitende Bewegungen, und dann war das Wuschelhaar da, das schwarze Käppchen, sie lachte zu meinem Tisch herüber, tanzte mit dem jungen Menschen mit der Hornbrille. Sie hat mich einmal angesehen, sie hat mich kaum gesehen, und ich habe sie ansehen dürfen, und das war die Belehrung, nicht meines Gehirns, sondern meiner Natur. Ach, so abgemüdet und ausgenutzt ist mein Gehirn, es ist schon bald nichts mehr daran zu zerbrechen, es hat getan, was es konnte, und siehe da, es war alles eitel, nichts und leer. Nachdem viele Philosophen in den Hörsälen und die größten Denker aus Büchern zu mir gesprochen haben, da ist die große kleine Lehrerin an mir vorbeigegangen und hat auf ihre Art gesprochen, eine knappe Viertelsekunde. O welche eindringliche Predigt, meine Knie zittern noch, wenn ich an diese Viertelsekunde denke. Ich brauchte Stunden, um mich davon zu erholen, und immer wieder muß ich darüber nachdenken, was ich gelernt habe, und kann es nicht fassen.
Weil ich dich gesehen habe, soll sich alles in mir wenden. Ich bin schon viel ruhiger. Ich denke während der Verhandlungen ruhig an dich, und du hältst es aus, daß ich ruhig an dich denke. Ich habe erst gefürchtet, das ginge nicht, du würdest dich dann als eine lächerliche Fratze enthüllen, die mich nichts angeht.
Jetzt kann ich auch an die Rosa denken. Ich habe hier vor mir einen Strauß Rosen, den habe ich mir heute morgen gekauft, jetzt liegt er vor mir auf dem Tisch, noch in dem Seidenpapier, und ich kann die Blumen ruhig und sogar herzlich betrachten. Es ist lange her, Rosa war gut, aber vorbei, vorbei, wer weiß, was aus ihr geworden ist, es hat nicht sollen sein. Jetzt erntet eine andere, was sie gesät hat. Ich bin froh, daß das Oberste in mir zuunterst gestülpt ist und das Unterste zuoberst. Ich habe meine Fassung wieder. Ich war erst fassungslos über mich. Ich hatte gedacht und bin manchmal nachts mit dem Schreck aufgewacht: Ich habe schon so lange gelebt, es war schon alles gut, warum muß das noch über mich kommen, warum konnte ich nicht in Ruhe sterben?
Ich war heute bei ihr, ihre Mutter war nicht zu Hause, sie hatte sie weggeschickt.
Ich habe sie vor zwei Stunden in meinen Armen gehalten. Es war ein Glück, das noch jetzt in meinen Armen, in meiner Brust nachklingt. Wie sie am Fenster, rosig, jung, ihren Mund an meinen legte, ich sie hielt um ihre Hüften – ich kann nicht davon sprechen. Himmlisch, der Himmel. Und die Begierde und der Körper? Es war ein Dienen und eine Demut. Was ist ein Kuß, was ist er anders als ein Untertauchen. Keine Aneignung, nein, eine Bitte um Zulaß, eine Danksagung und zugleich ein Sichhinwerfen und Aufgeben. Aber ihr ist davon, glaube ich, nichts bewußt, vielleicht tue ich ihr auch Unrecht. Es sieht bei ihr nur aus wie Staunen und Spiel.
Das ist das Eigentümliche der Liebe: diese Geste des Körpers, diese große und besondere Rolle, die der Körper spielt. Nirgends sonst steht er so sehr, so völlig, so hundertprozentig im Dienst der Seele. Wie da das Körperliche durchsichtig wird. Da war man sonst ein starres, isoliertes und gefrorenes Tier. Man war wie in Stücke gehauen. Man hatte da seine Gedanken, anderswo seine Neigungen, anderswo bewegte man sich. Jeden Teil ließ man einzeln laufen.
Ich habe dich wieder in den Armen gehabt. Du hast dich von mir umarmen lassen. Umarmen: das heißt, daß meine Arme, wie ich in dein Zimmer trat, sich um dich legen durften. Ich habe deinen schlanken, leichten, schwebenden Körper gefühlt. Und während ich dich hielt, habe ich innerlich gezittert und gefragt: wer bist du? Wer ist das hier, wer will hier etwas von mir? Wem bin ich hier gut? Ich kann nicht an deine Familie denken, für mich bist du nur das schlankgliedrige Mädchen, das Wuschelhaar mit den großen Augen. Du bist für mich der Mensch, der mir fehlt, das Stück von mir, das ich nicht habe, das junge zarte Weibchen, die Natur, die mir viel näher ist, viel mehr, als die Gesellschaft.
Und jetzt sehe ich: Ich, der Jurist, der Paragraphenmensch, ich bin im Begriff, die Gesellschaft zu durchbrechen und die Natur zu finden. Das hat einen leicht kriminellen Geschmack, aber wahrer werden mir die Dinge.
Ja wahrer, transparenter. Ich bin vorhin, wie ich ihr Haus verließ, langsam durch die Straßen gegangen, und da konnte ich wie ein gehörnter Siegfried nicht die Sprache der Vögel, aber die Sprache aller Menschen verstehen, aller Menschen, die da gingen, der Männer, der Frauen und der Kinder. Ihre Kleider machten mir nichts vor. Sie liefen als Naturwesen herum. Das war eine glückliche und erfreuliche Art zu blicken.
Das habe ich erreicht durch die Begegnung mit ihr. Es liegen überall Schlüssel zur Natur herum. Man braucht nur die Hand auszustrecken. Aber es gehört wohl auch Bereitsein dazu. Nun sitze ich zu Hause und denke an sie.
Geliebt zu werden, empfinden viele als ein Glück; mag sein. Lieben ist ein viel größeres Glück, glaube ich. Freilich, das Schönste muß sein, das Größte und am meisten Stärkende, Lebenspendende: Lieben und glauben dürfen, geliebt zu werden.
Sie hat mir ihr Bildchen geschenkt, ich trage es in der Tasche. Ich bin von dieser Tasche her elektrisiert. Ich muß das Bild wechseln in eine andere Tasche; mir kommt vor, mein Arm wird schlaff an dieser Seite. Es ist nicht ausgeschlossen, daß ich das Bild ganz aus meinem Anzug nehmen muß. Denn ich bin von dem, was das Bild ausströmt, wie umnebelt. Es ist so, wie wenn man in Sumpfluft, in die tropisch heiße und feuchte Luft eines anderen Klimas tritt. So umnebelt mich das. Aber doch bin ich froh, daß ich sie jetzt immer bei mir trage. Die Photographie taugt nichts; ihr Gesicht sieht so auf dem Bild weder klug noch beseelt aus. Der Photograph kann nicht die Spannungen, die Strahlen photographieren, die von ihr ausgehen und die nur ich empfinde, eben weil ich so empfindlich für sie bin. Ja, sie ist ein Naturwesen von ungeheurem Liebreiz für mich.
Ich komme eben von einer Begegnung mit ihr. Sie hat mir wieder vor dem Gericht aufgelauert und mich gegenüber in ein kleines Café geführt. Das Lokal war eben erst eröffnet, wir hatten nicht recht freien Platz, überall saßen Menschen, die Tür war gerade vor uns, und immer guckte uns einer ins Gesicht. Ich habe meine Stimme diese Stunde über nicht gefunden. Das Wuschelhaar saß blühend da, mit ihren kirschroten sehr vollen Lippen, den Hut mit einem Schleier auf dem Kopf, die Handschuhe behielt sie an, ab und zu trank sie von ihrer Schokolade. Sie hat nicht bemerkt, daß ich so dasaß und meine Stimme nicht fand. Ich dachte, während ich dasaß, über sie nach. Was mochte sie von mir wollen. Sie war recht zärtlich und wunderbar innig zu mir. Auf welche Weise? Im Lokal, mitten unter den Menschen, dicht an der Tür, wo einem jeden Augenblick einer ins Gesicht sah? Ja, ich hätte das auch früher nicht beantworten können. Sie war innig und herzlich einfach dadurch, daß sie so blühend dasaß, kirschrote Lippen hatte, ihren Arm manchmal rückwärts um meinen Stuhl legte und mir einmal erlaubte, ihren linken Handschuh auszuziehen. Ich brauchte die ganze Stunde nicht zu sprechen, ich hatte genug damit zu tun, sie zu betrachten, den Tisch zu betrachten, auf dem die Schokolade stand und ihr einer Handschuh lag, ihren kleinen Stirnschleier anzusehen und zu wissen, daß sie hier saß für mich. Darin bestand das ganze Wunderbare, Herzliche und Innige. Sonst erzählte sie noch, daß sie jetzt ohne Arbeit sei, und von ihren früheren Stellungen.
Wieviel habe ich dir schon verziehen und muß ich dir noch verzeihen. Stundenlange Erregung, Warten, Warten, und immer wieder laufe ich zum Fenster, zur Tür, mache auf, horche die Treppe hinunter, falle auf, denn warum öffne ich, die Wirtin ist ja zu Haus, du kommst nicht. Was du machst, was du gemacht hast, ich weiß es nicht. Wenn du dann nach ein paar Tagen kommst, kriege ich es auch nicht heraus. Es war gar nichts los, du hattest das zu tun und das zu tun, und du hast auch den kennengelernt und bist auch wieder allein tanzen gegangen. Manchmal schwindelst du. Ich bin durcheinander glücklich, wenn du da bist, und gar nicht vorhanden. Ich brauche manchmal Stunden, ehe ich über die Nachqual hinwegkomme, und dann dauert es nicht lange und du mußt gehen. Ich gönne dir ja jeden, aber gehe doch recht mit mir um. Siehst du mich gar nicht? Ach, wie bin ich geknechtet.
Was ich gesehen habe, ist dieses.
Ich sah ihre dunklen Haare, ihr schmales Gesicht, ihre glänzenden Augen. Ich sah, wie ihre Hände auf den Knien eines Mannes lagen. Ich hörte sie kichern, sprechen, den Kopf drehen. Und der Mann war nicht ich. Er saß mit dem Rücken gegen mich. Ich saß ganz dicht bei ihr, sie sah mich nicht.