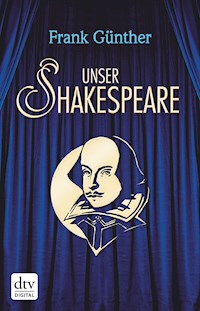
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zum 400. Todestag im Taschenbuch Unkonventionell, akribisch und mit großer Leidenschaft folgt Frank Günther den Spuren des berühmtesten Dramatikers der Weltliteratur. Kenntnisreich und wortgewaltig umkreist er das Phänomen ›Shakespeare‹. In einer Art Kaleidoskop vereint der größten Shakespeare-Übersetzer unserer Zeit historische Fakten, Fiktion und Fantasie: Ein facettenreiches Faszinosum – genau wie sein unsterblicher Titelheld.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Frank Günther
Unser Shakespeare
Einblicke in Shakespeares fremd-verwandte Zeiten
ZUEIGNUNG
William Shakespeare. Licht meines Lebens, Befeurer meiner Leidenschaften. Meine Sucht, meine Seele. Wwwil-li-ammm-shake-spppeare: Die Zunge rollt schmiegsam über den Gaumen, dreimal schließen die Lippen sich kosend um Deinen Namen und rufen Dich bei drei im Explosivlaut in die Welt – Will. Jemm. Shake. S-pear.1
O Du Einzigartiger, Du Weltweiser, Du Weltschöpfer, Du Weltverzauberer, Du Menschheitserfinder, Du Seelenabgrundergründer, Du Alles-immer-schon-gewusst-Habender, Du Alles-Beweisender, Du Halt in Untiefen, Du Leuchtfeuer im Grauen der Welt, Du Mein-dein-sein-unser-euer-ihr-Shakespeare, der Du jedem alles bist, was Du ihm sein sollst, Du Unfassbarer, Du Dich Entziehender, Du allen Zwecken Dienender, Du Chamäleon, Du proteischer Verwandler, Du Angepasster, Du Zwangsthema für Hausarbeiten, Seminararbeiten, Dissertationen und Habilitationen, Du Stoffgeber für Aufsätze, Essays und Bücher, Du Motto für Festschriften und Gedenkfeiern, Du Anreger für Weltentwürfe und Gedankengebäude, Du Paradeplatz für Theorieexerzierer und Hypothesenbauer, Du Gründer von Industrien und Karrieren, Du Arbeitgeber für Generationen von Texthandwerkern, Du Folterknecht gequälter Schulklassen, Du Köder für englische Touristenfallen, Du sinnentleerte Ikone gepflegter Langeweile, Du immer schon dagewesener Nichts-mehr-Sager, Du britischer Kulturexportartikel! Du Einer, der Du unzählige Shakespeares bist! Du Mein-dein-sein-unser-euer-ihr-Shakespeare! Der Du nichts bist als – ein Buch.
DAS BUCH ODER WIE WIR ES LESEN
Shakespeares Werkausgabe, die First Folio, sollte auf der Frankfurter Buchmesse laut Herbstkatalog eigentlich schon 1622 präsentiert werden; die Herstellung erwies sich aber als schwierig, sodass es erst im Folgejahr 1623 erscheinen konnte – sieben Jahre nach Shakespeares Tod. Zwei Schauspieler aus Shakespeares Truppe, seine Kollegen Henry Condell und James Heminges (gelobt seien ihre Namen in alle Ewigkeit!), hatten die 37 Shakespeare-Dramen zusammengestellt und damit achtzehn Texte für die Nachwelt gerettet: Diese wurden nämlich erstmals in dieser Folio-Ausgabe gedruckt und wären ohne Condell und Heminges für immer verloren gewesen. Nicht, dass das die Frankfurter Messebesucher im Jahr 1623 sonderlich gekümmert hätte: Wer war schon dieser Shakespeare aus England? Und wer las schon primitive Theatertexte in einem teuren Buch?
Aber möglicherweise ist dieses Angeregtsein nur eine schöne Illusion – denn wer kann, bei 6000 Publikationen im Jahr, die man alle nicht gelesen hat, denn wissen, ob das, was man da geistig angeregt Originelles denkt, nicht schon längst viel besser, origineller, vollständiger, konsequenter und schöner von anderen gedacht und gesagt wurde? Wer kann schon wissen, ob nach den vielen gelesenen Aufsätzen und Büchern über Shakespeare das angeblich Selbstgedachte nicht nur ein unbewusstes pêle-mêle, ein halbplagiatorisches Recyceln von vage erinnerten Versatzstücken ist, nur ein rag, ein aus den Gedanken anderer Shakespeare-Angeregter zusammengestoppelter Flickenteppich? »Wer heute über Shakespeare spricht, wird wohltun, wenn er auf jeden Anspruch, Neues zu sagen, gründlich verzichtet!«, meinte schon 1887 der Kunsthistoriker Jakob Burckhardt.1
Vor 450 Jahren wurde Shakespeare geboren. Mit jedem Tag, der vergeht, schieben sich mehr Bücher, mehr Geschichte, mehr Neuerung, mehr naturwissenschaftliches Verständnis, mehr Weltwissen, Welterfahrung und Weltbeherrschung zwischen uns und Shakespeare. Mit jeder Sekunde rückt Shakespeares merkwürdig faszinierende Zeit weiter von uns weg. Mit jedem neuen piepsenden Elektronikspielzeug, das uns zappelnde Abbilder der Welt über Elektronenflüsse als Wirklichkeit vermittelt und unseren Umgang miteinander verändert, wird eine neue Barriere zwischen uns und der Shakespeare-Zeit errichtet. Unsere Welt wird vom Bild, vom Blick, vom Auge dominiert – Shakespeares Welt war vom Ohr, vom Hören, von der Wunderwelt der Sprache bestimmt. »Schau’n wir uns das Stück an«, sagen wir heute, wenn wir ins Theater gehen, um dann Video-Projektionen zu bewundern; »Let’s hear a play«, sagte man ganz anders zu Shakespeares Zeiten und ergötzte sich an den uferlosen, bunten Sprachphantasien der Autoren. Für die Ohren war’s mal bestimmt, für die Augen muss es heute aufbereitet werden. Wir rühmen ehrfürchtig Shakespeare für seinen angeblich riesigen aktiven Wortschatz von über 17000 Wörtern – ohne zu bedenken, dass dieser in Wahrheit eher ärmlich ist, verglichen mit dem durchschnittlichen Wortschatz eines jeden heutigen Jack Smith oder John Miller im United Kingdom: Sie verfügen nämlich über etwa 60000 Wörter, welche Zeugnis geben von vierhundertjährigem Zuwachs an Technik, Wissenschaft und Geschichte, vom Umfang heutiger Weltbenennung, Welterfassung und Weltneuerfindung.
Shakespeare, auf der Schwelle zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit, wusste vom meisten, was heute jedes Schulkind weiß und zur alltäglichen Lebensbewältigung unabdingbar braucht, nichts. Er war fest eingebunden in die Vorstellungen, Konzepte und Gedankenhorizonte seiner Zeit. Sie ist uns Heutigen so fern wie der Mars – wir wisssen mehr und anderes als der vordemokratische Shakespeare, der für seine Zeit über seine Zeit schrieb. Er schrieb nicht für uns Nachgeborene. Er schrieb in einer gefährlichen, unsicheren Umbruchsepoche für machtgierige Höflinge einer frühabsolutistischen Feudalgesellschaft, für ein sich allmählich entwickelndes, aufstiegsorientiertes Bürgertum, zu dem er selbst gehörte, und für eine breite Volksmasse, die zum größten Teil nicht lesen und schreiben konnte. All dies war überwölbt vom Totalitätsanspruch eines zwar kriselnden, aber den Alltag eisern beherrschenden christlichen Glaubens in militanter katholischer und protestantischer Ausformung. Die Hölle war so real wie der Himmel, der Gottesleugner war ein Schreckbild, wer sich autonom selbstbestimmen wollte, erschien als angsteinflößendes Monster. Davon handelt so manches Shakespeare-Stück. Die Erde wurde als grausames Jammertal voller Krankheiten, Pest und Krieg erlebt, und das Leben war kurz. Vieles in Shakespeares Welt und Werken erscheint uns als Aberglaube und Vorurteil, vieles als nackte Barbarei und Unmenschlichkeit. Seine Sprache ist oft kaum mehr verständlich. Shakespeare und seine untergegangene Welt sind uns fremd.
Trotzdem erscheinen Jahr für Jahr diese genannten 6000 wissenschaftlichen Schriften über Shakespeare. Alle behaupten implizit, dass Shakespeare für uns wichtig sei. Und tatsächlich: Wenn wir uns etwas eingelesen haben, uns an die befremdliche Sprache, an die Verse, an die seltsame Gesellschaft aus Kesselflickern und Königen, an die seltsamen Umgangsformen seiner Figuren gewöhnt haben, erscheint uns dies alles auf seltsame Weise bekannt und verwandt. Wir können uns zumeist mit den Sorgen, Freuden und Nöten der Gestalten identifizieren; wir können zumeist ihre Konflikte und Probleme nachvollziehen; wir staunen über ihre Schicksale, sind erschüttert von ihren oftmals extremen existenziellen Leidenschaften, erschrecken zunehmend über ihre Maßlosigkeit und teilen ihren bitteren Spott über die Weltverhältnisse. Es ist ein Rätsel, wie das möglich ist: Sie kommen uns hinter den historischen Einkleidungen und überholten sozialen Verhältnissen oftmals als sehr heutige, sehr lebendige Wesen immer näher. Und, ja, je länger wir in diesem Buch lesen, um so weitere Assoziationsräume eröffnen sich, um so uferlosere Landschaften der menschlichen Seele scheinen sich neu auszubreiten, bis man sich vielleicht beklommen fragt: Überfordert das Buch mich womöglich?
Wohl oft – aber auch nicht immer. Manchmal meinen wir zu spüren, dass uns etwas Wesentliches entgeht, wenn wir die Texte lesen; dass über Dinge geredet wird, die wir nicht so ganz nachvollziehen können; und wenn von »Ehre«, »Grazie«, »Königstreue« und »Edelmut« gesprochen wird, merken wir, dass Shakespeares Personen ein Wertesystem haben, das uns doch ziemlich fremd ist. Und manchmal stolpern wir geradezu über Dinge, die wir auf gar keinen Fall mehr akzeptieren wollen: Todesstrafe für vorehelichen Geschlechtsverkehr wie in Maß für Maß z.B. erscheint uns geradezu als pervers und inakzeptabel – ein Stück, das in unserer Welt anscheinend nichts mehr zu sagen und zu suchen hat. Und wenn der Macho-Frauendompteur Petruchio in Der Widerspenstigen Zämung über seine rebellische Ehefrau sagt:
Sie ist mein Hab und Gut, mein Land, mein Haus,
Mein Hausgerät, mein Acker, meine Scheune,
Mein Pferd, mein Ochs, mein Esel und mein alles …
III,2,228
und »seine« Katharina zum Schluss erklärt, die Frau habe pflichtgemäß »die Hand dem Mann unter den Fuß zu legen«, so ist auch dies heute nicht mehr zu rechtfertigen. Dann sagen wir höflich: »Ach, das muss man eben aus seiner Zeit heraus verstehen« – und halten es im Stillen für reichlich verstaubt. Also versuchen wir, Shakespeare historisch einzuordnen.
Dafür gibt es ungeheuer viele Hilfen: Educational-Shakespeare-Kurse und Geschichtslektüre, Shakespeare-in-der-Schule-Handreichungen, ungezählte Monographien und Ausstellungen breiten das Panorama der faszinierenden elisabethanischen Epoche lebensprall und bunt vor uns aus. Wir lernen die Anwohner der Henley Street in Stratford kennen, erfahren viel über Jagdbräuche der Renaissance, machen uns kundig über die außenpolitischen Manöver von Königin Elisabeth, studieren das metaphernreiche elisabethanische Weltbild, erleben die englische Erschütterung über die erste Weltumsegelung von Sir Francis Drake, verspüren fast physisch das Gruseln der Katholikenverfolgung, wenn wir das ausgestochene Auge eines gefolterten und hingerichteten katholischen Priesters unter Glas betrachten, lernen vor allem alles über das elisabethanische Theater – und finden uns, als Krönung des historischen Interesses, im wunderschönen Globe Theatre am Themseufer in London wieder, wo uns Shakespeare-Stücke lebendig »original« gezeigt werden. Ein Einblick in Shakespeares ferne, fremde Welt, der uns für die Dauer der Aufführung in Elisabethaner verwandeln will.
Nun sagen andere, all das Historische würde uns gar nicht so sehr viel nutzen. Denn schließlich: Was gehen uns heute die Probleme der Leute von 1600 denn eigentlich noch an? Können wir uns, selbst wenn wir uns noch so viele historische Kenntnisse erarbeiten, wirklich in das fremde Weltbild und die ferne Sichtweise eines Handschuhmachersohns um 1600 hineinversetzen? Wohl kaum. Wichtiger sei doch, wo wir Heutigen uns in der Essenz der alten Geschichten wiederfänden, wenn wir sie lesen. Wir müssten Shakespeare zu uns und unseren heutigen Verhältnissen herüberholen, heißt es – wir müssten ihn aktualisieren. Ein Bestseller des polnischen Autors Jan Kott etablierte 1965 ein dauerhaftes Schlagwort im praktischen Umgang mit Shakespeare: »Shakespeare, unser Zeitgenosse«. Es suggeriert plastisch, dass Shakespeare auf eine merkwürdige Art überzeitlich sei: »Jede Epoche findet das bei ihm, wonach sie selbst sucht und was sie selber sehen will«2. Ein Wunderschränkchen – für jeden gibt’s in der Schublade genau das, was er sucht. Ob Shakespeare es wirklich zuvor hineingelegt hat? Oder legen wir es selbst hinein und finden es dann? Shakespeare ist demnach immer Zeitgenosse, »for all times«, wie schon sein Kollege Ben Jonson rühmend in der First Folio schrieb. Wundersamerweise – denn wie kann das gehen? Gibt es eine überzeitliche menschliche Wesensart, ewig gleichbleibend über alle Epochen hinweg? Laut Kott sollten uns keine historistischen Betrachtungen über Vater und Mutter Shakespeare, Anne Hathaway, die Schafzucht in Warwickshire und die sozialen Verhältnisse in Stratford von 1564 interessieren, und die Strumpfhose als elisabethanisch korrektes männliches Standardkostüm hatte ausgedient. Sie erschien als wahrer Verhinderer einer tatsächlichen existentiellen Erfahrung mit Shakespeares Dramenwelt und ihren Konflikten. Shakespeare sei uns nah verwandt, wurde behauptet; wir müssten nur unsere Themen in Bruder Shakespeares alten Geschichten auffinden. Oder sie in sie hineinlegen.
Und es ist ja wahr – das schöne historisierende Globe Theatre in London und seine Schauspieler tun zwar so, als könnten sie uns zu Elisabethanern machen; tun für zwei Stunden so, als könnten wir Shakespeares Zeitgenossen werden; als könnten die heutigen Schauspieler die fotografierenden Touristen aus aller Welt, die sich um den Bühnenrand drängen, allein durch ein bisschen linkisches Haareverwuscheln in ein waschechtes elisabethanisches Publikum verwandeln. Aber das klappt natürlich nicht – da fehlt es schon an den Äußerlichkeiten: am elisabethanischen pestilenzialischen Gestank von 3000 dicht gedrängt stehenden ungewaschenen Leibern in ungewaschenen Kleidern; am Brodem der ungeniert abgelassenen Pisse, denn es gab keine Toiletten; es fehlt der Gestank von geronnenem Blut von den grausamen Tierhatz-Veranstaltungen, die es in manchen Theatern gab, oder der von faulen Zähnen und altem Knoblauch; es fehlen die Nüsse, die der elisabethanische Zuschauer laut knackte und kaute und samt den zischend geöffneten Bierflaschen zu Wurfgeschossen gegen schlechte Schauspieler umfunktionierte. Es fehlt die unterschwellige Angst vor der tödlichen Ansteckung mit der Schwarzen Pest, die damals über jedem größeren Menschenauflauf hing. Von den scharfen Waffen, die im Publikum ganz selbstverständlich jedermann trug, gar nicht zu reden, denn wie leicht konnte man in ein Messer laufen – schließlich war man im Rotlichtbezirk in Southwark, wo finstere Gestalten lauerten. Und es fehlt vor allem das Movens, das die Londoner damals täglich zu Abertausenden in die Theater trieb: die brennende Neugier darauf, wie ihre eigene, aktuelle Welt da oben in dem brandneuen Medium der öffentlichen Unterhaltungstheater verhandelt wurde. Alles war Hier und Jetzt. Ein Spiegel der aktuellen Welt. Wir hingegen erleben heute im Globe alte Texte über alte Probleme, wir hören alte Witze, und wir verpassen die Ober- und Untertöne, die die alten Stücke für Shakespeares Zeitgenossen ehemals aktuell transportiert haben. Unsere aktuellen Probleme werden dort nicht verhandelt. Wir müssen sie mühsam in die Stücke hineinlesen. Wir werden keine Elisabethaner. Das wunderschöne, mit viel Liebe erbaute Denkmal des historistischen Shakespeare-Verständnisses, das Globe Theatre, das jeder einmal besucht haben sollte, ist eine Simulation, wie eine begehbare Installation über das Neolithikum im Naturkundemuseum. Oder wie Neuschwanstein in Disneyland. Das historische Sehen hilft unserem Verständnis, aber immer nur ein Stück weit.
Wenn wir also nicht zu Shakespeares Zeitgenossen werden können, können wir laut Kott umgekehrt versuchen, Shakespeare zu unserem Zeitgenossen zu machen. Das machten und machen die Theater notwendigerweise bei jeder neuen Inszenierung, die so ein altes Stück mit jeweils modernen Menschen für moderne Menschen verlebendigen will; da wird immer zuerst überlegt: Wo finden wir Heutigen uns in den alten Geschichten wieder? Was geht das uns an? Inwiefern ist uns all das verwandt – bei aller historischen Fremdheit? Shakespeares alte Stücke werden mit neuen Assoziationen und neuen Ober- und Untertönen aufgeladen, an die Shakespeare nie gedacht hat. Das ist völlig legitim: Ein Shakespeare-Stück ist kein Geschichtsunterricht und kein Museumstableau. Es muss uns betreffen. Es ist eine Binsenweisheit, dass jede Epoche auf ihre Façon die Brillengläser neu einschleift, durch die wir die alten Texte betrachten. Und so kann’s dann vorkommen, dass »unser« Zeitgenosse Shakespeare – durch unsere heutige Brille gesehen – irgendwie Marx gelesen zu haben scheint, oder Sigmund Freud, oder Michel Foucault, Jacques Derrida, und Judith Butler. Sperrige neue Sichtweisen auf einen alten Text können spannend und erkenntnisträchtig sein. Umgekehrt können sie den Zugang zu Shakespeare auch versperren, und die Frage taucht auf, ob wir Shakespeare dabei wirklich als uns verwandten Zeitgenossen wiederfinden – oder ob wir den Fremden nur nach unserem Geschmack modisch verkleiden bis zur Unkenntlichkeit.
Vor einigen Jahren sah ich in Stockholm zum ersten Mal junge Paare Hand in Hand auf der Straße, die einander in Haartracht und Kleidung so ähnlich waren, daß man unmöglich sagen konnte, wer Junge oder Mädchen war – da fiel mir ganz plötzlich die Ähnlichkeit mit Viola und Rosalinde auf,
schrieb Jan Kott und schloss daraus auf eine enge Verwandtschaft unserer Zeit mit der Shakespeare-Zeit.3 Nun ist eine solche Ähnlichkeit erst einmal reines Kostüm. Im Theater sehen wir heute den Römer Coriolan im NATO-oliven Tarnanzug mit Maschinenpistole und Springerstiefeln, Macbeth als Börsenbroker im Maßanzug, Hamlet im Strampelhöschen mit Schnuller. Das sind zunächst recht äußerliche Verkleidungen; manchmal klappt’s und erzählt Spannendes über den Kern der alten Geschichte, manchmal läuft es als modische Geste leer und verfehlt jenes Kraftzentrum des Fremd-Verwandten, das in den Stücken steckt. Manchmal wird ein Stück gar zum reinen Vehikel für ganz stückfremde Erzählungen: Wenn wir die Bankenkrise nebst Occupy-Bewegung anhand des Kaufmanns von Venedig darstellen wollen, aus keinem anderen Grund, als dass es ja hier wie da um Geld geht, so werden wir wohl den Reichtum von Shakespeares Stück verfehlen; oder wenn wir die popkulturelle Beliebigkeits-Assoziations-Maschine anwerfen und Macbeth plötzlich in Transsylvanien unter Vampiren spielt oder Othello der weiße Lead-Sänger einer Rockband auf Zypern wird, so ist das zwar »Shakespeare entstaubt« und geht vielleicht »geil ab«, ist poppig bunt und kultverdächtig, aber es könnte uns auffallen, dass bei solchen Ineinssetzungen etwas auf der Strecke bleibt. Das neue Kostüm ist in solchen Fällen entweder zu eng oder zu weit oder zu kurz oder zu lang – es passt den alten Figuren und Geschichten und Kontexten nicht so recht auf den Leib; und so wird, statt das Kostüm dem Leib anzupassen, der Leib passend gemacht. Zumeist wird er beschnitten, hier ein Finger, da ein Ohr, dort ein Arm weg, und er bleibt verstümmelt als Torso zurück. »Eine gelungene Vergewaltigung Shakespeares ist der Beginn eines neuen Stils«4, schrieb Jan Kott. Möglich; aber wenn die Vergewaltigung nicht gelingt …? Der Versuch, verwandte Nähe gewaltsam zu stiften, kann ganz ungemein entfernen. Auch die Suche nach der radikalen Zeitgenossenschaft hilft uns nur ein Stück weit.
»Shakespeare heute« oder »Shakespeare historisch« – keiner der beiden Wege ist ein Königsweg zu Shakespeares merkwürdigen, fremd-verwandten Werken. Beide Wege sind erkenntnisträchtig und legitim. Ins Extrem getrieben, werden beide fragwürdig. Ob wir die Texte auf der Suche nach Shakespeare »heutig« oder »historisch« lesen – immer blicken wir letztlich in Zerrspiegel, in denen wir im »Shakespeare« wesentlich uns selbst erkennen. Große Texte sind immer klüger als ihr Autor: Sie halten mehr bereit, als ihr Schöpfer bewusst erdachte. Wenn wir uns kühn heutig assoziierend im Sinnüberschuss der alten Texte wiederfinden wollen, sollten wir ihre widerständige historische Fremdheit nicht übersehen: Sie ist ein notwendiges Korrektiv für unsere produktive und übermütige Willkür der Aneignung. Das vertrackte Verhältnis von Verwandtschaft und Fremdheit muss bei Shakespeares Stücken immer wieder neu austariert werden.
Dieses Buch will von beidem erzählen: von Shakespeares historisch ferner, fremder Welt ebenso wie von jenem Shakespeare, der auf verschlungenen Wegen »unserer« geworden ist. Oder besser gesagt – von den vielen Shakespeares, die wir uns im Laufe der Zeit erfunden haben. Denn »Shakespeare«, unser Verwandter, besteht aus unseren Phantasien.
VON NOSTRIFIZIERUNG UND ENT-ENGLISIERUNG ODER WIE SHAKESPEARE UNSER SHAKESPEARE WURDE
Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, vergebens; Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.
Schiller und Goethe, Xenien, Nr. 96
Am Anfang war Deutschland wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Der Geist Shakespeares schwebte noch nicht über den deutschen Landen. So unglaublich es scheint – es gab einmal eine Zeit, als man in Deutschland von Shakespeare nichts wusste. Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts – Shakespeare war seit fast hundert Jahren tot, nämlich seit 1616, und in England längst mit dem Dichterlorbeer gekrönt – hatte man in Deutschlands gebildeten Bürgerkreisen kaum auch nur seinen Namen gehört. Das lag unter anderem daran, dass man ihn nicht recht lesen konnte – es gab keine einzige Shakespeare-Übersetzung, man stelle sich vor! Und auf Englisch lesen konnten ihn nicht sehr viele, denn Englisch war für die Deutschen nicht unbedingt die Fremdsprache erster Wahl: Das war damals Französisch, die internationale Kultursprache der Zeit, die Sprache der Höfe und der Bildung. Mit Französischkenntnissen bewies man, dass man très en vogue, auf der Höhe der Zeit und der Kultur war. Wer’s nicht konnte, flickte bei jeder occasion mit coquetterie wenigstens französische Wörter in die conversation ein. Friedrich der Große von Preußen konnte später Deutsch nur radebrechen, hielt es für vulgär und betrachtete Französisch als seine Muttersprache.
Vorbild aller europäischen Höfe und Bürgerstuben war Frankreichs Prunkhof Versailles, der Nabel der zivilisierten Welt. Der Festglanz der französischen Hofkultur überstrahlte seit Ende des 17. Jahrhunderts ganz Europa und erleuchtete auch die letzten Winkel der vielen deutschen Lande, denn eine einheitliche deutsche Nation gab es nicht. Es gab nur die deutsche Kleinstaaterei, einen Flickenteppich aus über 300 kleinen und kleinsten selbstständigen Fürstentümern im erschütterten Überbau des Heiligen Römischen Reiches; in ihrem Mittelpunkt rückständige Miniatur-Residenzen, die sich alle mühten, Versailles nachzueifern. Von der galanten Kleidermode, dem abgezirkelten Hofzeremoniell, den Umgangsformen bis zur korrekten Perücke war Frankreich der Maßstab: Seit Ludwig XIV. wegen Haarausfalls zur gelockten Zweitfrisur gegriffen hatte, wurde die weiß, blau oder rosa gepuderte Allongeperücke überall in Europa zum höfischen wie bürgerlichen Statussymbol.
Unter den Puderlocken verbreitete sich in den Köpfen auch das aus Frankreich importierte cogito ergo sum (Ich denke, also bin ich) des Descartes: der neue, mathematisch begründete Glaube an die Vernunft, der Rationalismus. Sein verspieltester Ausdruck waren die Gärten und Parkanlagen: Da wurde die wuchernde Natur mit Zirkel und Lineal zu geometrisch-mathematischen Wunderwelten gezähmt.
Das Universum war eine große rationale mathematische Maschine, man lebte laut Leibniz in der besten aller denkbaren Welten, alles war vernünftig geordnet und geregelt. Auch die Dichtkunst. »Die Gartenkunst und die dramatische Dichtkunst haben in neuern Zeiten ziemlich dasselbe Schicksal gehabt«, meinte Schiller später, 1793, »dieselbe Tyrannei der Regel in den französischen Gärten und in den französischen Tragödien. Dieselbe bunte und wilde Regellosigkeit in den Parks der Engländer und in ihrem Shakespeare.«1 Und so war auch das Theater.
Mit dem Theater hatte es in Deutschland seit dem Dreißigjährigen Krieg lange recht schlimm gestanden. Zwar wurde überall an den Höfen und in den Residenzstädten der vielen deutschen Kleinstaaten Theater gespielt, ob am Hoftheater oder durch Wanderbühnen – aber es war grobschlächtiges Zeug, wie Gotthold Ephraim Lessing später erinnert: »Unsre Staats- und Helden-Aktionen waren voller Unsinn, Bombast, Schmutz und Pöbelwitz. Unsre Lustspiele bestanden in Verkleidungen und Zaubereien; und Prügel waren die witzigsten Einfälle derselben.«2
Dies zu verändern, war ab 1727 ein 27-jähriger deutscher Gelehrter in Leipzig angetreten: der Professor für Poetik, Logik und Metaphysik, Johann Christoph Gottsched. Er war ein der Vernunft verpflichteter, aufrechter Bürger, der den Idealen der Frühaufklärung anhing und eine große emanzipatorische Mission hatte: Er wollte die konfuse deutsche Sprache, die rückständige deutsche Literatur und vor allem das chaotische und stillose deutsche Theater reformieren. Er wollte den Traum eines deutschen Nationaltheaters verwirklichen, den damals viele Bürger angesichts des deutschen Zoten- und Rüpeltheaters träumten. Nach dem Vorbild der Comédie-Française sollte es eine Agentur des aufklärerischen Denkens für Bürger, »Volk« und Adel werden – ein allgemeines aufklärerisches Erziehungsinstitut. Es sollte in der deutschen Kleinstaaterei eine übergreifende deutsche Nation erst eigentlich formen helfen, denn die gab es noch gar nicht. Statt eines Nationalstaats also wenigstens ein Nationaltheater.
Zusammen mit der Leipziger Theaterdirektorin Friederike Caroline Neuber verbannte der vernünftige Gottsched als Erstes demonstrativ die Figur des pöbelnden, furzenden und frech anarchischen deutschen Hanswurstes von den Bühnenbrettern. Seine Vorbilder waren – was sonst – französisch: die Dramen eines Corneille und Racine.
Missionarisch verbreitete Literaturpapst Gottsched deren Dramentheorie, wie sie in der rationalistischen Dichtungsrezeptur ›L’Art poétique‹ des Nicolas Boileau dargelegt war. Es handelte sich um eine »Regelpoetik«, die auf die klassischen Vorbilder der großen »Alten« wie Horaz und Aristoteles zurückging. Dramen müssten nach korrekten Regeln geschrieben werden, die auf Vernunft gründeten, wurde da behauptet, und müssten vor allem einen moralischen Nutzen als belehrenden Anschauungsunterricht haben. Gottsched stellte sich – mit den französischen Dichtern – eine Art Bastelanweisung für das Schreiben von Dramen vor. Das ging etwa so:
Der Poet wehlet sich einen moralischen Lehrsatz, den er seinen Zuschauern auf eine sinnliche Art einprägen will. Dazu ersinnt er sich eine allgemeine Fabel, daraus die Wahrheit eines Satzes erhellet. Hiernechst sucht er in der Historie solche berühmte Leute, denen etwas ähnliches begegnet ist: … Er erdencket sodann alle Umstände dazu, um die Hauptfabel recht wahrscheinlich zu machen. … Dieses theilt er denn in fünf Stücke ein, die ungefehr gleich groß sind, und ordnet sie so, daß natürlicher Weise das letztere aus dem vorhergehenden fliesset.3
Ein Drama hatte also einen nützlichen moralischen Lehrsatz zu illustrieren. Der Dichter war pädagogischer Verpackungskünstler desselben im Dienste von Aufklärung, Vernunft und Humanität. Als oberstes Gebot galt Gottsched die Natürlichkeit und Wahrscheinlichkeit des Werkes. Darunter verstand er nicht etwa naturalistische Abbildung der Realität, sondern ihm genügte die »Ähnlichkeit des Erdichteten mit dem, was wirklich zu geschehen pflegt«4. Also war alles Wunderbare, Phantastische und Übernatürliche verboten – keine Geistererscheinungen, keine Götterauftritte und keine Feenreigen. Zentrales Gerüst seiner Theorie war die strenge Einheit von Ort und Zeit – Zeitsprünge in der Dramaturgie waren untersagt, denn »die besten Fabeln sind also diejenigen, die nicht mehr Zeit nötig gehabt, wirklich zu geschehen, als sie zur Vorstellung brauchen«5. Die Spielhandlung sollte idealerweise – gemäß einer etwas absonderlichen Wirklichkeitsauffassung– »wirklich« die genaue Dauer der Vorstellung haben. Sonst wäre es nicht natürlich.
Ebenso untersagt waren dem Dichter Ortsveränderungen im Ablauf der Handlung, denn
die Zuschauer bleiben auf einer Stelle sitzen, folglich müssen auch die spielenden Personen alle auf einem Platze bleiben, den jene übersehen können, ohne ihren Ort zu ändern. … Wo man ist, da muß man bleiben; und daher auch nicht in der ersten Handlung im Walde, in der andern in der Stadt, in der dritten im Kriege und in der vierten in einem Garten oder gar auf der See sein. Das sind lauter Fehler wider die Wahrscheinlichkeit: Eine Fabel aber, die nicht wahrscheinlich ist, taugt nichts: weil dieses ihre vornehmste Eigenschaft ist.6
Nun lässt ein solches Gerüst (oder eher Schnürkorsett) beim Schreiben nicht allzu viel Luft zum Atmen; es schließt alles aus, was sich nicht in ein paar Stunden und an ein und demselben Ort ereignen kann. Das hatte natürlich Folgen auch für die Darstellung komplexer Charaktere; solche lassen sich, angenagelt an einen einzigen Ort, schlecht in ein paar Stunden Realzeit entfalten, und daher meinte Gottsched:
Ein widersprechender Charakter ist ein Ungeheuer, das in der Natur nicht vorkömmt; daher muß ein Geiziger geizig, ein Stolzer stolz … seyn und bleiben; es würde denn in der Fabel durch besondere Umstände wahrscheinlich gemacht, daß er sich ein wenig geändert hätte. Denn eine gänzliche Aenderung des Naturells oder Characters ist ohnedieß in so kurzer Zeit unmöglich.7
Auch die Einheitlichkeit des menschlichen Charakters wurde also verlangt: Was eine Figur einmal war, hatte sie unveränderlich zu sein und zu bleiben; etwaige Wandlungen einer Figur waren verboten, weil in ein paar Stunden kaum darstellbar und sowieso »in der Natur« unwahrscheinlich, laut Gottsched. Eine etwas enge Sicht: Von den Werdensmöglichkeiten eines Menschen konnte in einem solchen mechanistischen Regelwerk nichts erzählt werden. Der Mensch war in diesem Prokrustesbett der rationalen Poetik ein starres, eindimensionales Etwas.
Besonders folgenreich an dieser Literaturverfertigungstheorie war aber die Ständeklausel. Sie besagte, dass die Tragödie nur von hohen, erhabenen und großen Menschen handeln konnte, also vom Adel in Form von Königen, Fürsten und Menschen hohen Standes. Denn nur standesmäßig hochstehende Menschen, hieß es, hätten eine Fallhöhe, aus der sie tragisch darniederstürzen konnten. Nur ein Fürst, der zum Bettler wird, hat demnach ausreichende Chancen auf tragische Darstellung. Eine solch adelige Figur etwa in einer Komödie zu zeigen war im absolutistischen Ständestaat unvorstellbar – dies hätte der schuldigen Ehrerbietung gegenüber Fürsten widersprochen. Die Gattung »Komödie« wiederum war ausschließlich den tumben Bürgern vorbehalten; denn der bürgerliche Mensch habe nun mal keine Größe und Erhabenheit, folglich könne er auch nicht tragisch stürzen; seine kleinkrämerischen Alltagsprobleme taugten daher nur für das klamottige Lustspiel; Bürger hätten nun mal kein Empfinden für das wahrhaft Tragische. So waren auch nur die Hoftheater berechtigt, Tragödien aufzuführen; die Wanderbühnen hatten sich mit grobschlächtigen Lustspielen zu begnügen. Und so gab es nur adelige Tragödien und bürgerliche Komödien auf den Theatern. Und deswegen war der für uns Heutige unscheinbare Begriff »Bürgerliches Trauerspiel«, wie es später Lessing kühn auf die Bühnenbretter brachte, ein Oxymoron, ein in sich widersprüchlicher Begriff: »Bürgerlich« und »Trauerspiel« schlossen sich gegenseitig wie von selbst aus. Sie zu vereinen, wie Lessing es tat, kam einer politischen Revolution gleich. Und weil Adel und Bürgertum dramatisch streng getrennt waren, sprachen die komischen Bürgerlichen in solchen Stücken auch ihre komische Alltagsprosa, während die Tragödienhelden in erhabenen Heldenversen sprachen – natürlich im französischen Versmaß des Alexandriners (welcher, wenn der deutschen Sprache aufgepresst, leider etwas mechanisch ausfällt). Gottsched legte selbst eine Probe vor: das Stück ›Der sterbende Cato‹ (1732), das er, wie andere spotteten, aus mehreren vorhandenen französischen Vorlagen »mit Schere und Kleister« zusammengebastelt hatte. Das klingt alexandrinisch so – man lese rhythmisch laut (der Schrägstrich signalisiert eine kleine Zäsur):
Er kam erhitzt darzu, / als schon die andern fochten, Und hat sich selbst dabey / den schönsten Kranz geflochten. Pharnazes drang auf ihn / mit bloßem Säbel ein, Doch alle seine Wuth / schien hier umsonst zu seyn: Weil ihm kein Hieb, kein Stoß / nach Herzenswunsch gelungen, Bis deines Sohnes Schwert / ihm durch die Brust gedrungen.8
Dieser alexandrinisch tönende oder eher deutsch stampfende ›Sterbende Cato‹ des Professors Gottsched feierte zehn Jahre lang auf allen deutschen Bühnen Triumphe. Dreißig Jahre lang beherrschte Literaturpapst Gottsched die deutsche Szene.
Ein anderer, 30 Jahre jüngerer deutscher Aufklärer fand’s dann dreißig Jahre später grässlich: Gotthold Ephraim Lessing, der studierte Theologe, Philosoph, Mediziner, Geschichtskundler und Dichter, kurz, ein promovierter Magister der Sieben Freien Künste. Er wollte, wie Gottsched, ein deutsches Nationaltheater. Aber ein ganz anderes. Dank unguter Erfahrungen an frankophilen absolutistischen Fürstenhöfen sowieso etwas frankophob orientiert (siehe den satirisch gezeichneten Chevalier de Riccault in seiner ›Minna von Barnhelm‹) und geradezu allergisch gegen Frankreichs spöttischen Vorzeigeintellektuellen Voltaire, hielt Lessing von der französischen Regelpoetik und ihren Backrezepten zur Dramenerstellung überhaupt nichts. Die feudale Ständeklausel war ihm nachgerade eine Beleidigung seines emanzipativen Bürgerstolzes.
Nicht nur das Theater schien Lessing reformbedürftig zu sein, sondern ebenso der absolutistische Ständestaat nebst der bibelbuchstabenhörigen orthodoxen lutherischen Kirche und deren Verdammung der Vernunft. Sein erträumtes Nationaltheater sollte nicht ein Abklatsch des preziösen Hoftheaters von Versailles mit pompös kostümierten Figuren auf hohem Kothurn und geziert geächztem »Helas!« werden, sondern ein Theater der aufgeklärten, also mündigen deutschen Bürger.
Und so schrieb Lessing am 16. Februar 1759 polemisch den epochalen 17. Literaturbrief gegen den nun bald 60-jährigen Frühaufklärer Gottsched, worin er programmatisch dem französischen Regeltheater den Abschied gab:
»Niemand« sagen die Verfasser der Bibliothek, »wird leugnen, daß die deutsche Schaubühne einen großen Teil ihrer ersten Verbesserung dem Herrn Professor Gottsched zu danken habe.«
Ich bin dieser Niemand; ich leugne es gerade zu. Es wäre zu wünschen, daß sich Herr Gottsched niemals mit dem Theater vermengt hätte. Seine vermeinten Verbesserungen betreten entweder entbehrliche Kleinigkeiten, oder sind wahre Verschlimmerungen. […]
Er verstand ein wenig Französisch und fing an zu übersetzen; er ermunterte alles, was reimen und Oui Monsieur verstehen konnte, gleichfalls zu übersetzen; er verfertigte, wie ein Schweizerischer Kunstrichter sagt, mit Kleister und Schere seinen »Cato«; … er legte seinen Fluch auf das extemporieren; er ließ den Harlekin feierlich vom Theater vertreiben … kurz, er wollte nicht sowohl unser altes Theater verbessern, als der Schöpfer eines ganz neuen sein. Und was für eines neuen? Eines Französierenden; ohne zu untersuchen, ob dieses französierende Theater der deutschen Denkungsart angemessen sei, oder nicht.9
Da tönt sie zum ersten Mal deutlich herauf: Die deutsche Denkungsart! Ein Thema, das in der Luft lag. Es ist der Keim all jener Diskurse über den deutschen Nationalcharakter und den deutschen Nationalgeist, die die kommenden Epochen führen werden. Eine wesensmäßig deutsche Art zu denken wird der ganz anderen französischen entgegengehalten. Inkompatibilität wird festgestellt. Und Lessing sagt auch gleich, wo es langgehen soll, wo die deutsche Denkungsart verwandtere Geister findet:
Er hätte aus unsern alten dramatischen Stücken, welche er vertrieb, hinlänglich abmerken können, daß wir mehr in den Geschmack der Engländer, als der Franzosen einschlagen.10
Engländer sind also deutscher als Franzosen. Und hier nun öffnet Lessing mit Fanfaren und Trompeten den Vorhang für den großen historischen Auftritt des William Shakespeare auf der deutschen Bewusstseinsbühne:
Wenn man die Meisterstücke des Shakespeare, mit einigen bescheidenen Veränderungen, unsern Deutschen übersetzt hätte, ich weiß gewiß, es würde von bessern Folgen gewesen sein, als daß man sie mit dem Corneille und Racine so bekannt gemacht hat. Erstlich würde das Volk an jenem weit mehr Geschmack gefunden haben, als es an diesen nicht finden kann; und zweitens würde jener ganz andere Köpfe unter uns erweckt haben, als man von diesen zu rühmen weiß. Denn ein Genie kann nur von einem Genie entzündet werden; … Nach dem »Ödipus« des Sophokles muß in der Welt kein Stück mehr Gewalt über unsere Leidenschaften haben, als »Othello«, als »König Lear«, als »Hamlet« etc.11
Der alte kahlköpfige Shakespeare hielt Einzug in den Kreis moderner Puderperückenträger. Der Engländer wurde in Stellung gebracht gegen das französisierende Theater und überhaupt die französische Kultur. Er sollte nach Lessings Vorstellung das neue Leitbild für die bürgerliche deutsche Denkungsart werden, der er wesensverwandter sei als die Franzosen. Er sollte das feudale ständische Theater verbürgerlichen helfen. Er sollte Freiheit vom französischen kulturellen und politischen Einfluss bringen. Sein englisches Genie sollte das deutsche Genie entzünden und zu sich selbst bringen. Ziemlich viel, was Lessing von ihm erwartete.
Nun sind Shakespeares Stücke in der Tat das glatte Gegenteil all jener nach französischem Regelpoetik-Rezept zusammengerührten Dramen, die literarisch á la mode waren. Sie kennen keine einschnürenden »Gesetze« und »Regeln«. Sie kennen keine Einheit der Zeit, sie zoomen nach Lust und Laune über Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte, ja, über ein Menschenleben hin. Mal schnurrt die reale Stundenzeit in ihnen zu Augenblicken zusammen, mal blähen sich Augenblicke auf, als wären’s Tage. Die »Wirklichkeit« der reinen Spielzeit löst sich auf im Zeitraffer wie slow motion der subjektiv erlebten inneren Zeit der Phantasie.
Sollte es denn jemand in der Welt brauchen demonstriert zu werden, daß Raum und Zeit eigentlich an sich nichts, daß sie die relativeste Sache auf Dasein, Handlung, Leidenschaft, Gedankenfolge und Maß der Aufmerksamkeit in oder außerhalb der Seele sind? Hast denn du, gutherziger Uhrsteller des Dramas, nie Zeiten in deinem Leben gehabt, wo dir Stunden zu Augenblicken, und Tage zu Stunden, Gegentheils aber auch Stunden zu Tagen und Nachtwachen zu Jahren geworden sind?12
– wird später Herder ausrufen in seinem Aufsatz ›Von deutscher Art und Kunst‹.
Und Shakespeares Dramen kennen weiß Gott keine Einheit des Ortes: Sie spielen tatsächlich in der einen Szene »im Walde, in der andern in der Stadt, in der dritten im Kriege und in der vierten in einem Garten oder gar auf der See«. – Was Gottsched als Fehler schulmeisterlich rot anstrich, ist ihr ureigenstes Bauprinzip. Sie springen vom höfischen Boudoir aufs Schlachtfeld, vom Thronsaal in die Bärenhöhle, vom Küstengestade zum Marktplatz, von Hochzeiten zu Friedhöfen. Sie springen zwischen Ländern: z.B. von Rom nach Sizilien, nach Alexandria, nach Athen, nach Rom, nach Syrien zurück, nach Rom, nach Messina, nach Actium, nach Alexandria und wieder nach Rom, im wilden Wirbel der Örtlichkeiten – der nackte Irrsinn in regelpoetischer Sicht. Sie springen aus der wirklichen Welt in Traumwelten, so real wie die wirklichen, und stürzen zurück auf die harte Erde, die so irreal wirkt wie ein Traum. Sie springen im Reden der Personen aus der Gegenwart in die Zukunft und zurück in die Vergangenheit; sie wechseln aus der Realwelt in Möglichkeitswelten. Sie folgen dem Flug kreiselnder Gedanken in die Innenräume der Seele, bohren sich in die Wahnwelten kranker Gehirne. Sie wechseln die Perspektive von Szene zu Szene, verlaufen sich in Irrgärten und taumeln durch Spiegelkabinette der Realitätswahrnehmung.
Und wenn irgendetwas jene Shakespeare-Charaktere auszeichnet, so ist es das völlige, absolute, radikale Fehlen jedweder Einheitlichkeit. Ihr Markenzeichen ist das genaue Gegenteil: Sie sind wahre »Ungeheuer« in ihrer hirnzerquälenden Widersprüchlichkeit, genauso, wie die Menschen eben »in der Natur vorkommen«; ein Geiziger ist niemals nur geizig, sondern weiß um Freigebigkeit; ein Stolzer ist niemals nur stolz, sondern weiß von Demut. Das Wichtigste all dieser Figuren: Sie sind nicht, was sie sind. Sie bleiben nicht, was sie waren. Sie sind in ständiger Wandlung begriffen. Es ist geradezu das Prinzip des alchimistischen Schmelztiegels der shakespeareschen Stücke, dass dort kein Mensch von Anfang bis Schluss er selbst bleibt, sondern durch das Mahlwerk extremer Erfahrungen geht und am Ende als Verwandelter dasteht, ob zum Guten oder zum Bösen, erschüttert in seinem alten Selbst. Wandlung, Verwandlung ist das zentrale, innerste Thema all seiner Texte: Der Mensch ist dort ein sich fließend Umgestaltender, sich immer neu Erfindender in ewigen Verpuppungen und wundersamen neuen Metamorphosen.
Und der allergrößte Affront gegen das französische Regeltheater: Shakespeare beachtet die politisch begründete Ständeklausel nicht. Nicht nur, dass in seinen Stücken erhabene Adelige und banale Bürger zusammen vorkommen – sie treten sogar gemeinsam in den Szenen auf ! Und es erscheinen sogar ganz einfache Leute aus den untersten Volksschichten zusammen mit Königen und Fürsten im Dialog. Und sogar Narren werden mit Königen gesellt – obwohl Gottsched den Hanswurst doch gerade von der Bühne verbannt hatte! Und Könige werden sogar als Narren vorgeführt! Da herrscht kein Respekt vor den höheren Ständen, keine Ehrfurcht, keine Distinktion. Alle Schichten der gesellschaftlichhierarchischen Pyramide werden wild durcheinandergewürfelt und in ihrer Interaktion gezeigt. Die Konflikte der Adeligen werden sogar unten auf der Ebene des gemeinen Volkes parodistisch wiedergespiegelt, so, als ob einer aus dem gemeinen Volk auch Tragödien erleiden könnte wie Fürsten. Helden und Pöbel in ein und derselben Szene! Und in traurigen Tragödien gibt es sogar massenhaft komische Szenen! Im herzerweichenden Romeo und Julia wird das halbe Stück über kräftig gelacht. In Tragödien treten witzereißende Narren auf wie in König Lear; in Hamlet ist der Titelheld selber einer und blödelt herum wie der Komiker auf der Wirtshausbühne. Sogar im düsteren Macbeth kann’s Shakespeare nicht lassen, da tritt ein halb besoffener Pförtner als Narrenfigur auf, der obszöne Kalauer von sich gibt, während oben im Haus König Duncan ermordet wird. Und umgekehrt spukt selbst durch seine burleskesten Komödien wie ein dunkler Schatten die Ahnung, dass die heitere Handlung jederzeit in die Katastrophe, in die Tragödie umschlagen könnte. Tragödie und Komödie werden wüst und wild gemischt und durcheinandergerührt – und das ist nach den französischen Dramenregeln und den fein säuberlichen Unterscheidungen der Genres und der aufklärerischen kühlen Vernunft völlig indiskutabel! Und gleich ganz unmöglich sind übernatürliche Erscheinungen wie Geister von toten Vätern, wie in Hamlet; Ermordete, die aus ihren Gräbern kriechen, wie in Richard III.; Götter auf Adlerflügeln, wie in Cymbeline; Tote, die auferstehen und ihre Mörder verfolgen, wie in Macbeth, Spuk-, Wald- und Elfengeiste, die mit den Menschen ihren bösen Schabernack treiben, wie im johannesnächtigen Sommernachtstraum. Denn das ist gegen die aufklärerische Vernunft. Quel horreur! Quel mauvais goût!
Literaturpapst Gottsched hat sich geschüttelt. Indem er das rationale Regelpoetik-Metermaß an Shakespeares Dramen anlegte, wurden sie ihm zu einer Ansammlung von gröbsten Fehlern – überall Verstöße gegen die Regel. Die Dichtung passte nicht zum Modell – also weg mit der Dichtung. Gottsched war unfähig, ein Werk an sich zu erfassen: Was nicht ins Raster der Regel passte, war für ihn falsch. Über Shakespeares Julius Cäsar schrieb er, das Stück habe so viel Niederträchtiges an sich, dass kein Mensch es ohne Ekel lesen könne:
Sonderlich ist das engländische Theater insgemein in der Einrichtung der Fabel fehlerhaft, als welche größtentheils nichts besser sind, als die altfränkischen Haupt- und Staatsaktionen der gemeinen Komödianten unter uns.13
Für ihn war das Theater ein moralischer Lehrkatheder, kein geistiger Raum der schöpferischen Phantasie und Freiheit. Shakespeares Theater war in jeder nur denkbaren Hinsicht das Gegenteil dessen, was der französische gute Geschmack, die Vernunft und die Regelpoetik verlangten. Als der große Spötter, Vordenker und Dramatiker Voltaire in England erkennen musste, welche Kraft in jener shakespeareschen Regellosigkeit und Phantasie lag, erklärte er in verständlicher Selbstverteidigung, Shakespeare sei ein »betrunkener Wilder«, »ein Monstrum ohne Geschmack«.
»Unser Shakespeare« war bei seinem ersten Auftritt in Deutschland gleich zwei Shakespeares: Shakespeare, der ekelerregende regellose Grobian, und Shakespeare, der die ästhetischen Verhältnisse auf den Kopf stellende rebellische Geistesverwandte der Deutschen, je nach Blickwinkel. Der Grobian war er für die beharrenden Kräfte in den absolutistischen deutschen Rokoko-Landen; ein befreiender Geistesverwandter war er für all jene, die in der deutschen Provinz auch schon von jenem ersten leisen Rumor erfasst waren, der in Frankreich dreißig Jahre später zur Französischen Revolution führen würde. Aber noch konnte man ihn nicht wirklich lesen …
»Wenn man die Meisterstücke des Shakespeare, mit einigen bescheidenen Veränderungen, unsern Deutschen übersetzt hätte …«, hatte Lessing geschrieben.14 Aber man hatte eben noch nicht. Es gab nur erste einzelne Versuche mit »schönen Stellen«, die in Anthologien veröffentlicht wurden. Doch nun, nach Lessings Aufbruchssignal und zunehmendem öffentlichen Interesse am neu ausgerufenen Meister der Dichtung, fand sich jemand, der es wagen wollte: der intellektuelle, faunisch französisch tändelnde Christoph Martin Wieland, der einmal zu einem der Vier Großen der Weimarer Klassik werden sollte und den Napoleon ansprechen würde mit den Worten: »So, Sie sind also der deutsche Voltaire?« Damals war er noch Kanzleiverwalter in seiner Geburtsstadt Biberach an der Riss und hatte Zeit für ein solches Unterfangen – und für das Theater: 1761 führte er mit Laien den Sturm in eigener Übersetzung auf, als erste originalgetreue Shakespeare-Inszenierung in deutscher Sprache.
1762 begann er als 29-Jähriger mit dem gewaltigen Pionierversuch einer Gesamt-Shakespeare-Übersetzung, die viele seiner Zeitgenossen für unmöglich hielten: Ohne Vorbild, ohne Vorgänger, ohne verbesserbares Muster versuchte er, Shakespeare auf Deutsch von Grund auf neu zu erfinden.
Anfangs war er begeistert von seinem Autor (»Welcher Schriftsteller hat jemals so tief in die menschliche Natur gesehen?«).15 In seinem Shakespeare-Enthusiasmus wollte er den Deutschen den »Shakespeare so geben, wie er ist«. Aber dies nahm eine seltsame Wendung: Wo Shakespeare Verse schreibt, übersetzte Wieland nämlich Prosa – was nicht so ganz dasselbe ist, vielmehr einen großen Unterschied verwischt: Shakespeares inhaltliche Differenzierungen durch Prosa und Vers. Und vor allem schrieb Wieland zunehmend empört Fußnoten:
Shakespeare mußte einen Reim auf den vorhergehenden Vers haben, und es ist kein Unsinn, keine Unanständigkeit, die er sich nicht erlauben sollte, um sich nicht lang auf einen Reim besinnen zu müssen …
Der Narr sagt hier etwas so elendes, daß der Übersetzer sich nicht überwinden kann, es herzusetzen …
[es folgen Einfälle], deren Absicht bloß war, die Grundsuppe des Londoner Pöbels lachen zu machen …
Hier folgen etliche Reden im tollhäusischen Geschmack …
… ungereimte Abfälle, aufgedunsene Figuren, frostige Antithesen, Wortspiele und alle nur möglichen Fehler des Ausdrucks …
Ich habe mich genötigt gesehen, einige ekelhafte Ausdrücke wegzulassen …
… die ekelhafte Unsittlichkeit derselben [Szenen] verbietet es uns sie zu übersetzen …16
Das klingt fast wie Voltaire. Wieland kann sich nicht überwinden, solchen Schmutz und Schund »herzusetzen«. Goethe und Herder waren später empört über die Peinlichkeit von Wielands moralinsauren Fußnoten. Wieland wandelte sich im Laufe der Arbeit zunehmend vom Shakespeare-Jünger zum Shakespeare-Kritiker. Er, der geschmäcklerisch verspielte Rokoko-Dichter, fand keinen eigenen Zugang zum Ganzen der dichterischen Renaissancewelt Shakespeares. Mit seinen »vernünftigen« Anmerkungen über das Rohe und Grobe der Texte scheint er sich persönlich von Shakespeares Derbheiten zu distanzieren und ihn zugleich vor seinem Publikum zu entschuldigen: Das Grobianische sei nur Zugeständnis Shakespeares an seine primitive, finstere, mittelalterliche Epoche, sodass man diese nur dem üblen Zeitgeschmack geschuldete Zutat natürlich jederzeit weglassen könne, um den reinen (gereinigten) dichterischen Kern des Genies Shakespeare zu vermitteln. Folglich verkürzte Wieland – insbesondere, wenn er auf »unmoralische« sexuelle Anspielungen traf – immer radikaler, ließ Dialogteile, Auftritte, ganze Szenen aus und schrieb manchmal nur noch kursorische Inhaltsangaben für komplette Akte. Er wollte Shakespeare zwar so, wie er war, dem deutschen Publikum bekannt machen, so, wie Shakespeare (angeblich) der Schnabel gewachsen war, aber ohne das Publikum wegen Anstößigkeiten zu verärgern. Also doch nicht ganz so, wie Shakespeare war. Eher so, wie der Publikumsgeschmack war. Oder wie Wieland, der Dichter der lüstern-lasziven Rokoko-Grazien in griechischem Gewande, ihn einschätzte. Ein Balanceakt der halbherzigen, anpasserischen Eingemeindung, der einigermaßen schiefging. Die Quadratur des Kreises ist schlecht möglich. »Unser« erster deutscher Shakespeare war Aufklärer Wielands Shakespeare – »sein« Shakespeare. Ein literarischer Zwitter. Vielleicht ist es geradezu symbolisch, dass Wieland, der kaum Englisch konnte, kein englisch-deutsches Wörterbuch besaß, sondern nur ein englisch-französisches, Boyers ›Dictionnaire royal francois et anglois‹17: Wieland hat Shakespeare quasi über das Französische rezipiert.
In Gefahr und großer Not / Bringt der Mittelweg den Tod: Die alten Regeltreuen fanden, Wieland hätte viel freier vorgehen, Shakespeares Schmierereien ganz weglassen und mehr dem eigenen Zeitgeschmack entsprechend gereinigt übersetzen müssen. Die jugendlichen Shakespeare-Begeisterten verhöhnten den »Franzennachäffer« Wieland wegen seiner Philisterei und forderten eine genauere, treuere Übersetzung – näher am angeblich wilden, chaotischen, ungeregelten Original.
Es hatte ruckhaft ein Umschwung der öffentlichen Stimmungslage stattgefunden: Die revolutionären Stürmer und Dränger, die jungen Autoren der neuen »Geniezeit« regten sich, denen der aufklärerisch strenge Vernunftgestus zu eng wurde. Weniger Kopf sollte sein, mehr Bauch sollte dazu; weniger Klügeln, mehr Gefühlsüberschwang; weniger gebändigte Sprache, mehr impulsiver Ausbruch aus der Fülle des Herzens; weniger Kasernierung des Verstandes, mehr individuelle Leidenschaft zum Verstand hinzu. Freiheit sollte sein im absolutistischen Ständestaat, im Sturm hinwegfegen wollte man das »tintenklecksende Säkulum« (Schiller). Und die literarische Lichtgestalt dafür sollte den Deutschen statt Frankreichs Racine Englands Shakespeare sein: »Unser« Shakespeare. Unser Verwandter. Unser Landsmann. Der andere Shakespeare, geboren in den schäumenden Phantasien des Sturm und Drang. Die deutsche Shakespearomanie und Eingemeindung begann mit dem Aufbruch der Stürmer und Dränger, die begeistert waren von Shakespeares scheinbarer Formverachtung und angeblich wilder Regellosigkeit. Beflügelt wurde der mit antifranzösischem Gestus gewürzte Shakespeare-Jubel dabei vom arg kritisierten Wieland’schen Shakespeare, der trotz all seiner Mängel und seiner Formverachtung (oder gerade wegen seiner Mängel und seiner Formverachtung) allgemein enorme Shakespeare-Begeisterung hervorrief und ihn in Deutschland überhaupt erst zugänglich machte.
1770 STRASSBURG. IM GASTHOF »ZUM GEIST«. Kein schlechter Begegnungsort für große Geister. Der 21-jährige Jurastudent Johann Wolfgang Goethe trifft dort den bereits berühmten 26-jährigen Theologen, Prediger, Sprach- und Literaturtheoretiker Johann Gottfried Herder. Goethe war schon ein halbes Jahr in Straßburg an der Universität, Herder nur auf der Durchreise, blieb aber wegen eines Augenleidens einige Wochen in der Stadt. In dieser Zeit wurde er, obwohl kaum älter, zum galligen Mentor und aufrüttelnden Inspirator in Goethes Freundeskreis stürmischer junger Männer und Literaten. Man diskutiert über die Schriften von Klopstock und Rousseau, dessen Kampfruf von der »Natur!« revolutionäre neue Gedanken bei jenen befeuerte, die Gefühl und Empfindsamkeit zumindest neben, wenn nicht vor die aufklärerische Vernunft setzen und die schöpferische Kraft der Phantasie beschwören wollten. Herder raunt, von humanistischem Pathos beflügelt, von seinen entstehenden Thesen über Poesie als Ursprache, als »Muttersprache der Menschheit«, über Dichtung aus dem natürlichen Ursprung des Volkes und der natürlichen Volkspoesie. Vor allem aber preist Herder Shakespeare als eines der großen schöpferischen Originalgenies der Welt in den höchsten Tönen, und Goethe wird mit ihm erstmals bekannt.
Die Folgen zeigten sich ein Jahr später, 1771, in der großen ekstatischen, wenn nicht gar delirierenden Rede ›Zum Schäkespears Tag‹18 des jungen, stürmischen Herrn Goethe in Frankfurt, zu dem er extra eingeladen hatte:
Die erste Seite, die ich in ihm las, machte mich auf zeitlebens ihm eigen, und wie ich mit dem ersten Stücke fertig war, stund ich wie ein Blindgeborner, dem eine Wunderhand das Gesicht in einem Augenblicke schenkt. Ich erkannte, ich fühlte aufs lebhafteste meine Existenz um eine Unendlichkeit erweitert, alles war mir neu, unbekannt, und das ungewohnte Licht machte mir Augenschmerzen. Nach und nach lernt ich sehen, und, dank sei meinem erkenntlichen Genius, ich fühle noch immer lebhaft, was ich gewonnen habe.
Shakespeare als rauschhaft religiöses Erweckungserlebnis von der Finsternis zum Licht. In drei Sätzen 13-mal »ich« und »mich« und »mir«. Das deutsche Individuum erwacht, vom Genie berührt, es empfindet sich selbst genialisch ins Unendliche gesteigert, es wird sehend. Man muss sich Lessings eher trockene Absage an Gottscheds und Voltaires Regelpoetik ins Gedächtnis rufen, wenn man zum selben Thema Johann Wolfgangs emphatischen Abgesang stilistisch recht würdigen will – die rationale Kontrolle ist im Leidenschaftsrausch weitgehend aufgegeben:
Ich zweifelte keinen Augenblick, dem regelmäßigen Theater zu entsagen. Es schien mir die Einheit des Orts so kerkermäßig ängstlich, die Einheiten der Handlung und der Zeit lästige Fesseln unsrer Einbildungskraft. Ich sprang in die freie Luft und fühlte erst, daß ich Hände und Füße hatte. Und jetzo, da ich sahe, wieviel Unrecht mir die Herrn der Regeln in ihrem Loch angetan haben, wieviel freie Seelen noch drinne sich krümmen, so wäre mir mein Herz geborsten, wenn ich ihnen nicht Fehde angekündigt hätte und nicht täglich suchte ihre Türme zusammenzuschlagen.
Kerker, Fesseln, Unrecht, Regeln, Loch – freie Luft, freie Seelen, berstende Herzen. Unter der Rokoko-Perücke fühlt der junge Goethe durch Shakespeare erstmals Freiheit, spürt erstmals, dass er einen Körper hat, dass er ein Leibwesen ist, dass ihm bitter Unrecht getan wurde von den Regel-Zuchtmeistern – und er kündigt den herrschenden (literarischen) Herren die Fehde an. Er will im sentimentalen Überschwang auch gleich alles zusammenschlagen, jedenfalls literarisch. Bis zur Französischen Revolution, bei der in Frankreich alles blutig zusammengeschlagen wird, sind es noch achtzehn Jahre.
Gefühlsintensität soll Rationalität ablösen. Besonders die französischen Dichter bekommen ihr Fett ab. Ihre lächerlichen Nachahmungsversuche der großen Griechen seien kläglich gescheitert:
Nun sag ich geschwind hintendrein: Französchen, was willst du mit der griechischen Rüstung, sie ist dir zu groß und zu schwer. Drum sind alle französche Trauerspiele Parodien von sich selbst Und ich rufe Natur! Natur! nichts so Natur als Schäkespears Menschen!
Ein grandioses Missverständnis – aber hier erklingt er nun, der neue sehnsüchtige Schlachtruf der jungen Stürmer und Dränger in perückenplustriger Rokoko-Zeit: Natur! Nichts als Natur! Und Shakespeare IST ihnen Natur. Unverbildet. Vielmehr – er wird dazu gemacht. Er wird zum Kronzeugen und Befreier für die frustrierten Sehnsüchte eines jungen Bürgertums stilisiert, dem es zu eng wird in absolutistischen Rokoko-Residenzen, fern aller imaginierten shakespeareschen freien menschlichen »Natur«:
Und was will sich unser Jahrhundert unterstehen, von Natur zu urteilen. Wo sollten wir sie her kennen, die wir von Jugend auf alles geschnürt und geziert an uns fühlen und an andern sehen.
Eine Jugendrevolte gegen die Alten. Mit Shakespeare auf die Barrikaden. Hamlet, der traumverlorene Dänenprinz, der mit Worten gegen Staatsverbrechen ankämpft, taugt prächtig zur nationalen Identifikationsfigur. Shakespeare wird titanisch erhöht:
Er wetteiferte mit dem Prometheus, bildete ihm Zug vor Zug seine Menschen nach, nur in kolossalischer Größe; darin liegt’s, daß wir unsre Brüder verkennen; und dann belebte er sie alle mit dem Hauch seines Geistes, er redet aus allen, und man erkennt ihre Verwandtschaft.
Shakespeare und Shakespeares Personal: alles unsere Brüder, alles Verwandtschaft. Aus dem Lob Shakespeares klingt Eigenlob: Die »kolossalische Größe« seiner Gestalten macht uns, die wir sie plötzlich erkennen, auch ziemlich groß. Der dichtende englische Prometheus Shakespeare wird dabei neu kostümiert: Als urschöpferischer Naturbursche wird er zum Kronzeugen gegen die falsche, künstlich geregelte, französisierende (Kunst-)Literatur ebenso wie gegen die falschen feudalen politischen Verhältnisse an deutschen Fürstentümern.
»Laßt mir Luft, daß ich reden kann!« – Goethes scheinbar »spontane«, luftschnappende Herzensergießung in brodelnden Satzfetzen ist, wie seine Handschrift zeigt, übrigens rhetorisch sehr sorgfältig komponiert.19
Herder, der später das Viergestirn des klassischen Musenhofes Weimar vervollständigen wird, schreibt zwei Jahre darauf über Shakespeare ähnlich hymnisch-rhapsodisch:
Wenn bei einem Manne mir jenes ungeheure Bild einfällt: »hoch auf einem Felsengipfel sitzend! zu seinen Füßen, Sturm, Ungewitter und Brausen des Meers; aber sein Haupt in den Strahlen des Himmels!« so ist’s bei Shakespeare! – Nur freilich auch mit dem Zusatz, wie unten am tiefsten Fuße seines Felsenthrones Haufen murmeln, die ihn – erklären, retten, verdammen, entschuldigen, anbeten, verleumden, übersetzen und lästern! – und die Er alle nicht höret!20
Das großgeschriebene Personalpronomen Er vergöttlicht Shakespeare endgültig. Ein grandioses, aber sehr fruchtbares Missverständnis. Vorbei ist es für die Literaten mit den alten gesellschaftlichen Klassifizierungen in Bauer, Bürger, Edelmann: Die »Größe« und Stellung eines Menschen misst sich nur noch am »Genie« des Einzelnen, der als Weltenschöpfer seiner Werke hoch erhaben ist über Lob und Tadel. Nicht Regelpoetik nach dem Maß der Griechen und Franzosen, sondern Naturpoetik nach dem organischen Maß der gewachsenen, individuellen nationalen Wesensarten sollte bestimmend sein. Herders Shakespeare-Aufsatz, betitelt ›Von deutscher [sic!] Art und Kunst‹, wird zum Manifest der Revolution des Sturm und Drang. »Kunst« und »Natur« werden Antagonisten in den stürmischen ästhetischen Debatten: Künstler ist nicht der, der die Natur kunstvoll nachahmt – das ist Natur aus zweiter Hand; Künstler ist nur der, der »original« wie die Natur selbst neue »Natur« schöpferisch erschafft. Genauso wie Shakespeare. Dieser verkörpert für Herder »das menschgewordene Schöpfertum des Lebens. Seine Kunst ist darum Natur, wie ihre Gesetze als Naturgesetze gelten müssen.«
Die Antithese, in die man Shakespeare packt, lautet: »Natur gegen Kunst«. Wobei Shakespeares Kunst die wahre »Natur« ist. Im neuen Shakespeare-Kult vermengen sich erwachender Nationalgedanke und Literatur: Die Vorstellung von der organischen »Natur« wird als Ursprung aller Volksdichtung verstanden, wie sie in den unterschiedlichen Sprachnationen verfasst wird. Die Vorstellung vom »großen« schöpferischen Originalgenie, das wie die Natur (oder Gott oder Prometheus) Neues erschafft, verschmilzt mit vagen revolutionären Phantasien des sich emanzipierenden Bürgertums zu einem neuen Lebensgefühl. Shakespeare macht’s angeblich vor. Das menschlich Subjektive und Individuelle wird zum Kriterium: Vernunft und Gefühl sollen sein, Hirn und Herz, intensiv, spontan und empfindsam, »ganzheitlich«, würde man heute sagen.
Das Shakespeare-Erweckungserlebnis in Straßburg hat jedenfalls schöpferische Folgen: Goethe konzipiert noch dort sein historisches Stück ›Götz von Berlichingen‹ und bringt es in Frankfurt in einem Schreibrausch zu Papier. Goethe macht radikal ernst mit dem Shakespeareschen Modell und sprengt gleich alle klassisch-französischen Konventionen von Zeit und Ort: Es werden über 50 rasende Szenen, vom Kaiserhof geht’s zum Feldlager, vom Wald ins Wirtshaus, von der Ritterburg zur Bischofsresidenz, vom Zigeunerlager zum Turmverlies, vom Dorf ins Gebirge, von Augsburg nach Bamberg, von Heilbronn nach Jagsthausen – das Stück wurde ein Skandal und ein riesiger Erfolg in jugendlichen Kreisen. »Die Welt ist ein Gefängnis«, heißt es da hochfahrend auf Deutsch. Wie in Shakespeares Hamlet, aber gleich eine Nummer größer: Dort hieß es noch etwas bescheidener nur: »Dänemark ist ein Gefängnis.« Hier im ›Götz‹ klang in wilder Sprache ganz unalexandrinisch-wielandisch der angeblich unverfälschte Shakespeare-Prosa-Ton der neuen Zeit: »Sag deinem Hauptmann: Vor Ihro Kaiserliche Majestät hab ich, wie immer, schuldigen Respekt. Er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsche lecken!« Sogar Herder wurde dieser sogenannte ›Ur-Götz‹ zu heftig: »Dass euch Schäckespear ganz verdorben«, nörgelt er gallig, und Goethe schreibt gehorsam glättend um.
Rebellion auf den Bühnen: 1776 wird zum allerersten Mal Hamlet auf einer deutschen Bühne aufgeführt,





























