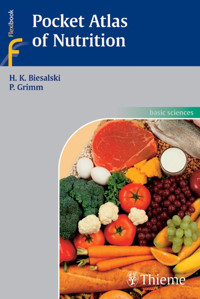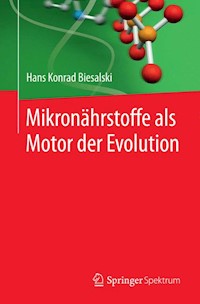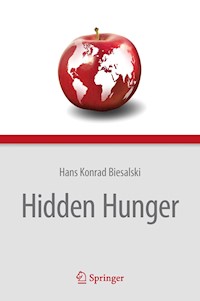19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das neue Wissen über gesunde Ernährung, verborgenen Hunger und sinnlose Diäten
Um Ernährung kommen wir nicht herum, sie begleitet uns das ganze Leben – wir haben tatsächlich eine Ernährungsbiografie - auch wenn uns das nur selten bewusst ist. Je nach Alter favorisieren wir einen bestimmten Lebensstil und probieren immer wieder neue Ernährungsformen oder Diäten aus. Dabei kann es zu folgenschweren Mangelerscheinungen kommen, die uns dick und krank machen. Endlich ein Buch, das die Vor- und Nachteile der wichtigsten Diäten und Ernährungsratschläge umfassend analysiert. Hans Konrad Biesalski, der renommierte Ernährungsmediziner, erklärt, wie wir unsere Ernährungsbiografie so gestalten, dass wir gesund bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Zum Buch
Das neue Wissen über gesunde Ernährung, verborgenen Hunger und gesundes Übergewicht:
• Was und wie viel wir essen, ist kein Zufall. Und was das Essen mit uns macht, auch nicht. Jeder hat eine individuelle Ernährungsbiografie.
• Es gibt fertige Kapitel in unserer Ernährungsbiografie und solche, die wir bis ins hohe Alter verändern können.
• Die ersten 1000 Tage prägen: Jene Kapitel am Beginn unserer Ernährungsbiografie schreiben Mutter, Vater und zum Teil sogar unsere Großeltern.
• Doch wir essen ein Leben lang – mehr oder weniger bewusst. Nur wer seine Ernährungsbiografie kennt, kann sie gezielt beeinflussen.
• Schluss mit dem Ernährungsstress: Denn kaum etwas ist so ungesund wie die Verbindung von Essen und Stress.
Zum Autor
Hans Konrad Biesalski, 1949 in Marburg geboren, studierte zunächst Physik und absolvierte anschließend das Medizinstudium an den Universitäten Bonn und Mainz. Seit 1995 leitet er als Ernährungsmediziner das Institut für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft der Universität Hohenheim. Seit 2014 ist er Direktor des Food Security Center. Biesalski forscht seit 30 Jahren über die Bedeutung von Mikronährstoffen für die Gesundheit und hat zahlreiche Lehrbücher veröffentlicht, u. a. den »Taschenatlas Ernährung«.
Weitere Informationen zu unserem Programm und Leseproben ausgewählter Titel unter www.knaus-verlag.de
Prof. Dr. Hans Konrad Biesalski
UNSERE ERNÄHRUNGS-BIOGRAFIE
Wer sie kennt, lebt gesünder
Unter Mitarbeit vonSusanne Warmuth undOliver Domzalski
Knaus
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1: Das 1000-Tage-Fenster
Wie unser Ernährungstyp geprägt wird
Das 1000-Tage-Fenster und die »Wettervorhersage«
Klein geboren und stattlich gewachsen: Die Rolle des Geburtsgewichts
Kapitel 2: Nachträgliche Veränderung des Genoms – wie geht das?
Das Phänomen der Epigenetik
Epigenetik: Das Nachjustieren des genetischen Programms
Was uns Väter, Mütter und Großeltern unter der Hand vererben
Kapitel 3: Makro und Mikro: Die Nährstoffe
Was sind Mikronährstoffe?
Wozu brauche ich Mikronährstoffe?
Wo bekommen wir unsere Mikronährstoffe her?
Woran erkenne ich einen Mangel?
Kapitel 4: Von Hunger, Appetit und Sättigung
Von Hungermachern und Appetitbremsen
Das egoistische Gehirn
Hormone und Hunger
Zuckerbrot und Salami: Unser Belohnungssystem als Mittel zum Zweck
Wie schmeckt’s?
Kapitel 5: Übergewicht – na und?
Übergewicht – Wahrheit und Mythos
Das Fettgewebe – ein unterschätztes Organ
Abnehmen im Alter?
Was soll ich, was kann ich tun?
Kapitel 6: Was tun?
Wenn es ein »Set« gibt, sollte es auch ein Reset geben
Was heißt gesunde Ernährung?
Wie soll ich mich denn nun ernähren?
Noch mal: Was ist gesunde Ernährung ?
Welche Rolle spielt die Fitness?
Schwangerschaft
Schlusswort
Anhang
Quellen
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
zu Beginn hier einmal vier seit Jahrzehnten feststehende Wahrheiten zum Thema Ernährung:
Wer dick ist, bekommt verschiedene Stoffwechsel-/Zivilisationskrankheiten und stirbt früher.Wer schlank ist, ist gesund und lebt länger.Dicke müssen abnehmen.Abnehmen (und Gewicht halten) ist nur eine Frage des Willens.Leider ist allen vier Weisheiten gemeinsam, dass sie sich mittlerweile als falsch entpuppt haben.
Das ist dramatisch, weil sich zumindest die Bewohner der reichen Nationen ja seit einigen Jahrzehnten erstmals in der Menschheitsgeschichte nicht mehr fragen müssen »Wie verhindere ich, dass ich verhungere?«, sondern »Wie ernähre ich mich richtig?«. Ausgerechnet in dem Moment, in dem unsere Ernährung erstmals keine existentielle Überlebensfrage mehr ist, haben wir sie zu einem hoch komplizierten Puzzle aus Gesundheitsfragen, Halbwissen und Lifestyle und religionsähnlichen Überzeugungen gemacht. Die Menschen beschäftigen sich massenhaft mit ihrer (meist inexistenten) Gluten- und Laktose-Unverträglichkeit, ernähren sich vegan oder kämpfen – meist vergeblich – gegen vermeintliches oder tatsächliches Übergewicht. Deshalb ist es so wichtig, neue, teilweise verblüffende Erkenntnisse der Wissenschaft bekannt zu machen.
Die neueste Forschung ermöglicht ein ganz neues Bild davon, was in den Zellen unseres Körpers vor sich geht, wenn wir Nahrung aufnehmen und verarbeiten – und was das mit unseren Genen zu tun hat.
In den vergangenen Jahren sind vor allem das Phänomen der Epigenetik und die Ernährungsbiografie in den Fokus gerückt. Was bedeutet »Biografie« in diesem Zusammenhang? Nun, wir sind bekanntlich geprägt durch die Umstände, in die wir hineingeboren wurden, sowie durch das, was seit der Geburt passiert ist. Und je besser wir wissen und verstehen, was bisher geschehen ist, desto eher können wir beeinflussen, wie es weitergeht. Ein Beispiel: Nur, wer sich darüber bewusst ist, dass er unter seinem dominanten Vater gelitten hat, versteht auch, warum er bei bestimmten Aussagen seines Chefs oder seines Partners schier aus der Haut fährt. Und er kann daran arbeiten, sich im Griff zu haben. Ähnlich ist es mit unserer Ernährungsbiografie. Wir haben natürlich eine genetische Prägung – wir gehören der Spezies »Homo sapiens« an, deren genetischer »Bauplan« sich allenfalls unmerklich langsam verändert. Unsere »Grundausstattung« ist seit Hunderttausenden von Jahren fast gleich – obwohl unsere Lebensumstände sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten dramatisch verändert haben. Wäre unser Genom, also unsere genetische »Grundausstattung« allerdings vollkommen unflexibel, wären wir längst ausgestorben. Hier kommt die erst in jüngster Zeit allmählich verstandene Epigenetik ins Spiel: Damit ist das Phänomen gemeint, dass das Genom eines entstehenden Organismus auf Umwelteinflüsse reagiert, auch wenn das Erbgut sich dadurch nicht verändert. So »erfährt« der Fötus im Mutterleib durch die Ernährung der Mutter, ob er in eine Situation des Nahrungsmangels oder des Überflusses hineingeboren wird. Durch flexibles »An- und Abschalten« der entsprechenden Gene stellt der Organismus sich auf das zu erwartende Leben ein und wird entweder zu einem »guten Kostverwerter«, der trotz verzweifelter Diätanstrengungen um jeden Preis Fett speichert und wenig Energie verbraucht, oder zu einem eher schlanken »Energieverschwender« – einem dieser Menschen, die regelmäßig drei Portionen Tiramisù verdrücken können und trotzdem nicht zunehmen.
Unsere individuelle Ernährungsbiografie wirkt sich auf vieles aus: z. B. den Appetit, die Anfälligkeit für Krankheiten, die Figur, das Belohnungssystem im Gehirn und die Reaktion auf Stress. Und sie hängt nicht nur mit der Prägung im wichtigen »1000-Tage-Fenster«, also der Schwangerschaft und den ersten beiden Lebensjahren zusammen. Entscheidend ist auch, wie gut wir versorgt werden mit den wichtigen Bestandteilen der Nahrung. Und dazu gehören nicht nur die »Grundbausteine«, also Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett, sondern auch die entscheidend wichtigen Mikronährstoffe wie Vitamine, Minerale etc. Die Frage, wie die Versorgung mit Mikronährstoffen sichergestellt werden kann, ist in der Vergangenheit vielfach zu kurz gekommen. So birgt der vollständige Verzicht auf Fleisch das Risiko einer Unterversorgung mit lebenswichtigen Substanzen – gerade bei Schwangeren und Säuglingen.
Dieses Buch erklärt die verblüffenden Zusammenhänge und Erkenntnisse rund um unsere Ernährungsbiografie und gibt Hinweise, wie wir klug mit unseren Anlagen umgehen und diese sogar noch nachträglich beeinflussen können. Es beantwortet die Frage, in welchen Fällen Übergewicht tatsächlich ein Problem ist, mit wie vergleichsweise geringen Anstrengungen wir die Fitness unseres Organismus verbessern können – aber auch, was sich hinter dem »verborgenen Hunger« verbirgt und welche ungeahnten Probleme wir uns und unseren Kindern durch Diäten und Ernährungsmoden einhandeln können.
Nicht alle Ernährungsmoden können allerdings in diesem Buch behandelt werden. Vieles entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage – beispielsweise die Vorstellung einer »Übersäuerung« des Organismus und die angeblich dagegen helfende Trennkost. Oder die Vorstellung, der Körper müsse regelmäßig durch Fasten »entschlackt« und »entgiftet« werden. Oder die Idee einer »Blutgruppendiät«.
Die im Buch behandelten biochemischen Prozesse und Phänomene sind teilweise ziemlich kompliziert, und manche werden gerade erst verstanden. Wir werden uns auf das konzentrieren, was für wissenschaftliche Laien nachvollziehbar und relevant ist. Wer trotzdem mal einen oder mehrere Abschnitte überblättert, weil er oder sie es so genau nicht wissen möchte, hat unser Verständnis. Und wer es noch genauer wissen will, sei auf Fachliteratur verwiesen.
Im 1. Kapitel schauen wir uns an, was während des 1000-Tage-Fensters geschieht und unsere Ernährungsbiografie prägt.
Im 2. Kapitel betrachten wir das faszinierende Phänomen der Epigenetik, das unsere seit Darwin bestehende Vorstellung von Vererbung entscheidend ergänzt hat.
Im 3. Kapitel widmen wir uns den Bestandteilen unserer Nahrung und ihren besten Quellen: den energiespendenden Makronährstoffen (Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß) und den ebenso lebenswichtigen Mikronährstoffen, also Vitaminen, Mineralen und sonstigen Verbindungen.
Im 4. Kapitel gehen wir dem Hunger und dem Sättigungsgefühl auf den Grund – hier hat der moderne, mit dauerndem Nahrungsüberfluss »gesegnete« Mensch am meisten zu kämpfen mit seinen genetischen Wurzeln, die noch aus Zeiten der Knappheit kommen und ihn zu einem meisterhaften Speicherer von Energie gemacht haben. Und wir entlarven unser Gehirn als ausgesprochen egoistischen Regisseur unseres Essverhaltens.
Im 5. Kapitel werfen wir die heikle Frage auf, wie es eigentlich um das Übergewicht steht. Ist es tatsächlich der Übeltäter, der uns krank macht? Oder muss man etwas genauer hinschauen?
Im 6. Kapitel schließlich beantworten wir die Frage »Was tun?«: Wie kann ich als Mensch des 21. Jahrhunderts, der nicht mehr für jeden Bissen durch den Wald oder die Savanne toben muss, mich vernünftig ernähren und einen gesunden Lebensstil pflegen? Sie werden merken: So kompliziert und entbehrungsreich, wie manche behaupten, ist eine gesunde Ernährung keineswegs.
Am Ende des 6. Kapitels geben wir außerdem ein paar gezielte Hinweise für die Zeit der Schwangerschaft – während der die Mutter ja nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Versorgung des heranwachsenden neuen Lebewesens verantwortlich ist.
Mein besonderer Dank gilt dem Knaus Verlag, der sich vom Thema »1000-Tage-Fenster« hat anstecken lassen. Die fachliche Betreuung durch das Lektorat von Frau Dr. Susanne Warmuth hat viele Stolpersteine beseitigt und in anregenden Diskussionen zum Verständnis komplexer Inhalte beigetragen. Nicht zuletzt ist es dem Lektorat von Dr. Oliver Domzalski zu verdanken, dass manches Fragezeichen in ein Ausrufezeichen gewandelt werden konnte und der Leser so weniger ins Grübeln kommen muss.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre – und als Ergebnis ein möglichst entspanntes Verhältnis zum Essen. Denn Stress und Ernährung sind keine gesunde Kombination.
Hans Konrad Biesalski
Stuttgart, im Februar 2017
Kapitel 1: Das 1000-Tage-Fenster
Wie unser Ernährungstyp geprägt wird
Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir zwar klein und unschuldig, aber keineswegs unbeschriebene Blätter: Zum einen haben wir in der Regel bereits neun Monate im Körper eines anderen Lebewesens zugebracht, das wir schon bald »Mama« nennen werden und das uns via Nabelschnur bereits erste Vorgaben mit auf den Lebensweg gegeben hat. Zum anderen ist in jeder unserer Körperzellen das Erbe von sechs Millionen Jahren Menschheitsgeschichte hinterlegt (genau genommen sind es sogar vier Milliarden Jahre Geschichte des Lebens auf der Erde, denn manche elementaren Lebensprozesse teilen wir mit allen anderen Organismen dieses Planeten). Unser genetisches Programm hat sich im Laufe der Evolution entwickelt (und entwickelt sich immer weiter), um das Überleben unserer Art zu gewährleisten. Die Gene, die Reproduktion und Überleben sichern, haben sich dabei in einer sich immer wieder verändernden Umwelt durchgesetzt. Dies gilt auch für die Ernährung, die ja ein Teil der Umwelt ist. Wir wissen heute, dass unter den frühen Menschen sowohl reine Pflanzenfresser als auch Allesfresser (Omnivore) waren. Die reinen Pflanzenfresser aus der Reihe der Hominini sind jedoch vor etwa 1,5 Millionen Jahren ausgestorben, während die Omnivoren überlebt haben. Was wir in uns tragen, ist das Erbe der überlebenden Spezies: der omnivoren Frühmenschen.
Mithilfe der Genetik konnte man feststellen, dass der menschliche Stoffwechsel und auch der der meisten Tiere darauf eingestellt ist, längere Hungerperioden zu überstehen. In einer Zeit, in der man von dem leben musste, was die Natur aktuell im Angebot hatte, war das ein unschätzbarer Vorteil. In unsicheren Zeiten gilt bekanntlich die Maxime: Hamstern, Bunkern, Sparen. Und über den allergrößten Teil der menschlichen Evolution waren die Zeiten vorwiegend unsicher. Unser Organismus ist daher eher auf wiederkehrende Energieknappheit als auf dauerhaften Überfluss eingestellt. Damit die Stoffwechselmaschinerie aber trotzdem immer einigermaßen gleichmäßig arbeitet, muss der Körper mit Schwankungen in der Energieversorgung zurechtkommen und den vorhandenen Brennstoff so »verwalten«, dass stets die richtige Menge für den aktuellen Bedarf in Umlauf ist. Diese »Verwaltung« (= Regulation) der Energieversorgung erfolgt im Wesentlichen über drei Hebel:
Nahrungsaufnahme: erhöhen oder vermindernFettspeicher: anlegen oder anzapfenEnergieverbrauch: erhöhen oder senkenHeute verkehrt sich der Vorteil des in unseren Genen verankerten Umgangs mit Nahrungsmangel für viele Menschen jedoch in einen Nachteil, da Nahrung – zumindest in den Industrienationen – immer und überall mehr als ausreichend verfügbar ist und wir uns dafür nicht einmal groß anstrengen müssen. Daran sind wir noch nicht angepasst, denn die Mühlen der Evolution mahlen langsam. Dass unser Erbgut noch auf Steinzeit optimiert ist, während sich unser Körper im digitalen Zeitalter befindet, gilt als ein Grund für die Zunahme bestimmter gesundheitlicher Probleme. (Allerdings hilft die sogenannte Steinzeit- oder Paleodiät wenig dabei, dieses Problem zu beheben, wie ich im Kapitel 6 erläutern werde.)
Bei der Geburt sind wir also zweifach vorgeprägt: individuell durch unsere Eltern, insbesondere unsere Mutter, und allgemein durch unsere Zugehörigkeit zur Spezies »Mensch«. Aber woher wissen wir eigentlich, was genau unsere Ernährungsbiografie prägt? Schließlich können weder unsere Vorfahren noch Neugeborene uns direkt Auskunft geben.
Forscher sehr unterschiedlicher Disziplinen haben in den letzten Jahren unglaublich viele neue, spannende Erkenntnisse gewonnen und zusammengetragen. Mit der fernen Vergangenheit beschäftigen sich Evolutionsbiologen und Anthropologen. Sie erforschen die Ernährung unserer Ahnen und betrachten dabei mit den unterschiedlichsten Methoden den Zeitraum von vor sieben Millionen Jahren bis zur Ankunft der modernen Menschen im heutigen Europa. Als wichtigstes Beweismaterial dienen ihnen Zähne dieser entfernten Vorfahren. Knochen und Zähne bleiben selbst nach so langer Zeit erhalten – und sie tragen die »Signatur« der Nahrung in sich. Wie ist das zu verstehen? In der Natur gibt es von allen chemischen Elementen verschiedene Varianten, die sogenannten Isotope – so auch für Kohlenstoff und Stickstoff, zwei der wichtigsten Bausteine für alles Lebendige. Die Mengenverhältnisse dieser vom Körper aufgenommenen und in die Zähne und Knochen eingebauten Isotope verraten uns auch Millionen Jahre später, welche Art Nahrung ein Lebewesen bevorzugt hat. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise eine grobe Unterscheidung zwischen Liebhabern einer pflanzlichen oder einer tierischen Kost treffen. Auch aus dem Aufbau des Kiefers und aus der Form und den Abriebspuren der Zähne können Rückschlüsse gezogen werden, was ihr früherer Besitzer damit einmal gekaut hat. Breite Mahlflächen etwa sprechen für pflanzliche, ausgeprägte Reißzähne für fleischliche Nahrung.
Molekularbiologen können dank moderner Methoden aus den Genen vieles über die besonderen Anlagen eines Lebewesens herauslesen – etwa, ob es in der Lage ist, Milch oder Fruchtzucker zu verdauen. Und diese Methoden ermöglichen es auch, weit in die Vergangenheit zu blicken: Durch DNA-Analysen und den Vergleich des Erbmaterials verschiedener Arten konnte man beispielsweise feststellen, dass unsere sehr frühen Vorfahren vor etwa 40 Millionen Jahren die Fähigkeit zur Vitamin-C-Synthese verloren haben, also die Möglichkeit, diesen überlebenswichtigen Mikronährstoff selbst aus Glukose (Traubenzucker) zu erzeugen.
Die Zusammenhänge zwischen den Lebensumständen von Müttern (aber auch Vätern und sogar Großvätern) und der späteren Gesundheit der Kinder schließlich untersuchen Epidemiologen, also Wissenschaftler, die sich mit der Häufigkeit und der Verbreitung von Krankheiten beschäftigen. Sie erfassen zunächst einmal rein statistisch, ob z. B. Kinder, deren Väter rauchen, häufiger an Asthma erkranken als Kinder von Nichtrauchern, oder ob Kinder von adipösen, also stark übergewichtigen Müttern später im Leben häufiger Diabetes bekommen als die Kinder normalgewichtiger Mütter. Aus solchen Erhebungen und dem Vergleich verschiedener Umstände und Bevölkerungsgruppen zeichnet sich immer deutlicher ab, dass nicht nur die Ernährung der Mutter vor und während der Schwangerschaft, sondern auch die Ernährung des Kindes selbst während seiner ersten beiden Lebensjahre entscheidenden Einfluss auf seine Gesundheit im Erwachsenenalter hat. Bekannt wurde dieses Phänomen unter dem Schlagwort »1000-Tage-Fenster«. In dieser Zeit wird ganz ohne unser Zutun das erste Kapitel unserer Ernährungsbiografie geschrieben.
Das 1000-Tage-Fenster und die »Wettervorhersage«
Warum sollen ausgerechnet die ersten 1000 Tage im Leben so wichtig sein? Diese griffige, gerundete Zahl ergibt sich aus 266 Tagen Schwangerschaft (durchschnittlicher Zeitraum zwischen Zeugung und Geburt) plus 365 Tage im 1. Lebensjahr plus 365 Tage im 2. Lebensjahr.
Auf die Spur kam man dem prägenden Einfluss dieses Zeitraums bereits in den 1960er Jahren durch Untersuchungen an mangelernährten und häufig kleinwüchsigen Kindern in Mittelamerika und in Afrika. Programme, mit denen die Kinder gesünder ernährt werden sollten, wirkten sich nur dann positiv auf die Entwicklung und das Längenwachstum der Kinder aus, wenn sie gleich nach der Geburt (über die Versorgung der stillenden Mutter) oder spätestens vor dem Ende des zweiten Lebensjahres einsetzten. Noch besser für die Entwicklung des Kindes war es, wenn bereits die Mutter während der Schwangerschaft gesunde, das heißt für den besonderen Bedarf ausreichende Ernährung bekam. Begann die bessere Ernährung des Kindes erst nach dem Ende des zweiten Lebensjahrs, ließen sich die Entwicklungsstörungen nicht mehr vollständig rückgängig machen (obwohl gewisse Korrekturen auch später noch möglich sind).
Wie genau sich die Ernährung während der Schwangerschaft und der Stillzeit auf die Entwicklung des Kindes auswirkt und warum sich Fehlentwicklungen nur innerhalb eines begrenzten Zeitraums, bis zum Ende des zweiten Lebensjahres, rückgängig machen lassen, war allerdings bis vor Kurzem völlig rätselhaft. Erst in den letzten Jahren konnten mehr und mehr Fragen beantwortet werden – auch wenn weiterhin viele offen sind.
Generell kennt der im Mutterleib heranwachsende Organismus zwei Möglichkeiten, auf Nahrungsmangel zu reagieren: Zum einen gibt es die sofortige Antwort, die in einer kritischen Situation zunächst einmal das schiere Überleben von Mutter und Kind sichert. So wird der Fötus bei plötzlicher Nahrungsknappheit vorrangig Gehirn und Herz versorgen – notfalls auch auf Kosten des Längenwachstums und der Entwicklung anderer Organe. Wenn die Nahrungsknappheit gravierend ist und länger anhält, kann sie also die Gesundheit des Kindes dauerhaft gefährden. Zum anderen gibt es die vorausschauende (»adaptive«) Antwort mit entsprechender Anpassung des entstehenden Organismus an die zu erwartende Mangelsituation. Hierbei entsteht der scheinbar paradoxe Zusammenhang zwischen der Ernährungssituation der werdenden Mutter (und damit der Versorgung des Fötus) und dessen späterer Konstitution, der so vielen Menschen in Form von Übergewicht zu schaffen macht: Kinder, deren Mütter gehungert haben, neigen später eher zum »Bunkern« des Energieträgers Fett – und unter bestimmten Umständen auch zu »Zivilisationskrankheiten« wie Fettleibigkeit (Adipositas), Bluthochdruck und Diabetes.
Hunger und Überfluss – den Zivilisationskrankheiten auf der Spur
Mehr oder weniger lange Mangelperioden oder echte Hungersnöte waren bis vor hundert Jahren auch in der westlichen Welt an der Tagesordnung. Neben Wetterkapriolen und Kriegen brachten Armut und Misswirtschaft die Menschen immer wieder in Not. Erst die beiden Erfindungen Kühlschrank und Kunstdünger sowie der wachsende Wohlstand der Industriegesellschaften haben die regelmäßige und sichere Versorgung mit ausreichenden Kalorienmengen weitgehend sichergestellt. Als Wissenschaftler die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen von Hungerkatastrophen untersuchten, kamen sie hochinteressanten Mechanismen auf die Spur, die auch und gerade für unsere – heute – übersättigten Wohlstandsgesellschaften relevant sind.
Den Stein ins Rollen brachten 1986 David Barker und Clive Osmond, zwei britische Epidemiologen. Ihnen war bei einer Studie über Menschen, die zwischen 1921 und 1925 geboren worden waren, aufgefallen, dass in armen Landstrichen von England und Wales die koronare Herzkrankheit, also eine Verkalkung der Herzkranzgefäße, häufiger als Todesursache auftrat als in begüterten Regionen – obwohl andere Untersuchungen doch einen direkten Zusammenhang zwischen zunehmendem Wohlstand und der steigenden Zahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu zeigen schienen. Gleichzeitig stellten sie fest, dass die Kindersterblichkeit in den 1920er Jahren in armen Familien höher gewesen war als in reicheren. Die Forscher zogen daraus den Schluss, dass armutsbedingte Mangelernährung in der Schwangerschaft einerseits für die damals hohe Kindersterblichkeit, andererseits aber für die späteren Herzprobleme der überlebenden Kinder, also für eine vermeintliche »Wohlstandskrankheit« verantwortlich war.
Ein Vergleich der Geburtsgewichte mit den späteren Todesursachen bestätigte die Befunde: Ein niedriges Geburtsgewicht führte später zu mehr Todesfällen infolge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Männer) und Diabetes (Frauen) als ein normales oder hohes Geburtsgewicht. (Grundlage dieser Hertfordshire-Studie waren übrigens Daten, die auf Initiative von Ethel Margaret Burnside, der ersten britischen »Gesundheitsbeobachterin und Inspektorin von Hebammen«, erhoben worden waren: Ab 1911 wurden die Familien Neugeborener regelmäßig einmal im Monat besucht, wobei man neben dem Geburtsgewicht und dem Gewicht im ersten Lebensjahr auch die Ernährung und den Entwicklungszustand erfasste.)
Nach dem überraschenden Befund, dass Menschen, die aus armen Verhältnissen stammten, später häufiger an »Wohlstandskrankheiten« litten, untersuchten viele Forscher einige der großen Hungerkatastrophen im 20. Jahrhundert, so z. B. den holländischen Hungerwinter 1944/45 und die Blockade von Leningrad (1941–1944).
Als »Vergeltung« für Streiks und Sabotageakte der niederländischen Eisenbahner begrenzten die deutschen Besatzer im September 1944 die Nahrungslieferungen in den westlichen Teil der Niederlande. Dazu kam einer der längsten und kältesten Winter, die Europa je erlebt hatte. Von Dezember 1944 bis Mai 1945, also sechs Monate lang, hatten Niederländer aller sozialen Klassen nicht mehr als 400–800 Kalorien pro Tag zu essen; erst nach der Befreiung im Mai 1945 standen ihnen dann wieder mindestens 2000 Kalorien zur Verfügung. Die Untersuchung von Menschen, deren Mütter in diesem Hungerwinter schwanger gewesen waren, zeigte, dass sie als Erwachsene häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen litten als Personen, die mehrere Monate vor oder gegen Ende der Hungersnot gezeugt wurden. Bemerkenswert war dabei, dass das höhere Krankheitsrisiko vor allem Kinder von Müttern betraf, die in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft hungern mussten, und weniger solche, bei denen der Hunger zu einem späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft auftrat. Offenbar werden die Weichen für die erhöhte Neigung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen also in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft gestellt.
Andere Folgen für die Überlebenden hatte der grausame Versuch der deutschen Wehrmacht, die Bevölkerung des eingeschlossenen Leningrad von September 1941 bis Januar 1944 auszuhungern. Im ersten Jahr der Blockade hatte ein Bewohner durchschnittlich 300 Kalorien pro Tag zur Verfügung. Über eine Million Leningrader fielen diesem Massenmord zum Opfer. Was aber geschah mit den Überlebenden? Lange nach dem Krieg untersuchte man drei Gruppen von Erwachsenen: erstens die, deren Mütter während der Schwangerschaft an Mangelernährung gelitten hatten; zweitens diejenigen, die vor Beginn der Blockade geboren worden waren; und drittens die, die außerhalb von Leningrad zur Welt gekommen waren. Überraschenderweise zeigten sich kaum Unterschiede bei Diabeteshäufigkeit und Übergewicht. Die Erklärung hierfür war, dass es sowohl vor als auch nach den prägenden 1000 Tagen (zu) wenig zu essen gegeben hatte. Wer den Mangel während der Schwangerschaft und frühen Kindheit überstanden hatte, hatte offensichtlich weniger Probleme mit koronarer Herzkrankheit, Diabetes und Übergewicht als die Kinder des holländischen Hungerwinters. Letztere hatten als Neugeborene plötzlich wieder genug zu essen, die Neugeborenen in Leningrad dagegen waren weiter mit Mangelernährung konfrontiert. Wie dieser Mechanismus funktioniert, lesen Sie weiter unten in den Abschnitten über die »Wettervorhersage«. Zuvor müssen wir uns aber mit der Frage befassen, wie die Prägung des ungeborenen Kinds und seines späteren Ernährungsverhaltens eigentlich funktioniert.
Die ersten neun Monate: Entwicklung im Mutterleib
Das 1000-Tage-Fenster öffnet sich mit der Empfängnis (die Mediziner sagen »Konzeption«), also der Befruchtung der weiblichen Eizelle durch eine männliche Samenzelle. In den folgenden 56 Tagen, also der ersten bis achten Woche, passiert unglaublich viel: Quasi aus dem Nichts entstehen alle Strukturen, die einen Menschen ausmachen. Damit am Ende alle Systeme des Körpers funktionieren, müssen Molekülbausteine aufgebaut und in der richtigen Weise zusammengefügt werden. Das klappt nur, wenn die genetischen Baupläne in den Zellkernen korrekt abgelesen und umgesetzt werden – und wenn das benötigte Baumaterial zur rechten Zeit und in der richtigen Menge geliefert wird.
Das »Baumaterial« sind die Nährstoffe, aus denen unsere Nahrung sich zusammensetzt. Ohne diese Nährstoffe kann es weder Wachstum noch Entwicklung geben. Und da das werdende Leben von allen Seiten vom mütterlichen Organismus umgeben ist, kann es seine Nährstoffe nur von diesem beziehen – es ist also auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass dieser alles »beschafft« und zur Verfügung stellt, was für das Wachstum und die Entwicklung des neuen Lebewesens benötigt wird. Die Mutter ist der einzige Zulieferer auf dieser kleinen Großbaustelle, und entsprechend wichtig ist ihre eigene Ernährung. Das Kind kann nur bekommen, was auch im Körper der Mutter vorhanden ist – sei es in gespeicherter Form oder als Bestandteil von Speisen und Getränken, die die Mutter mit dem Fötus »teilt«. Da eine Schwangerschaft allerdings in den ersten vier Wochen – und manchmal noch länger – gar nicht bemerkt wird, kommt es nicht nur auf die bewusste Ernährung der werdenden Mutter an. Auch ihre allgemeinen Lebensumstände wie z. B. ihre Ernährungsgewohnheiten (Diäten oder andere besondere Ernährungsweisen) oder Erkrankungen (Diabetes oder Infektionskrankheiten, besonders des Magen-Darm-Traktes) sowie die Zufuhr von Nervengiften wie Alkohol, Nikotin und Koffein spielen eine wesentliche Rolle. Je vielseitiger die Mutter sich ernährt, desto größer sind die Chancen, dass das Kind alles bekommt, was es für eine gesunde Entwicklung braucht. Ohne sich darüber bewusst zu sein, schreibt die werdende Mutter mit ihrer eigenen Ernährung während der Schwangerschaft bereits ein frühes Kapitel der Ernährungsbiografie ihres Sprösslings.
Dieser benötigt, während er im Mutterleib heranwächst (und auch noch danach), jede Menge unterschiedlichster Nährstoffe. Die sogenannten Makronährstoffe – Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß (Proteine) – liefern die Strukturkomponenten (»Bausteine«), die Körper und Gehirn wachsen lassen, und die Energie, die die biochemischen Prozesse antreibt. Die Mikronährstoffe hingegen – Vitamine und Mineralstoffe – sind für die Regulation der zahllosen Stoffwechselvorgänge im Körper zuständig, können aber keine Energie liefern. Insbesondere die Bedeutung der Mikronährstoffe ist erst in den letzten Jahren zunehmend ins Bewusstsein gerückt.
Makro- und Mikronährstoffe
Unter Makronährstoffen versteht man drei Gruppen von Nahrungsmitteln: Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate. Zu den Mikronährstoffen zählen Vitamine, Minerale und Spurenelemente. Mit der Ausnahme von Vitamin D und Niacin kann der Mensch diese Vitamine nicht selbst herstellen. Man nennt sie daher essentiell, also einen unentbehrlichen Teil der Ernährung. Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht darin, dass Makronährstoffe Energie liefern, während Mikronährstoffe dies nicht tun. Näheres zur Bedeutung der Makro- und Mikronährstoffe erfahren wir in Kapitel 3.
In 56 Tagen vom Ei zum Embryo (die Embryogenese)
In den ersten 5–6 Tagen wandert die befruchtete Eizelle als »Keimblase« durch den Eileiter in die Gebärmutter, wo sie sich in die Gebärmutterschleimhaut einnistet. Die Keimblase besteht aus sogenannten Trophoblasten, das sind Ernährungszellen, die die Embryonalzellen umschließen und aus denen später die Plazenta hervorgeht. Die Einnistung (»Implantation«) ist ein entscheidender Vorgang: Bis dahin bewegt sich die Keimblase frei und lebt vom begrenzten Vorrat ihrer Ernährungszellen. Um an die Nährstoffe für ihre weitere Entwicklung zu kommen, muss sie eine Verbindung zum Stoffwechsel der Mutter herstellen. Also »dockt« sie an deren Gebärmutterschleimhaut an und gibt gewebsauflösende Substanzen ab, sodass sie in das Gewebe einsinkt und von mütterlichem Blut (in dem sich die Nährstoffe befinden) umspült wird. Ab jetzt können Sauerstoff, Glukose (Zucker) und Fette für die Energiegewinnung in den Mitochondrien, den Kraftwerken unserer Zellen, sowie einzelne Eiweißbausteine (Aminosäuren) aus dem Blut aufgenommen werden, die die wachsende Zahl von Zellen in der Keimblase versorgen. Damit die Einnistung problemlos abläuft, ist eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralen erforderlich. Fehlt einer oder mehrere dieser Mikronährstoffe, kann sich die Eizelle unter Umständen nicht einnisten und die Entwicklung ist zu Ende (was die Frau zu diesem Zeitpunkt aber nur in den seltensten Fällen bemerkt).
Anfangs besteht die Keimblase aus nur wenigen, gleichartigen Embryonalzellen. Diese sind »pluripotent« – das bedeutet, dass aus ihnen faszinierenderweise noch jede Art von Gewebe und Organ werden kann. Schnell beginnt jedoch die Spezialisierung, denn wenn eine Zelle sich zu lange offenhält, ob sie ein Zehennagel oder ein Lungenbläschen werden will, entsteht natürlich Chaos auf der Baustelle. (Das ist vergleichbar mit dem Bau eines Hauses: Dafür braucht man viel Holz, aber die Bauarbeiter können mit »Holz« nichts anfangen, wenn nicht klar ist, ob es sich um einen Dachbalken oder eine Zimmertür handelt.) Sobald eine Zelle sich auf einen bestimmten Zelltyp oder ein bestimmtes Gewebe spezialisiert hat, ist sie unumkehrbar »unipotent«: Eine Muskelzelle bleibt für immer eine Muskelzelle, und alle weiteren durch Teilung aus ihr hervorgehenden Zellen werden ebenfalls Muskelzellen sein. Insgesamt gibt es etwa 200 verschiedene Zelltypen, die nichtsdestoweniger alle dasselbe Erbmaterial, also dieselbe DNA, in sich tragen. Wie aber funktioniert die Spezialisierung? Sie erfolgt durch das »Sperren« bestimmter Genabschnitte, die damit nicht mehr abgelesen werden können. Die Muskelzelle bekommt also nur noch Zugang zu den Informationen, wie sich eine Muskelzelle weiterentwickeln soll, nicht aber auf die »gesperrten« Informationen über die Weiterentwicklung der Leberzellen, der Hirnzellen etc.
Die ersten sechs Wochen sind eine höchst kritische Phase der Embryonalentwicklung, in der alle wichtigen Körperstrukturen angelegt werden und alle Schritte fein aufeinander abgestimmt ablaufen müssen. Und das Ablesen und Sperren bestimmter Genabschnitte kann von außen beeinflusst und gestört werden – z. B. durch Hunger bzw. fehlende Nährstoffe, schädliche Substanzen, Krankheiten oder starke Stressbelastung der Mutter. Dies kann sich im späteren Leben des Kindes als Krankheit bemerkbar machen. Wir kommen im Kapitel 2 unter dem Stichwort »Epigenetik« darauf zurück.
Frühe Weichenstellungen
Die Plazenta ist genau genommen ein Gemeinschaftswerk von Mutter und Kind, denn sie besteht aus einem mütterlichen Anteil, der von der Gebärmuttermuskulatur gebildet wird, und einem kindlichen Anteil, der seinen Ursprung in den Nährzellen der Keimblase hat. Durch den engen Kontakt mit dem mütterlichen Gewebe können Nährstoffe aus dem Blut der Mutter in den kindlichen Kreislauf übernommen werden. Qualität und Quantität der Versorgung hängen dabei zum einen vom Ernährungszustand der Mutter ab, zum anderen aber auch von der Plazenta.
Deren Funktionsfähigkeit wird vor allem durch das Rauchen beeinträchtigt, da Nikotin die Blutgefäße verengt und damit die Durchblutung verringert. Außerdem verdrängt das Kohlenmonoxid aus dem Zigarettenrauch den Sauerstoff aus den roten Blutkörperchen, sodass das Kind einer Raucherin ständig unter Sauerstoffmangel leidet und wegen der schlechteren Durchblutung der Plazenta weniger Nährstoffe erhält. Aber auch manche Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Infektionen können die Funktion der Plazenta stören und sich genauso auf die Versorgung des Fötus auswirken wie eine Mangelernährung der Mutter.
So wie die Außenwelt der Mutter deren Stoffwechsel und Verhalten beeinflusst, wirkt die intrauterine Umgebung, also die Gebärmutter plus Plazenta, auf den Fötus. Insbesondere die Menge und die Qualität der Ernährung bilden seine »Außenwelt« und verbinden ihn mit der Umwelt der Mutter. Die Signale, die diese Umwelt über die Mutter sendet, werden von der Plazenta an das Kind weitergegeben. Sie zeigen dem kindlichen Organismus an, was er später »da draußen« zu erwarten hat. Die Plazenta übermittelt also sowohl Informationen über den Organismus der Mutter als auch über deren Umweltbedingungen. Dabei kann sie sich sowohl der Versorgungssituation der Mutter (Mangel oder Überfluss) als auch dem Bedarf des Fötus anpassen, indem beispielsweise die Oberfläche, an der die Nährstoffe weitergegeben werden, vergrößert oder die Zahl der körpereigenen »Nährstofftransporter« erhöht wird.
Nicht nur Mangelernährung, sondern auch Überernährung – wie sie häufiger in Industrienationen zu finden ist – führt zu Weichenstellungen beim Fötus, die seine spätere Gesundheit beeinträchtigen können. Das Geburtsgewicht kann dann deutlich über dem Normalwert liegen. Grund dafür ist meist Übergewicht der Mutter, das oft mit einer Neigung zu Diabetes 2 (siehe Kasten) einhergeht.
Diabetes
Diabetes Typ 1 wird auch jugendlicher Diabetes genannt. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Autoimmunreaktion des Körpers, die langsam zur Zerstörung der insulinproduzierenden Zellen führt. Weil der Körper selbst kein oder kaum noch Insulin herstellt, muss dieses von außen zugeführt (»gespritzt«) werden. Bei 10 Prozent der Typ-1-Diabetiker ist die Ursache genetisch. Die Betreffenden sind wegen der geringen Insulinmengen (schwache Fettspeicherung) oft schlank.
Diabetes Typ 2 wird auch Altersdiabetes genannt. Es handelt sich nicht um einen Insulinmangel, sondern um das Gegenteil: Weil der Organismus zu wenig auf Insulin reagiert (»Insulinresistenz«), wird immer mehr davon produziert, um den Blutzucker in Schach zu halten. Reicht selbst die höhere Insulinmenge nicht mehr aus, so liegt der Blutzuckerspiegel nach Gabe von Glukose über dem eines gesunden Menschen (gestörte Glukosetoleranz). Ist der Blutzucker dauerhaft erhöht, spricht man auch von diabetischer Stoffwechsellage. Die hohen Insulinwerte begünstigen die Entwicklung von Übergewicht und Adipositas.
Die Überversorgung mit Energie in Form von Glukose treibt das fötale Wachstum voran. Unglücklicherweise kann Glukose die Plazenta durchqueren, und zwar in unbegrenzten Mengen – nicht aber das mütterliche Insulin. Deshalb bildet der Fötus selbst – als Reaktion auf die hohen Glukosewerte – vermehrt Insulin, was die Speicherung von Fett und Eiweiß fördert. Wie wir noch sehen werden, kann diese erhöhte Insulinausschüttung im kindlichen Organismus eine Wirkung auf die spätere Regulierung von Hunger und Sättigung im Gehirn haben.
Die Abbildung zeigt die Einflüsse, die auf den Fötus wirken (schwarze Kreise im linken Teil), wie der Fötus darauf reagiert (weiße Kreise rechts), und was die Folgen sein können (schwarze Kreise rechts). Im Zentrum steht die sogenannte adaptive Antwort, also die Anpassungsreaktion. Bei Mangelernährung führt sie zu Wachstumshemmung und verändertem Stoffwechsel, was ein niedrigeres Geburtsgewicht und ein höheres Risiko für Stoffwechselkrankheiten im Erwachsenenalter zur Folge haben kann.
Hatte Lamarck doch recht?
Anders als in der Vorstellung der meisten Menschen sind Erbanlagen in gewissen Phasen der Entwicklung form- und veränderbar. Wäre dem nicht so und unser Organismus stünde Umweltveränderungen vollkommen unflexibel gegenüber, wäre es, wie erwähnt, wohl nicht gut bestellt gewesen um uns im Laufe der Evolution.
Aber wie kann man sich diese Plastizität, also Formbarkeit vorstellen, die zu Anpassungen der verschiedensten Art führt? Und in welchem Zusammenhang steht sie mit dem genetischen Programm, das in unserem Erbgut gespeichert ist? Dieses verändert sich ja nur langsam, in Form von Mutationen, und nicht in schneller Reaktion auf veränderte Umweltbedingungen. Das bedeutet: Die Fähigkeit, mit einer bestimmten Umweltveränderung klarzukommen, muss bereits im Erbgut angelegt sein, auch wenn sie vor der Veränderung der Umweltbedingungen nicht benötigt und deshalb nicht aktiv war. Und wenn eine genetische Anlage, wie z. B. ein besonderer Geschmack für weniger Süßes oder die Entwicklung besonders scharfer Schneidezähne, plötzlich überlebenswichtig wird, wird sie »mobilisiert«. Bis diese an die neuen Bedingungen angepasste Art sich durch Fortpflanzung durchgesetzt hat, vergehen allerdings Tausende von Jahren. Ein Teil unserer genetischen Ernährungsbiografie liegt also in der fernen Vergangenheit. Sie ist das Ergebnis eines evolutionären Selektionsprozesses, der es ermöglicht hat, dass immer diejenigen überlebten, die am besten mit dem stark schwankenden Angebot an Nahrung umgehen konnten oder einen zusätzlichen Vorteil hatten. Es kam also durch Selektion zu einer kontinuierlichen »Optimierung« des Menschen in Bezug auf sein Nahrungsangebot. Dazu gehört das Einstellen des Stoffwechsels auf einzelne Nahrungsmittel, also etwa, ob wir Laktose vertragen oder nicht, oder ob wir Stärke mehr oder weniger gut spalten können – aber auch, ob wir lieber Süßes oder Bitteres mögen, um nur einige Beispiele zu nennen.
An dieser in unseren Genen festgelegten Biografie können wir nichts ändern. Wohl aber, wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat, an der Biografie, die uns von unserer Mutter in die Wiege gelegt wird. Denn es gibt noch eine ganz andere Reaktion auf die Umwelt, die sich innerhalb einer Generation auf Veränderungen einstellen und genauso schnell auch wieder verschwinden kann: die Epigenetik (vom griechischen epi für »außerdem, zusätzlich«). Die Epigenetik wird dafür verantwortlich gemacht, dass Erfahrungen der Mutter in ihrer Umwelt, wie z. B. ein plötzlich verändertes Nahrungsangebot, an die Nachkommen weitergegeben werden können, damit diese besser damit umgehen können. Der Vorgang wird im Kapitel 2 näher besprochen.
Dass es jenseits der Genetik (und natürlich der Erziehung) etwas gibt, das uns formt, wurde lange für unmöglich gehalten. Aber möglicherweise lag ein Forscher wie Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck doch richtig, als er im 19. Jahrhundert vermutete, dass Besonderheiten, die ein Lebewesen erwirbt, an die Nachkommen weitergegeben werden können. Veränderte Umweltbedingungen, so Lamarck, veranlassen die Tiere, ihre Gewohnheiten zu verändern, wodurch sich auch ihr Phänotyp, also ihre äußere Erscheinung ändert. Und diese Änderungen können an die Nachkommen weitergegeben werden. Man hat Lamarck lange verlacht – aber mittlerweile kommt die Wissenschaft doch ins Grübeln.
Wettervorhersage: Manchmal kommt es anders, als man denkt
Stellen Sie sich vor, Sie hören an einem Apriltag den Wetterbericht im Radio. Für den nächsten Tag werden Temperaturen um 4 Grad, Schneeregen und kräftiger Wind aus Nordost prophezeit. Sie gehen also am nächsten Morgen mit Mantel, Mütze, Schal und Schirm aus dem Haus und sind bestens gerüstet – wenn die Vorhersage eintrifft. Sollten sich die Wetterfrösche aber geirrt haben und es stellt sich überraschend eine milde Südwestströmung ein, dann schleppen Sie Ihre »Ausrüstung« nachmittags schwitzend und fluchend durch milde 20 Grad und strahlenden Sonnenschein.
Ähnlich wie die Meteorologen bei der Wetterbeobachtung entwickelt der Fötus im Bauch der Mutter anhand der eintreffenden Ernährung vermutlich eine Art Vorhersage seiner späteren Ernährungssituation. Die Forscher, die diese Hypothese entwickelt haben, sprechen von »intrauteriner Programmierung« – das werdende Lebewesen wird im Uterus, also der Gebärmutter, für eine bestimmte Situation »programmiert«. Manche Wissenschaftler sprechen lieber von »Konditionierung«, weil es nicht um unveränderliche Festlegungen geht. Es finden eher erste Eintragungen in die aktuelle Ernährungsbiografie statt, mit denen bestimmte zukünftige Handlungsstränge angelegt bzw. Ereignisse vorbereitet werden. Das muss noch nicht heißen, dass alles quasi vorbestimmt ist, aber es werden bestimmte Wege gebahnt.
Wenn die Mutter – unfreiwillig oder freiwillig – auf ausreichende und vielfältige Nahrung verzichtet (oder die Funktion ihrer Plazenta eingeschränkt ist), schaltet der Stoffwechsel des ungeborenen Kindes in eine Art Energiesparmodus. Die Menge an Energie und an Mikronährstoffen sowie die Hormone der Mutter, die es über die Plazenta erreichen, vermitteln ihm den Eindruck, es werde in eine Welt des Mangels hineingeboren. Darauf stellt der entstehende Organismus sich ein, indem er beispielsweise energieverbrauchende Organe langsamer wachsen und damit kleiner ausfallen lässt. (Interessanterweise betrifft das allerdings nicht das Wachstum des Gehirns, obwohl es unser größter Energieverbraucher überhaupt ist; mehr dazu lesen Sie im Abschnitt über das »egoistische Gehirn« im Kapitel 4.) Die embryonale Erfahrung, dass die Umwelt der Mutter durch Mangelernährung geprägt ist, führt aber nicht nur zu reduziertem Wachstum, sondern auch zur Aktivierung von Genen oder Stoffwechselvorgängen, die den zu erwartenden Mangel durch effektiveres Speichern ausgleichen sollen. Diese Anpassung sichert quasi vorausschauend das Überleben unter ungünstigen Bedingungen. Das Kind entwickelt sich zu einem »guten Kostverwerter« – was in Notzeiten ein großer Vorteil war, unter Überflussbedingungen aber eher ein Nachteil werden kann.
Ein Problem entsteht immer dann, wenn sich das »Wetter« unerwartet ändert, die Bedingungen wie Ernährung, Klima, soziales Umfeld etc. nach der Geburt also nicht denen in der Schwangerschaft entsprechen. Trifft ein Neugeborenes, das infolge einer Mangelversorgung ein niedriges Geburtsgewicht hatte, auf eine Umgebung, die Nahrungsenergie im Übermaß bereithält, so ist die Neigung zu Übergewicht und eventuell auch zu damit einhergehenden Stoffwechselkrankheiten quasi vorprogrammiert. (Wobei die verbreitete Vorstellung, ein »guter Kostverwerter« mit Übergewicht sei automatisch weniger gesund als der »normalgewichtige« Zeitgenosse nicht zutrifft, wie im Kapitel 5 ausführlich erläutert wird.)
Dass sich ein heranwachsender Organismus an die »Wettervorhersage« anpasst, ist in der Natur weit verbreitet. So können Vögel die Nährstoffzusammensetzung ihrer Eier je nach Nahrungsangebot oder Zahl der mitessenden Geschwister variieren. Allerdings kann diese »Programmierung« nur in bestimmten Phasen der Entwicklung stattfinden. Die Voreinstellungen bezüglich der Organentwicklung und des Stoffwechsels bleiben dann meist dauerhaft bestehen und können in seltenen Fällen sogar auf weitere Generationen vererbt werden, wie wir später sehen werden. Hat sich das Zeitfenster einmal geschlossen, gibt es scheinbar kein Zurück mehr. So bildet beispielsweise der im Süßwasser lebende Wasserfloh Daphnia eine helmartige Struktur aus, wenn die Mutter Kontakt zu chemischen Signalen eines Fressfeindes hatte. Entwickelt er sich dann jedoch in einer Zone, in der dieser Fressfeind doch nicht oder nicht mehr vorkommt, so wird der Helm vom Schutz zur Belastung, da er die Ernährung im Vergleich zu den nicht behelmten Kollegen erschwert.
Auf einen ähnlichen Fall von nicht mehr aktueller Anpassung – ebenfalls bei Helmträgern, aber diesmal menschlichen – stießen japanische Wissenschaftler, als sie der Frage nachgingen, warum manche Soldaten in heißen Klimazonen belastbarer waren als andere. Als Erklärung fanden sie einen Einfluss der Umwelt in der frühesten Jugend. Soldaten, die in kalten Regionen zur Welt gekommen waren, hatten weniger Schweißdrüsen als solche, die in warmen Regionen geboren worden waren. Da sich die Schweißdrüsen kurz nach der Geburt bilden und sich deren Zahl danach nicht mehr verändert, haben die an Wärme angepassten Soldaten einen Vorteil in heißen Klimazonen, die an Kälte adaptierten dagegen vertragen die Wärme schlechter.
Gesundheitsrisiko Wettervorhersage
Wie jeder von uns wohl selbst schon erlebt hat, treffen Prognosen – gleich welcher Art – keineswegs immer zu. Und ob die Folgen einer falschen Vorhersage nur kurzzeitig unsere Laune oder vielleicht langfristig unser ganzes Leben beeinträchtigen, hängt davon ab, ob es sich um den Wetterbericht fürs Wanderwochenende oder die Anlageempfehlung für die Altersvorsorge gehandelt hat. Die »nutritive Wettervorhersage« für das ungeborene Kind zählt zu den Prognosen mit langfristigen und tiefgreifenden Folgen. Sie schreibt sich ganz dick in die Anfangskapitel unserer Ernährungsbiografie ein und legt eine Reihe wichtiger Handlungsstränge – Stoffwechselwege und Reaktionsweisen – für unser späteres Leben fest.
Aus der wissenschaftlichen Untersuchung der Hungersnot 1944/45 in Holland haben wir gelernt, was geschehen kann, wenn die »Wettervorhersage« nicht mit den tatsächlichen Lebensumständen übereinstimmt. Menschen, die während der Schwangerschaft oder in einer besonderen Phase im Kindesalter mit Nahrung unter- oder überversorgt waren, haben ein höheres Risiko, als Erwachsene sogenannte Zivilisationskrankheiten zu entwickeln, wenn die spätere Ernährungssituation sich deutlich von der »erwarteten« unterscheidet. Die »Zivilisationskrankheiten« gehören zu den »nicht übertragbaren Erkrankungen« (englisch: non communicable diseases, NCD), die man den Infektionskrankheiten gegenüberstellt, weil sie anders als diese eben nicht von Krankheitserregern wie Bakterien, Pilzen oder Viren auf Menschen »übertragen« werden. Eine bestimmte Kombination von »Zivilisationskrankheiten« wiederum wird als »metabolisches Syndrom« bezeichnet.
»Metabolisches Syndrom«
Unter dem »metabolischen Syndrom« (»Metabolismus« steht für »Stoffwechsel«) versteht man eine Kombination von verschiedenen Stoffwechselstörungen, die jede für sich das Risiko einer koronaren Herzkrankheit erhöhen, also der Verkalkung der Herzkranzgefäße und letztlich eines Herzinfarkts. Die vier Störungen sind: Adipositas (also Fettleibigkeit), Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, erhöhter Nüchtern-Blutzucker (Diabetes Typ 2). Tritt Adipositas zusammen mit mindestens zwei weiteren Störungen auf, so spricht man vom metabolischen Syndrom.
Seit vielen Jahren nimmt die Zahl der Betroffenen zu, und die Herz- und Gefäßerkrankungen zählen zu den häufigsten Todesursachen. Allergien, Immunerkrankungen, neurodegenerative Krankheitsbilder, Krebs und psychische Erkrankungen wie z. B. Depressionen zählen ebenfalls zu den nicht übertragbaren Krankheiten. Die Zunahme an NCD wird von vielen Wissenschaftlern als Folge der zunehmend ungünstigen Entwicklungsbedingungen im 1000-Tage-Fenster interpretiert. Zwar hat die Zahl der unterernährten und hungernden Kinder weltweit abgenommen, die Zahl der mangelernährten Kinder und vor allem jungen Frauen ist jedoch gleich geblieben und in einigen Ländern sogar gestiegen. Die Folgen sind bereits jetzt in einem dramatischen Anstieg des Übergewichts – vor allem in Entwicklungsländern – zu sehen. Hier sorgt die Nahrung mit viel Fett, aber wenig inhaltlicher Qualität dafür, dass das Gewicht steigt und der Mangel bleibt. Ein Zustand, der auch als »doppelte Last« (englisch double burden) bezeichnet wird und der die Entwicklung der NCD besonders begünstigt. Kein Wunder also, dass die UN-Generalversammlung Maßnahmen gegen niedriges Geburtsgewicht und Mangelernährung gefordert hat, damit die genannten Folgen eingedämmt werden.
Letztlich hängt es natürlich auch vom Lebensstil und weiteren äußeren Umständen ab, ob man die Krankheiten tatsächlich entwickelt. Ein »ungesunder« Lebensstil lässt sie bei Kindern, die im Mutterleib Mangel gelitten haben, auf jeden Fall rascher und häufiger eintreten als bei solchen mit normaler Entwicklung.
Der Gedanke, dass sich hinter den sogenannten Zivilisationskrankheiten – und hier vor allem der Adipositas – noch etwas anderes verbergen könnte als ungezügelte Fresslust, Faulheit und Willensschwäche, hatte es lange schwer, in der wissenschaftlichen ebenso wie in der Alltagswelt. Das Argument »Veranlagung« galt schlicht als Ausrede, zumal die Genetik auch nicht alle Beobachtungen erklären konnte. Erst mit der (im Kapitel 2 genauer erläuterten) Epigenetik, also der Veränderung von Anlagen infolge von Umwelteinflüssen, kam man Mechanismen auf die Spur, die viele der manchmal verwirrenden und scheinbar widersprüchlichen Details in einen plausiblen Gesamtzusammenhang stellen.
Genetik und Epigenetik
Die Genetik befasst sich mit dem Genom. Das Genom enthält die Gesamtheit aller genetischen Information, die in der Reihenfolge der DNA-Bausteine (»Basen«) festgelegt ist und so vererbt wird.
Die Epigenetik befasst sich mit dem Epigenom. Das Epigenom ist die Gesamtheit aller Modifikationen, durch die die Ablesbarkeit der Erbinformation dauerhaft oder vorübergehend verändert wird. Veränderungen am Genom (z. B. Mutationen) sind immer mit Veränderungen der DNA-Bausteine oder ihrer Reihenfolge verbunden. Epigenetische Veränderungen dagegen haben keinen Einfluss auf die Bausteine der DNA. Im Gegensatz zum Genom, welches sich nur über sehr lange Zeit verändert, kann das Epigenom kurzfristig auf veränderte Umweltbedingungen reagieren. Das Genom ist folglich statisch, das Epigenom dynamisch.
Eine unzureichende bzw. unausgewogene Versorgung des sich entwickelnden Kindes mit Nahrung hat Veränderungen des Stoffwechsels, der Hormonregulierung und der Entwicklung von Zellen und Geweben zur Folge. Dies wiederum hat Einfluss auf das Epigenom – mit genetischen wie entwicklungsbedingten Konsequenzen für die spätere Entwicklung von Krankheiten.