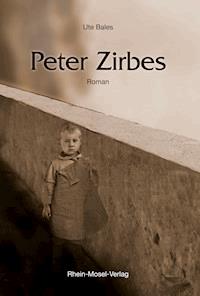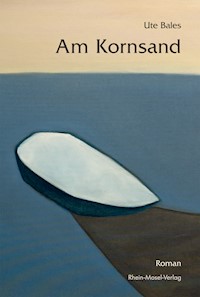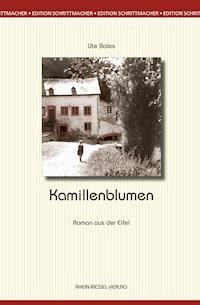Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigenmächtig bewirbt sich der 19-jährige Pitt Kreuzberg im Sommer 1907 an der Düsseldorfer Kunstakademie und wird angenommen. Er hat ein wohlhabendes Elternhaus im Rücken; sein Urgroßvater war der Entdecker der weltberühmten Apollinarisquelle in Ahrweiler. In Düsseldorf gerät Pitt in eine Gruppe Künstler, die gegen Althergebrachtes aufbegehren, besonders gegen die naturgetreue Wiedergabe in der Malerei, wie sie an der Akademie gelehrt wird. In den Künstlerhäusern und im Backladen von Johanna Ey, einem Künstlertreff, geht es bald um mehr als bloßes Abbilden. Grell leuchtende Farbflächen stehen Kante an Kante, bilden starke Kontraste: blaue Menschenleiber vor rotem Wald, orangefarbene Bäume vor gelbem Himmel. Das Wesen der Welt ergründen, erfassen und darstellen zu wollen, wird zu einer Idee, von der auch Pitt getragen wird. Etwas geschieht, etwas ganz Neues …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 881
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2012 Rhein-Mosel-Verlagwww.rhein-mosel-verlag.deBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-816-6 Ausstattung: Marina Follmann Lektorat: Michael Dillinger Endkorrektur: Melanie Oster-Daum Titelfoto: Pitt Kreuzberg, Nachlass Heinrich Pieroth, Mayen
Ute Bales
Unter dem großen Himmel
Roman
RHEIN-MOSEL-VERLAG
***
Traurig und groß ist die Bestimmung des Künstlers. Nicht er wählt seinen Beruf, sondern der Beruf wählt ihn und treibt ihn unaufhaltsam vorwärts. Sein Wille steht fest und bleibt unverwandt dem Pole zugewandt; und dieser Pol ist ihm die Kunst, ist ihm die sinnliche Wiedergabe des Geheimnisvollen, des Göttlichen im Menschen und in der Natur.
Franz Liszt
Nebelgesträuch
Auf Strümpfen verließ er das Zimmer. Das Atmen fiel ihm schwer, aber das Herzstechen blieb aus und bis zum Maar* (Vulkansee) würde er es schaffen. Er schlich die Treppe hinunter, brauchte eine Weile, bis er die Schuhe fand, und als er sie gebunden hatte, lehnte er für einen Moment erschöpft an der Wand. Schweiß perlte auf seiner Stirn.
Draußen atmete er freier. Er folgte der Wegspur durch nasses, hohes Gras hinab zum morastigen Ufer. Ungeschickt wich er einem Vogelgerippe aus, das mit verdrehten Flügeln auf dem Schlick unter dem Nebelgesträuch lag. Das Weiß blendete. Wochen war es her, seit er das Haus verlassen hatte. Viel zu lange hatte er gelegen. Beklemmende, unnütze Tage.
Zwei verspätete Mäher kamen ihm entgegen. Sie grüßten mit blitzenden Sensen und als sie vorüber waren, hörte er sie lachen.
Das Maar dampfte. Trübfarbig und tief schien es ihm schwebend. Unter dem Wasserdunst wurde Gehölz sichtbar, ans Ufer getrieben, gefangen zwischen Schilf und Algen. Da waren die Stufen, der Hang. Wie hinter einem Schleier die Büsche auf der gegenüberliegenden Seite. Über allem der Schrei eines Vogels. Brombeersträucher wucherten an den Sumpflöchern, daneben Brennnesseln und Disteln in wilden Büscheln.
Der Sommer war lang und heiß gewesen, am Ufer waren die Höhen der letzten Wasserstände in Ringen von getrocknetem Schlamm und Schwemmgut abgezeichnet.
Auf dem verwachsenen Pfad kam er nur langsam voran. Manchmal blieb er stehen, rang nach Luft, sah auf die bewegte Wasseroberfläche, unter der es schwärzlichgrün heraufwallte, schmeckte den fischigen Moder. Auch heute glaubte er vom Grund des Maares herauf ein dumpfes Grollen zu hören, ein unterirdisches Geschiebe, und es war ihm, als ob im tiefsten Inneren das Wasser von unsichtbaren Stößen bersten würde. Wasserblasen würgten empor, Kraft geladener Atem des Maares, zerplatzend an der Oberfläche, silbern zerfließend.
Damals, vierzehnjährig, hatte er das Maar zum ersten Mal gesehen. Es war an einem Sommertag gewesen und das Wasser, gegen die Sonne, war leicht und klirrend herangekommen. In Wellen aus flüssigem Silber hatte er seine Zehen getaucht und sich fortgeträumt vom Schattenleben eines Schülers und sich an diesem Ufer gesehen, sitzend vor seiner Staffelei, den Pinsel in der Hand, das Glitzern malend, die Wärme.
Unzählige Male hatte er sommers das Holzgestell zwischen dornigem Ufergestrüpp aufgerichtet, oft im knietiefen Morast, sich zerfressen lassen von Schnaken und Bremsen. Im Winter, wenn der See zugefroren war, hatte er die Malwerkzeuge auf die eisige Mitte gezogen und im Frühjahr, während die Eisflächen rissen, unter dem Stöhnen und Brüllen des Maares seine Farben gemischt.
Nirgends sonst hatte er sich allen Ursprungs so nah gefühlt. Nirgends sonst war das Wechselspiel des Lichtes mit den Farben des Wassers und der Wolken stärker. An diesen Ufern hatte er in die Tiefe der Erde gelauscht. Hier war nichts von den Schmerzen der Welt: alles untrüglich, alles wahrhaftig.
Nur mit den Menschen war es anders.
Gleich würde Theodora kommen. Gleich würde sie kommen und ihn fortbringen.
Frühsommer 1907
Der Brombeerbusch hatte ihn fast vollständig unter sich aufgenommen. Auf der Steinbank liegend sah er nichts als dieses luftige Blättergrün, das sich, je länger er es betrachtete, immer lichter auffächerte und schließlich vom glasigen Blau des Himmels aufgesaugt wurde. Er spürte Trägheit in den ausgestreckten, weit entfernten Gliedern, verfolgte den Flug einer Wespe, dann verlor sich sein Blick wieder im Blätterwerk mit seinen unreifen, grünrötlichen Beeren.
Er langte nach einem der Äste, beugte ihn zu sich herab, riss an einer Frucht, die er sich in den Mund schob. Wenn man sie nur lange genug kaute, mindestens fünf oder zehn Minuten lang, würde sie süß werden und weich, und so wäre es auch mit dem Leben. Das hatte der Vater gesagt. Wenn man nur lange genug Geduld aufbrächte, lange genug den Kiefer mahlen ließe, bis das Herbe nachgäbe, würde auch das Leben süß und lockend. Und das, was ihm jetzt, während er kaute, bitter und sauer das Gesicht verzerrte, die Schleimhäute zusammenzog, die Zunge pelzig und den Mund trocken machte, dieses stumpfe Gefühl würde einem warmen, reifen und vollen Aroma weichen, unerschöpflich und groß.
Wenn man nur lange genug kaute. Wieder entschwebte sein Blick. Es machte ihn ruhig, dieses satte Grün, die tausend verschiedenen Nuancen, die bis ins Bläuliche wuchsen. Sogar riechen konnte er das Grün der gezackten Blätter, die am Rand wie gesägt aussahen, die Oberseite matt und dunkel, die Unterseite filzig. Er spuckte etwas Holziges in die Büsche. Bitter war der Geschmack in seinem Mund. Er dachte an die Schule. Letztes Jahr war er auf das Gymnasium nach Brühl gewechselt und jetzt, wo das Abitur kurz bevorstand, war es mit den schönen Künsten doch nicht das gewesen, was er erwartet hatte. Zu allem Möglichen hatte er sich Farben und Formen ausgedacht, aber zu einer für ihn nützlichen praktischen Übung war es nicht gekommen.
Er fixierte ein verschrumpeltes Blatt, peilte seine Größe mit dem Daumen, bildete Konturen und Linien nach, so lange, bis die Augen schmerzten, das Blatt an den Rändern unscharf wurde und mit dem Himmel verschmolz.
Am Morgen hatte er in einem furiosen Anfall über die misslungene Darstellung eines Kirschzweiges ein gutes Dutzend Zeichnungen, an denen er verbissen und wie betäubt gearbeitet hatte, vor den Augen seiner erschrockenen Schwester zerfetzt und in die Ecke geworfen. »Was du dir antust«, hatte sich Agnes entsetzt, aber es war ihr anzusehen gewesen, dass sie nichts begriff von dem, was in ihm vorging. Tante Therese kam ihm in den Sinn, die, mit Blick auf die mit bemalten Papieren und Pappen beklebten Wände seines Zimmers, die Augenbrauen hochgezogen und anerkennend genickt hatte. »In unserem Pitt steckt was drin.« Auch die Tante verstand nichts, rein gar nichts, ebenso wenig wie die gesamte protzige Verwandtschaft, die sein Tun für vorübergehend hielt, Auswüchse der Pubertät, unbedeutend für die spätere Karriere. Sollten sie alle denken, was sie wollten.
Seit er vor Jahren seinen Vater nach Düsseldorf zur großen Kunstschau begleitet hatte, stand sein Entschluss fest. Sobald wie möglich wollte er sich ins Leben werfen, nach Düsseldorf gehen, um Kunst zu studieren an der Akademie, ab dem Herbst schon. Im Malen würde er den Dingen nah kommen, ihr Wesen und ihren Ursprung ergründen.
Düsseldorf, das klang wie eine Verheißung. Dort hatten auch Feuerbach und Vogeler studiert, Böcklin nicht zu vergessen, von dem ein Ausstellungsplakat an seiner Zimmertür klebte. Fortgehen würde er aus dem riesigen Haus. Der Vater würde nicht begeistert sein, aber letztlich zustimmen müssen; war er doch selbst ein musischer Mensch und besonders der Kunst zugetan. Eine neue Welt würde sich für ihn auftun, fern der Enge seines Heimatortes, bevölkert von frei denkenden und feinsinnigen Menschen. Dazu Farben, überall Farben …
Die Beere in seinem Mund war zu einem Brei geworden. Vermischt mit Speichel hielt sich der herbe Geschmack, auch das Pelzige auf der Schleimhaut hatte nicht nachgelassen.
Mit den Augen bildete er Blätter und Wolken nach, grau, grün und weiß, dann wieder schieferblau, wie hineingehaucht schwefelgelb und violett. Er sah sich Farben mischen, Leinwände spannen, Firnisse anrühren. Er würde Menschen abbilden, auch Tiere, Pflanzen und Landschaften – ja, vor allem Landschaften.
Ein Windstoß bewegte die Blätter der Hecke und entblößte Stachel an kräftigen Stängeln. Manche der Blätter waren angefressen, löchrig – auch der Himmel darüber löchrig, zerzaust.
Als er Ammis Schritte über den Kies heranknirschen hörte, dachte er an den Brief, den er am Nachmittag abgeschickt hatte. Eigenmächtig hatte er um Aufnahme an der Düsseldorfer Kunstakademie angefragt und jetzt, wo Ammi in ihrer weißen Schürze vor ihm stand, lächelnd den Korb mit der Weißwäsche auf die Hüfte stützte, ihn keck ansah und ankündigte, süßen Sirup für ihn kochen zu wollen, hätte er es ihr fast gesagt. Aber er wollte sein Geheimnis auskosten, bewegte es in Gedanken hin und her, malte sich dies und das aus, fühlte es wachsen und Formen annehmen, als ein noch entferntes Gehöchtnis* (geschützter Ort, Refugium) reifen und gedeihen.
Ein langes Gesicht hatte Ammi gezogen, weil er nicht auf den Sirup reagiert hatte. Mit dem Wäschekorb sah er sie in Richtung der Dienstzimmer verschwinden. »Dann eben net«, hatte sie gemurmelt, dabei mürrisch den Zaun zum Garten aufgestoßen und eine Katze aufgescheucht, die fauchend zur Seite sprang.
Nicht einmal Ammi, dem Dienstmädchen, wollte er es verraten, obwohl sie für manchen Scherz zu haben war und bei Verhandlungen mit dem Vater immer überdurchschnittlich gut abschnitt. Niemand sollte es wissen. Auch Arnold und Theodor nicht, die jüngeren Brüder, schon gar nicht Fritz, weil der nichts für sich behalten konnte. Lucia, die Älteste, kam ohnehin nicht in Betracht.
Agnes würde es als erste erfahren. Sie kannte seine totale Erschöpfung, die tagelangem Malen folgte. Sie kannte sein hartes und verbissenes Gesicht, das er bekam, wenn ihm etwas nicht gelang. Energisch spuckte er den Beerenbrei auf den Boden. Nein, die Frucht war nicht weicher geworden im Geschmack, aber wenn schon: süß oder bitter – Kunst würde er trotzdem studieren.
Blaue Hortensien
Das Haus der Kreuzbergs, in dessen unteren Räumen das Weinkontor untergebracht war, stand direkt an der Wilhelmstraße, unweit der Ahr, gleich neben dem Haus des Landrats von Groote, und war eines der schönsten im Ort. Schon die Fassade strahlte aus, was sich vom Besitzer ahnen ließ. Drei Etagen mit eleganten Erkern und Salons gab es, Kronleuchter und Stuck, Silberlüster und hohe Spiegel, reich verzierte Kamine, eine ausladende hölzerne Treppe, weiche Teppiche. Hinter dem Haus, in einem großzügigen Garten mit jahrhundertealten Bäumen, warf ein Springbrunnen seinen glitzernden Staub in die Sonne, daneben schütteten steinerne Putten Füllhörner voller Pfirsiche und Weintrauben in efeuberankte Gefäße. Auf einer Balustrade aus pompösem Stein wuchsen Jasmin und Rosen, darunter üppige Sträucher von blauen Hortensien. An warmen Abenden vergnügten sich die jüngsten Kreuzbergs zwischen Akazien und Flieder, verausgabten sich unter Ammis wohlwollender Aufsicht mit Fangen, Verstecken und Blinder Kuh. »Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, meine Mutter kochte Rüben, meine Mutter kochte Speck und du bist weg …«
An Weihnachten wurden in diesem Garten Tannen aufgestellt und Gaslichter entzündet, die bis zur Mitternacht brannten. Zu Ostern schmückte Ammi die blühenden Forsythiensträucher mit bunten Papierfahnen und fluchte, wenn die Pracht wegen Regens allzu schnell verblasste.
Pitts Vater, der Weinkaufmann Leopold Kreuzberg, in Ahrweiler geboren und aufgewachsen, war ein hochgewachsener beleibter Mann mit einem breiten Gesicht von frischer Farbe. Er liebte die Kunst und das Theater, verkehrte mit Literaten und Musikern, suchte bei allem, was er tat, seine gesellschaftliche Stellung zu festigen. Seiner Meinung nach bedurfte das Leben immer der richtigen Form.
Er hatte jung geheiratet. Seine Frau Maria, eine weitläufige Cousine, die ebenfalls den Namen Kreuzberg trug – über einen gemeinsamen Urgroßvater waren sie miteinander verwandt – war eine Frau, der man hinterhersah, wenn sie vorbeiging. Ihr Gang war anmutig, das ebenmäßige Gesicht mit dem ernsten Blick und dem für sie typischen melancholischen Lächeln hatte etwas Unnahbares. Ihre Kleidung zeigte eine Mischung aus Phantasie und Eleganz. Zu Spaziergängen an der Ahr trug sie mit Blumen geschmückte Hüte, in der Hand einen Sonnenschirm aus weißen Spitzen, pastellfarbene engtaillierte Kleider, dazu Handschuhe mit feinen hellen Streifen auf dem Handrücken. Sie sprach fließend Französisch, hatte als Mädchen Anstands- und Tanzschulen besucht und spielte Klavier. Maria hielt Wohltätigkeitsveranstaltungen für die Quintessenz gesellschaftlichen Lebens und spendete Erlöse aus Festen und Empfängen dem Roten Kreuz oder dem Komitee für Waisenkinder. Von ihren Kindern verlangte sie eiserne Disziplin. Sie sorgte zu exakt festgesetzten Stunden für Hausaufgaben und Mahlzeiten, Spiele, Besuche und das Zubettgehen.
Beide, Leopold und Maria, waren beflissen, ihr offenes, lebhaftes Haus zu einem Mittelpunkt der Kreisstadt zu machen. Deshalb luden sie zu Gesellschaftsabenden ein, debattierten mit Leuten wie dem Fiskalrat, dem Apotheker und dem Magistratsrat über Wilhelm II. und dessen Drang nach Größe, über den Wettlauf um Kolonien oder Bismarcks Außenpolitik.
Für Leopold Kreuzberg entsprach dieses bürgerliche Dasein seiner Vorstellung vom Glück. Hinzu kam, dass er seinen Kaufmannsberuf liebte. Er liebte seine Rotweine, am meisten die Burgunder mit ihren süßlichen Düften nach Schokolade und roten Früchten, Holunderblüten und Veilchen. Er schwärmte von seinen Weißherbsten mit den feinen Aromen von Aprikosen und Pfirsichen, vom Blauen Portugieser mit dem leicht barocken Duft, den feinen, filigranen Kamille- und Tabaknoten sowie von seinem Riesling, der an den schieferigen Lagen der Ahr wuchs. Auch das Handeln lag ihm, das Kalkulieren und Spekulieren und die Reisen zu den Winzern nach Mayschoß, Walporzheim, Altenburg, Heppingen und Bachem. Wie gerne besah er sich die Wingerte, begutachtete die Trauben vom Burggarten, auf dem Pfarrwingert und der Schieferlay, am Kräuterberg, Trotzenberg, Mönchberg und Silberberg.
Redlichkeit, Sparsamkeit und Weitblick, das waren die Grundsätze, die für ihn den ehrbaren Kaufmann ausmachten und waren gleichsam Tugenden, die für seine Glaubwürdigkeit unerlässlich waren. Er war von gutmütigem Naturell, konnte aber auch, wenn man ihn reizte, herrisch und jähzornig werden. Mit seinen Kindern machte er wenig Federlesens; die Erziehung überließ er Maria und den Dienstmädchen. Manchmal sah man ihn mit Fritz an der Hand durch das Haus gehen, ihn herumtragen und die Uhr zeigen. Eigenhändig zog er allen seinen Kindern die wackelnden Zähne mit Faden und Taschentuch. Bisweilen unternahm er mit ihnen Ausflüge, war bestrebt, ihnen den Sinn von Kunst und Kultur näherzubringen, aber auch das Unternehmerische und das auf Erfüllung von Pflichten ausgerichtete Gefühl.
Früh schon hatte er Pitt zu Federzeichnungen angeregt und sich über den Eifer gefreut, mit dem die kleinen Hände zeichneten und strichelten. In Sachen Kunst war der Vater lange Zeit das Perpendikel, der einzige, der sich ein Urteil erlauben durfte. Für Pitt war es quälend, in seiner Ungnade zu stehen. Vor allem, da sich der Missmut des Vaters niemals in Taten oder Worten äußerte, sondern in zermürbendem, langem Schweigen.
Alle Kreuzbergkinder waren eigenwillig. Pitt und Arnold fielen früh als phantasievolle und begabte Selbstdarsteller auf, die mit Talent und Charme Theaterstückchen einübten und aufführten, was besonders die Mutter zu fördern wusste. Sie las ihnen Märchen vor, vor allem die Grimmschen, nahm sie mit zu Kostümbällen, veranstaltete Grammophonabende im Kaminzimmer, spielte Lieder von Schubert und Mozart auf dem Klavier, gerne die Abendlieder und Romanzen.
Die Mädchen waren der Mutter ähnlich. Lucia, dunkelhaarig und mit wachen Augen, amüsierte sich über die Brüder, bewunderte gleichzeitig deren kecke Auftritte. Als gute Schülerin brillierte sie vor allem in Latein. Kaum das Gymnasium angetreten, ließ Lehrer Joerres sie eine Klasse überspringen. Agnes war verträumter und weniger für die ideenreichen Spiele ihrer Geschwister zu haben, wohl aber eine kritische Zuschauerin. Sie zog sich oft zurück, las und stickte, presste Blumen in einem kleinen Holzrahmen, womit sie Postkarten beklebte.
Außer der Familie lebte noch Dienstpersonal im Haus, darunter Ammi, die eine Kammer im Parterre bewohnte. Ammi war unsentimental aber herzlich, redete zu schnell und deshalb undeutlich, frühstückte mit den Kindern, ging mit ihnen sommers zum Baden an den See, winters zum Schlittenfahren, backte ihnen Sandkuchen oder mimte die schusselige Köchin, die unter dem Kinderjauchzen die unmöglichsten Zutaten verwechselte. Von Fritz ließ Ammi sich sogar zum Indianerspiel überreden, entzündete zu diesem Zweck Feuer im Garten und streifte mit ihm durch die Büsche an der Ahr. Dann gab es noch eine Köchin, eine verschüchterte, knöcherige Mamsell aus dem Trierer Land, die sich aus Angst vor ihren Herrschaften am liebsten unsichtbar gemacht hätte und deswegen für manchen Scherz der Jugendlichen herhalten musste.
Die liebste von allen blieb Ammi. Fast alle Nachmittage war es ein Kampf für sie, die Bande – wie sie die Spielgefährten ihrer Schützlinge nannte – so lange vom Haus fernzuhalten, bis die Hausaufgaben erledigt waren. »Et gibt noch nix! Noch lang net …« Aber das wilde Gelände an der Ahr lockte mit verschlungenen Pfaden, knorrigem Gehölz, Brennnesseln und Disteln, Tümpeln, Feldern und Weingärten.
Paul kam täglich. Mit Scheu und Ehrfurcht betrat er das Kreuzbergsche Haus und legte seine Befangenheit erst im Garten wieder ab. Er tauchte mit immerwährend schmutzigen Knien auf und war, der Läuse wegen, kahl geschoren. Auch Michel, der früher mit Pitt in die Schule im Weißen Turm gegangen war, betrat das Haus ungern. Sein Vater war ein Rümpchenfischer und Michel schämte sich des penetranten Fischgeruchs, der aus seinen Kleidern nicht fortzubringen war. Felix und Eugen, aus ebenso angesehenen Häusern wie Pitt, kannten diese Scheu nicht.
Stundenweit streiften sie herum, suchten im Fluss nach Krebsen, verursachten mittels Lehmstücken und Steinen Wasserstaus, bauten Tretmühlen und Papierschiffe, fingen Molche und Kaulquappen, sammelten Wasserflöhe in Eimerchen und jagten glanzversprühenden Libellen hinterher. Vergaßen sie die Zeit, war es Ammi, die sie aufstöberte und besonders im Frühjahr, wenn der Schnee auf den Bergen schmolz und die Ahr plötzlich anschwoll und aus den Ufern zu treten drohte, sich mit fliegenden Haaren und rotem Kopf auf die Suche nach ihren Schützlingen begab.
Fußstapfen
Als Junge konnte Pitt sich nicht satt hören an den Geschichten, die um seine Familie rankten. Turbulente Zeiten hatten die Kreuzbergs durchgestanden, sich geschickt manövriert durch allerhand Widrigkeiten. Immer schon gehörten sie zu den angesehenen und begüterten Familien, die der Stadt in diversen Ehrenämtern dienten und der jahrhundertealten Schützengesellschaft, die einen preußischen König, Kirchenfürsten und sonstige hohe Persönlichkeiten zu ihren Mitgliedern zählte, etliche Schützenkönige stellten. Alle Kreuzbergs waren gut ausgebildet, sprachen mindestens zwei Sprachen – einige der Tanten hatten ins europäische Ausland geheiratet – und parlierten italienisch oder französisch untereinander. Sie bauten und bewohnten die Adels- und Klosterhöfe, die Patrizierhäuser in der Wilhelmstraße, besaßen Weinberge in besten Lagen und kontrollierten den Weinhandel der Stadt. Ihnen gehörte der Rodderhof am Obertor, der Blankartshof in der Ahrhutstraße, der Velbrücksche Hof am Adenbachtor, der gegenüberliegende Kolwenhof, der Gereonshof am Niedertor, das barocke Bürgerhaus mit der schwarzen Türkenmadonna, das Telgsche – sowie das Franzesche Haus in der Niederhutstraße, das Heinzenhaus in der Houverathsgasse. Zudem galten sie als Wohltäter der Stadt. Sie alle waren Nachfahren der jüdischen Familie Seeligmann, der Kaiser Maximilian bereits im Mittelalter das Monopol verliehen hatte, von Basel bis zur Nordsee mit Salz zu handeln, worüber sie reich geworden waren. Noch ehrenwerter und reicher wurden sie, als der Jude Seeligmann vor gut hundert Jahren auf dem Sterbebett entschied, seine Familie mitsamt allen Kindern zur Taufe zu verpflichten.
Lange verstand Pitt nicht, was Reichtum mit Glauben zu tun haben sollte. Die Mutter hatte ihm erklärt, dass die Juden ein Volk seien, das von Ewigkeit her dazu bestimmt wäre, den Hass und die Rache anderer Völker auf sich zu ziehen und dass sie alle, wenn der Ahne Seeligmann nicht so weitsichtig gehandelt hätte, immer weiter Opfer diverser Verfolgungen geworden wären. Bis in die Unendlichkeit hätte sich das fortgesetzt, denn so sei es vom Schicksal bestimmt. Von der Mutter wusste Pitt, dass die jungen Seeligmanns gehörige Angst vor der Taufe gehabt hatten. Trotz des Unterrichts von den Franziskanermönchen vom Kreuzberg hätten sie sich heimlich und mit vorgehaltener Hand gefragt, was wohl passieren würde, wenn der Gott des Alten Testaments ihnen die Entscheidung übel nähme. Ammi, von der Pitt wissen wollte, was es mit Gottes Rache auf sich habe, hatte ihn mit einer wegwerfenden Handbewegung fortgescheucht: »Ach wat! Über sowat ärgert sich Gott net! Dat ging doch nur um et Geld!«
Jedenfalls hatte ein Seeligmann nach dem anderen die Taufe unbeschadet erhalten; zuletzt der Jüngste, Samson Seeligmann, der von da an Petrus Josefus Franziskus Kreuzberg hieß, von allen aber bloß Jüseppchen genannt wurde. Als der nämlich seine Knabenhand auf den Schädel des Steinlöwen legte, den glasigen Blick nach oben richtete und getreu dem Leitspruch des biblischen Samsons um Segen für sich, seine Kinder und Kindeskinder betete, wuchs nicht nur das Vermögen: Jüseppchens spätere Frau Margaretha schenkte ihm neun Kinder, darunter Georg, den Entdecker der Quellen.
Georg Kreuzberg war allgegenwärtig.
In der oberen Diele des Hauses hing neben einem Bücherschrank sein imponierendes Portrait, gemalt in Öl. Das mächtige Antlitz mit den straffen Muskelzügen an Gesicht und Hals, dem eckigen Kinn und dem in die Ferne gerichteten, entschlossenen Blick wirkte streng und unbewegt, was Arnold immer wieder – besonders bei Tisch – dazu veranlasste, diese energische Miene nachzuahmen, was seitens der Eltern jedes Mal einen Verweis einbrachte, bei den Geschwistern aber regelmäßig für größtes Gelächter sorgte. Diese Parodie war ein Frevel im Kreuzbergschen Haus, war doch dem Wirken Georgs einiges zu verdanken.
Seit der nämlich die Apollinarisquelle erbohrt und weitere Heilquellen erschlossen hatte, seit in Altenahr ein Straßentunnel eröffnet und die Ahrtalbahn für Mobilität sorgte, war ein Schaffen und Wirken in den Gassen und Straßen, ein Gestalten und Bauen, das den ganzen Ort erfasst hatte. Seltsam schienen Pitt die Bestrebungen seiner weit verzweigten Verwandtschaft, die lediglich um die Frage kreisten, wie die Gunst der Zeit zu nutzen und Ansehen und Macht zu vergrößern seien. Suspekt waren ihm die Scharen von Ferien- und Kurgästen, die Männer mit ihren fein gezwirbelten Schnurrbärten, die Damen mit den spitzenbesetzten Kleidern, den Seidengürteln und Perlenhalsbändern, die allesamt der Quellen wegen nach Ahrweiler und Neuenahr strömten. Vor Tagen erst war Pitt jungen Reitern aus dem Weg gegangen, Studenten, die die weißen und blauen Seidenstürmer der feudalen Bonner Corps Borussia und Hansea trugen. Lachend hatten sie ihre Pferde an die Stämme der Platanen gebunden und sich ohne Säumen zu den Weinlokalen begeben. Gleichzeitig war ihm ein offensichtlich ausländischer Adliger aufgefallen, der in einem ganzen Pulk von Leuten – darunter einige mit preußischem Schneid – daherkam und mit Grandezza und vielen Verbeugungen seinen verbeulten Schlapphut vor einer aristokratisch aussehenden Dame zog, die soeben ihrem Dogcart, einem offenen zweirädrigen Jagdwagen, entstiegen war. »Immer solche Leute, nur solche Leute«, dachte er. Mit Spazierstöcken und Sonnenschirmen stolzierten sie durch die Parkanlagen, der Hoch- und der Geldadel, Künstler und Geschäftsleute, kehrten hier und da ein, das Geld saß locker. Weinhandel und Hotellerie, Fuhrgeschäfte und Vergnügungslokalitäten florierten derart, dass sich Bauern und Fischer, die Waschfrauen an der Ahr, selbst die Mägde die Hände rieben. Letztere nähten und strickten in ihren freien Stunden, boten ihre textilen Erzeugnisse im Park feil, was sich als lohnend erwies. So wie sie war der ganze Ort Georg Kreuzberg dankbar. »Wenn der alte Kreuzberg net gewesen wär …« Immer und überall wurde Pitt auf diesen Namen angesprochen, immer und überall erwähnte man die Wohltätigkeiten und einmal, als die Mutter wieder von Georg und dessen Klugheit anfing, hatte er ihr an den Kopf geschleudert, dass ihm all die Ruhmeshymnen über seine Vorfahren aus dem Hals heraus hingen und er keineswegs vorhabe, in diesen Fußstapfen weiterzugehen, schon gar nicht in denen Georgs. Diese Bemerkung hatte ihm einen roten Abdruck der väterlichen Hand mitten im Gesicht sowie eine Woche Ausschluss von den Mahlzeiten eingebracht, was ihn in seinem Denken nur bestärkte.
Jedes Jahr im April feierte man zu Ehren des Urgroßvaters den Georgstag. Jedes Jahr mussten sich die Kinder vor dem Portrait versammeln, zu der imposanten Person aufsehen und das Georgslied singen. Dann wurde vom Tag der Quellenweihe berichtet, der Anwesenheit der Prinzessin Augusta von Preußen, den preußischen und englischen Wappen, die die Trinkhalle zierten. Pitt verband Wecken und süßen Apfelsaft mit diesen Gedenktagen, vor allem aber pausenlose Schilderungen von Georgs Klugheit und Weitsicht.
Georg Kreuzberg war ein Erfolgsmensch. Bereits als Kind war er hingerissen gewesen vom Pomp der Aufzüge und der Ehrfurcht grüßender Kleinstädter, den die vierspännigen Kutschen der Adligen verursachten. Seinem Vater hatte er verraten, dass auch er einmal vierspännig durch das Ahrtal fahren werde. Und so wie jede Vorstellung das Streben zur Verwirklichung in sich trägt, so erklärte es sich, dass Georg wie mit einer magnetischen Richtnadel zu dem Ziel geführt wurde, nach dem sich seine jugendliche Vorstellungskraft sehnte.
Nachdem ihn sein Vater in eine Kaufmannslehre gegeben und er am Befreiungskrieg der verbündeten Heere gegen Napoleon teilgenommen hatte, machte er sich als Kaufmann selbstständig und firmierte als Inhaber der Weinhandlung Georg Kreuzberg & Compagnie. Zu einem Spottpreis hatte er Weingärten zwischen Heppingen und Wadenheim ersteigert. Unter diesen Gärten fand sich einer, der nicht gedeihen wollte. Georg ging dem Übel an die Wurzel und fand den Grund des schlechten Wachstums in Form eines hochkonzentrierten Kohlensäurevorkommens. Zunächst dachte er, das schädliche Gas durch einen Stollen und einen Schacht ableiten zu lassen, dann aber brach nach Abteufen etlicher Schächte unter starkem Getöse, dichten Dampfmassen und einer beträchtlichen Menge von kohlensaurem Gas unter den massiven Grauwacken eine Quelle hervor, die seine Erwartungen bei Weitem übertraf und ihm sofort die Möglichkeit einer geschäftlichen Verwertung bot. Weil Arbeiter bei Bohrungen auf dem Gelände einen Bildstock des Heiligen Apollinaris von Ravenna, Schutzpatron des Weines, zutage gefördert hatten und Georg diesem Bildstock eine Bewandtnis zutraute, benannte er die Quelle nach Sankt Apollinaris. Als ob das geholfen hätte, Georg wurde von Tag zu Tag mächtiger. Er erbohrte den großen Geysir, die warmen Quellen von Beul, wurde Gründer des Bades, schuf den Kurpark, die Trinkhalle, das erste Kurhotel und schenkte der aufstrebenden Gemeinde ein Krankenhaus, was ihm von den Honoratioren sämtlicher Kreise in und um Ahrweiler hoch angerechnet wurde.
Zeitlebens fuhr er vierspännig.
Als in Versailles das II. Kaiserreich gegründet wurde, war Georg längst ein gemachter Mann. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass die mineralischen Bestandteile seines Wassers nicht nur Durst bekämpften, sondern auch für Trink- und Badekuren geeignet waren. Sie halfen bei akuten und chronischen Entzündungen des Halses und der Atmungsorgane, bei Ekzemen, Magen- und Nierenleiden, Grieß des Harns, Rheumatismus, Gallensteinen, Skropheln, Hypochondrie, Blasenkatarrhen und allen möglichen inneren Leiden. Bald schon lieferte Georg seine Tonkrüge nach Amerika, England, Holland mit den indischen Besitzungen, Frankreich und Italien, alle mit der Inschrift ›Georg Kreuzberg, Ahrweiler, Rheinpreußen‹. Zu Ehren des neuen Kaisers ließ er Mammutbäume pflanzen und wünschte sich, dass das Kaiserreich wie die jungen Bäume zum Riesen erstarken und tausend und mehr Jahre Bestand haben sollte.
Feuerberge und Maare
Obwohl die schönen Künste im Hause Kreuzberg gepflegt wurden, gab es niemand, der daraus einen Beruf gemacht hatte. Der vielfältige Handel versprach sichere und glänzende Perspektiven, ein leichtes und sorgenfreies Leben.
Pitt hatte nur eine vage Vorstellung von seiner Zukunft, in der allerdings das Kontor des Vaters nie vorkam. Er sah sich nicht in dieser ummauerten Stadt, hinter den mit Moos und Efeu berankten Stadttoren in einem feudalen Haus lebend, inmitten seiner aufstrebenden Verwandtschaft. Er war voller Lust am Zeichnen und Malen; sein ganzes Denken und Tun war davon erfüllt. Dieser unbedingte Wille und die Beharrlichkeit, mit der er übte und arbeitete, gaben ihm das Gefühl, über den Dingen zu schweben. Seinem Freund Felix vertraute er an, berufen zu sein für die Kunst. Sie sei sein einziger Lebenssinn, sein Ein und Alles. Worauf Felix in schallendes Gelächter ausbrach: »Wat du dir einbildest …«
Für Pitt war der Brief, den er nach Düsseldorf geschickt hatte, ein erster Schritt in diese Richtung. Am Ergebnis zweifelte er nicht.
Wochenlang trug er sein Geheimnis mit sich herum. Die Antwort aus Düsseldorf ließ auf sich warten. Er schrieb erneut und als Ammi Ende Juli mit der ersehnten Antwort an seiner Zimmertür anklopfte, riss er ihr das Kuvert ganz in Erwartung einer guten Nachricht aus der Hand. »Endlich!« In knappen Sätzen wurde ihm der Eingang seines Gesuchs bescheinigt und ihm ein Termin offeriert, an dem man eine Auswahl seiner Werke in Augenschein nehmen wolle. Mindestens acht, höchstens aber zwölf Bilder oder Zeichnungen seien einem Gremium vorzuzeigen, das aus Professoren sowie Assistenten bestünde. Er war für einen Dienstagnachmittag, den 16. Juli 1907, eingeplant.
»Wat freuste dich denn so?«, wunderte sich Ammi, denn Pitt sprang herum, küsste den Brief und warf ihn in die Luft. »Jetzt ist es so weit. Ich werde Kunst studieren! In Düsseldorf! Wenn sie nur meine Bilder sehn … Jetzt mach ich meinen Weg!«
»Dann isset doch wahr«, lachte Ammi, »dat hab ich mir ja lang gedacht. Malen kannste ja. Aber wat willste denn damit werden? En Künstler, dat is doch nix Richtiges.«
»Ach Ammi, Ihr wisst ja nichts. Für Euch hört die Welt doch am Gartenzaun auf. Fortgehen werd ich. Malen werd ich. Sagt, ist der Vater im Kontor?«
»Der gnädige Herr hat eben anspannen lassen. Ich weiß net, ob der noch da is …«
Mit dem Brief, der ihm den Herzschlag bis in den Hals jagte, stürzte Pitt die Stufen hinunter. Um Atem ringend trat er zu seinem Vater ins Kontor. Leopold Kreuzberg saß über den Büchern. »Vater! Ich bitt Euch! Lasst mich nach Düsseldorf!« Ohne zu grüßen legte Pitt den Brief auf den Verkaufstresen. »Die Akademie hat geschrieben. Sie wollen meine Bilder sehn.« Erstaunt betrachtete Leopold seinen Sohn und hätte fast über dessen entschlossene Miene gelacht. Es fiel ihm auf, dass Pitt aufgeschossen war im letzten Jahr, dass er die Haare anders trug als sonst, wirrer und länger und er wunderte sich, dass Maria nicht längst den Frisör gerufen hatte. Pitts Hände, gestützt auf die Korkmaschine, trugen Spuren von Farben. »Hab mir die ganze Zeit schon gedacht, du trägst etwas herum …« Er nahm den Brief und las. »Ist es dir auch wirklich ernst damit?« Sein Blick wirkte angestrengt, als er aufsah. »Ja, Vater.« Lange sah er seinen Sohn an, bemerkte dessen Erregtheit in den tiefgründigen, blauen Augen, auch an der Art, wie er den Kopf hielt und wie er vor ihm stand. »Kein leichter Weg«, urteilte Leopold, »wahrhaftig nicht. Kunst war immer schon das Brotloseste, was sich ein Mensch hat aussuchen können. Da reicht nicht nur Talent. Auch Disziplin gehört dazu. Und ausgerechnet das soll es sein?« Wieder betrachtete er seinen Sohn, der nur nickte, dessen Gesichtsausdruck aber nichts von seiner Beharrlichkeit verloren hatte. »Und die Kaufmannslehre? Du hättest alle Möglichkeiten. Denk an den Weinhandel! Eine sichere Sache.« Pitt schüttelte den Kopf. »Ihr wisst es doch.«
»Wissen ist zuviel gesagt. Kanns mir denken. Die Entscheidung Kunst oder Kontor fällt dir nicht schwer, was?« Lange sprach er über die Möglichkeiten, aber auch über die Risiken eines Studiums der Künste, über das Weinkontor und die Frage, wer es wohl fortführe. Pitt hörte dem Vortrag nur mit halbem Ohr zu. Seit er den Brief gelesen hatte, glaubte er, auf Farben zu laufen. Farben, die alles übergossen, so beredt, so leuchtend, wie er sie auf Papier nie gesehen hatte. Er war wenig und viel, klein vor der Welt, aber groß vor sich selbst. Groß, wenn er an sein Wollen dachte, grenzenlos hungrig und durstig nach Leben, seine Ideen wie Vögel, seine Träume wie Funken. »Dann wird es für dich wohl die Kunst sein«, hatte der Vater am Schluss gesagt und mahnend den Finger gehoben: »Dass du nur ordentlich studierst …«
Dass ihm der Vater kaum etwas in den Weg legen würde, hatte er geahnt. Schon als Kind hatte der ihn zu Museen und Ausstellungen mitgenommen und auch früh schon bemerkt, dass es die Farben waren, die Pitt faszinierten. Keine Gelegenheit hatte Leopold ausgelassen, seinen Kindern den Wert und die Wichtigkeit der Künste näherzubringen. Wenn sie nach Königswinter und Bonn reisten, besuchten sie Kirchen und Museen, das Siebengebirge, den Drachenfels. Hier sah Pitt Mosaiken der Römer, Wandmalereien und Keramiken, lernte Spuren deuten, die die Völker entlang von Rhein und Mosel hinterlassen hatten, stand vor den Bildern flämischer und italienischer Meister, fuhr mit dem Finger über bemalte Leinwände, spürte die Konturen und verfolgte mit dem Auge Linien und Schattierungen. Zu Hause drängte es ihn, es den Malern nachzutun. Als er der Mutter in einem selbst geschnitzten Rahmen sein erstes Bild überreichte, eine Gebirgslandschaft, die er aus der Erinnerung mit Feder gezeichnet hatte, war es der Vater gewesen, der mit dem Bild in der Hand herumgegangen war, es hierhin und dorthin prüfend an die Wände gehalten und nach einem guten Platz gesucht hatte. »Es braucht Licht, viel Licht …«
Die Wochen verliefen zäh. Der Sommer war heiß und trocken. Pitt hatte Homer, Vergil und den Faust gelesen, aber ansonsten tat er für die Abiturprüfungen wenig, zu wichtig waren jetzt andere Dinge. Noch im letzten Sommer hatten es Felix und Paul leicht gehabt, ihn zu den Verstecken an die Ahr oder in den Wald zu locken, wo sie Fische gefangen und Feuer entfacht, im Gras gelegen und über Wolkenfiguren phantasiert hatten. In diesem Sommer sahen sie trotz hartnäckigen Nachfragens und unterschwelligem Spott über seinen Ehrgeiz keine Möglichkeit, ihn zu den üblichen Streifzügen zu bewegen.
Unablässig saß Pitt und zeichnete, strichelte, mischte Farben und wenn er das Haus verließ, geschah dies ausschließlich der Motive wegen, die er in der Natur suchte. Sogar Ammi konnte sich einiger Kommentare nicht enthalten, was Pitt dazu veranlasste, die Tür seines Zimmers von außen mit einem Plakat zu beschriften, worauf deutlich geschrieben stand, um was es ihm ging: Ruhe!
»Der Junge übertreibt es.« Oft stand Maria Kreuzberg besorgt vor ihrem Mann im Weinkontor und mokierte sich über Pitt, der, wie sie meinte, nichts anderes als die Kunst im Kopf habe, was schädlich sei. Obwohl ihr Leopold versicherte, diese Leidenschaft verstehen zu können, blieb sie bei ihrer Meinung und jedes Mal, nachdem sie festgestellt hatte, dass ihr Mann nicht eingreifen werde, verließ sie enttäuscht das Kontor.
Leopold Kreuzberg gefiel, was Pitt tat. Regelmäßig ließ er sich die Bilder zeigen, auch die Mappe mit den Federzeichnungen, unterhielt sich mit ihm über Landschaften und deren Darstellungen in der Kunst, über Künstler und deren mögliche Absichten. Auch über Literatur sprachen sie. Lessings Laokoon lasen sie zusammen, besprachen die Unterschiede zwischen Literatur und Kunst und was Lessing wohl meinte, wenn er schrieb, dass Poesie mit nacheinander geordneten Zeichen arbeite, die dann eine Handlung ergäben; Malerei hingegen mit nebeneinander geordneten Zeichen, die Körper darstellten, weswegen anscheinend die Malerei nur Gegenstände, die Dichtung nur Handlungen darstellen könnte. Es war ein komplizierter Text, den Pitt nur bruchstückhaft erfasste. Gar nicht begriff er, wie Lessing die Meinung vertreten konnte, eine Landschaft sei kein Betätigungsfeld für Künstler, weil sie keine Seele habe.
Weil Pitt über Lessings Satz so aufgebracht war, ließ Leopold Kreuzberg am Dreifaltigkeitssonntag in aller Frühe seinen Sohn herbeiholen und die Pferde anspannen. Die Kutsche stand schon zur Abfahrt bereit, die Pferde angeschirrt, als er Pitt verriet: »Um Landschaften geht es heute, eine ganz besondere allerdings, du wirst schon sehn. Ich hab für dich ein paar Sachen einpacken lassen. Wir übernachten unterwegs.« Eigentlich hatte Pitt vorgehabt, das Portrait von Ammi fertig zu zeichnen, aber in Anbetracht der in Aussicht gestellten Motive brauchte der Vater nicht zu drängen.
Während der ganzen Zeit verriet Leopold nicht, wo es hingehen sollte. Ein gutes Stück folgten sie der Ahr. An Mayschoß und Altenahr ging es vorbei, wo die Weinberge endeten und die Gegend waldiger wurde. Hinter Adenau wechselten sich Tannen- und Buchenwälder ab. Gerade hohe Stämme ragten steil empor. Bis die Nürburg in Sicht kam, erreichten sie eine ziemliche Höhe, dann wieder krümmte sich der Weg ins Tal, an Schluchten und massigen Felsen vorbei, auf denen sich gelbe Flecken von Flechten ausbreiteten. Wilde Bäche schlängelten sich durch Wiesen, an den Lichtungen der Wälder standen Hochsitze. Die Dörfer waren rauchig, die Hütten elend. Moos und Brennnesseln wucherten auf den Dächern, unzählige Misthaufen dampften und stanken, Schweine grunzten im Unrat. Die Kutsche fuhr durch Hühnergeflatter und Jauchepfützen, die grünlich schimmerten. Häuser aus Fachwerk und Kirchen aus Bruchstein, Fichtenwälder, Schafherden, weißgetünchte Heiligenhäuschen mit betenden Figuren wechselten sich ab.
In Nürburg waren wegen eines Festes die Häuser weiß getüncht, die Fenster mit Wiesenblumen geschmückt. Schwarzgekleidete Frauen standen in den Türen, Kinder hingen an ihren Kittelschürzen. Ein Porzellanhändler hatte seine Waren neben einem Brunnen aufgebaut und schwenkte die Mütze. »Porzellan und Steingut aus Niederkail! Beste Ware …!« Eine Bäuerin feilschte um eine Schüssel. Auf dem Rücken trug sie einen Korb, gearbeitet wie ein hoher Vogelkäfig, worin ein Kind aufrecht stand, die Hände um das Geflecht geklammert. Ochsenkarren zogen vorbei. Ein Bauer, mit Körben bepackt, trieb eine Herde Ferkel vor sich her. Am Dorfende meckerte eine Ziege dem Gefährt hinterher.
Je weiter sie fuhren, desto jämmerlicher wurden die Dörfer. Auch Bäume wuchsen kümmerlicher und den Anwohnern war anzusehen, dass sie das ganze Jahr nicht satt wurden. »Die vulkanische Eifel. Eine der ärmsten Gegenden Preußens«, sagte der Vater, »das Volk ist kleinwüchsig, verkrüppelt und von der scharfen Luft größtenteils brustleidend. Das Land ist untauglich für guten Ackerbau. Es ist zu rau wegen der hohen Lage, auch zu felsig. Tausende von Auswanderern hat es hier gegeben. An Dünger mangelt es und an einer tüchtigen Stadt. Im Winter trauen sich die Wölfe bis in die Dörfer.« Pitt dachte an die Prämien, die für tote Wölfe gezahlt wurden und an Ammi, die erzählt hatte, dass es deswegen keine Wölfe mehr gäbe. »Aber das Land! Wie weit man hier sehen kann!« Pitt füllte die Augen mit Landschaft, die Nase mit Fahrtwind. Horizontweit staffelten sich schwarzgrüne, düstere Wälder und lang hingestreckte Bergrücken. Ihre Umrisse schienen mit der Luft zu verschwimmen; hier und da tauchten Ruinen zwischen den gezackten Linien auf und massige, kahle Basaltkuppen. Wolkeninseln schwebten darüber, zwischen denen sich das Blau des Himmels ausdehnte.
Unerwartet tat sich ein Wall von Fels vor ihnen auf, an dem krüppelige Bäume wuchsen, an die die Sonne nicht reichte. Leopold deutete auf einen der Felsen. »Urmenschen mit Fellen haben hier Höhlen ins Gestein gegraben.« An den Eingängen wucherten Gekräusel von Farn und Sauerdornbüschen.
Bis zum Nachmittag erreichten sie Müllenbach. Es stank nach Gerberlauge. Barfüßige Kinder in armseligen Leinenkitteln rannten lärmend hinter der Kutsche her. Hunde kläfften und Leopold hatte alle Mühe damit, die Pferde ruhig zu halten. »Hoo … Hooohh!« Die Tiere hoben die Köpfe und für ein paar Schritte gingen sie strenger ins Geschirr. Vor Hütten mit wettergeschwärzten Strohdächern blieben die Kinder zurück, scharten sich aneinander, wirkten auf Pitt wie eine Herde verängstigter Schafe.
In diese Gegend war er nie gekommen.
An Gehöften und Weilern vorbei führte die Schotterstraße über Kelberg nach Daun und von dort steil bergan nach Mehren. Die aufsteigenden Rauchsäulen aus Köhlermeilern vermischten sich mit den Farben der Luft, der Atmosphäre. Ginsterstauden wucherten, von Erika und Fichten durchwirkt; dazwischen Wacholderhecken und hohes Wolperngesträuch* (Heidelbeersträucher). Der Weg wurde beschwerlich. Mühsam stemmten sich die schnaubenden Pferde den Weg hinauf. Pitt roch ihren Schweiß. Ein Automobil überholte sie; der Fahrer winkte. »Ein Simplex, schon wieder einer«, sagte Leopold und verriet Pitt, dass er vorhabe, auch so einen zu kaufen, bald schon, zur nächsten Messe in Frankfurt. Die Mutter würde Augen machen.
Das Fuhrwerk hielt auf einem Plateau, wo Ziege und Schafe weideten. Von dort gingen sie zu Fuß. Der Weg war steinig, voller Geröll und Gestrüpp. Auf dem Schotter hatte Pitt kaum Halt, immer wieder bröckelte der Grund, prasselten Steine unter seinen Füßen. Der Vater ging voran, drängte das dornige Gezweig zurück, unter dem die Erde Stachelkräuter mit zackigen Blättern wachsen ließ. Das laute und raue Rätschen eines Vogels war Pitt fremd und eigen; das Geschwätz eines Eichelhähers aus spärlichen Hecken erschreckte ihn.
Plötzlich blieb er stehen. Steil unterhalb des Pfades lag ein kreisrundes, dunkles Gewässer. Auch der Vater verhielt den Schritt. »Da unten liegt es, das Totenmaar.«
Es lag in einer Einsamkeit, die Pitt erschütterte und zutiefst berührte. Aber es war nicht nur die Einsamkeit, es war die ganze wunderbare in Wasser und Wind versunkene Welt, in die er sah. Schweres Gewölk hing darüber, so sperrend, dass die Sonne kaum durchdrang. Wind kräuselte die Oberfläche des Sees.
Leopold hob die Hand über die Augen. »Das ist eines der Eifeler Maare. Ein Vulkansee ist es. Ein gefährliches Wasser. Nicht nur der Tiefe wegen. Unberechenbar. Man sagt, es flöge kein Vogel darüber.« Während sie weitergingen, konnte Pitt den Blick nicht abwenden. Er war erleichtert, dass der Vater redete. Er selbst hätte nichts sagen können, so beeindruckten ihn die Farben, die Stimmung und der schwere Geruch nach zerstäubter Erde und wilden Kräutern. Leicht vorstellbar waren die unterirdischen Gewalten, die hier einmal getobt hatten. Auch das Feuer und die Lavamassen, der Kraterschlund in bodenloser Tiefe. Der Vater erzählte, dass einer Sage nach an dieser Stelle einmal ein Schloss gestanden haben soll. »Wenn arme Leute hinkamen und sich was erbetteln wollten, so hat die Gräfin sie fortgejagt. Irgendwann versank das Schloss mit der hartherzigen Gräfin und an seiner Stelle entstand ein See. Der Graf wurde gerettet. Sein Kind auch, das in einer Wiege auf dem Wasser schwamm.« Er blieb stehen und wischte sich die Stirn. Im Weitergehen fuhr er fort: »Der Graf baute später aus Dankbarkeit für die Errettung seines Kindes eine Kapelle. Aber das sind Sagen. In Wirklichkeit ist es ein Vulkan, der vor zigtausenden von Jahren durch Gasexplosionen beim Zusammentreffen von Wasser und heißem Magma entstanden ist. So wie alle Maare hier in der Gegend. Dieses hier hat keinen Zufluss und keinen Abfluss. Und sieh mal das Ufer. Es läuft nicht flach aus wie bei einem See. Das Wasser ist unvorstellbar kalt. Man muss schon ein geübter Schwimmer sein, um hinüberzukommen.« Er deutete auf das gegenüberliegende Ufer, den Abhang eines Berges, karg bewachsen mit dornigem Rankengestrüpp, darüber nackte Höhen mit mageren Viehweiden. »Ja Pitt, alles Vulkane …«
Es drängte Pitt hinunter ans Wasser, aber zu steil ging es bergab und der Vater hatte ihn auf anderes aufmerksam gemacht. Inmitten der baumlosen Landschaft über dem Kratersee stand eine Kapelle hinter einer brüchigen Mauer, geschützt von hohen Eschen. Ein schwärzlicher Turm ragte gegen den Himmel. Um die Kirche herum lag der Kirchhof, grau und düster, selbst im Sommer. Ein Dorf war weit und breit nicht zu sehen. Wurmdurchbohrte Holzkreuze standen schief im Boden, schwarzes Gestein rahmte die Grabhügel, Krotzen der erloschenen Vulkane. Regen und Wind hatte die Steine verwittern lassen, Moos kroch darüber. Die Namen der Toten waren kaum lesbar. »Früher hat hier das Dorf Weinfeld gelegen. Es ist längst ausgestorben, vielleicht wegen eines Brandes. Möglich ist auch, dass Kriegsvölker die Pest anschleppten. Die Menschen starben nämlich massenweise und plötzlich. Kurz darauf ist der letzte Pastor hinunter nach Schalkenmehren gezogen. Nur die Kapelle ist geblieben und die Dörfler tragen bis heute ihre Toten hier hinauf.« Leopold blieb vor einem der Gräber stehen und las die Inschrift. »Die Sache mit der Pest ist denkbar. Noch denkbarer ist, dass die Leute hier oben verhungert sind.«
In der Kapelle war es düster und stickig. Nur ein spärliches Licht fiel durch die rundbogigen Fenster. Jemand hatte seltsame Zeichen in die Wand hinter dem Portal geritzt, auf der sich Risse und Flecken ausbreiteten. Einige Bodenplatten waren als Grabsteine erkennbar. Im kreuzgewölbten Chor flackerte eine Kerze vor einem Holzaltar mit Vesperbild. Von einem Gnadenbild konnte sich Pitt kaum losreißen. Es war eine Darstellung der Gottesmutter, den toten Jesus auf dem Schoß haltend. Ihr Herz war von sieben Schwertern durchbohrt, das Gesicht verzerrt von unsäglichem Schmerz. Jemand hatte ihr Blumen zu Füßen gelegt, verwelkender Rainfarn mit gelben Knopfblüten.
Auf dem Weg nach Schalkenmehren sprachen sie nicht. Das Maar und die Kapelle hatten eine seltsame Stimmung geschaffen und beide waren in Gedanken vertieft. Sie erreichten einen tiefer gelegenen Bergsattel, der den Blick zu einem zweiten Maar freigab. Das Totenmaar lag nun rechterhand und auf der anderen Seite, gute sechzig Meter tiefer, tauchte wie ein riesiger flacher Teller, das Schalkenmehrener Maar auf und ein Dorf, das sich an die östliche Uferseite lehnte.
Ein Honigverkäufer winkte mit seinem Strohhut. Mit einer Hotte auf dem Rücken kam er heran. »Guter Honig! Köstlich und sehr gesund …« Er war der einzige Mensch weit und breit und bot sich, als er keine Möglichkeit sah, den Honig loszuwerden, auf tölpelige Art als Fremdenführer an. Leopold verscheuchte ihn mit einer Handbewegung und Pitt sah ihm nach, bis er mit seiner schweren Last zwischen den Büschen verschwand. Sie kletterten zu einer Anhöhe. »Der See dort unten ist ja ganz anders …«, staunte Pitt. »Ja, ist das nicht herrlich? Aber es sind keine gewöhnlichen Seen«, korrigierte der Vater und ließ die Landschaft auf sich wirken. »Grandios.« Pitt stand neben ihm und malte mit den Augen: Wolken, die nach der Schalkenmehrener Seite dünner und lichter wurden, darüber einen hohen, weiten Himmel, das Licht, jetzt hell und gleißend, das Blinken des zweiten Maares, das, anders als das Totenmaar, lebendiger und leichter wirkte.
Die Blautöne des Himmels mischten sich mit dem des Wassers und dem Gelb des Rainfarns, der hier zu wilden Büschen angewachsen war. Königskerzen und Spornblumen ragten hüfthoch empor, der Ginster schien in sattgelben Wellen die Hänge hinabzurollen. Niemals zuvor glaubte er ein solches Licht empfunden zu haben. Nirgendwo sonst schien ihm der Himmel so hoch, die Luft so klarsichtig in ihren großen Farbakkorden, das Leuchten des Wassers so durchdringend und kostbar. Und auch die Natur selbst, nirgends sonst hatte er sie so ursprünglich erlebt, in diesen Kontrasten, in einem Urzustand belassen, nur wenig von Menschenhand berührt. Hatte er am Totenmaar kaum Vögel bemerkt, auch wenig Blühendes, sah er jetzt Farben. Obstbäume wuchsen und an den Ufern hatten sich Felberich und Rittersporn ausgebreitet; wilder Mohn flammte in Furchen und Gräben. Im Wasser tummelten sich Kinder, Spaziergänger schlenderten an den Ufern, darunter Damen in hellen Kleidern mit Sonnenschirmen und Schoßhündchen.
Während der Vater weiterging, blieb Pitt zurück. Auf einem Felsenvorsprung harrte er, konnte die Augen nicht abwenden, die ihm flimmerten vor Licht. Die Farbenpracht dieser Stunde war wie Musik, seine Seele vibrierte wie ein Orchester: Rosa, weiß und lila, gelb in allen Nuancen, Wolkenrücken in Fernblau, unten Häuser und ein roter Kirchturm, dazwischen Braun und Grün der Wiesen und Felder, der angrenzenden und alles umspannenden Wälder, der mit tausend Stimmen singende See und tief unter dem Wasser, geheimnisvoll wie der Gral, das im Mund der Erde schlafende Feuer. Er hätte nicht in Worte fassen können, was ihm hier begegnete, wusste nur, dass es Schönheit in ihrer reinsten Form war. Diesen Ort und diese Stunde zu sehen und zu malen, dachte er sich als höchstes Glück. »Hier will ich einmal leben und malen. Nirgends sonst«, flüsterte er und bückte sich nach einem rötlichen Lavakrotzen, den er wie zum Schwur in seiner Hand presste und in der Tasche verschwinden ließ. »Nirgends sonst.«
»Zuviel versprochen? Was ist nun mit der Seele der Landschaft?« Grinsend stand der Vater neben den Pferden und sah Pitt schon beim Näherkommen an, dass ihn die Gegend in ihren Bann geschlagen hatte. »Es ist schön hier, Vater. Schöner als überall sonst.«
»Ah! Du wirst noch Schöneres sehn. Die Alpen und Italien …!«, rief er im Weitergehen, »bloß so eine, wie diese hier, wirst du schwerlich woanders finden! Jetzt fahren wir hinunter. Wirst sehn!« Er drehte sich nach Pitt um, der hinter ihm ging, zwinkerte ihm ein Auge und begann zu singen: »Die Erde ist gewaltig schön, doch sicher ist sie nicht …«
Pitt dachte an Lessing und argwöhnte, dass der in seiner sächsischen Heimat sicher nichts Vergleichbares erfahren hatte. Schweigend saß er in der Kutsche. In langem Bogen führte der Weg talabwärts. Die Pferde liefen jetzt locker im Geschirr. Bauern waren beim Heumachen. Mit langen Gabeln luden Frauen das Heu auf Leiterwagen. Kühe und Ziegen reckten die Köpfe nach ihrem Gefährt, dessen Geschwindigkeit der Vater, eines Kindes wegen, das eine Kuh trieb, verlangsamen musste. Pitt belustigte sich über das Aufklatschen von Kuhfladen.
Schalkenmehren blickte aufs Maar. Die meisten Häuser waren dem Wasser zugewandt. Winkelige Ecken und Fachwerk fielen auf, frisch getünchte Hütten und Ställe, zerfallene Schuppen, dahinter Gerümpel und Ackergerät, dazwischen Gärten, in denen Vogelscheuchen standen, die mit Blechbüchsen behangen waren. In jedem Hof türmten sich Misthaufen. Die Straße lag voller Dung und Stroh. Die ältesten Häuser waren aus schwarzer Lava gebaut. Wohnhaus, Stall und Scheune lagen unter einem Dach. Schwalben nisteten an den Giebeln, umsegelten Dächer. An den Fenstern blühten Geranien und Fuchsien, Fleißiglieschen und Myrten in Zigarrenkisten und ausgedientem Kochgeschirr. Hühner gackerten über die Straße, die gelben Füße in rinnender Jauche. Ein Bauer kehrte die Straße; Strohhalme, Sand und Blätter sammelten sich unter kräftigen Besenstrichen. Aus einer Schmiede drang lautstarkes Fluchen. Eine Frau rief nach einem Kind. Ihr Ruf sorgte dafür, dass eine Horde Jungen, die auf einem Platz Klicker spielte, wie ein Heuschreckenschwarm davon stob.
Sie entstiegen der Kutsche in der Nähe des zweiten Maares und gingen ein Stück am Ufer. Das Licht hatte sich völlig verändert. Ungehindert brannte die Sonne und blendete in den Augen. Schweißperlen standen dem Vater auf der Stirn. Er zog ein Tuch aus der Hosentasche und wischte sich das Gesicht. Auch Pitt klebte das Hemd am Rücken, aber seine ganze Aufmerksamkeit galt den Farben. Die dicken Wolken hatten sich zerstreut. Hier unten war die Luft klar wie das Wasser. Eine Frau sammelte Wäschestücke ein, die zum Bleichen am Ufer lagen, Kinder tummelten sich im Maar. Ausgelassen alberten sie herum, brachten einen Kahn zum Schwanken, was sie noch aufgeregter kreischen ließ. Ein Stück weiter standen Angler bis zu den Knien im See. Aus einem Korbwägelchen drang Kindergeschrei. Eine Frau streckte den Kopf unter das Verdeck und begann ein Lied zu summen.
In einem Gasthaus, wo sie Fisch aßen, verhandelte Leopold seines Weines wegen mit dem Wirt, der sich auf ein Geschäft einließ und sechs Kisten roten Ahrburgunder orderte. »Den trinken Leut mit Geld. Ist beliebter als der von der Mosel«, lachte der Wirt und verriet Pitt, was es im Maar alles zu fischen gab: »Aale, Barsche, Karpfen und Rotaugen, Schleien auch. Sogar Hechte!«
Nach dem Essen drängte es Pitt ans Maar. Während der Vater im Wirtshaus blieb und gähnend die Glieder unter dem Tisch streckte, folgte er dem schmalen, mit Wacholderhecken bewachsenen Fußweg. Die Dämmerung hatte sich schon fast hinabgesenkt. Der Schein der Sonne zerging in gelbe und goldene Streifen, die das Gewässer in ein neues Licht tauchten, rätselhaft und schimmernd, bläulicher als am Nachmittag, als die Ufer belebt und voller Stimmen waren. Jetzt lag alles ruhig. Da waren das Zwielicht, das die Wolken verdunkelte, das vom dem Wind bewegte Wasser, der Abendbrand der sinkenden Sonne mit seinen tausendfältigen Farben, der Geruch nach Erde und wilden Gräsern.
Im Westen, über dem Hügel, war der Himmel aufgerissen. Grellrote Wolkenbänke standen ineinander verkeilt. Pitt bückte sich nach flachen Steinen, die er über das Wasser springen ließ. Die Wasserfläche glitzerte. Plötzlich schien es ihm, als ob der Boden unter ihm grollte, in leisen Stößen zu beben begann. Die Schärpen des Himmels hoben sich, Steine rutschten. Er fühlte, wie sich tief unter ihm etwas durch Spalten und Bruchstellen nach oben wühlte, sah, wie ein gewaltiger Druck Reste eines Pfropfs nach oben stieß, Lava und Felsbrocken aus der Kraterwand mitriss, die Erdoberfläche hob und schließlich durchbrach. Sein Herz hämmerte gegen die Schläfen, als rotleuchtendes, flüssiges Magma hervorquoll, eine Fontäne gegen Himmel geschleudert wurde und wenig später als Ascheregen herunterkam. Heftig atmend, die Augen weit aufgerissen, hörte er ein ohrenbetäubendes Krachen, sog die fauligen, gelben Schwefeldämpfe ein, gewahrte, wie sich ein glühender Schlammstrom unaufhaltsam voranwälzte, am Ort der ungeheuren Explosionen Gesteinsschichten in sich zusammenfielen und eine trichterförmige Mulde entstand, die sich mit siedendem Wasser füllte. Mit geballten Fäusten stand er, die Fingernägel tief in die Handballen gegraben. Er meinte sich in einem Bild zu bewegen, selbst Teil eines Bildes zu sein. Dann plötzlich, als ob eine Kulisse verschoben würde, ging das Feuer zurück, das Wasser beruhigte sich und der See war wieder wie vorher.
Atemlos ließ sich Pitt im feucht werdenden Ufergras nieder.
Ein Mistkäfer kroch auf einem Grashalm. Immer höher zog er den kugeligen Körper, metallischblau schimmerten die Flügel. Zwei Drittel des Halmes waren geschafft, da senkte sich der Halm zur Seite, der Kletterer fiel zurück ins Gras. Mit stummer Sehnsucht bewegte das auf dem Rücken gelandete Tierchen die Fühler und die seltsam geformten Beine, lag auf der gleichgültigen Erde und versuchte den Halm zu greifen, den Pitt ihm hinhielt. Auch der Käfer, dem er mit dem kleinen Finger auf die Füße half, war Teil des Bildes.
In seiner Tasche kramend fand er einen Bleistiftstummel und Papier, in das Ammi die Brote gepackt hatte. In einer Erdmulde hockend strichelte er den brombeerfarbenen Himmel, darunter Gräser und Wurzeln zwischen schwarzen Lavakrotzen, bis der Mond aufging und wie ein dünnes Viertel eines abgeschnittenen Apfels über ihm hing. Mit dem Mond kamen die Sterne. Sie strahlten zahlreich und hell, so dass alle anderen Lichtquellen darin versanken. Sie schienen ihm so nah, als könnte er sie pflücken. »Hier will ich einmal leben.«
16. Juli
Tagelang beschäftigten ihn die Maare. Oft lag er mit geschlossenen Augen auf der Bank im Garten und dachte an die klaren Farben des Himmels und des Wassers. Er las alles, was er über die Vulkane der Eifel finden konnte. Dann zeichnete er, mit Bleistift zuerst, später mischte er Farben, vor allem Blau- und Weißtöne. Anfangs gerieten die Bilder lediglich zu einem schwachen Abklatsch dessen, was er gesehen und gespürt hatte. Aber er übte und schulte das Auge durch stundenlanges und genaues Hinsehen, durch Stricheln und Zeichnen.
Am Morgen des 16. Juli stand er bereits in aller Frühe mit nassen Haaren und frischem Hemd in der Küche und bat Ammi um Wegzehr. Er hatte sich das Gute-Wünsche-Sagen und Verabschieden der Eltern und Geschwister an diesem Tag verbeten. Als Ammi damit anfangen wollte, wies er sie barsch zurück: »Lasst gut sein, Ammi. Sie werden mich nehmen.«
Viel zu früh brach er auf, verbrachte über eine Stunde am Bahnhof, wo er mit dem Geld seines Vaters ein Billett löste. Jede freie Minute der letzten Wochen hatte er über Skizzen und Studien gesessen, die er nun, in einer Mappe sortiert, bei sich trug. Ein Aquarell des Schalkenmehrener Maares war darunter, das er nach Wochen des Übens für gelungen befand. Im Zug kroch Anspannung in ihm hoch. Ammis Brote brachte er kaum hinunter.
Der Vater hatte ihm erklärt, in welcher Richtung die Akademie lag und da noch Zeit blieb, ging er zu Fuß Richtung Rhein. Die Straßen waren belebt und laut. Satte Basstöne von Hupen mischten sich mit dem prasselnden Geklingel der Radfahrer, den Glockenstößen und dem schleifenden Geräusch der Trams und dem harthölzernen Klappern der Pferdehufe. Bäckerjungen liefen mit Körben auf dem Rücken, Motorkutschen, Automobile und Droschken wechselten sich ab, modisch gekleidete Damen mit Federhüten trippelten auf Knopfstiefelchen, ein Zeitungsverkäufer schrie aus offenem Hals: »Erdbeben in Santiago de Chile! Reichspostdampfer Prinz Ludwig auf Jungfernfahrt von Bremerhaven nach Japan!«
Der Marktplatz war überfüllt. »Brucht ehr nix för in de Zopp, Madame?« Marktfrauen hielten ihre Ware in die Höhe, Hausmädchen feilschten um Pfennige, befühlten Kohlköpfe und Salate, Metzger standen hinter vollen Fleischmulden, dazwischen bewegten sich Postwagen mit Kutschern und über allem thronte ein ausladendes Reiterstandbild. »Eene Penning, dann schlonn ech et Rad«, bot ein Junge einem älteren Herrn an, der, nachdem der Radschläger seine Kunst gezeigt hatte, Münzen in die Luft warf.
In einem weißen Schürzenkleid saß ein Mädchen auf einem Schemel vor einem Baum und stützte das Kinn in die Hand. Ihr braunes Haar war fest an den Kopf frisiert und gab den Rahmen zu einem rotwangigen Gesicht mit schwarzen Augen. Missmutig musterte sie Pitt, der stehen blieb und das Plakat las, das neben ihr aufgestellt war: Pauline lass das Reiben sein, nimm Persil … Im Weggehen winkte er ihr zu, während sie sich wegdrehte.
Die Straße, nach der er suchte, vermutete er in einem Gewinkel von Gassen, in denen strenge Düfte nach gebratenem Fisch und Zwiebeln sich mit dem Gestank von Urin und Hundekot mischten. Dass er sich verlaufen hatte, merkte er, als er zwei Hausiererweiber nach dem Weg fragte und sie ihn herzhaft auslachten.
Die ganze Zeit schon war der Himmel verhangen und als er an der Andreaskirche ankam, setzte ein kurzer, heftiger Platzregen ein. Leute stülpten sich Taschen und Aktenkoffer über den Kopf, Männer zogen die Jacketts im Genick hoch; Frauen bejammerten ihre Frisuren und Kleider, die ihnen triefend am Körper klebten. Alles presste sich in die Hauseingänge. Pitt fürchtete um die Mappe, die er schützend unter die Jacke hielt, während er seinen Weg fortsetzte. Der Schauer dauerte nur ein paar Minuten. Danach roch alles wie frisch gewaschen.
Die Wohnung von Professor Steinmann war Teil einer Villa und lag in einer Seitenstraße der Akademie. Von einem hochnäsigen Mädchen wurde Pitt aufgetan und mitgeteilt, dass er zu warten habe, zwei Stunden mindestens, es seien noch weitere Studenten da, die Auswahl zöge sich. Sie bat ihn in einen muffigen Raum, der bis auf zwei Stühle und einen Tisch, worauf eine abgegriffene Zeitung lag, leer war. Er ging ein wenig auf und ab, sah eine Weile auf tropfende Büsche und Kastanienbäume hinter dem Fenster. Schließlich nahm er die Zeitung zur Hand und blätterte. Er überflog einen Bericht über Kaiser Wilhelm, der ein Automobilrennen um den Kaiserpreis im Taunus besucht hatte; dann einen Artikel über die Niederschlagung des Hottentottenaufstands in Deutsch-Südwestafrika. Er erfuhr, dass es Unstimmigkeiten wegen eines geplanten Sozialistenkongresses in Stuttgart gegeben hatte, dass unter den Teilnehmern auch Rosa Luxemburg gewesen war, die ihm wegen ihrer gewagten Haltung zur Kolonialfrage gefiel. Er las, dass auf einer Friedenskonferenz in Haag über Rüstungsbegrenzungen verhandelt worden war, konnte sich aber schlecht darauf konzentrieren, denn immer horchte er nach Schritten, sah auf seine Uhr. Es dauerte, bis das Mädchen die Tür öffnete und ihm einen Wink gab.
Der Raum, in den sie ihn führte, war überhitzt. Die Fenster hatten blinde Scheiben, Tische und Stühle lagen voller Hefte, Bücher und Bilder. Professor Steinmann stand gebeugt über Zeichnungen und drehte Pitt den Rücken zu. »Wie viele denn noch?«, bemerkte er und tupfte sich die Stirn mit einem Tuch. Neben ihm sichtete ein junger Mann eine Mappe mit Aquarellen. »Er ist der letzte.«
Pitt hatte ein Gremium mit Adleraugen erwartet und fühlte Erleichterung. »Bevor er die Mappe aufbindet, frage er sich, was ihn zur Kunst treibt und ob er sich echter Begabung sicher ist. Die Plätze an der Akademie sind begehrt, so rar wie Wasser in der Wüste.« Steinmann drehte sich um und sah Pitt an. Er hatte ein grob geschnittenes Gesicht, das ganz von den Augen beherrscht wurde. Augen, die nichts anderes konnten als prüfen und abschätzen. »Hat er überhaupt in Betracht gezogen, dass die Kunst mehr und mehr zum Sammelfeld gescheiterter Existenzen wird? Den meisten fehlt es an wahrer Eignung und Disziplin, gar nicht zu reden von moralischer Kraft. Man betrachte nur die Zumutungen, die täglich auf meinem Tisch landen. Jawohl, moralischer Kraft!«, wiederholte er, »der Kernpunkt der Kunst! Oder hat man eine andere Meinung darüber?« Mehrfach wollte Pitt antworten, aber Steinmann ließ es nicht dazu kommen. »Los, los, so bindet auf«, drängte er. Pitt legte die Mappe auf den Tisch und zog die Kordel auf. »Nicht mehr als fünf Bilder, das alles zieht sich viel zu lang …« Kurz nur ruhte Steinmanns Blick auf Pitts Bildern. »Hmm, Landschaften also. Mäßig, mäßig. Einzig Landschaften? Keine unterschiedlichen Werkzeuge, Materialien, Papiere? Sind sie der Wirklichkeit nachempfunden?«
»Ja, die Ahr, die Weinberge …«
»Hat man aus der Erinnerung gemalt oder in Anschauung des Objektes?« Eine Antwort wartete er nicht ab. »Das erste ist mäßig, das zweite nicht besser. Dies hier könnte angehen.« Mit dem Aquarell des Schalkenmehrener Maares begab sich Steinmann zum Fenster. Er nahm die Brille ab. »Ein guter, sicherer Strich, ein sicheres Auge. Und selbstbewusst, sehr selbstbewusst.« Er ging mit dem Blatt auf und ab. Die hölzernen Dielen ächzten unter seinem Schritt. Pitt hatte das Gefühl, etwas sagen zu müssen und erklärte, dass es die Farben seien und die Natur, die ihn zur Kunst drängten. Steinmann reagierte nicht. An seiner Stelle war der Assistent bemüht einzuwerfen, dass er Ahrweiler kenne, sogar einmal dort gewesen sei und machte bald einen gemeinsamen Bekannten mit Pitts Familie ausfindig, den Dichter Müller aus Königswinter. Diese Bekanntschaft schien auch den Professor zu interessieren, denn er hakte nach und hob die Augenbrauen. Dann nahm er den Zwicker von der Nase, zog ein Tuch aus der Weste und putzte das Glas. Es lag etwas Zermalmendes in seiner Überlegenheit, als er erneut die Zeichnung gegen das Licht hob. »Nicht aussichtslos. Werden sehn. Die Sache steht so übel nicht.«
Am Abend, zurück in Ahrweiler, wurde Pitt bestürmt und ausgefragt. Wie der Professor ausgesehen habe, wollte Agnes wissen und welchen Eindruck Pitts Bilder gemacht hätten. Ob er schon eine Zusage habe und wie lange er warten müsse. Ob er andere Bilder von anderen Studenten gesehen habe und wie Düsseldorf sei. Pitt gab kaum Auskünfte. »Abwarten«, sagte er und tat geheimnisvoll.
Unverdrossen malte er weiter und als er Ende des Monats im Poststapel seines Vaters einen Brief mit dem Absender der Akademie fand, rief er, noch bevor er den Brief öffnete: »Ammi, jetzt brauch ich Taschen und Koffer!«