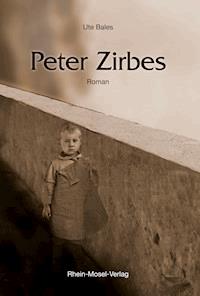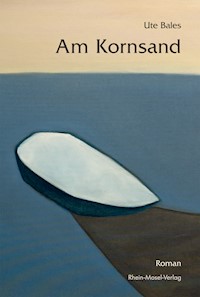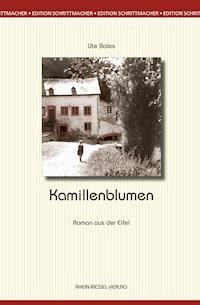Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1934 lernt Eva Justin während eines Lehrgangs für Krankenschwestern Dr. Robert Ritter kennen. Sie ist Anfang zwanzig, er Mitte dreißig, verheiratet, Oberarzt mit besten Karriereaussichten. An Ritter ist nichts zufällig, nichts nebensächlich. Sie ist bereit, als er fragt, ob sie seine Arbeit unterstützen will. »Saubere« Menschen sind sein Ziel. Eine »Rasse« ohne Makel. Von Anfang an tut sie, was er sagt, hinterfragt nichts, sieht weg, wo es heikel wird, verbeugt sich vor jedem seiner Worte. Bald geht sie eine Beziehung mit ihm ein und folgt ihm 1936 nach Berlin, wo er zum Leiter der »Rassenhygienischen Forschungsstelle« berufen wird. Im Rahmen großangelegter Untersuchungen vermessen, verhören und klassifizieren die Arbeitsgruppen, zu denen Eva Justin gehört, Tausende Sinti und Roma. Die Gutachten, die sie erstellen, bilden die Grundlage für die späteren Deportationen in die Konzentrationslager. Bei allem, was sie tut, bleibt Eva Justin unzugänglich und kalt. Nur Ritter gegenüber zeigt sie Gefühle. Erbarmungslos reißt sie Familien auseinander, horcht Kinder aus, lässt Leute verhaften, hilft bei Selektionen. Spiele, mit denen sie Sinti-Kinder in einem Kinderheim testet, entscheiden über Leben und Tod. Nach dem Krieg setzen Eva Justin und Robert Ritter ihre Karrieren ungestraft fort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2018 e-book-Ausgabe Rhein-Mosel-Verlag Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 www.rhein-mosel-verlag.de Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-866-1 Ausstattung: Stefanie Thur Lektorat: Michael Dillinger Korrektorat: Melanie Oster-Daum Titelfoto: © Can Stock Photo Inc./foreverleestock
Ute Bales
Bitten der Vögel im Winter
Roman
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Es gibt eine Zeit, in der keiner zaubern kann.
Dann geschieht, was in der Zeit ist.
Das kann eine Stunde sein, ein ganzer Tag sein,
ein ganzes Jahr,
oder ein ganzes Leben.
Kann sein, dass das nur ein Tag lang ist.
Oder eine Nacht.
Kann sein –
Sabine M. Krämer
Rassen gibt es nicht. Aber es gibt Rassismus.
Für Landolo Werst, genannt Zigeuner-Schorsch, den ich, und das war ein Versäumnis, nie nach seiner Vergangenheit gefragt habe.
Vorwort
Es ist leichter, über Opfer zu schreiben als über Täter. Wer über Opfer schreibt, kann mit dem Mitgefühl und Verständnis der Leser rechnen. Für Eva Justin rechne ich weder mit Mitgefühl und schon gar nicht mit Verständnis und unternehme auch nichts, dergleichen zu schüren. In der Zeit, in der sie wirkte, hatte das Böse die Eigenschaft verloren, an der die meisten Menschen es erkennen. Es trat, wie Hannah Arendt es formulierte, nicht mehr als Versuchung an den Menschen heran. Für Eva Justin war das, was sie tat, richtig und gut. Das Ausmaß ihres Handelns war ihr bewusst.
Weil der Roman zum Teil aus der Sicht und der Gedankenwelt einer Täterin geschrieben ist, kommen darin rassistische Klischees zum Ausdruck. Es sind Zuschreibungen, die es mehr oder weniger heute noch gibt. Den Nazi-Jargon verwende ich lediglich aus Gründen der Authentizität. Den Begriff »Zigeuner/in« gebrauche ich notgedrungen.
Freiburg, im Oktober 2018
Kinderheim Mulfingen, Frühherbst 1942
»Nun iss endlich! Nun mal los, iss! Und sitz gerade!« Diese Worte genügen. Er stößt den Teller zurück, die Suppe schwappt über, gelbliche Brühe bildet eine Pfütze, die langsam in den Ritzen der Tischplatte versickert. Mit erhobener Hand steht die Schwester vor ihm, die weiße Flügelhaube zittert. »Was für ein Tölpel!« Er schrammt den Stuhl zurück: »Ich will nach Hause!« Die Schwester reißt an seinem Haar, droht mit Arrest. Er hält die Hände vors Gesicht, erwartet, dass sie zuschlägt. Aber sie schreit nur. »An Regeln halten musst du dich! Sonst wird es nichts mit dir!« Ihre Stimme wird grell, türmt sich vor ihm auf. Ob er das verstanden hat. Er sitzt da, sieht den aufgerissenen Mund mit den schadhaften Zähnen, die roten Flecken, die sich in ihrem Gesicht gebildet haben und klammert sich an die Sitzfläche des Stuhls. »Ich will nach Hause!«
Ein Junge sitzt ihm gegenüber. Seine Haare sind so kurz, dass man die Kopfhaut sieht. Er löffelt und hält den Kopf gesenkt. Als die Schwester eilt, einen Lappen zu holen, flüstert er: »Halt die Klappe mit so was. Wenn sie böse ist, nimmt sie dir den Teller weg.« Der Junge schielt nach der auf der Tischplatte zerfließenden Suppe. Mit schnellen Bewegungen tupft er mit einem Stück Brot die restlichen Brühepfützen vom Tisch, stopft sich alles in den Mund und schmatzt.
Das Sprechen während des Essens ist verboten. Nur das Scharren der Löffel und das Klappern mit Besteck sind zu hören. Der Kahlgeschorene hat ständig die Schwester im Blick. Wenn sie nicht hinsieht, kratzt er sich an den Füßen. Er ist barfuß. Seine Zehen sind voller Frostbeulen.
Anton ist noch nicht lange im Heim. Er sitzt neben zwei Mädchen. Sie heißen Rutla und Dori. Er hat gehört, wie die Schwester ihre Namen gesagt hat. Rutla und Dori sind auch barfuß. Sie könnten Zwillinge sein, so ähnlich sehen sie sich. Sie sind gleich groß, tragen bunte Tücher, unter denen geflochtene Zöpfe hervorsehen. Alles an ihnen ist rund und prall: die Gesichter mit den Knopfaugen, die kleinen Hände, die Bäuche unter den gestrickten Kleidern, sogar die Füße. Sie sitzen nur da und sehen herüber. Als die Schwester mit dem Lappen kommt, rücken sie dicht zusammen, wie Vögel im Winter.
Die Schwester schwenkt den Lappen und sieht Anton strafend an. »Das machst du nicht noch mal, sonst kommst du in den Keller!« Der Kahlgeschorene gibt ihm einen Tritt unterm Tisch. Der Speisesaal ist voller Kinder. Viele sind Geschwister. Die Jüngsten können kaum über die Tischplatte sehen. Die größeren Jungen besetzen einen Tisch am Fenster. Sie tragen braune Arbeitsanzüge und Holzschuhe. Manche kommen nur abends. Tagsüber helfen sie im Feld oder im Wald, harken die Wege, die akkurat sein müssen, pflegen die Blumenrabatten. Einer von ihnen heißt Emil. Er ist bei einem Bauern eingeteilt. Es ist zwecklos, mit ihm zu sprechen, weil er taub ist.
Nach dem Essen klatscht die Schwester in die Hände. Sie steht mit ihrer riesigen Flügelhaube vorne neben der Tür: »Los, los, a bissle schneller!« Alle erheben sich von den Plätzen, sofort ändern sich die Töne im Saal. »Wir danken dir, allmächtiger Gott, für alle Wohltaten, der du lebst und herrschest in Ewigkeit …« Die Schwester hebt die Hand, berührt Stirn und Brust, dann die linke und die rechte Schulter: »Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.« Mit ihr bekreuzigen sich alle.
Jungen und Mädchen schlafen getrennt. Außer einem Stockbett hat jedes Kind einen Schemel, ein kleines Spind, einen Trinkbecher, einen Napf und einen Löffel. Blitzblank muss alles sein. Kein bisschen Staub darf an den Schuhen kleben. Spind und Bett müssen ordentlich gehalten werden. Die Bettlaken haben oben rechts drei rote Kreuze. Die roten Kreuze müssen sichtbar sein, wenn das Laken zusammengefaltet ist. Jeden Morgen, vor dem Appell, werden Spinde, Schuhe und Hände kontrolliert.
Alles ist Anton fremd. Der Schlafsaal mit dem trüben Licht, die vielen Betten übereinander, das Wecken um fünf Uhr morgens. Auch das Beten, das unbehagliche Schweigen zu den Mahlzeiten, das frühe Zubettgehen. Die gestärkten Hauben der Schwestern, ihre flatternden Gewänder, die andauernden Warnungen vor Todsünden machen ihm Angst. Wenn gesungen wird, klingt es nicht wie früher, als die Mutter noch die Lieder angestimmt hat. Das Essen schmeckt scheußlich. Das schwarze Brot ist so hart, dass man sich die Zähne ausbeißen könnte. Die Milch aus dem verbeulten Aluminiumnapf ist mit Wasser verdünnt.
Bitter ist es, dass er seine Sprache nicht mehr sprechen darf. Und dass sie ihm die Haare geschoren haben wie einem Schaf. Am schlimmsten aber ist, dass er nicht weiß, wo der Vater und die Mutter und die Geschwister sind und wann sie ihn endlich holen.
»Ich will nach Hause.« Das ist alles, was er sagt. Die Schwester sitzt vor ihm und zieht ihn an den Ohren. »Nach Haus? Wo soll das sein? Na, kannst mir das mal sagen?« Er ballt die Fäuste. »Aber ich will nach Hause! Zu meinem Vater!« Da packt sie ihn am Kragen: »Kannst nix andres sagen? Dein Vater! Wo soll er schon sein? Eingesperrt habens ihn, weil er um die Häuser geschlichen ist. Froh sein kannst, dass du da bist! A Suppe gibts heut keine mehr! So ein Sturkopf! Jetzt kniest dich in die Ecke, da nüber, unters Kreuz, und da bleibst, bis ichs sag.«
Am Tag ist alles voller Stimmen. Nachts sind es die Atemzüge und das Stöhnen der vielen Schlafenden. Einer von ihnen ist Emil. Anton weiß, dass Emil eine Ohrfeige von einem Polizisten bekommen hat, die so stark war, dass er in ein Wasser fiel, wo er bewusstlos liegenblieb und erst gefunden wurde, als seine Ohren nichts mehr taugten. Er weiß auch, dass Emil nichts gemacht hat, gar nichts, nur nach seinen Geschwistern hat er gefragt, aber das war dem Polizisten zuviel gewesen. Für Anton ist Emil ein Wunder. Einmal hält er sich die Ohren zu, weil er wissen will, wie es ist, wenn man nichts hört. Aber so sehr er die Ohren auch presst, er hört trotzdem etwas.
Der Kahlköpfige aus dem Speisesaal heißt Karli, liegt in der Pritsche über ihm und ist schon ein halbes Jahr da. Meint er jedenfalls. Genau weiß er es nicht. Karli besitzt ein Messer und eine Flöte. Die Flöte hat er aus Weiden geschnitzt. Wo er das Messer versteckt hält, sagt er nicht. Manchmal murmelt er im Schlaf und schlägt um sich, dass das Bettgestell wackelt und Anton wach wird.
Einmal, es ist tiefe Nacht, da steht Anton auf und setzt sich mit angezogenen Knien auf das Fensterbrett, presst sich so dicht ans Fenster, dass er den kalten Luftzug spürt. Er schnieft und friert, aber das Frieren macht ihm nichts. »Was hast du?«, fragt Karli und beugt sich über die Bettkante. »Hör auf mit dem Geschnauf. Das hilft überhaupt nichts. Leg dich und gib Ruhe!« Karli verschwindet wieder. Anton lehnt den Kopf an die Scheibe, sieht, wie das Glas an der Stelle beschlägt, auf die sein Atem trifft, wie die beschlagene Stelle kleiner wird, wenn er einatmet, wie sie größer wird, wenn er ausatmet. Es dauert ein bisschen, dann taucht Karlis Kopf wieder auf. »Warum glotzt du ständig aus dem Fenster?« Anton ignoriert die Frage. Am liebsten wäre er allein. Er versucht sich den Kahlgeschorenen wegzudenken, der aber hängt fast über ihm: »Wirst schon sehn, wie es ist, wenn du nauskommst, wirst schon sehn, wie’s dann ist …«
Anton stellt sich vor, wie es wäre, tot zu sein. Ob er dann so etwas wie Luft wäre, schwebend über Baumwipfeln? Im Frühjahr waren sie noch alle zusammen gewesen. Der Vater, die Mutter, die Geschwister, die Tante. Ob sie nach ihm suchen? Der Vater sicher. Aber warum kommt der Vater nicht und holt ihn? Die Schwester sagt, dass er eingesperrt ist, aber seinen Dada kann man nicht einsperren. Er ist stark und kann sogar fliegen, wenn er nur will. Auch die Männer, die ihn geholt haben, können ihn nicht einsperren. Der Vater hat sich gewehrt, als sie kamen. Geschrien, geschrien, geschrien hat er. Dass er seine Kinder nicht wiedersehen wird. Die Geige haben sie ihm deshalb zerschlagen.
Manchmal sieht Anton den Vater. Er muss nur die Augen ganz fest schließen, dann steht der Vater unten im Hof, die Kappe in der Hand, und nickt ihm zu. Über sein Haar fliegen die Krähen. Der Vater schwankt ein bisschen, die Hose ist voller Fusseln, die feinen Streifen seines hellen Sonntagsanzugs laufen schief und krumm und durcheinander. Die Schnürsenkel seiner Schuhe sind offen. »Dada, Dada, nimm mich mit!« Anton darf nur nicht die Augen öffnen, denn dann verschwindet der Vater wieder mitsamt seinem Schnurrbart und seinen weiten, grauen Hosen. Als ob der Wind ihn davonträgt, so wie die Töne seiner Geige, die irgendwann verklungen waren.
Früher hatte der Vater in Pfullendorf einen Laden betrieben, wo er Musikinstrumente reparierte und verkaufte. Dann war die Polizei gekommen, hatte ihm seinen Handel verboten, weswegen er kurz darauf, mitten in der Nacht, Kleidung und Essen zusammengerafft, die Pferde aus dem Stall geholt – zwei schöne Pferde waren es, zwei Lichtfüchse – und den Wagen bepackt hatte.
Seither waren sie unterwegs, lebten in Wäldern, in alten Fabriken, manchmal bei Bauern. Einmal hatten sie in der Dämmerung am Ufer eines Flusses ihr Lager aufgeschlagen, ein Feuer gemacht, Fische gebraten und die Gitarren ausgepackt. Die Tante, seine Bibije, hatte getanzt. Er erinnerte sich an ihren blau schimmernden Rock, die funkelnden Ohrringe und die Schellentrommel, mit denen sie den Takt angab. Damals hatte er vom Vater wissen wollen, wo denn die Töne hingingen, wohin sie aufstiegen, ob sie sich sammelten. Da hatte der Vater hinaufgezeigt, ins Schwarze über den Wipfeln der Bäume und zurückgefragt: »Aber hörst du sie denn nicht? Sie sind alle noch da. Nichts vergeht, gar nichts. Es ändert sich nur, nimmt eine andere Gestalt an, aber sonst …«
Damals hatte er die halbe Nacht mit seinem Dada am Fluss gesessen. Wie aufgehängt hingen die Sterne am Himmel. Ins Bett gingen sie erst, als im Frühlicht die Pferde schnaubten.
Die Wiese, auf der sie lagerten, lag vor einem massigen Felsen. Butterblumen, Wiesenschaumkraut und Disteln wuchsen in Büscheln. Mit jeder Distel, die Anton fand, rannte er zu den Pferden, hielt sie ihnen auf der flachen Hand vors Maul und lachte, wenn die weichen vorgestülpten Lippen der Tiere ihm das stachelige Zeug von der Hand fraßen. Ganz in der Nähe sprudelte eine Quelle aus der Erde. Käfer und winzig kleine Rädertierchen gab es dort. Der Vater wusste, dass die Berge vor Millionen von Jahren Vulkane gewesen waren, die das Land mit glühender Lava übergossen hatten. Immer noch brodele und koche es im Erdinneren. Die Quelle sei der Beweis.
Immer waren Kinder in der Nähe der Quelle, füllten Eimer und Krüge. Manchmal kamen welche an den Wagen, streichelten die Pferde, brachten Rüben oder einen Sack Stroh. Die meisten hielten Abstand, standen mit misstrauischen Blicken und rannten weg, wenn die Mutter sie ansprach.
Heiß waren die Tage. Einmal war er bis zu einem riesigen Felsen gelaufen. Von oben hatte er die alten Häuser unter sich gesehen, die Brücke über den Fluss, den Bahnhof mit den schwarzen Loks, weiter hinten eine verfallene Burg und Leute in ihren Gärten, ganz klein, wie winzige Punkte. Noch weiter hinauf war er dem grasigen Hang gefolgt, bis dorthin, wo Kiefern wuchsen, Nusshecken und Eichen. Tastend versuchte er die Füße richtig zu setzen. Steil fiel neben ihm der Berghang ab. Überall blühten gelbe Sträucher, wie golden sahen sie aus gegen den hellen Himmel. Sonderbare Steine gab es. Kleine Tiere, auch Fische wohnten darin, die zu Stein geworden waren. Wildblumen dufteten, grünglänzende Käfer trugen Hörner auf dem Kopf. An Baumstämmen wuchsen grüne, kelchförmige Pilze. Ameisenhügel gab es hier mehr als anderswo. Lange hatte er über einem der Hügel gehockt und den Tieren zugesehen, die in emsigen Kolonnen Kiefern- und Fichtennadeln, winzige Äste, Grashalme und Rindenstückchen schleppten.
Da war ihm ein Bauer mit einer geschulterten Sense entgegengekommen, hatte die Kappe gehoben, gelacht, die Hand nach ihm ausgestreckt und gerufen, dass er einen so feinen Zigeunerjungen gut gebrauchen könnte. Gerannt, gerannt, gerannt war er. Zurück zu seinem Dada. »Dada! Wo bist du? Wo bist du, Dada?«
Aufgefangen hatte ihn der Dada, ihn auf seine starken Schultern gehievt und am Ufer der Kyll wieder abgesetzt. Barfuß waren sie über glitschige Steine gelaufen, hatten Ausschau gehalten nach Äschen und Forellen. Gewirbelt und gegurgelt hatte der Fluss.
Später hatte er mit seinem Bruder Stöcke und Steine gesammelt, einen Damm gebaut und im gestauten Wasser kleine Papierschiffe schwimmen lassen, die, wie Wasserläufer, feine gefiederte Spuren hinter sich herzogen.
Wenn er an seinen Dada denkt, fühlt er sich wie ein Baum ohne Blätter. Sogar das, was nicht schön war, das Schuheputzen, das Reinigen der Eimer im Bach, selbst die verhassten Schweinemagen, die der Vater wie eine Delikatesse verzehrte, scheint ihm jetzt in einem hellen Licht.
Mindestens drei Sonntage ist es her, dass sie ihn fortgerissen haben. Seitdem schläft er auf der schmalen Pritsche unter der des Kahlköpfigen, der Karli heißt. Die Sonntage sind leicht zu erkennen, denn dann gibt es richtige Milch zum Frühstück und sie müssen nicht in die Schule, dafür zweimal in die Kirche. Dabei marschieren sie in Zweierreihen, den Zeigefinger vor den Lippen. Disziplin und Schweigen sind das Wichtigste. Einmal in der Woche wird geduscht und es gibt frische Unterwäsche. Das ist am Samstag. Die Jungen duschen getrennt von den Mädchen. Bei den Jungen kontrolliert Schwester Ricarda die Unterhosen. Ist eine verschmutzt, schlägt sie den Schweinen, wie sie sie nennt, mit einem Rohrstock auf den entblößten Hintern, bis es rote Striemen gibt und manchmal die Haut aufplatzt.
Im Schlafsaal ist es immer unruhig. Karli schläft schlecht und knirscht mit den Zähnen. Manchmal werden welche mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen und auf einen Nachttopf gesetzt. Manche hören nicht auf zu schreien. Dann bekommen sie etwas in den Mund gestopft und werden schnell ruhig. Auf Wilhelm hat es die Schwester Oberin besonders abgesehen. Wenn er ins Bett macht, steckt sie ihn in eine Wanne mit eiskaltem Wasser. Einmal erbricht er das Essen. Da stopft die Oberin es ihm mit Gewalt in den Mund zurück.
Am liebsten würde Anton die Schule schwänzen. Aber das geht nicht. »Heil Hitler! Setzen! Hände auf den Tisch!« Gut, dass Karli mitgeht. Karli geht in die vierte Klasse und sitzt bei den größeren Schülern. Manchmal dreht er sich nach Anton um und grinst.
Das Klassenzimmer ist groß, weiß gekälkt und riecht nach Kreide und Bohnerwachs. Die Schülerbänke sind eng. Es sind Doppelsitzer mit einem Tisch, der Löcher für Tintenfässer hat. Die Tintenfässer fehlen. Auf den Pultdeckeln haben sich Flecken ins Holz gefressen.
Vorne stehen ein niedriges Pult und ein Stuhl für Fräulein Nägele. Eine große schwarze Tafel muss reihum abgewischt werden und darf keine Streifen haben. Anton muss jeden Morgen die Fingernägel vorzeigen, auch seine Schiefertafel, die sauber gewischt sein muss. Sprechen darf er nur, wenn er gefragt wird. Wird er etwas gefragt, muss er zuerst überlegen. »Erst den Kopf einschalten, dann reden«, sagt Fräulein Nägele, der sein Überlegen meist zu lange dauert. Fräulein Nägele redet schwäbisch. Ihre Stimme hört sich an wie die kleinen Maschinchen, mit denen man Messer schleift, spitz und scharf. Es hört sich fast so an, als ob seine Tante Banana in der Nähe ist. Wenn er kurz die Augen schließt, sieht er die Tante, wie sie getrocknete Tabakblätter zwischen den Händen zerreibt und daran riecht.
Wenn er die Augen wieder öffnet, ist statt Tante Banana das Fräulein Nägele da. Sie redet ununterbrochen, unterrichtet alle Klassen und damit alle Kinder. Sie ist es auch, die die Kinder den Klassen zuteilt und das geht nicht nach Alter, sondern nach Wissensstand. Anton ist schon fast 10, aber sie hat ihn der Anfängerklasse zugeteilt.
Neben einem großen Bild des Führers hängt eine Landkarte, auf der die Siege mit kleinen Fähnchen markiert sind: Dänemark und Norwegen, die Niederlande, Luxemburg und Belgien. Anton kennt die Länder nicht. Dafür kennt er Schwaben, den Schwarzwald und die Eifel, wo er mit den Eltern war. Die Eifel und Schwaben sind auf der Karte nicht zu finden. Karli kennt die Länder mit den Fahnen auch nicht, dafür kennt er sich im Rheinland aus, hat einen großen Fluss gesehen, mächtige Burgen und einen Felsen, auf dem ein blondes Mädchen saß und sich die Haare kämmte. Anton würde gerne etwas über Vulkane und Quellen sagen, aber danach fragt Fräulein Nägele nicht.
Jeden Morgen müssen die Kinder ganz gerade stehen, sich in Zweierreihen aufstellen und den rechten Arm heben. Der Winkel muss immer gleich schräg sein. Fräulein Nägele korrigiert bei jedem die Haltung. Wenn alles stimmt, schnippt sie mit den Fingern. »Heil Hitler!«
»Sieg! Heil!«, schreien die Kinder. Manchmal müssen sie den Gruß wiederholen. Dabei müssen sie stillstehen und streng geradeaus sehen, die linke Hand an der Hosennaht. Das Stillstehen dauert so lange, bis Fräulein Nägele fertig ist mit dem Heftesortieren. Dann erst dürfen sie sich setzen.
Alle müssen die Länder Europas kennen und wissen, wo die deutschen Truppen kämpfen, wo sie einmarschiert sind und welche Länder bereits deutsch sind. Immer wieder müssen sie sie aufzählen, im Chor und einzeln. Es dauert, bis sich Anton alle merken kann. Dann aber ist er stolz und sagt sie manchmal zum Spaß vor sich her: »Belgien, Frankreich, Holland …« Bei denen, die die Antwort nicht wissen, kann es passieren, dass Fräulein Nägele den Rohrstock über die Finger tanzen lässt oder jemand ins Besinnungszimmer sperrt. Vor dem Besinnungszimmer haben alle Angst. Stockdunkel und muffig, wie in einem Keller, ist es dort und es gibt nichts zu essen. Karli nennt das Besinnungszimmer Bunker. Er war schon zweimal drin. Einmal hat er eine ganze Nacht zwischen Putzlappen und Eimern gehockt. Gestärkt hat ihn das, sagt er zu Anton.
Im Rechenbuch stehen Aufgaben, die Anton nicht versteht: Ein Jungzug hat 71 Pimpfe. In seinen ersten beiden Jungenschaften sind je 15, in der dritten 14, in der vierten 13. Wie viel Pimpfe hat die fünfte Jungenschaft? Er rechnet und rechnet, nimmt die Finger zu Hilfe. Als Fräulein Nägele durch die Reihen geht und ihm über die Schultern sieht, schreibt er 23 in sein Heft und sieht sie gespannt an. Fräulein Nägele schüttelt den Kopf und gibt ihm eine Ohrfeige. »Erst überlegen, dann schreiben! Jetzt hast du dein Heft versaut.« Zur Strafe muss er nachsitzen und bekommt eine noch schwierigere Aufgabe: a) Ein feindliches Bombengeschwader wird im Anflug auf eine Stadt gemeldet (Geschwindigkeit 250 Kilometer pro Stunde). Als es noch 450 Kilometer von dieser Stadt entfernt ist, startet ein Geschwader von schnellen Jagdflugzeugen (Geschwindigkeit 350 Kilometer pro Stunde) zur Abwehr. In welcher Entfernung von der Stadt kommt es zum Kampf? b) Nach welcher Flugzeit stoßen die Geschwader aufeinander? Für Karli wäre diese Aufgabe ein Mückenschiss, wie er sagt. Anton hingegen brütet darüber, bis ihm der Kopf raucht. Zum Piloten würde er niemals taugen, sagt Fräulein Nägele.
Obwohl er fast zehn ist, muss er Schönschreibübungen machen. Weil er eine Sauklaue hat, sagt Fräulein Nägele. Das Schönschreiben gefällt ihm. Seitenlang malt er As mit Schnörkeln. Erst wenn der Buchstabe akkurat ist, darf er den nächsten nehmen. Manchmal muss er lesen. Lesen mag er nicht. Es gibt zu wenig Schulbücher, und er muss sich das Lesebuch mit Buberli teilen. Buberli schubst ihn ständig in die Seite, macht sich in der Bank breit und hält stur den Finger genau auf die Stellen, die Anton lesen will.
Die Pausen sind am schönsten. Auf dem Schulhof spielen sie Fangen und Verstecken. Karli gibt das Kommando. Anton muss sich bücken und die Augen schließen. Dann trommelt Karli auf seinem Rücken herum und ruft: »Eins, zwei, drei, vier, Eckstein, alles muss versteckt sein. Hinter mir und vorder mir gilt es nicht und an beiden Seiten nicht! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn – ich komme!« Erst dann darf Anton sich aufrichten und nach den anderen suchen. Dabei gibt Karli ihm Hinweise: »Heiß! Noch heißer! Jetzt wird es wieder kälter … jetzt ganz kalt.« Es ist immer ein Geheul, wenn er einen aufstöbert und beim Namen ruft. »Angela, ich hab dich!«
Manchmal ist Fliegeralarm. Dann müssen sie hinunter in den Keller, egal was sie gerade tun. Oft dauert es Stunden, bis sie wieder hinauf dürfen. Aber im Keller braucht Anton nicht zu rechnen, auch nicht zu lesen und es stellt niemand schwierige Fragen.
Zum Heim gehört eine Landwirtschaft. Es gibt Scheunen und Ställe, Felder und Gärten. Nach der Schule müssen die Kinder helfen, in den Kartoffelferien den ganzen Tag.
Der taube Emil muss mit seinem Eimer die Wege um das Heim sauber halten. Rutla und Dori, die Zwillinge, werden in die Felder gebracht. Es regnet und es gibt viele Kartoffelfelder. Die weiche Erde klumpt an ihren Sohlen. Bis es dunkel wird, klauben sie mit klammen Fingern Kartoffeln aus der Erde. Am Abend spüren sie ihre Hände nicht mehr und können kaum gerade stehen.
Als der Regen aufhört, werden Anton und Zweigerli hinausgeschickt zum Sammeln von Beeren und Kräutern. Eimerweise schleppen sie Nüsse, Himbeeren und Brombeeren, Schlehen und Hagebutten ins Heim zurück, helfen beim Entsteinen von Obst, beim Kochen von Marmeladen, Säften und Sirup, die sie in Gläser abfüllen, abkühlen lassen und dann in Kisten verpacken. »Das ist für unsere tapferen Soldaten, die für uns an der Front kämpfen«, sagen die Schwestern.
Angela und Loli helfen im Stall beim Kühe melken und Schweine füttern. Auch beim Ausmisten. Loli wäre gerne bei den Pferden. Aber das erlaubt die Schwester nicht.
Später wird Anton mit Kajetan und Buberli zur Rübenernte abkommandiert. Bleiben sie auch nur einen Moment stehen und strecken den Rücken, hagelt es Strafen. Meist Schläge mit dem Stock. Der Tag auf dem Feld will nicht vorbeigehen.
Alois und Wilhelm müssen Gräben ziehen und Felder umstechen. Das ist auch nicht viel besser. Die Zwillinge werden in die Waschküche geschickt. Die Waschküche ist ein guter Ort, weil es dort warm ist. Trotzdem sind am Abend alle erschöpft. Arme und Beine sind taub, alles tut weh.
Wer beim Kirchgang ungehorsam ist, wird ins Besinnungszimmer gesperrt. Einmal muss Karli 50 Mal in der Hocke eine Treppe hinaufsteigen, die Hände hinter dem Kopf. Ein anderes Mal sperrt die Schwester Oberin eine Handvoll Kinder für zwei Tage ohne Essen in einen Raum, weil sie beim Mittagessen geflüstert haben. Sie weiß genau, dass die Nichtschuldigen die Schuldigen zu Brei schlagen.
Wenn sie nicht zu anderen Arbeiten eingeteilt sind, stehen für die Mädchen Hausarbeiten an. Sie sticken, stricken, nähen, kochen und backen. Sie sollen gute Hausfrauen werden, sagt Fräulein Nägele und meint, dass ihnen nichts Besseres passieren kann, als später einen Haushalt zu übernehmen.
Die Jungen sollen Arbeiter werden oder Bauern.
Manchmal kommen Bäuerinnen mit Pferdefuhrwerken angefahren und suchen sich Kinder für die Landwirtschaft aus. Es sind Bäuerinnen, deren Männer im Krieg sind. Sie prüfen die Kinder wie das Vieh, schauen ihnen in den Mund, betasten die Muskeln.
Manche der Kinder bleiben dann lange weg. Diejenigen, die Geschwister im Heim haben, kommen hin und wieder an Sonntagen vorbei und bringen Gemüse, Speck und Brot. Es gibt auch Kinder, die von der Polizei abgeholt werden und nicht mehr wiederkommen.
Über die, die verschwinden, wird leise gesprochen. »Die Gestapo holt sie«, flüstert Karli von seinem Bett herunter und Anton stützt sich auf die Ellenbogen und fragt schläfrig: »Was ist Gestapo?« Karli tut geheimnisvoll. Was Gestapo heißt, will er nicht verraten. Nur, dass Gestapo die Kinder ins Lager bringt, vielleicht aber auch zu ihren Eltern, sagt er. In dieser Nacht wartet Anton auf die Gestapo, stellt sich vor, wie sie ihn zu seinem Dada bringen.
»Der Einzelne ist nichts, die Allgemeinheit, der Staat, ist alles«, sagt Fräulein Nägele und spricht über Gerechtigkeit und Gehorsam, über den Führer, den sie gottgesandt nennt, über dessen Liebe zum Volk. Dann sagt sie, dass Natur und Rasse gottgegeben seien und dass kein Schüler ins Leben entlassen werden dürfe, der keine Kenntnis über diese Dinge habe. Sie sagt etwas von Unreinheit des Blutes und blickt in fragende Gesichter. Was das sein soll, sagt sie nicht, aber ihre Stimme ist fest und klar: »Der Führer sagt, das Schwache muss ausgehämmert werden.«
Manchmal, an seltenen Tagen, bringt Fräulein Nägele Briefe mit. Die Briefe sind geöffnet und enthalten oft nur ein paar lesbare Zeilen. Alle anderen Zeilen hat jemand so oft durchgestrichen, dass man nichts mehr lesen kann. Die Umschläge werden nicht verteilt. Karli sagt, dass niemand wissen darf, wo sie abgeschickt wurden. Karlis Eltern schreiben nie. Auch Anton bekommt keine Post. Er wartet erst gar nicht darauf. Der Vater schreibt nämlich nicht gerne.
Am Sonntag marschieren sie in Zweierreihen hinaus auf die Wiese. Die Mädchen mit der Schwester Oberin, die Jungen mit Schwester Ricarda. Alle hören auf die Pfeife der Oberin. Ein Pfiff: Gehen. Zwei Pfiffe: Stehen bleiben.
Der Himmel spannt sich über ihnen in einem blassen, fernen Blau, das es nur im Herbst gibt. Die Bäume stehen ernst und hoch. Anton hat die Weite des Himmels und den Geruch des Waldes vermisst und atmet tief ein. Er erinnert sich, dass sie einmal mit dem Wagen an Seen vorbeigefahren sind, die wie Augen aussahen und dass sein Vater in die Hände geklatscht und ein Lied angestimmt hatte.
Einen Moment bleibt er stehen, die Hand gegen die Sonne, sieht in den Himmel, entdeckt ein Loch zwischen den Wolken. Unendlich weit scheint es ihm und unsagbar tief. Die Schwester Oberin schubst ihn in den Rücken. »Was stehst du und glotzt Löcher in die Luft?« Er senkt den Blick, geht weiter. Sie spornt alle an, schneller zu gehen. Die Erde ist weich, matschig. Noch blühen späte Blumen. Zwischen kleinen Steinen wachsen Grashalme. Ein Fuhrwerk, gezogen von einem mageren Ochsen, holpert vorbei. Mit hängenden Köpfen stehen Pferde in einer Koppel, zucken mit den Ohren. Plumpe Brauereipferde sind es mit struppigem Fell.
Sie marschieren ein Stück auf dem aufgeweichten Weg und dann links, an Gärten vorbei, in denen Kürbisse wachsen und Sonnenblumen ihre schweren Köpfe hängen lassen. Anton weicht einer Pfütze aus. An einem Zaun steht eine Kuh, deren Augen tränen und von Fliegen verklebt sind. Anton streicht ihr über das samtige Maul. Schwester Ricarda zieht eine Pfeife aus der Tasche und bläst hinein. Der Ton schmerzt in den Ohren. »Los, jetzt! Alles steht gerade! In einer Reihe! Und jetzt: Achtung – fertig –los!« Bei »Los« pfeift sie und alle rennen. »Bis zu dem Baum da hinten!«, schreit die Schwester und als sie am Baum sind, heißt es: »Bis zum Zaun!« Vom Zaun geht es wieder zum Baum, vom Baum zum Zaun. Von Zaun zum Baum. Fast eine Stunde geht es so. Die Lungen stechen. Das Atmen schmerzt. »Jetzt Liegestütze! 20 Mal! Und jetzt noch mal 20! Weiter, weiter, weiter!« Während Anton die Zunge aus dem Hals hängt, spielen die Mädchen Ringelreihen. Anton findet Ringelreihen albern und ist froh, dass er rennen darf. Auf dem Rückweg sagt die Schwester Oberin zu Karli, dass die Schule für ihn zu Ende ist und er ab nächster Woche mit aufs Feld muss. Karli lacht und fühlt sich stark.
Karli hilft Felder umstechen. Morgens um vier muss er raus. Am Abend schläft er vor Erschöpfung sofort ein. Er sagt, dass die Äcker riesig sind, dass sie vom Morgen bis zum Abend reichen und dass, wenn es regnet, das halbe Feld an seinen Füßen klebt. Schwer wie ein Sack Zement wären die Schuhe. »Das würdest du gar nicht aushalten«, urteilt er und sieht prüfend auf Anton. Karli ist zäh und drahtig. Er hat sich zwei Jahre lang mit seinen Eltern in den Wäldern versteckt. Jetzt ist er froh, ein Bett und Essen zu haben. Vor allem Essen. Karli hat ständig Hunger. Auch Anton hat Hunger. Das Essen im Heim reicht nicht. Er weiß, dass fast alles, was sie im Heim ernten oder herstellen, auch Milch und Brot, für die SS-Männer in Crailsheim oder für die Soldaten an der Front bestimmt ist. Für die Kinder gibt es deshalb nur dünne Brotsuppe. Manchmal auch Brei oder Steckrüben, selten Kartoffeln. In der Suppe schwimmen manchmal kleine weiße Würmer, die Karli mit den Fingern herausfischt. Karli sagt, dass das immer noch besser ist, als sich das Essen draußen im Wald suchen zu müssen.
Wenn Karli abends nicht sofort einschläft, erzählt er merkwürdige Dinge. Dass viele der Leute, die bei den Bauern arbeiten, aus Polen kämen und nichts zu lachen hätten. Karli weiß auch, dass die SS-Männer Juden einfangen und zu Mehl verarbeiten. Wenn Karli solche Sachen erzählt, kann Anton nicht einschlafen. Er will wissen, ob er auch ein Jude ist, aber Karli tippt sich an die Stirn. »Du doch nicht.« Anton ist froh, dass er kein Jude ist. Auch, weil die Juden an allem schuld sind, wie Karli sagt.
In der großen Pause steht Fräulein Nägele im Hof und spricht mit einer fremden Frau. Die Frau sieht aus, als ob sie aus der Stadt kommt. Sie ist schlank, trägt ein graues Kostüm. Ihr rotes Haar wird von einer Spange gehalten. Je länger sie sprechen, desto aufgeregter wird Fräulein Nägele. Dann verabschiedet sich die Frau und Fräulein Nägele rennt ins Haus.
Sie kommt später in die Klasse als sonst, steht am Pult, ihr Blick geht von einem zum anderen. »Liebe Kinder! Ihr wisst, dass der Krieg uns einiges abverlangt. Wir haben viele Feinde, vor denen wir uns wappnen müssen. Wir müssen alle sehr tapfer sein. Vor allem müssen wir aufmerksam sein und gut aufpassen auf das, was um uns herum passiert. Ordnung und Anstand müssen gewahrt bleiben. Und deshalb …« Kajetan muss grinsen, weil das Fräulein Nägele die Sätze so seltsam unterbricht und manchmal nicht weiter weiß. Auch Alois ist dick vor Lachen. Fräulein Nägele senkt den Kopf, spricht weiter, Verworrenes, Unverständliches. Am Ende fordert sie alle auf, ein Versprechen abzulegen. »Ihr müsst alle gut aufeinander aufpassen. Immer.« Alle stehen auf und geben ihr das Versprechen. Weshalb, weiß keiner.
Tage später steht sie mit einer fremden Frau vor der Klasse. Es ist die Rothaarige, mit der sie kürzlich auf dem Schulhof gesprochen hat. Die Frau ist sehr blass, trägt immer noch das graue Kostüm und sieht streng aus. Eine schwarze, prall gefüllte Aktentasche lehnt am Pult. »Das ist Fräulein Justin«, sagt Fräulein Nägele, »sie kommt aus unserer Hauptstadt. Aus Berlin. Sie schreibt eine Arbeit über unser Heim und über euch und will eine Untersuchung mit euch machen. Ich möchte, dass ihr sie unterstützt. Macht ihr das?« Alle nicken. Fräulein Justin lächelt und sagt: »Latscho diwes1!«
Alle sehen sich irritiert an. Erst gestern hat die Schwester Oberin mit ihnen geschimpft, ihnen eingeschärft, kein Romanes mehr zu sprechen, nur noch Deutsch. Wir sind doch hier nicht in Zigonesien, hat sie gesagt. Und jetzt spricht das fremde Fräulein plötzlich ihre Sprache, kündigt an, Spiele mit ihnen zu spielen und Wettkämpfe zu veranstalten. Auch Fotos will sie von allen machen. Dass alle belohnt würden und dass es viel zu gewinnen gäbe, sagt sie. Auch, dass es vielleicht sogar einmal schulfrei gäbe.
Scheue Kinderblicke wandern von Fräulein Justin zu Fräulein Nägele. Zuerst will Kajetan in die Hände klatschen vor Glück, aber die anderen Kinder bleiben seltsam abwartend, und so lässt er die Hände wieder sinken.
»Wir haben sie Lolitschai genannt, die Rote«, sagt Rosa, als sie nach der großen Pause in den Speisesaal gehen. »Sie hat meine Eltern untersucht. Das war im ersten Jahr, als ich in die Schule gekommen bin. In Hechtingen war das. Dann ist die Polizei gekommen und hat alle mitgenommen. Onkel Landolo hat gesagt, dass sie an allem schuld ist. Auch, dass wir uns verstecken mussten.«
»Bei uns war sie auch. Ich weiß noch, dass mein Vater sehr böse auf sie war«, flüstert Alois, »sie spricht ja auch gar kein richtiges Romanes. Sie will uns untersuchen und dann schickt sie uns vielleicht in den Steinbruch.«
»Aber vielleicht bringt sie uns auch wieder zu unseren Eltern.«
»Glaub doch so was nicht. Sie hat einen bösen Blick. Rund und böse kommt der Blick aus ihrem Auge. Habt ihr nicht gesehn, wie sie lacht?«
»Ja, bitterbitterböse. Sie schaut durch einen durch. Durch und durch.«
»Sie spricht Romanes wie die Polizei. Da müssen wir aufpassen.« Buberli hält dagegen. »Ihr macht euch alle was in die Hose! Sie wird uns schon nichts tun. Sie sieht doch nicht aus wie eine Hexe. Wenn wir machen, was sie will, passiert uns gar nichts.«
Am Abend, während des Essens, kündigt Fräulein Nägele Spiele für den nächsten Tag an. »Für die Großen fällt der Unterricht morgen aus. Fräulein Justin möchte sehen, wie geschickt ihr seid. Macht also mit und tut, was sie sagt.«
Anton gehört zu den Kleinen, darf also nicht mitspielen und muss anderntags in die Schule. Später hört er, dass Fräulein Justin mit Angela und Rutla Mikado gespielt hat, auch Mühle, und dass sie alles aufgeschrieben hat, was die Mädchen gesagt und getan haben. Angela weiß nicht, was sie von der Roten halten soll. Sie hat dann noch eine Kette mit Glasperlen auffädeln müssen, wobei die Rote sogar die Reihenfolge der Farben notiert hat. »Vielleicht wollte sie sehen, ob du farbenblind bist«, mutmaßt Kajetan.
Eine ganze Woche spielt die Rote nur mit den Mädchen. Zweimal übernachtet sie sogar in deren Schlafsaal. Die ganze Nacht hätte sie etwas in ein Heft geschrieben, erzählen die Größeren.
Dann kommt ein Mann hinzu, der Fräulein Justin begleitet. Er baut im Hof eine Kamera auf und filmt ein paar Jungen beim Schuhe putzen. Die Jungen lachen, winken und schneiden Grimassen. Der Mann zwinkert mit den Augen und lacht. Bloß die Schwester Oberin funkt dazwischen. »Hört auf mit den Grimassen! Ihr benehmt euch ja wie Wilde! Und ausgerechnet vor Dr. Ritter!« Der Mann bleibt freundlich. Er hat nur wenig Haare. »Es sind doch Naturkinder, Schwester Oberin. Da darf man nicht so kleinlich sein.« Dr. Ritter ist genauso freundlich wie Fräulein Justin. Buberli versteht nicht, dass manche der Kinder Angst vor ihm haben. Er sieht zu, wie Dr. Ritter die Kamera mit dem Stativ auf die Schulter hievt und sie ein paar Meter weiter, vor einem Birnbaum aufstellt. »So jetzt alle mal ran! Rauf auf den Baum und runter mit den Birnen!«, ruft er und klatscht in die Hände. Buberli rennt los, ist als erster auf dem Baum, stopft sich zwei Birnen links und rechts in die Hosentaschen, die er Sekunden später dem erstaunten Dr. Ritter entgegenstreckt. »Donnerwetter!«, sagt der Doktor und drückt ihm zwei Bonbons in die Hand. Buberli ist glücklich. Bonbons hat er schon lange nicht mehr gesehen. Gerne würde er sie seiner Schwester bringen, aber er weiß nicht, wo sie ist.
Vor dem Mittagessen filmt Dr. Ritter die Mädchen beim Kartoffelschälen. Jedes muss laut die Sekunden zählen, die es zum Schälen braucht. Dori schiebt sich vor Hunger blitzschnell eine Handvoll Kartoffelschalen in den Mund. »Kriegst du nichts zu essen?«, fragt Dr. Ritter und schüttelt den Kopf. Dori lächelt verschämt in die Kamera. Rutla ärgert sich, sagt, dass sie nur dicke Kartoffeln bekommen hat und Angela kleine, aber Dr. Ritter beruhigt. »Das hat gar nichts zu sagen.« Dann notiert er Zahlen in der Spalte mit ihren Namen.
Am Nachmittag dürfen die Jungen bei Spielen mitmachen. Seit Dr. Ritter da ist, wird jeden Tag gespielt: Fußball, Völkerball, Ringkämpfe. Den Gewinnern winken Belohnungen. Zweimal schon hat Kajetan ein Tütchen mit Brausepulver gewonnen. Zweimal mit Waldmeistergeschmack. Anton wird auch belohnt, wenn auch nicht bei Wettkämpfen. Er hat beim Beerensammeln sein Körbchen bis zum Rand gefüllt, weshalb Dr. Ritter ein Kreuzchen neben seinem Namen gemacht hat. Für die Beeren bekommt er Brause mit Himbeergeschmack. Lustig ist es auch, wenn Dr. Ritter sie Karamellbonbons, an denen ein Haken hängt, mit einer Holzangel aus einer Dose herausfischen lässt. Die herausgefischten Bonbons können sie behalten, aber höchstens drei dürfen es sein.
Immer hat Fräulein Justin neue Ideen. Einmal sollen sie Igel aufstöbern. Darin ist Alois der beste. »Ich weiß, wo ich welche finden kann«, sagt er, »sie verstecken sich in Nestern am Waldrand oder im Gebüsch.« Zusammen mit Anton durchstreift er die Gegend. Ein paar Mal muss er ihm einen lehmigen Abhang hinaufhelfen, ihn einmal über einen Wasserlauf schleppen. Eine Weile hocken sie vor einem Ameisenhaufen, zwingen mit kleinen Hölzern einen Käfer ins Insektengewühl. Dann bricht Alois für sich und Anton einen Stecken. Damit durchstochern sie das dornige Dickicht, das ihnen Arme und Beine zerkratzt. Zuerst finden sie nichts. »Es ist eine schlechte Zeit«, weiß Alois, »die Igel bauen jetzt ihre Winternester und sind schon unter der Erde.« Trotzdem schleppen sie nach weniger als zwei Stunden zwei Igel an. Die Tiere liegen zusammengerollt in einem Korb und bewegen sich nicht. Wie stachelige Kugeln sehen sie aus. »Das hab ich früher mit meinem Onkel gemacht«, erinnert sich Alois und meint die Igeljagd, »jetzt wärs schön, wenn wir ein Feuer hätten und wir die Igel braten könnten.« Er bückt sich, schiebt eine Hand unter den Bauch des größeren Tieres, hebt die Stachelkugel aus dem Korb. Die Kinder stehen um ihn herum und staunen. »Mein Onkel schmiert sie dick mit Lehm ein. Dann brät er sie in einem Loch in der Erde, bis sie gar sind. Die Stacheln gehen mit dem Lehm einfach ab. So ein Igel schmeckt noch besser als Brause.« Die Rote notiert, was Alois sagt. Da tut es ihm leid, dass er verraten hat, wie sein Onkel die Igel brät.
Kajetan und Buberli finden gar keine Igel. Sie wollen lieber Kunststücke machen, klettern auf einen Baum, von dem die Rote sie wieder herunterholt. Karli hört, wie sie zu Fräulein Nägele etwas von Schwäche und Flatterhaftigkeit sagt. Alles, aber auch alles, schreibt sie auf.
Beim Kartoffelernten setzt Fräulein Justin acht Geldpreise für die schnellsten Gruppen aus. Alle dürfen mitmachen. Außer Zweigerli. Er war beim Igelsuchen zu langsam und ist zum Äpfelpflücken abgeholt worden. Buberli weigert sich mitzumachen. Alois glaubt, dass es wegen Zweigerli ist, aber genau weiß er es nicht. Buberli sitzt auf seinem Eimer, verschränkt die Arme vor der Brust und zieht ein Gesicht. Fräulein Justin trägt alles ins Heft ein und schickt ihn zum Helfen in die Küche.
Dudela schafft 21 Eimer in einer Stunde und erntet drei Kreuzchen hinter ihrem Namen, was ihr später zwei Groschen einbringt. Loli hat schon ein paar Eimer gefüllt, da mag sie nicht mehr. Dudela, die neben Loli durch die Furchen geht, schubst sie in die Seite. »Mach weiter! Mach schon! Wenn du gut bist, kriegst du ein Kreuzchen und dann Geld. Und dann schicken sie dich nicht ins Lager.« Alois, der in der Reihe neben ihnen Kartoffeln aufhebt, hört, was Dudela sagt und argwöhnt mit gepresster Stimme: »Es ist genau andersrum. Die Fleißigen stecken sie ins Lager! Meine Eltern haben alles gemacht, haben gearbeitet und geschuftet. Nur deshalb sind sie in den Steinbruch gekommen.«
Fräulein Nägele mag Fräulein Justin nicht. Da ist sich Kajetan sicher. Er hat gesehen, wie Fräulein Nägele den Kopf über die Spiele der Roten geschüttelt hat und gehört, wie sie gesagt hat, dass vom Brausepulver die Zähne schwarz werden. Kajetan meint, dass sich Fräulein Nägele nur ärgert, weil sie glaubt, dass alle die Spiele besser finden als den Unterricht.
Nach Ende der dritten Woche will die Rothaarige alle untersuchen. Fräulein Nägele ruft die Namen nach dem Alphabet auf. Anton ist als dritter dran. Er hat Angst, als er in den Klassenraum geschubst wird.
Die Rothaarige trägt eine weiße Schürze und eine Haube, wie eine Krankenschwester. Sie sieht streng aus, aber als sie »Latscho diwes« sagt, verschwimmt das Strenge in ihrem Gesicht. Die Sprache seines Vaters kommt ihm an diesem Ort unwirklich vor, so weit weg, dass er zunächst nicht reagiert. Sie wiederholt den Gruß, nennt ihn ihren Phrála2, fragt nach seinem Namen und er nimmt seinen Mut zusammen und antwortet: »Me bushwar Anton3.«
Sie spricht die Sprache seines Vaters, ein bisschen anders und mit einem merkwürdigen Akzent, aber er kann sie verstehen. Unsicher macht ihn das. Der Vater hat ihm eingeschärft, draußen kein Wort Romanes zu sprechen. Nicht auf der Straße, nicht in der Schule. »Warum nicht, Vater?« Da hatte der Vater ihn nur streng angesehen.
Unbeholfen steht Anton vor Fräulein Justin. »Setz dich.« Er rückt in die Bank. Sie sitzt ihm gegenüber, hält einen Stift in der Hand. Die Hand ist voller Sommersprossen. Vor ihr steht eine Schale aus Blech mit kleinen Sachen: kurze, dünne Gummischläuche, eine Spritze, Tupfer aus Mull, ein paar Röhrchen. »Dann wollen wir mal sehn. Zieh mal das Hemd aus.« Sie lächelt ihn an, legt den Stift ab, zieht die Schale näher heran. Er zieht das Hemd über den Kopf, legt es neben sich auf die Bank, sitzt mit nacktem Oberkörper und hält die Hände zwischen die Knie geklemmt. »Leg den rechten Arm aufs Pult.« Er zögert und legt den linken Arm ab. Sie sieht ihn scharf an und spricht wieder Deutsch: »Weißt du nicht wo rechts ist?« Sie greift nach seinem rechten Arm, zieht ihn zu sich heran, inspiziert die Haut, klopft mit flach ausgestreckten Fingern auf der Armbeuge herum. »Mach mal ne Faust!« Sein Atem geht schnell, als sie nach der Spritze greift, auf die sie eines der Röhrchen steckt. Unwillkürlich dreht er sich weg und hält die Luft an. Die Rote setzt die Spritze an, trifft aber die Vene nicht, sticht mehrmals zu. Er zuckt. »Halt still!« sagt sie, »ein Junge wie du spürt das doch gar nicht.« Als er sich wieder umdreht, sieht er, wie dunkles, dickes Blut ins Röhrchen läuft. Sie wartet, bis das Röhrchen vollgelaufen ist, dann legt sie einen Streifen Verbandsmull auf die Einstichstelle und zieht die Nadel heraus. Kurz streicht sie ihm über den Kopf. Dann sieht sie ihm in den Hals, in die Nase, in die Ohren. »So, das wars schon. War doch gar nicht schlimm, oder?« Sie greift noch mal nach seinem Arm und presst die verletzte Stelle mit dem Daumen.
»Au.«
»Ach was, au.« Er beißt die Zähne zusammen, beobachtet, wie sie das Röhrchen verschließt, eine Flüssigkeit hinzufügt und es zurück auf die Schale legt. Dann zieht sie ein gelbes Band aus der Tasche. »So, jetzt der Kopf. Setz dich gerade hin und sieh geradeaus.« Sie steht auf, rückt seinen Kopf zurecht. Unter ihren Armen riecht das Kleid muffig, ein wenig nach Schweiß. »Zuerst der Kopfumfang, die Augenbrauen.« Er schließt die Augen, zu nah sind ihre Hände. Sie führt das Band um seinen Kopf. Das Band riecht nach Medizin und fühlt sich kühl an. »42 Zentimeter«, sagt sie. Ihre Finger kitzeln auf seinem Gesicht. »3,5 Zentimeter«, sagt sie und meint die Augenbrauen, legt das Band ab und schreibt alles in ihr Heft. »Jetzt der Abstand.« Wieder spürt er das Band, wieder tasten ihre Hände über sein Gesicht. Sie misst die Augenbreite, die Breite zwischen den inneren Augenwinkeln, notiert mit krakeliger Handschrift Zeichen auf der Karte. Dann sieht sie ihn an und vermerkt, was sie laut sagt: »Augenbrauen mittelbreit, leicht gebogen, aber nicht winklig und auch nicht über der Nase verwachsen. Die Lippen dünn, nicht wulstig.« Auch die Lippen misst sie. Das Band verrät den Umfang des Halses, den Abstand der Ohren, die Länge der Nase, die Höhe des Gesichtes, auch die Arm- und Beinlänge, den Schädelumfang, den Hüftumfang. Zuletzt greift sie ihm ins Haar. »Haarfarbe dunkelbraun, Haare lockig, nein, eher wellig. Eine richtige Wolle ist das. Sie müssen dringend geschnitten werden. Nachher meldest du dich bei der Schwester.« Zuletzt hält sie eine Tafel neben seinen Kopf. Verschiedene Augenfarben sind darauf abgebildet. Schnell hat sie seine Farbe gefunden. »Graubraun«, vermerkt sie. Dann fragt sie ihn nach seinem Vater, seiner Mutter, den Geschwistern und Großeltern, ob sie zigeunerisch gelebt hätten und will wissen, ob alle zu Hause Romanes sprechen. Auch seine Antworten trägt sie ins Heft ein.
Kajetan ist längst daran gewöhnt, untersucht zu werden. Er steht mit entblößtem Oberkörper vor einem der Waschbecken im Waschsaal. Mit der hohlen Hand trinkt er aus dem Wasserhahn und reibt sich mit dem Handrücken den Mund ab. Anton erzählt von der Spritze, vom Einstich, vom Blut. »Die Rote will nur wissen, ob du gesund bist. Sie ist ein Doktor. Warst du denn noch nie bei einem Doktor?« Anton schüttelt den Kopf. »Also, ich hab das schon tausendmal hinter mir.« Kajetan wirkt überlegen mit seiner speckigen Kappe, dem eckigen Gesicht, dem Pullover mit dem Rollkragen. »Tausendmal. Es macht mir nichts. Von mir aus kann sie das jeden Tag machen.« Er krempelt seinen Ärmel auf und hält Anton die Einstichstelle vor die Nase. »Tausendmal schon hat sie das bei mir gemacht.« Anton betrachtet Kajetans Armbeuge. Eine Einstichstelle ist nicht zu erkennen, nur eine Ader schimmert bläulich. »Und warum macht sie das mit dem Band?« Kajetan fasst sich mit der Hand an den Kopf und lacht. »Mensch, bist du dumm! Das war doch ein Maßband. Mit kleinen Strichen drauf. Jeder Strich ist ein Millimeter. Zehn davon sind ein Zentimeter. Hat denn dein Vater nie gemessen, ob du gewachsen bist?« Anton weiß nicht, was er sagen soll. Kajetan sieht ihn mitleidig an. »Du weißt aber auch gar nichts. Du musst doch wissen, ob du wächst und das kann man nur mit einem Maßband feststellen.« Sein Blick ist abschätzig. Er setzt sich auf Antons Bett und schlägt die Beine übereinander. Fast sieht er aus wie ein junger Mann. »Unser Doktor hatte auch so ein Band. Er kam in unseren Wagen und hat jedes Mal richtig gestaunt. Unser Wagen war eine Pracht. Mit Schränken vom Boden bis zur Decke. Alles aus Wurzelholz. Und die Spiegel, Betten und Schränke waren mit Schnitzereien verziert. Im Wohnzimmer gab es ein rotes Plüschsofa und Kissen mit Fransen dran. Hinter der Schiebetür war die Küche mit dem Herd und Töpfen aus Kupfer. So einen Wagen kannst du dir gar nicht vorstellen. Acht Meter lang und zwei Meter breit.« Anton hat so einen Planwagen nie von innen gesehen und stellt sich alles in Gold vor. Früher hatte der Vater auch einen Planwagen gehabt, aber nur einen kleinen. In Pfullendorf hatten sie in einem Haus mit fünf Zimmern gewohnt, gleich neben der Kirche. Sie waren nur selten gereist, höchstens im Sommer. In ihrem Haus gab es sogar mehrere geschnitzte Schränke, aber davon sagt Anton nichts.
Kajetan kommt wieder auf die Rote zurück. »Du bist klein. Wahrscheinlich wächst du langsam oder gar nicht. Weißt du was? Der Mann von der Roten fährt einen Mercedes Benz und übernachtet im Gasthaus Krone. Aber jetzt ist er wieder weg.«
»Woher weißt du das?«
»Ich weiß alles.«
»Bin ich gewachsen?«, fragt Anton, als Fräulein Justin beim nächsten Mal wieder das Maßband anlegt. Sie überprüft die Zahl, die das Maßband verrät, mit der Zahl, die sie beim letzten Mal notiert hat und sagt das Gleiche wie Kajetan. »Bei dir geht es langsam. Wenn man dich mit den anderen vergleicht, na ja, was soll ich sagen? Buberli ist genau so alt und ein gutes Stück größer.« Wieder misst sie seine Beine, seine Arme, einfach alles, notiert die Werte in einem schwarzen Heft und schenkt ihm zum Abschied ein Stückchen Würfelzucker, auf das sie drei Tropfen einer gelblichen Flüssigkeit träufelt. »Da nimm! Eine Belohnung, weil du so tapfer warst. Langsam lutschen«, rät sie und sieht ihn streng an. Gerne hätte er das Stück eingesteckt und verwahrt, aber sie bleibt stehen und wartet, bis er den Zucker in den Mund steckt. Rau und süß ist das Stück, kratzt an seinem Gaumen. Ganz langsam wird es weniger und immer flacher, bis es sich schließlich auflöst.
Dann soll er Murmeln nach Farben in Kästchen sortieren. »So schnell du kannst«, feuert sie ihn an, aber er muss erstmal die Murmeln in die Hand nehmen, betrachten und staunen. So große Murmeln hat er nie gesehen. »Wenn ihr bloß nicht so schwer von Begriff wärt«, sagt Fräulein Justin und er sieht ihr an, dass sie sich ärgert. »Die Lehrerin hat mir gesagt, dass du nur sehr schlecht lesen kannst. Stimmt das?« Anton senkt den Kopf. »Warum liest du so schlecht?«, fragt sie erneut und zieht ihn am Ohr. »Mein Vater sagt, es ist wichtiger, mit dem Landjäger4 fertig zu werden. Wenn man nicht lesen kann, kann man auch die Bestimmungen nicht wissen, sagt der Vater.«
»Soso, der Vater. So klug ist er also, dein Vater. Und was würdest du tun, wenn ich dir 50 Mark schenken würde?«
»Ich würde sie dem Vater bringen. Der braucht immer Reisegeld, wenn der Landjäger kommt.«
»Hast du Angst vor dem Landjäger?«
»Manchmal schon. Sogar unser Hund versteckt sich, wenn er kommt.«
»Zahlt dein Vater denn keine Hundesteuer?«
»Das weiß ich nicht.«
»Na sicher zahlt er nicht!«, schreit die Rote, »sonst würde er wohl kaum den Hund darauf abgerichtet haben, sich zu verstecken, wenn der Landjäger kommt.« Sie greift nach ihrem Heft und schreibt etwas auf. Dann hebt sie den Kopf und zeigt mit dem Finger auf die Tür. »Raus jetzt! Geh!«
Kajetan hat Brötchen versteckt. Manchmal hört Anton ihn in der Nacht kauen. Kajetan hat ständig Hunger. Auch Anton hat Hunger. Der Hunger ist schlimmer als alles andere. Die Suppen der Schwestern werden immer dünner, genau wie die Brotscheiben. Oft hört er seinen Magen knurren, aber dann ist es noch weit bis zum Morgen oder zu den Mahlzeiten. Die Schwestern sagen, dass es gesund ist, wenn man sich nicht satt isst. Anton träumt von seiner Mutter. Wie er, schwer vom Schlaf, seinen Kopf auf ihre Schulter legt, wie sie ihn aufhebt, ihn auf die Wangen küsst, mit dem Daumen ein Kreuzzeichen auf seine Stirn zeichnet und ihn ins Bett bringt.
»Sieh mal die Perlen«, sagt Fräulein Justin, als Anton zur Tür hereinkommt und vor Verlegenheit nicht weiß, wie er die Hände halten soll. Auf dem Tisch liegen ein Stück Faden, eine Nadel und eine Handvoll gelber Perlen. »Setz dich und mach mal ne Kette draus.« Anton setzt sich, nimmt den Faden, fädelt die Nadel ein und nimmt zwei Perlen auf. »Zeig mal! Das wird schön! Wunderschön!« Sie sieht auf die Uhr, notiert die Zeit und schreibt ein paar Sätze in ihr Heft, während er die restlichen Perlen aneinanderreiht.
Dann zieht sie einen Holzkasten mit einem gelöcherten, beweglichen Brett in der Mitte aus der Tasche und gibt ihm eine Murmel. »Leg die Murmel ganz unten in die Ecke. Und dann versuchst du sie über das Brett zu balancieren ohne dass sie in eines der Löcher fällt. Du darfst auf keinen Fall das Spielbrett mit den Händen berühren.« Das Brett wackelt in seinen Händen. Auf der Unterseite befindet sich eine Wippe, sodass es bei der kleinsten Berührung hin und her schwingt. Die Kugel befindet sich kaum auf dem Brett, da verschwindet sie schon in einem der Löcher. Er versucht es wieder und wieder und wieder. Einmal schafft er es fast bis zur Mitte, da nimmt sie ihm das Brett wieder weg. »Das reicht.« Diesmal notiert sie die Zeit, die er gebraucht hat.
Als nächstes wickelt sie ein Stück Kordel von einer Spule, schneidet die Kordel ab, fasst sie zu einem Ring und knotet sie an den Enden zusammen. Dann streckt sie die Hände aus, legt sich den Faden über beide Handrücken, schlüpft mit der rechten Hand unter die Kordel der linken Hand und zieht sie herüber. Das Gleiche macht sie mit der anderen Hand, führt dann den rechten Mittelfinger unter den Faden, der über der linken Handfläche verläuft und zieht die Hände wieder auseinander. So schnell kann Anton gar nicht schauen. Eine Kreuzfigur entsteht zwischen ihren Händen. »Jetzt bist du dran. Du musst ins Fadenkreuz fassen, von oben, in die Mitte … Ja genau so, und jetzt ziehst du alles über die Außenfäden, nimmst die Kordel von meiner Hand und … Hast du sie?« Die Kordel rutscht ab, er hat Angst, dass sie schimpft. »Du hast es nicht verstanden, oder?« Er schüttelt den Kopf. Sie will noch ein Spiel mit ihm spielen, aber er will nicht mehr, hat Angst, alles falsch zu machen, weiß nicht, was sie aufschreibt, weiß nur, dass es etwas mit ihm zu tun hat und spürt eine gereizte Stimmung zwischen ihnen. »Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Pass auf: Ein Mann muss einen Wolf, eine Ziege und einen Kohlkopf in einem winzig kleinen Boot zum anderen Ufer transportieren. Das Boot ist so klein, dass außer ihm nur ein Tier oder der Kohlkopf mit hineinpassen. Allerdings muss er auch auf die Tiere und den Kohlkopf aufpassen, denn ist der Wolf mit der Ziege allein, so frisst der Wolf die Ziege, ebenso frisst die Ziege den Kohlkopf, wenn sie mit ihm allein ist. Wie schafft er es, alles gut auf die andere Seite zu bringen?« Anton will nicht mehr spielen. Das Spiel gefällt ihm nicht. Ohne zu überlegen sagt er: »Er soll den Wolf zuerst mitnehmen.«
»Aber dann ist die Ziege mit dem Kohlkopf allein und frisst ihn.«
»Dann soll er die Ziege zuerst mitnehmen.«
»Gut geraten. Und dann?« Er antwortet nicht. Sieht auf ihre Hände, auf ihre helle Haut mit den Sommersprossen. »Was ist? Willst du nicht mehr?« Er senkt den Kopf. »Weißt du es nicht?« Wieder schüttelt er den Kopf. »Buberli hats gewusst.« Sie macht einen roten Strich in ihr Notizheft. Der Strich sieht aus wie eine Wunde. Er denkt an seinen Onkel Landolo und an die Streichholztricks, die er ihm beigebracht hat. Gerne hätte er Fräulein Justin gezeigt, wie man Streichhölzer verschwinden lässt, aber als er davon anfängt, sagt sie nur. »Ja, mit Tricks seid ihr gut. Aber sonst?«
»Das ist doch ganz einfach!« Kajetan plustert sich auf und fährt sich mit der Hand über den geschorenen Kopf. »Der Mann muss zuerst mit der Ziege über den Fluss, lässt sie dann am anderen Ufer und kommt allein zurück. Dann bringt er den Wolf zur anderen Seite, lässt ihn da und nimmt die Ziege wieder mit zurück. Er lässt sie am Ufer, fährt mit dem Kohlkopf rüber, fährt wieder zurück und holt dann die Ziege.«
Kajetan steht da als ob er eine Medaille gewonnen hätte. Anton kann nur staunen. »Wie lange hast du gebraucht, es herauszufinden?«
»Keine zwei Minuten!« Kajetan ist klug, klüger als alle. »Sie hat meine Antwort aufgeschrieben und mir eine Brause geschenkt. Als Belohnung. Man muss eben nur wissen, wie es geht.«
»Es ist ein Trick, oder?«
»Das ist doch kein Trick, das hat man hier oben«, kreischt Kajetan und tippt sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. »Das hat man oder man hat es nicht.« Er zieht einen Beutel unterm Bett hervor und entnimmt ihm eine Dose Fisch. »Wo hast du die her?« Kajetan lächelt wissend, antwortet aber nicht. Auch ein Stück Brot findet sich in seinem Beutel. Er nimmt seinen Löffel, bearbeitet mit der Spitze des Löffels den inneren Rand der Dose, bewegt die Löffelspitze eine Weile vor und zurück, bis der Deckel durchgescheuert ist. Karli, Alois und Buberli kommen näher, dann Wilhelm und Jani. Im Halbkreis stehen sie um Kajetan herum, warten, bis der auf diese Weise auch andere Stellen durchgescheuert hat und sich der Deckel öffnen lässt. Kajetan reißt das Brot auseinander, kippt den fischigen Inhalt der Dose darüber, klappt es zusammen, beißt kräftig ab. Öl rinnt ihm über die Hand. Von unten nach oben leckt er es ab. Dann reicht er das Brot weiter. Alle staunen und schmatzen. Der Fisch riecht salzig und fettig. So etwas Feines gab es lange nicht mehr.
Am Abend, im Schlafsaal, kommt keine Ruhe auf. Immerzu flüstert jemand. Zweimal schon hat die Schwester an die Tür geklopft. Die großen Jungen scharen sich um Jani. Er ist am längsten im Heim und alle wollen hören, was er flüstert. Auch Anton reckt den Kopf. »Die Rote ist hinterlistig und böse. Sie tut ganz unschuldig, aber das ist sie nicht. Ihre Augen sind messerscharf. Denen entgeht gar nichts. Ich hasse es, wenn sie mich ansieht, mich beobachtet, als ob ich in der Schule eine Prüfung machen muss.« Buberli stimmt ihm zu. »Wenn mich jemand so ansieht wie sie, dann werde ich böse, da kann ich gar nicht anders. Ja, richtig böse werde ich, weil sie sich so wichtig macht und sich als was Besseres fühlt als die Nägele. Und weil sie uns für Dummköpfe hält. Ich habs gehört, als sie es der Schwester Oberin gesagt hat. Vernagelte Dummköpfe hat sie gesagt. Und dass wir nichts begreifen, gar nichts, wir sind ja so dumm, dass wir nicht mal richtiges Deutsch sprechen. Das hat sie gesagt. Ich hab es gehört und deshalb glaube ich ihr nicht mehr. Sie behandelt uns wie Affen im Urwald. Sie will was von uns, deshalb kriegen wir die Bonbons.« Kajetan und Alois mustern ihn mit zweifelndem Blick, die anderen sind unentschlossen. »Und was sollen wir machen? Wenn mein Vater hier wäre, der würde ihr ganz schön zusetzen.« Alois verzieht das Gesicht. »Dein Vater nützt uns jetzt auch nichts. Am besten, wir machen gar nichts. Sie bleibt bestimmt nicht mehr lange hier.«
»Und wenn sie weg ist? Was macht sie dann mit den Sachen, die sie über uns aufgeschrieben hat? Habt ihr den Baukasten im Speisesaal gesehen? Sie hat genau aufgeschrieben, wer damit gespielt hat, dabei auf die Uhr gesehen und dann wieder was aufgeschrieben. Sie hat auch aufgeschrieben, wer am Kasten vorbeigegangen ist. Sie sieht alles. Sie sieht genau, wer sich anstrengt und wer nicht. Sie schreibt sogar auf, wie wir gehen, wer von uns barfuß ist und ob wir die Sonntagskleider richtig angezogen haben.« Jemand nähert sich der Tür. Blitzschnell rennen alle auseinander und verkriechen sich in ihren Betten. Eine der Schwestern klopft mit einem Stock an die Tür. »Ruhe da drinnen! Dass ihr jetzt Ruhe gebt!«
Später, Anton schläft noch nicht richtig, wird mitten in der Nacht das Licht angeknipst. Schwester Ricarda kommt herein, tritt vor Wilhelms Bett. »Aufstehen! Na wird’s bald?« Wilhelm hat sich kaum erhoben, da trifft ihn schon ein Schlag ins Gesicht. »Geht das nicht schneller? Mach voran, bevor du wieder ins Bett pinkelst! Na los, los!« Wilhelm hält beide Hände über den Kopf und beeilt sich, aus dem Bett zu kommen. Im Hinausgehen droht die Schwester den anderen: »Weiterschlafen! Oder hat sonst noch jemand solche Schweinereien vor?« Alle können hören, wie die Schwester Wilhelm nach nebenan in die Waschräume zerrt, wie sie ihn beschimpft, wie sie den Wasserhahn aufdreht, wie sie sein durchdringendes Schreien immer wütender macht, wie dumpfe Schläge niederprasseln, regelmäßig und hart, wie die Schwester stöhnt und keucht und schreit und stöhnt und schreit. Den Wilhelm hören sie nicht mehr.
Irgendwann kommt er zurück. Er tappt zu seinem Bett und verkriecht sich unter der Decke. Die Decke zuckt und Anton hört, wie Wilhelm weint.
Grün und blau ist er am Morgen, die Augenbraue aufgeplatzt, ein Auge blutunterlaufen.