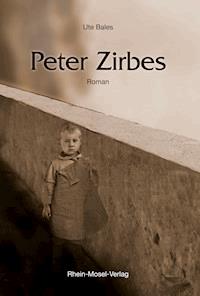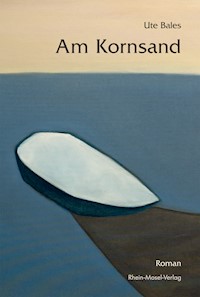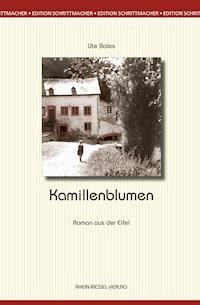Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die hier versammelten Geschichten wagen sich tief ins Universum des Menschlichen. Sie erzählen von Aufbrüchen und Fluchten, von Anmaßungen und Drahtseilakten, von letzten und vorletzten Dingen. Sie zeigen Menschen an Wendepunkten ihres Lebens, mit Ängsten und Hoffnungen, einsam und unverstanden, auf diffusen Wegen, oft zustrebend auf einen Punkt der Katastrophe. Es sind Geschichten über die, die nicht dort sind, wo sie hinwollen. Über die, die es nicht aushalten, dort, wo sie sind. Geschichten über die, die Umwege machen, die etwas ändern wollen, die von etwas träumen, auf etwas warten und etwas suchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2024 – e-book-AusgabeRhein-Mosel-VerlagBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel. 06542/5151 www.rhein-mosel-verlag.deAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-950-7Ausstattung: Stefanie ThurTitelbild: bit.it / photocase.deLektorat: Michael DillingerKorrektorat: Melanie Oster-DaumAutorenfoto: Michael Spiegelhalter
Ute Bales
Keiner mehr da
und andere Erzählungen
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Die hier versammelten Geschichten wagen sich tief ins Universum des Menschlichen. Sie erzählen von Aufbrüchen und Fluchten, von Anmaßungen und Drahtseilakten, von letzten und vorletzten Dingen. Sie zeigen Menschen an Wendepunkten ihres Lebens, mit Ängsten und Hoffnungen, einsam und unverstanden, auf diffusen Wegen, oft zustrebend auf einen Punkt der Katastrophe. Es sind Geschichten über die, die nicht dort sind, wo sie hinwollen. Über die, die es nicht aushalten, dort, wo sie sind. Geschichten über die, die Umwege machen, die etwas ändern wollen, die von etwas träumen, auf etwas warten und etwas suchen.
Stress
Viertel vor sieben. Jetzt aber zack, zack! Wo ist das graue Hemd? Ob er das Kind mitnehmen könne zur Krippe, ausnahmsweise, ruft Lilly vom Flur aus, sie müsse nämlich um halb neun schon im Geschäft sein. »Klar, mach ich!«, ruft Paul aus dem Bad, während er sich die Zähne putzt und gleichzeitig nach dem Hemd angelt. Dann hält er die Zahnbürste unter das fließende Wasser, steckt sie zurück in den Becher, wischt den Mund ab, knöpft das Hemd zu, greift nach der Krawatte. Schnell noch frühstücken, einen Kaffee im Stehen, währenddessen Unterlagen zusammensuchen, nachsehen, ob er alles dabei hat: die Mappe mit den Bauplänen, seine Notizen für die Sitzung, Brille, Handy, Geld. Die Kleine schläft noch halb, als Lilly sie für die Kinderkrippe anzieht und die Dose richtet mit den gestifteten Möhren und den Apfelstücken. »Ich komm mit runter«, sagt sie, verstaut noch zwei Windeln und das Fläschchen in der Tasche mit dem Einhorn. Die Kleine sträubt sich, als Lilly sie hochhebt und verzieht das Gesicht, als ob sie anfangen wolle zu heulen. Aber Lilly setzt sich das Kind auf die Hüfte, folgt Paul die Treppe hinunter zum Auto und küsst ihn. »Denk dran«, sagt sie, »heute Abend sind wir zu Ferchs eingeladen. Wir sollen was mitbringen. Einen Salat oder so was.«
»Sorry, bei mir wird’s spät heute. Entscheide du. Hab jetzt keine Zeit mehr. Drück mir die Daumen für die Sitzung.« Lilly packt die Kleine in den Kindersitz auf der Rückbank und gibt ihr einen Kuss. »Tschüss, meine Süße, bis später. Mama hat dich sooo doll lieb.« Dabei reißt sie die Arme nach oben und malt einen riesigen Ballon in die Luft. Die Kleine streckt die dicken Ärmchen. Paul ist kaum vom Hof gefahren, da schläft sie ein.
Zur Firma ist es Gott sei Dank nicht weit, 30 Minuten, wenn es gut läuft, allerdings ein paar Kreisverkehre und Ampelschaltungen, die Zeit brauchen. Das Radio ist leise gestellt, aber so, dass er alles hören kann. Er trommelt mit den Fingern auf das Lenkrad. »Billie Jean is not my lover, she’s just a girl who claims that I am the one, but the kid is not my son, she says I am the one, but the kid is not my son …« Er mag Michael Jackson und überlegt, welches Album das war. Dann Nachrichten zur halben Stunde. Belgien will der Ukraine 30 F-16 Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen. Macron ist auf Staatsbesuch in Deutschland. Es folgen Prognosen zur Europa-Wahl. Zum Schluss das Wetter. Sonnig soll es bleiben, wolkenlos, bei 20 Grad. Er hört nur mit halbem Ohr zu. Die Mutter liegt in der Klinik mit Oberschenkelhalsbruch. Er überlegt, wann er hinfahren könnte. Vielleicht morgen.
Vor ihm trödelt ein E-Golf. Der Fahrer fährt 40, obwohl 60 erlaubt sind. Das Handy klingelt. Er kann nicht abheben. Das Klingeln hält an und macht ihn nervös. Er dreht das Radio lauter. »Israelische Streitkräfte haben erneut Angriffe im südlichen Gazastreifen in Rafah durchgeführt. Mehrere Dutzend Menschen sind dabei getötet worden. Medienberichten zufolge sind Panzer ins Zentrum der Stadt vorgedrungen.« Er dreht leiser. Die Nachrichten sind kaum auszuhalten. Das Handy beruhigt sich, aber keine zwei Minuten später vibriert es wieder. Nein, er kann jetzt nicht. Aus dem Augenwinkel sieht er, dass es Alain ist. Was kann er wollen? So früh? Eine Viertelstunde wird er sich noch gedulden müssen. Paul fällt ein, dass er vergessen hat, die Computerbrille mitzunehmen. Mit der sieht er besser als mit der Lesebrille. Er zweifelt, ob er die Lesebrille auch wirklich eingepackt hat, tastet in seiner Tasche herum. Die Brille ist da. Gott sei Dank. Was Alain wohl gewollt hat? Alain ist sein Vorgesetzter. Sie sind per Du, dennoch lässt Alain den Chef oftmals ganz schön raushängen. Paul geht die Tagesplanung nochmal durch. Die Sitzung wird sich ziehen. Sicher fällt die Mittagspause aus. Um neun kommen Rix, der Architekt, und Marcel Durant vom Vorstand, und dann noch einer von einer Agentur, ein junger Schnösel, jedenfalls nach Meinung der Sekretärinnen. Frühestens um Viertel nach neun wird es losgehen, mit der üblichen Begrüßung durch Alain. Dann wäre er dran. Ein paar einleitende Worte, dann würde er seinen gläsernen Pavillon präsentieren. Ganz in die Landschaft hat er den Bau integriert, flankiert von Birken und Kiefern, als Übergang zu einem Park, dabei ausschließlich umwelt- und klimaschonende Aspekte bei der Konstruktion bedacht. Nur lokale Materialien sollen verbaut werden. Die großzügige Glaswand, die sich in eine breite Türöffnung verwandeln kann, gefällt ihm besonders. Gäste gleiten sozusagen durch den Pavillon hindurch, denn die gläserne Wand lässt sich komplett zur Seite falten und verbindet den Bau unmittelbar und schwellenlos mit den Plätzen und Wegen des Parks.
Paul hat alles bedacht, alles berechnet. Der Entwurf ist gut geworden. Sehr gut sogar. Er lehnt sich zurück, während er den Drücker bedient, mit dem er das Fenster der Fahrertür einen Spalt breit öffnet. Wenn er bloß etwas mehr Ruhe hätte. Auch im Büro. Aber da ist ständig jemand mit einer Frage, einer Bitte, einem Kommentar. Ein Großraumbüro mit sechs Arbeitsplätzen. Eines der Telefone klingelt immer.
Auch zuhause hat er keine Ruhe. Gestern hatte Lilly ihn, noch bevor er am Abend seine Jacke an die Garderobe hängen konnte, aufgefordert, die Spülmaschine auszuräumen. Oft ist sie so genervt, sieht nicht, dass er hungrig und müde ist. »Du hast’s gut, hast mit alldem nichts zu tun«, hatte sie gesagt und auf das Spielzeug gewiesen, das im Wohnzimmer verbreitet herumlag, auf die halb ausgeräumte Einkaufstasche, auf die ungeöffneten Briefe, auf den Korb mit Wäsche, auf die Kleine, die in ihrem Babystuhl vor einem halb leer gegessenen Teller mit Brei saß, von dem ein Teil in ihren Haaren, auf dem Lätzchen und auf dem Boden gelandet war. Lillys Stimme war gereizt. »Du kannst gleich mal loslegen«, hatte sie ihn angefahren und geklagt, dass sie erst am Morgen geputzt hätte, und jetzt, hach, sieh dir das mal an, wie es wieder aussieht. Er wollte sich über den Kühlschrank hermachen, fand aber nichts außer einem Becher Joghurt, den er, gelehnt an die Küchentür, mit einem benutzten Löffel auskratzte. Später dann Lillys Gemurre, weil er das Zeug auf dem Wohnzimmertisch zusammengeschoben hatte und seine Akten ausbreiten wollte. »Kannst du nicht warten, bis die Kleine schläft?« Also gut, Spülmaschine ausräumen, Boden säubern und Müll runterbringen. Gegen neun, als Lilly und die Kleine schliefen, konnte er damit anfangen, seine Planung nochmal durchzurechnen, Ungenauigkeiten zu bereinigen.
Paul ist gut in dem, was er macht. Sehr präzise. Das sagt jeder. Er will auch gut sein und aufsteigen. Das Haus muss bezahlt werden, ein Urlaub sollte auch drin sein. Er will seiner Familie etwas bieten. Aber er ist auch oft erschöpft, das weiß er selbst, denkt aber, dass die Erschöpfung zum Erfolg gehört wie der Strand zum Meer. Lilly sagt ihm oft, dass er zu viel arbeitet. Manchmal macht ihn das wütend. Natürlich hat sie recht. Sein Leben platzt aus allen Nähten, er schläft zu wenig, er unternimmt zu wenig mit seiner Familie, hetzt von der Arbeit nach Hause, gelegentlich noch zum Sport. Abends ist er platt. Auf dem Kühlschrank haften kleine Zettel: Alex zurückrufen. Zahnarzttermin verschieben. Geburtstag Claire. Konzert bei Christine. Steuerunterlagen abgeben. Er hetzt sich ab, weiß nicht, wie andere das schaffen, mit ihren ausgeglichenen Partnern, den perfekten Wohnungen, den perfekten Kindern. Sein Leben ist eine Aufeinanderfolge von Aufgaben und Verpflichtungen. Die Kollegen fragen schon gar nicht mehr, ob er nach der Arbeit mit ihnen etwas trinken gehen möchte.
Im Radio spielen sie ein Stück von Queen. Wie für ihn bestellt, denkt er, als er die ersten Takte hört. Ja, Freddie, der hat es vielleicht anders gemacht als er. Aber Freddie ist tot, hat für seinen Lebenswandel bezahlt. »I want to break free, I want to break free, I want to break free from your lies, you‘re so self satisfied, I don‘t need you, I‘ve got to break free, God knows, God knows I want to break free …«
Nein, seine Freiheit wird anders aussehen. Er sieht auf die Uhr. Nicht mehr weit bis zur Firma. Die Sitzung fängt um neun an. Bis dahin kann er sich alles nochmal ansehen. Noch ein Stück Landstraße, eine eintönige Strecke, die er täglich fährt. Manchmal weiß er nicht mehr, ob er schon an diesem oder jenem Dorf vorbei ist und an diesem oder jenem Kreisverkehr. Er blinkt, biegt ab. Keine hundert Meter entfernt hat sich ein Stau gebildet. Polizisten versuchen den Verkehr zu regeln. Wenn nur nicht diese ständigen Verzögerungen wären. Er überlegt, das Gebiet zu umfahren. Er kennt sich aus. Aber dann wartet er doch. Morgens ist jede Minute kostbar. Fünf davon hat er schon verloren. Es dauert weitere fünf Minuten, der Verkehr rollt langsam wieder an. Das Industriegebiet kommt in Sicht mit den Bürotürmen. Wieder vibriert das Handy. Ein Kreisverkehr nähert sich, er fährt 20, nimmt das Handy kurz hoch, überlegt abzunehmen, lässt es dann aber wegen der Polizisten und schaltet es auf lautlos. Dass Alain immer so eine Angst hat, wenn Präsentationen anstehen. Hinter dem Kreisverkehr liegt das Firmengelände. Der Parkplatz ist voller als sonst. Er parkt weiter hinten, neben Alains weißem BMW.
Obwohl es hell ist, knipst er im Büro die Lampe über seinem Schreibtisch an. Dann fährt er den Computer hoch. Zwanzig nach acht. Zwei Kollegen sind schon da, nicken herüber, wieder vibriert das Handy, dann klingelt das Telefon. Die Frau am anderen Ende der Leitung hat ein Problem, das er nicht lösen kann, weswegen er sie weiterverbindet. In der Leitung tutet es, Musik setzt ein, er legt auf. Durch die Glastür sieht er einen seiner Kollegen, der in der Küche vor dem Marilyn-Poster von Warhol steht, eine Zigarette raucht und einen Kaffee trinkt. Der Kollege grüßt, indem er die Kaffeetasse hebt. So locker will ich es auch mal haben, denkt Paul, da stürzt Alain auf ihn zu. Paul entschuldigt sich, dass er unterwegs nicht antworten konnte, zu viel Verkehr und massenhaft Polizisten. Alain ignoriert, was er sagt und fragt ihn nach Unterlagen, einem gelben Ordner mit wichtigen Sachen, wichtig für die Sitzung. Gestern habe er sie auf Pauls Schreibtisch gelegt, heute seien sie verschwunden. Schon eine Stunde lang sei er dabei, alles abzusuchen. Paul weiß nichts von einem gelben Ordner, schüttelt den Kopf. »Keine Ahnung.« Alain ist genervt. Hektisch seine Stimme. »Das gibt’s doch gar nicht.« Paul hilft suchen und als sie den Ordner endlich finden – er liegt auf dem Kopierer und es ist kein gelber, sondern ein blauer – ist es halb neun. Alain blättert sich durch die Seiten und stellt fest, dass eine der Kalkulationstabellen fehlt. »Die hab ich mitgenommen, nochmal durchgerechnet«, sagt Paul. »Zeig nochmal alles her«, verlangt Alain, und als Paul seine überarbeiteten Pläne auf dem Schreibtisch ausbreitet, Alain mit dem Finger hierhin und dorthin zeigt und schließlich nach der Kalkulation der Glastüren fragt, ringt Paul nach Luft. »Sag bloß, du hast die Kalkulation vergessen?« Alain hat wieder diesen durchdringenden Blick. »Nein, hab ich nicht.« Paul zieht den eigenen Ordner heran. Kurz zweifelt er, ob er die neue Kalkulation nicht vielleicht doch hat liegen lassen, auf dem Wohnzimmertisch, zwischen all den Zeitschriften und Prospekten. Dann aber hält er seine Berechnung in der Hand. »Hier«, sagt er erleichtert, schiebt das Blatt in Alains Richtung und erklärt seine Veränderungen. Alain ist einverstanden, nickt.
Paul kehrt zurück an den Computer, schickt der Sekretärin seine Zeichnung. Für die Power-Point-Präsentation, schreibt er dazu. Mit ein paar Klicks ist das erledigt. Wieder läutet das Telefon. Er klemmt den Hörer ans Ohr, betätigt die Maus, klickt sich zum Kalender. »Woche siebenundzwanzig sagen Sie? Moment mal, Moment bitte, das ist schlecht, da bin ich schon voll, kann auch nichts schieben, oder Moment noch, doch vielleicht in der Woche achtundzwanzig, am Donnerstag, aber nein, halt, klappt auch nicht. Wie wär’s nochmal eine Woche später, am Mittwoch, den 3.? Ja, da könnte ich den Vormittag anbieten. Aha, prima, passt. Dann trage ich das so ein.«
Rix kommt herein, wirft den Mantel über einen Stuhl. Paul fällt auf, dass Anzug und Krawatte nicht aufeinander abgestimmt sind. »Guten Morgen, die Herren«, sagt Rix und grüßt in die Runde. Er folgt Alain in den Besprechungsraum. Paul rafft seine Unterlagen zusammen und fährt sich durch die Haare. »Dann wollen wir mal«, sagt er. Aus den offenen Bürotüren dringt gedämpftes Reden und unterdrücktes Lachen. Im Besprechungsraum stehen Orangensaft- und Mineralwasserflaschen vor einer Reihe umgestülpter Gläser. Wie immer ist eine Platte mit belegten Brötchen gerichtet worden. Die Fenster sind geöffnet. Frühlingsluft zieht herein, verweht den Duft der Wurstbrötchen. Einen Moment steht Paul am Fenster, sieht auf den Parkplatz, auf die wenigen Sträucher. Dann begrüßen ihn Kollegen, der Raum füllt sich.
Alain eröffnet die Sitzung, verweist aber bald auf Paul, der mit wenigen Klicks auf dem bereitgestellten Computer seine Planung präsentiert.
Paul sieht, wie Rix gleich vorne, neben Durant und dem Schnösel von der Agentur, in der ersten Reihe sitzt, zurückgelehnt, die Arme verschränkt, mit erwartungsvoll hochgerecktem Kinn. Während der ganzen Zeit behält er diesen arroganten Blick bei, bis zum Schluss, aber Paul lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sein Vortrag ist gut. Flüssig und schlüssig. Auch seine Ideen. Er muss einige Fragen beantworten, darauf ist er vorbereitet. Eine der Fragen führt zu einer kurzen Debatte. Paul hat gute Argumente, kennt das Für und Wider, kann überzeugen. Ein paar Kleinigkeiten müssen angepasst werden, für Paul ein Klacks, eine Sache von nicht mal einer halben Stunde.
Die anschließende Diskussion dauert, wie erwartet. Am Ende gibt es Applaus. Alain sieht erleichtert aus. Seine Aufregung scheint verflogen. Er nickt Paul sogar zu und hebt die Kaffeetasse, als wolle er mit ihm anstoßen. Erst gegen zwei verabschieden sie sich. Es sind noch ein paar von den Brötchen übrig, Paul schnappt sich eines mit Salami und sitzt ein paar Minuten später wieder an seinem Schreibtisch. Alain kommt kurz vorbei, meint, dass alles noch flüssiger hätte laufen können, ist aber insgesamt zufrieden. Der Anrufbeantworter blinkt und achtzehn neue Mails sind reingekommen. Zuerst die Sachen für Rix, entscheidet Paul, nur vorher noch ein Blick auf das Handy. Ein Freund fragt, ob sie sich zusammen ein Fußballspiel ansehen wollen, am Abend, im Scooters. Geht nicht, tippt er zurück, wir sind schon eingeladen. Er schiebt das Handy zurück in die Tasche und will sich den besprochenen Korrekturen seiner Bauzeichnung widmen, checkt aber dann doch noch vorher die Mails und hört den Anrufbeantworter ab. Bis halb vier ist er damit beschäftigt, einige der Mails sind dringend, er wird mindestens noch eine Stunde dranhängen müssen, wenn das mit dem Bauplan heute noch erledigt werden soll.
Kurz nach vier klingelt das Handy. Lillys Foto erscheint auf dem Display. Was sie wohl will? Er hat ihr doch gesagt, dass es später wird. Er hebt ab. Lillys Stimme klingt seltsam, anders als sonst. »Ich bin in der Krippe. Marie ist nicht da, mein Gott, Paul, wo ist Marie?« In diesem Moment trifft ihn etwas, das ihn wie ein heißer Strahl durchbohrt. Der Bauch zieht sich zusammen. Marie, Marie, seine kleine Marie! Angst umklammert ihn, würgt ihn, er sieht sich fallen, mit dem Kopf voraus, in eine Tiefe ohne Boden, und die Luft bleibt weg, wie wenn man zu weit geschwommen ist und kein Land mehr sieht und der Sauerstoff fehlt und man gierig atmet. Er kann Lilly nichts sagen, lässt das Handy fallen und stürzt aus dem Büro. Der Aufzug ist irgendwo, das dauert zu lange, er drückt nicht, sondern rennt die Treppen hinunter, tastet unterwegs nach dem Autoschlüssel. Sein Herz schlägt bis zum Hals. Marie, seine kleine Marie! So lang kam ihm nie ein Weg vor, zweiter Stock, erster Stock, Parterre und der lange Flur, und endlich ist er draußen auf dem Hof, dann bei den Parkplätzen, er rennt, sein Wagen steht ziemlich weit hinten, er rennt, vorbei an den Glascontainern. »Marie, Marie …!« Schon aus der Entfernung drückt er die obere Taste des Klappschlüssels, los, los, komm schon, es klackt, da ist er am Auto, reißt die Tür auf. Marie, Marie! Maries Kopf liegt seltsam verbogen, die Ärmchen liegen schlaff neben dem kleinen Körper. Er öffnet den Gurt, will sie aus dem Sitz heben, aber sie ist so weich, so weich. »Nein, nein!«, schreit er, »nein, nein, nein!« Er hebt sie auf, presst sie an sich, spürt, was er nie spüren wollte, niemals. Sein Herz hämmert, ihn schwindelt, es dröhnt in seinem Kopf, er hält sein Kind fest, ganz fest, dann öffnet er den Mund, schreit aus tiefsten Tiefen, ein Schrei, wie man ihn in Schützengräben hört, ein Schrei, gefüllt mit Rotz und Blut und Schmerz, ein Schrei, der nicht mehr aufhört, nie mehr aufhört für ihn, nie mehr.
Überleben
Rückblickend schrumpften die Jahre, und obwohl sie viele Jahre im Historischen Archiv der Universität geputzt hatte und darüber alt geworden war, blieb genau genommen nur dieser eine Tag, der letzte, der sich ihr ins Gedächtnis brannte. Die anderen Tage versanken in der Ödnis der Lappen, des Putzmittels mit dem Zitronenduft, den sie längst nicht mehr wahrnahm. Sie versanken auch in der Eintönigkeit der Gegenstände, die sie abstaubte, polierte, abrieb und wischte: die Flure mit den marmorierten Fliesen, die Waschbecken und Spiegel, die Toiletten, die Treppen mit den rutschigen Stufen, die unaufgeräumten Schreibtische – bitte so lassen, wie sie sind und nichts verändern, höchstens die Telefone desinfizieren – die graumelierten Teppichböden, die sie täglich mit einem viel zu schweren Sauggerät vom Staub befreite.
Sie arbeitete immer gegen Feierabend, wenn die Büros sich leerten und nur noch diejenigen zurückblieben, die entweder das Tagespensum nicht geschafft hatten oder sich profilieren wollten. An jenem Tag saß nur noch ein Mann mittleren Alters im vorletzten Büro vor einem Computer. Sie kannte ihn vom Sehen, hielt ihn für einen der Assistenten, denn neben der teuren Kleidung, die er trug, ging eine gewisse Arroganz von ihm aus, die sie für assistententypisch hielt. Er war für ihren Geschmack zu modisch gekleidet, seine mit Gel zurückgekämmten, gewellten, an den Ansätzen graumelierten Haare saßen perfekt. Die Hände waren leicht gebräunt. Am Zeigefinger steckte ein Silberring mit einem blauen Stein. Zu seinem sichtlich teuren Smartphone, das auf dem Schreibtisch lag, gehörte ein silberfarbenes Lederetui, das eine erkaufte Eleganz verströmte, die ihr nicht gefiel, ebenso wenig wie der schwarze Füllfederhalter mit den Goldstreifen. Ein Wichtigtuer, dachte sie.
Er schien sie nicht zu bemerken, arbeitete konzentriert, und auf ihre Frage hin: »Stört es Sie, wenn ich hier sauge?«, zuckte er nur mit den Schultern und sah sie nicht an. Ihr fiel auf, dass er die Tastatur nicht professionell betätigte, sondern mit zwei Zeigefingern darauf herumhackte. Wer weiß, wie lange er noch brauchen würde, dachte sie und wollte nicht warten. Die anderen Büros waren schon gemacht und das Saugen würde schnell gehen. Sie bückte sich, steckte den Stecker ein, betätigte das Pedal. Der Staubsauger heulte auf. Der Lärm war unangenehm. Auch der Mann war unangenehm.
Lächerlich fand sie es, als er den Stuhl zurückschob, aufstand, und das Zimmer verließ. Nicht einmal zwei, drei Minuten Lärm waren ihm also zuzumuten. Sie schüttelte den Kopf, lenkte das Gerät um zwei Zimmerpflanzen, sammelte ein paar abgefallene Blätter auf, nutzte dann die Gelegenheit, um unter dem Schreibtisch zu saugen. Sie konnte nicht anders als hinsehen: Der Bildschirmschoner zeigte eine Alpenlandschaft, idyllisch, mit weißen Bergspitzen. Neben der Tastatur und unter einer Lampe, die ihren Kopf über die Schreibtischplatte beugte, lagen Fotos. Die Fotos waren vergilbt, sichtlich alt, schwarzweiß. Sie war an etwas erinnert, trat näher heran, lehnte den heulenden Staubsauger an die Kante des Schreibtisches und hob eines der Fotos auf.
Da war es, als ob sie in etwas versänke. In ihrem Kopf waren sofort das Brüllen und die Kommandos von denen wieder da, die vor der Rampe für Ordnung sorgten. Da waren die Rufe von Leuten, die sich verloren hatten, der Gestank, das Durcheinander, da war die Angst. Auf einem der Fotos war eine Frau zu sehen, eine Frau mit einem Kopftuch, halb abgewandt, mit einem Mädchen an der Hand. Mutter, dachte sie, aber es war nicht ihre Mutter, es war eine fremde Frau mit einem fremden Kind, aber doch eine Mutter, wie ihre eine gewesen war und ein Kind, das so aussah wie sie. Genau dort hatten sie gestanden, auf dem zertretenen Boden an dieser Rampe und ihre Ohren waren voll gewesen von diesem Geschrei, von den Befehlen, von den Rufen Hunderter Menschen, die blass und kraftlos aus den Waggons strömten und vor den Wagen auseinandergerissen, geprügelt und gestoßen wurden. Auch sie waren auseinandergerissen worden, obwohl die Mutter sie fest umklammert hatte. Aber dann war eine andere Hand dazwischen gegangen, eine harte, brutale Hand, und die Hand der Mutter war zu schwach gewesen, musste nachgeben, und da hatte sie plötzlich ganz allein dagestanden in diesem Gewirr.
Ihre Hände zitterten. Ja, genau dort, wo die Frau mit dem Kopftuch und das Mädchen standen, hatten auch sie gestanden. Und neben ihr lag ein Mann auf dem Boden, ein gebrechlicher, alter Mann, der sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Einer der Aufseher hatte dem Alten seine schwarzen Lederstiefel in den Hals gebohrt und gelacht.
Vielleicht war sie dieses Kind an der Hand dieser Frau, vielleicht war das das letzte Foto der Mutter. Aber nein, die Mutter war blond und die Frau auf dem Foto dunkelhaarig. Das Herzklopfen wurde schlimm. Mit dem Fuß trat sie auf das Aus-Pedal des Staubsaugers, das Heulen verebbte. Sie schwitzte, konnte den Blick nicht von dem Bild lösen. Die Mutter hatte das gleiche Tuch. Und das Kind war ungefähr sechs, so wie sie damals. Sie hob das Foto bis dicht vor die Augen, als ob sie hineinkriechen wollte. »Mutter«, flüsterte sie immer wieder, »Mutter.«
Als der Mann zurückkam, stand sie immer noch da mit dem Foto in der Hand. »Was tun Sie da? Legen Sie das weg.« Aber sie konnte das Foto nicht weglegen, es war doch ein Foto der Mutter, das wollte sie ihm sagen, aber sie konnte es nicht sagen, sie konnte nur dastehen und den Mann anstarren. »Legen Sie es zurück!«, wiederholte er und als sie es nicht tat, riss er ihr die Bilder aus der Hand und herrschte sie an: »Was erlauben Sie sich? Lassen Sie mich endlich arbeiten!«
Sie bückte sich nach dem Staubsauger, streckte den Arm vor. Unleserlich aber doch vorhanden am Unterarm die Nummer 50463. Unterhalb der vier ein kleiner schwarzer Winkel.
Der Mann sah, was sie sah. Zögerte. Ein abschätziger Blick traf sie. »Sie haben also überlebt«, sagte er. Sie nickte. »Wie haben Sie denn überlebt?« Sie schluckte, konnte nichts sagen, wusste nicht, was er meinte, weil sie sich ertappt fühlte wegen des Fotos und weil so eine Schärfe in seiner Stimme lag und auch in seinem Blick. »Indem Sie anderen das Essen weggenommen haben? Indem Sie sich die besseren, wärmeren Kleider gegriffen haben und die anderen frieren ließen? Indem Sie sich die dicke Suppe von ganz unten aus dem Topf geschöpft und den anderen die wässrige Brühe von oben überlassen haben?« Sein Gesicht näherte sich ihrem. »Oder indem Sie jemanden denunziert haben?« Sie antwortete nicht. Er redete weiter. »Sie sagen also nichts. Typisch. Niemand redet darüber. Die, die rausgekommen sind, haben es verstanden, andere zu schinden. Sie waren rücksichtslos, skrupellos, nur deshalb haben sie überlebt. Und deshalb reden sie nicht.«
Sie spürte Brechreiz aufsteigen. Wollte weg. Er baute sich vor ihr auf. »Sie haben auf Kosten anderer überlebt. Es muss beschämend sein, am Leben geblieben zu sein.« Herausfordernd sah er sie an. Sie hasste die Art, wie er im Stehen die eine Hüfte herausdrückte und beim Sprechen mit den Fingern spielte. »Sie haben kein Recht«, sagte sie, ging in Richtung der Tür, taumelte, hielt sich an der Klinke fest, sah noch, wie er die Fotos zusammenlegte. Sie hatte die Mutter vor Augen, hörte, wie sie beim Namen gerufen wurde. Sie zögerte. Dann kehrte sie um, ging in Richtung des Schreibtischs. Der Mann sah auf. Ihre Stimme war fordernd: »Geben Sie mir das Foto. Es ist bei Ihnen in keinen guten Händen.«
»Was soll das? Machen Sie, dass Sie …!«
»Rauskommen? Ich soll also gehen? Nicht ohne das Foto dort!« Mit dem Finger zeigte sie auf die Aufnahme, die oben auf dem Stapel lag, wollte danach greifen. Er sprang auf. »Wenn Sie nicht sofort verschwinden …«
»Dann sorgen Sie dafür, dass mir gekündigt wird, oder?« Sie schnappte sich das Foto und wollte hinaus. Ihr Herz raste. Sie spürte es bis in den Kopf. Dann aber blieb sie stehen, drehte sich nach ihm um, hielt das Bild hoch: »Das sind wir. Das hier vorne bin ich und hier, sehen Sie, das ist meine Mutter«, sagte sie, deutet auf die Frau mit dem Kopftuch und fügte hinzu: »Meine Mutter hat den Dreck der Kapos wegputzen müssen, damals, und ich putze jetzt Ihren weg! Wir haben uns also nicht gerade verbessert.« Wieder wollte er auffahren, aber sie ließ ihn nicht zu Wort kommen, denn während sie das Foto in ihre Schürzentasche steckte, trat sie ganz nah an ihn heran und flüsterte ihm ins Gesicht: »Wir hatten immer schon mit Kapos zu tun, verstehen Sie? Kapos, so wie Sie. Und immer, wenn ich meine, dass die Zeit besser geworden ist, begegne ich solchen Leuten. Leute, die nichts verstanden haben. Und wissen Sie, was daran das Schlimmste ist? Dass es genau deshalb niemals aufhören wird.«
Amerika
I
»Stell dir vor, Johann, übers Meer, mit dem Wind und dann: Amerika! Dort sind wir frei und keiner kann uns was! Kein König, kein Kaiser. Schon gar keine Armee. Wir reisen mit dem Dampfschiff. Auf so ein Schiff würde unser ganzes Dorf passen. Da wo wir ankommen, sie sagen dort Eiländ, ist alles voller Menschen. Der Hafen muss riesig sein. Zuerst werden wir untersucht, dann prüfen sie, ob wir lesen und schreiben können. Wenn wir aufgenommen sind, heißt es: Pusch tu Nu Jork. Das heißt, wir werden nach Nu Jork gebracht. Nu Jork … Pferdebahnen und Restaurants gibt es dort und Häuser, die so hoch sind wie unsere Kirche!«
»Ja, aber Nick, sag, wie viel Geld haben wir? Was, wenn es nicht reicht?«
Hubert Metzen saß am Küchentisch und aß, die Ellbogen aufgestützt. Vor ihm stand eine Schale mit saurer Milch, in die er Brot gebrockt hatte. Die Tür stand offen. Er konnte nicht anders, als der Unterhaltung seiner beiden Söhne zuzuhören, die in der Kammer nebenan altes Werkzeug reparierten. Jetzt planen sie wieder, dachte er. Seit Wochen sprachen sie von nichts anderem und wie es aussah, war es ihnen ernst damit. Er dachte an Lisbeth, seine verstorbene Frau, und dass er spätestens im Frühjahr auch ohne die Söhne sein würde. Wenn Lisbeth bloß bei ihm geblieben wäre. Ob sie versucht hätte, die beiden umzustimmen? Er sah Lisbeth vor sich. Ihr glattes, dickes Haar, zum Dutt zusammengebunden, ihre dunklen Augen und wie sie so stolz den Kopf in den Nacken werfen konnte. Er erinnerte sich an einen Tag kurz nach der Hochzeit. Lisbeth hatte in einem Tümpel des Baches Bettlaken gewaschen und neben den Apfelbäumen zum Bleichen ausgelegt. Unendlich heiß war es gewesen, so heiß, dass sogar die Vögel verstummt waren. Plötzlich hatte er Lisbeth schreien hören. Sofort war er losgestürzt, fand sie am Bach, wo sie völlig aufgelöst am Ufer saß und ihm ihre Hand entgegenstreckte: »Sieh doch! Sieh! Der Ring …« Sie schluchzte, heulte, schwitzte, flehte zum Heiligen Antonius. Dass der Verlust des Traurings Unglück bringen werde, Pech für viele Jahre, davon war sie überzeugt. Er beruhigte sie, durchforschte die Wiese, durchwühlte jedes Grasbüschel. Dann kämpfte er sich durch das Ufergestrüpp, und dort, wo die Äste der Weiden sich mit der Strömung bewegten und schwarze Wellenringe über das Wasser liefen, war es plötzlich, als teilten sich die Zweige. Und wirklich, sie gaben den Blick frei auf etwas, das an einem Ast hing und glänzte. Wie er dann den Ring zum Vorschein gebracht und juchzend gegen das Licht gehalten hatte! Wie der Ring funkelte! Und Lisbeth, wie sie am Ufer stand, mit in der Hüfte gestemmter Hand, wie sie sich mit der anderen eine Haarsträhne aus dem erhitzten Gesicht strich und lachte, lachte, dass sich Grübchen auf ihren Wangen bildeten. Er konnte ihr Lachen noch hören, hell wie die Glocken der Marienkapelle, aber verwischt und von sehr weit her. Wie jung sie damals waren.
In der Kammer nebenan war das Gespräch der Jungen leiser geworden. Jetzt redeten sie über das Schiff. Es ging um Preise für Fahrkarten der dritten Klasse und darum, ob sie nicht doch lieber den Segler wählen sollten, was die Reise zwar verlängern würde, aber halb so teuer wäre.
Draußen in den Bäumen lärmten Krähen. Es waren so viele, wie all die Jahre nicht. Frech waren sie, krakeelten vor der Stalltür, stürzten sich auf alles, was essbar war, stießen kurze, heisere Rufe aus, was sich anhörte, als ereiferten sie sich über die Kälte, über den Nebel, über das Wenige, was sie zum Fressen fanden, über ihn. Als ob sie Metzen vorwerfen wollten, dass die Obstbäume in diesem Jahr kaum getragen hatten.
Seit Wochen steckten die Jungen die Köpfe zusammen und warfen sich vielsagende Blicke zu. Längst hatte Nick seinem Bruder Johann die neue Welt schöngeredet. Abhauen würden sie. In ein paar Monaten schon. Auf alle Fälle, bevor der Brief kam, der auch Johann zum Militärdienst zwingen würde. Besonders Nick war angesteckt von den vielen, die es über den weiten Ozean geschafft hatten und hoffnungsvolle Briefe schrieben. Dass es Arbeit für alle gäbe, Wohlstand und Verdienstmöglichkeiten, gutes Land und Vieh für wenige Dollar, schrieben sie. Vor allem aber sei Amerika frei, ein goldenes Land, wo jeder so leben könne, wie es ihm gefiel.
Nick wusste viel, sammelte alles, was ihm über Amerika in die Hände fiel: Zeitungsartikel, Dollarkurse, Berichte der Reedereien, sogar Abfahrtszeiten der Dampfer. Er besaß ein Konversationsbuch für Reisende, das neben einem Wortverzeichnis auch Fragen auf Amerikanisch enthielt. Immer wenn er daraus las, war es so, als trüge er den Klang der großen Welt in seiner Stimme. Do ju spieck Inglisch? Wotts jor näm?
Einmal hatten sich die beiden mit einem Agenten getroffen. Ein sogenannter Anwerber der Hamburg-Amerika-Linie war es, der sein Geld damit verdiente, Schiffspassagen nach Übersee anzupreisen. In der Wirtschaft war er aufgetaucht, sonntagmorgens zum Frühschoppen, und ins Schwärmen geraten. »Land, Land, eine Weite, das kann sich bei euch hier keiner vorstellen. Gutes, fruchtbares Land. Wer als Knecht geht, kommt bald als Herr zurück und fährt im Wagen zur Kirche.« In seinem teuren Anzug mit einer an der Weste befestigten teuren Uhr mit entsprechender Kette, versprach er den Brüdern einen enormen Tagelohn und schilderte nichts weniger als das Paradies, wohin er sie führen wollte, selbst wenn die Militärpapiere für Johann nicht vorlägen.
Immer, wenn Agenten dagewesen waren, hörte man, dass Häuser und Inventar verkauft wurden und sich ganze Familien mit Koffern und Kisten auf große Fahrt begeben hatten. Metzen war nie mit einem Agenten ins Gespräch gekommen. Das lag daran, dass er kaum aus seinem Dorf fortkam und sich selten in der Wirtschaft blicken ließ. Er wusste nicht, was er von diesen Herren mit den schwarzen Aktenkoffern halten sollte. Sie hatten leichtes Spiel. Zu gerne glaubten die Leute, was sie sagten, war doch ihr Landstrich arm und längst nicht jeder wurde satt. Die Armut saß überall. Metzen musste sich nur sein Hornvieh ansehen. Ein trauriger Anblick. Nicht auszudenken, wenn er Brot und Kartoffeln hätte kaufen müssen. Zu karg waren die Böden, zu rau war das Klima. Bis in den Mai hinein lag oft noch Schnee. Anfang November fiel er schon wieder. Nichts wurde reif, vieles verdarb und verkam. Wie oft waren ihm die Kartoffeln erfroren. Überhaupt die schlechten Ernten, die nichts anderes bedeuteten als Hunger und Schulden. In den letzten Jahren waren die Preise für Getreide und Kleidung ins Unendliche gestiegen. Es war sogar schon so, dass manche Dörfer die Last der Armenunterstützung von sich abzuwenden versuchten, indem sie die Bedürftigsten auf ihre Kosten nach Amerika schickten und für ihre Schulden aufkamen. Das war billiger als sie durchzufüttern. Nein, für die Agenten war es nicht schwer, die Leute von Besserem zu überzeugen. Seit Jahren warteten sie. Wie das Volk Israel auf den Messias.
Hubert Metzen konnte seinen Söhnen nichts verdenken. Je älter er wurde und je mehr er sah und hörte, desto besser konnte er sie verstehen. Söhne wie Bäume waren es. Das dachte er jedes Mal, wenn sie mit bloßen Oberkörpern vor der Waschschüssel standen und sich wuschen. Stark waren sie, obwohl sie sich kaum sattessen konnten. So viele junge Männer gab es, die für den Heeresdienst unbrauchbar waren, weil sie nur aus Haut und Knochen bestanden. Da waren seine Jungen anders.
Der ältere, Nikolaus, von allen Nick genannt, mit rötlichen Locken und einem gezwirbelten Bart, der jüngere, Johann, dunkler und stämmiger, beide mit geraden Rücken, starken Armen und entschlossenen Mienen: »Vater, wir werden Preußen nicht dienen. Wir haben alles bedacht. Es ist zwecklos hier. Wir gehen fort. In Amerika braucht man Leute wie uns. Sie suchen alles: Zimmerer, Schreiner und Metzger, Schneider und Stahlarbeiter. Auch Minenarbeiter und Leute, die sich in der Viehwirtschaft auskennen, so wie wir. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ein Ochsengespann. Vater, wenn es drüben so ist, wie wir denken, kommst du nach.« Metzen spürte, dass auch ein bisschen Abenteuerlust mitschwang. Er glaubte daran, und der Gedanke gefiel ihm, dass jedem Menschen Chancen geschenkt würden, nach denen er greifen müsse, schon allein deshalb, weil sie nicht wiederkehrten. Dass man also sogar eine Verpflichtung hätte diesen Möglichkeiten gegenüber. Dass auch Gott es so sehen müsse, denn sonst hätte er die Chancen nicht zur Wahl gestellt. Ob es gut und richtig wäre, könne man ohnehin erst in ein paar Jahren sagen.
Dennoch war er in Sorge um seine Söhne und gab dies und das zu bedenken. »Was, wenn ihr vielleicht das Land bekommt, aber kein Arbeitsgerät? Vielleicht sind es Betrüger, diese Agenten, wer weiß es schon? Man hört so manches. Und was ist mit Johann? Was, wenn sie dahinterkommen, dass er nicht beim Militär war?«
Bei allem, was er einwarf, wusste er, dass er sie nicht würde abhalten können. Nick hatte lange genug gedient und war voller Hass auf alles Militärische zurückgekommen. »Gestatten vorbeigehen zu dürfen, gestatten eintreten zu dürfen, gestatten wegtreten zu dürfen … Linksum, rechtsschwenkt, ein Lied zwo drei vier! Dann aufspringen und strammstehen, sobald ein Vorgesetzter den Raum betritt.« Natürlich hatte Metzen versucht, seinem Sohn den Mund zu verbieten, ihn gewarnt, dass sie ihn, je nachdem wo er solches äußerte, eines Tages einsperren würden. Aber Nick ließ sich den Mund nicht verbieten. Er wurde nicht müde von Demütigungen zu sprechen, von Drill und Prügelstrafen, davon, dass ihm alle Würde ausgetrieben werden sollte und dass viele schon nach wenigen Wochen am Rand der Verzweiflung gestanden hätten. »Sklaven machen sie aus uns, die sich zu jeder Schandtat kommandieren lassen, sich benutzen lassen, und sogar, wenn sie fertig abgerichtet sind, ohne mit der Wimper zu zucken auf Vater und Mutter schießen würden. Das Ehrgefühl heißt kriechen und der Charakter äußert sich im Lecken von Stiefeln. Und der Adel kennt natürlich alle Schleichwege, um das nicht mitmachen zu müssen. Bloß wir sind gut genug. Außerdem sieht es nach Krieg aus. Bismarck ist ein Kriegstreiber und hat nichts anderes im Sinn, als Preußen nach oben zu bringen. Aber was bedeutet uns schon Preußen? Nichts und nochmal nichts! In Amerika kriegen wir Land, günstiges, gutes Land. Wenn wir uns verpflichten, es für fünf Jahre zu bestellen, gehört es uns. Das mit dem Ackergerät wird sich schon fügen. Eine neue Existenz werden wir aufbauen. Leben werden wir dort, anders als hier.«
Metzen ließ sich nichts anmerken, aber er trauerte. Wie würde es sein ohne die Söhne? Wer würde die Arbeit auf dem Hof und auf den Feldern tun? Abgesehen von einer Magd war er allein. Das Dreschen im Herbst war eine mühsame Arbeit, so wie das Pflügen im Frühjahr. Auch deshalb hatte er die beiden gebeten, abzuwarten. Ordentlich abwägen sollten sie. Nichts überstürzen. Ein Entschluss fürs Leben sei das. Denn kaum jemand, der gegangen war, kehrte wieder zurück.
Sie hatten ihm noch den Winter versprochen, aber ein Winter, was war das schon? »Auf was sollen wir warten, Vater?«, hatte Nick gefragt. Metzen wusste es selbst nicht. »Komm doch mit«, sagten die Söhne. Aber nicht einmal im Traum dachte Metzen daran, sein Land zu verlassen, jetzt, wo sein Haar grau und dünn und sein Gang langsam geworden waren. Wenn er jünger gewesen wäre, dann vielleicht.
Metzen verglich. Die Söhne vom Nachbargehöft waren auch fortgezogen. Brasilien. Seitdem hatten sich die Mundwinkel des Nachbarn verändert. Scharf abwärts zeigten sie jetzt, unablässig schimpfte er mit gepresster Stimme vor sich hin und manchmal schäumte sein Blut derart auf, dass er tobte und schrie, was man bis ins Dorf hören konnte.
Metzen schrie nicht. Schreien half nicht. Helfen würden einzig und allein andere Gedanken von denen, die regierten. Etwas müsste geschehen, damit die jungen Leute nicht dazu gezwungen wären, anderswo ihr Glück zu suchen. Jetzt schon waren ganze Dörfer entvölkert.
Die Sommerarbeit war hart gewesen. Wochenlang hatten sie in der Heuernte geschuftet, zuerst gemäht, dann jeden Morgen das Heu ausgebreitet, abends zusammengeschlagen und gehoppt. Todmüde waren sie abends in die Betten gefallen. In den Wochen darauf hatten sie mit Sicheln auf den Feldern gestanden und das Getreide geschnitten.
Im Herbst dann das Dreschen. Eine Knochenarbeit. Wie gut war es, wenn Johann abends in der Küche verschwand, um Gerstenkaffee zu kochen und jedem einen Brei zu rühren. Wie gut, wenn dann alle die Beine unter den Tisch strecken konnten.
Im nächsten Jahr würde er ohne sie auskommen müssen.
Der Winter kam früh. Weit vor der Zeit hatten die Bäume das Laub abgeworfen. Die Schatten waren lang geworden. Aufgeplusterte Spatzen hockten auf den Holzstapeln vor dem Haus. Längst glitzerten am Morgen die Wiesen. In der Stube wurde es den ganzen Tag nicht hell.
An Allerheiligen standen sie gemeinsam am Grab der Mutter. Auf dem Weg zurück nach Hause fluchte Johann über die Kälte. Dass es der letzte Winter in der Heimat sei, sagte er. Nach Illinois oder Ohio würden sie ziehen. Vielleicht auch nach New York. Man müsse sehen.
II
Die Wochen flogen. Als sich an den Obstbäumen Knospen zeigten und die Kraniche zurück waren, packten sie ihre Sachen.
Der Georgstag hatte noch kein Licht, da standen sie mit Kisten und Koffern in der Küche. Ein letzter Haferbrei, ein letzter Schluck Milch, eine letzte Umarmung. Dann ein letzter Blick. Alles ging so schnell.
Später ging Metzen zur Frühmesse, stand in der hintersten Bank, dachte daran, wo die Jungen jetzt sein würden. Ob er sie jemals wiedersehen würde?
Beim Hinausgehen tauchte er die Finger ins Weihwasserbecken, sah, wie die Wasseroberfläche sich kräuselte und bekreuzigte sich. »Und? Sind sie fort?«, fragte einer der Bauern, der mit ihm den Heimweg teilte. »Ja, fort«, sagte Metzen und beschleunigte seinen Schritt. Er konnte nicht sprechen, alles ging ihm durcheinander.
Den ganzen Tag war er zu kaum etwas fähig. Er versorgte die Ziegen und molk die Kühe. Den Nachmittag verbrachte er auf der Eckbank in der Küche, wo er rauchte, vor sich hinstarrte und immer wieder mit den Händen über die Tischplatte rieb. Wie still das Haus war ohne die Söhne. So leer, wie die Haken im Flur, an denen sonst Mützen und Jacken hingen. Die Dielen im Zimmer der Jungen knarrten nicht mehr. Keiner polterte auf der Treppe.
Wieder wünschte er Lisbeth herbei, aber das Wünschen half nicht. Er saß, sinnierte über alles und nichts, starrte in die Ecke.
Irgendwann stand er auf, beobachtete durch das Fenster wie der Wind durch die blühenden Obstbäume strich, hörte, wie die Elstern in den Heckenrosen lärmten. Er zog die Jacke vom Stuhl und ging hinaus auf den Hof. Die Luft war gläsern, der Himmel hing hoch. Da waren schon wieder die Krähen, wo kamen sie bloß her? Harr, harr, riefen sie und beobachteten ihn aus ihren Krähenaugen. Der Wind schob die Wolken vor sich her und zerblies ihre Ränder. Die Krähen hockten auf dem alten Apfelbaum, der irgendwann begonnen hatte, sich nach der Seite zu neigen und fast ans Liegen gekommen war. Eigentlich hätte er ihn fällen müssen, denn er trug nicht mehr und Efeu und Moos krochen am Stamm. Er besah sich die Birnbäume und mutmaßte, dass einer von ihnen den Winter nicht überstanden hatte. Im Stall hörte er die Kühe. Zwei Kühe und zwei Ziegen waren es. Kurz ging er hinein, um nach ihnen zu sehen. Die Kühe lagen im Stroh und drehten die Köpfe. Warm war es im Stall. Es roch nach Stroh, nach Mist, nach Staub. Metzen ging wieder, verriegelte die Stalltür von außen.
Draußen pickten Hühner im Gras. Sie plusterten das Gefieder und gackerten, als er näherkam. Er öffnete das Scheunentor, das quietschend aufging. Zaumzeug hing an der Wand, daneben Besen, Sense und Rechen. An der Wand stand der Pflug, an den Johann den Blecheimer gehängt hatte. Sauber und geordnet hatten sie alles zurückgelassen.