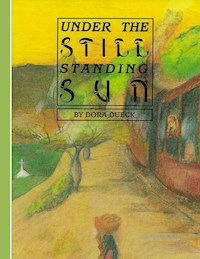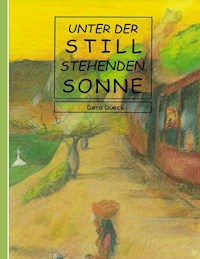
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Annegret Horsch, Mennoblatt schreibt: „Ein mennonitischer Roman, der sich im paraguayischen Chaco abspielt - und ein guter! ... Von vorne bis hinten interessant, dynamisch, spannend ... " „Mennonite Historian“schreibt: Einer der wesentlichen Elemente dieses Romans ist ... Die Perspektive einer Frau auf das Leben der Pioniere in einer von Männern dominierten Gemeinschaft ... zu empfehlen, nicht nur für seine Schilderung des Lebens in einer bahnbrechenden Familie, sondern auch, weil es das Wesen der paraguayischen mennonitischen Erfahrungen erfasst. Der Historiker Wilhelm Schroeder in Mennonitische Rundschau schreibt: "NEBEN der interessanten Erzählung enthält das Buch auch eine ausgezeichnete Schilderung des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, psychologischen, religiösen Hintergrundes eines bedeutenden Kapitels in der Geschichte der Mennoniten." Lesen Sie Auszüge des Buchs –sie sprechen für sich- bei den bekannten internationalen Internet Bookshops… indem Sie einfach die EAN 9783734795008 in einer Ihrer bevorzugten Suchmaschinen eingeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein mennonitischer Roman aus dem paraguayischen Chaco
Für H.
INHALTSVERZEICHNIS:
Unter der still stehenden Sonne
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Zweiter Teil
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Dritter Teil
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Nachwort
Portrait der Autorin Dora Dück:
Endorsements/reviews/Buchbesprechungen:
“An inspiring story, told with skill, vigour and understanding” – Barbara Smucker
“a gem of lucid understatement” –– Prairie Fire
“her accomplishment in this relatively brief novel is considerable” – Mennonite Quarterly Review
“delightful, yet painful portrayal…carefully researched…vivid descriptions” – Mennonite Reporter
“Author’s ability to make Anna’s life authentic at every age is most impressive” – Al Reimer, MB Herald
“Neben der interessanten Erzählung enthält das Buch auch eine ausgezeichnete Schilderung des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, psychologischen, religiösen Hintergrundes eines bedeutenden Kapitels der Geschichte der Mennoniten.” – Historian: Wilhelm Schroeder in Mennonitische Rundschau
“Ein mennonitischer Roman, der sich im paraguayischen Chaco abspielt—und ein guter!…von vorne bis hinten interessant, dynamisch, spannend…” Annegret Horsch, Mennoblatt
“One of the significant elements of this novel is…a wo
man’s perspective on pioneer life in a male-dominated community… recommended not only for its portrayal of life in a pioneering family, but also because it captures the essence of the Paraguayan Mennonite experience.” Mennonite Historian
Unter der stillstehenden SonneErster Teil
1
Als die Apipe endlich in den Hafen bei Puerto Casado einlief, schritt ich gehobenen Hauptes ans Land, war ich doch mit sechzehn Jahren, obwohl Flüchtling, voller Hoffnungen und Ideale. Ich hatte mir vorgenommen, meine neue Heimat ins Herz zu schließen. Bald wäre ich auf dem festen Hafendamm gestolpert, da meine Beine sich an den Rhythmus des leise schaukelnden Flussbootes gewöhnt hatten. Aber nur für einen Augenblick; dann berührten meine Füße das graue Ufer.
“Hier bin ich”, murmelte ich halblaut aber ehrfürchtig vor mich hin. “Endlich bin ich im Chaco!”
Eifrig ließ ich den Sack mit meinen Habseligkeiten auf den Boden sinken und begab mich auf eine kleine Inspektionstour meiner neuen Umgebung. Acht Monate hatte ich auf den Chaco gewartet, diesen Landstrich Paraguays der uns Rußlandmennoniten Siedlungsmöglichkeiten bieten sollte. Ohne Zögern wollte ich ihn in mein Herz schließen.
Glutrot ging die Sonne im Westen unter. Wellenartig verbreitete sie ihre Farben über den westlichen Himmel, vom flammenden Rot langsam ins Orangene übergehend. Erst den östlichen Horizont färbte ein mattes Blau.
Zu meiner Rechten sah ich einen riesigen Schlot. “Er wird wohl”, dachte ich, “ein Teil der Fabrik sein, in der man aus dem Chacoholz Gerbersäue gewinnt.” Schon vernahm ich die lachenden Stimmen der Arbeiter und hörte die Maschinen in der Fabrik. Ich warf auch einen schnellen Blick auf die Arbeiterhäuschen beim Hafen. Alle waren sie mit Pastellfarben angestrichen worden, rosa, grün oder auch blau, oder einfach angeweißt. Im Schein der untergehenden Sonne trugen sie alle den rosa Abglanz ihrer letzten Strahlen.
Und die Bäume! Palmen standen da, mit dunklen sich türmenden Stämmen und langen anmutigen Blättern; Farnkräuter waren fast wie Miniaturbäume; da waren Eukalyptusbäume mit schlanken Blättern und viele andere, die ich sicherlich mit der Zeit alle kennenlernen würde.
Jetzt schaute ich zurück zum Flussboot. Die Wellen des Flusses tanzten im Licht der untergehenden Sonne. Leise plätscherten sie ans Ufer, als ob sie murmelten: Du bist jetzt zu Hause, zu Hause, zu Hause. Da sah ich auch die anderen Passagiere austeigen, alles unsere Leute. Wie eine langsame braune Wasserflut füllten sie bald den Hafendamm, ihre langen Schatten auf die Apipe werfend.
Da sah ich auch schon unseren Gruppenleiter, Herrn Schroeder, wie er die Hafenbeamten grüßte und mit seinen knochigen Händen gestikulierte. Er versuchte, sich mit seinem gebrochenen Spanisch verständlich zu machen. Sein scharf geschnittener Kinnbart hob sich und fiel, während er die ungewohnten Laute der Südlandsprache zu artikulieren versuchte.
Mehrere dunkelhäutige Paraguayerfrauen in hellen Kleidern und Kopftüchern und bedeckten Körben auf ihren Köpfen verschwanden in der Menge. Ich sah eben noch wie die eine kurz vor Hans Wiebe Halt machte, mit anmutiger Geste den Korb vom Kopf nahm, ihn aufdeckte und ihm das fremde Gebäck anbot. Fremde Laute gab sie lachend von sich. Wiebe runzelte nur die Stirn und schüttelte den Kopf. Die Verkäuferin gab aber nicht nach, sondern blieb beharrlich vor dem errötenden Wiebe stehen. Schließlich konnte er ihr entweichen, nicht aber ohne ein peinliches Gefühl, dass sie ihn zum Besten gehabt hatte. Die Verkäuferin lachte nur, als hätte sie ihm den Inhalt des ganzen Korbes verkauft, deckte ihn wieder zu und stellte ihn auf ihren Kopf. Auch ich musste lachen.
Andere Frauen standen in ihren Türrahmen und schauten dem Treiben neugierig zu. Ich fand sie wunderschön mit ihren dunklen Gesichtern, ihrem nachtschwarzen Haar und ihren farbigen Kleidern. Wie tropische Blumen sahen sie aus, und ihre weißen Zähne glänzten in ihren dunklen Gesichtern, wenn sie lachten.
Die Arbeiter auf dem Boot riefen einander zu und winkten den Frauen in den Türrahmen. Immer wieder schauten sie auch auf uns, auf unsere grauen, dunkelblauen und braunen Kleider. Einer der Matrosen rief mir etwas in seinem Kauderwelsch zu. War es Guaraní oder Spanisch? Ich verstand ihn nicht, warf ihm aber ein Lächeln zu. Warum auch nicht? Ich war doch so glücklich endlich angekommen zu sein. Sein Lächeln verzog sich zu einem Grinsen und mit einem Freudenschrei hob er einen schweren Kasten auf seine Schulter.
Paraguay ist wunderschön, musste ich nur immerfort denken. Die Luft war feucht und süß wie reifes tropisches Obst. Und dieses sollte der paraguayischer Winter sein? Noch nie war ein Winter mir so angenehm vorgekommen.
Wir hatten Russland im Winter verlassen. In der Nacht als wir unser Dorf in Orenburg verließen und um die Wegbiegung fuhren, war es bitterlich kalt gewesen. Der scharfe Wind hatte mit einem richtigen Schneesturm gedroht. Wir flohen heimlich in großer Hast, kaum dass wir wussten, was wir taten. Ich schaute noch einmal zurück, aber unser Bauernhof war vor Schneegestöber nicht mehr zu sehen.
“Lieb Heimatland, ade!” hatte ich noch geflüstert. Meine Augen hatten sich mit Tränen gefüllt.
Eine Stunde hatte die Fahrt zum Bahnhof gedauert. Niemand hatte ein Wort gesprochen. Eng zusammengekauert saßen wir unter den Decken. Ich schaute nur immer nach dem unendlich scheinenden grauen Nachthimmel und versuchte zu begreifen, dass ich nie mehr zurückkommen würde. So viel war mir deutlich gewesen. In den folgenden Monaten hatte ich immer das Gefühl, dass ich mein Leben in meinen Händen trug wie eine Gepäcksache, die ich bald irgendwo hinstellen müsste.
Und nun war ich im Chaco! Endlich sollte das Ungewisse, das Unstete ein Ende haben. Hier konnte man wieder sesshaft werden, fest, wie der Flussdampfer mit Tauen an die Landungsbrücke befestigt war. Dieser Moment musste doch gefeiert werden. Ich schloss meine Augen und wiederholte in Gedanken langsam die beiden Namen: “Russland” und “Paraguay”. In Gedanken, wie wenn man mit dem Finger eine Landkarte betastet, bereiste ich noch einmal die lange Strecke von meinem Heimatdorf über Moskau, dann weiter bis Deutschland, wo wir den langen Aufenthalt im Lager Mölln hatten. Dann kam die Ozeanfahrt über den Atlantik. Leise flüsterte ich die Namen “Buenos Aires” und “Asuncion” und vergegenwärtigte mir noch einmal die lange Flussfahrt von Asuncion bis Puerto Casado. Endlich waren wir im Chaco…
“Anna!”
Ich sprang auf.
“Aber Mama, du hast mich erschreckt!” Dann, mich schnell besinnend, rief ich, “Ist er nicht schön?”
Mama, schwerfällig von Körperbau, stöhnte nur. “Schön? Wer?”
“Der Chaco ist schön!”
“Der Chaco! Aber mein liebes Kind, was sprichst du denn für dummes Zeug?” Dann blickte sie wie suchend auf die ans Ufer eilenden Leute.
“Ich suche den Papa”, sagte sie. “Hast du ihn irgendwo gesehen? Auch Klaus und Maria habe ich aus den Augen verloren… Warum muss Papa auch immer so schnell laufen? Ich kann doch nicht mit ihm Schritt halten!”
“Und du,” fuhr sie fort, “jedes Mal, wenn du mir helfen sollst, bist du auf und davon. Was machst du denn? Du stehst und träumst wieder, wie ich merke!”
“Ich wollte mir die neue Heimat nur etwas ansehen”, antwortete ich. Dann auf ihre Fragen: “Papa wird dich schon vermissen; wollen wir nur stehen bleiben, dann findet er uns gewiss.”
Mama seufzte. “Nie im Leben will ich wieder Wasser sehen!”
Ich konnte sie schon verstehen. Arme Mama! Zuerst hatte sie die Seekrankheit auf der langen Ozeanfahrt, und nun hatte sie noch die lange Flussfahrt auf dem keineswegs reinlichen Boot mit der unzureichenden Bedienung machen müssen!
“Schmutzig! Gedrängt! Und die spanische Speise! Das ist doch alles nichts für uns Deutsche! Ja, die europäische Zivilisation haben wir zurückgelassen!”
“Wir gehen nicht mehr aufs Schiff, Mama”, tröstete ich sie. “Wir sind angekommen.”
Aber Mama ließ sich nicht so leicht trösten.
“Wenn man sechzig Jahre alt geworden ist, macht so ein Zigeunerleben keinen Spaß mehr”, schalt sie weiter.
Plötzlich war Papa da. “Siehst du”, sagte ich leise zu Mama.
“Da seid ihr ja!” rief Vater triumphierend, als ob wir uns hatten verstecken wollen.
“Ich will nie mehr etwas mit Wasser und mit Schiffen zu tun haben!” sagte Mutter ganz entschieden.
“Dann bist du am richtigen Ort, Schatz”, sagte Vater trocken. “Die Mennoniten, die schon im Chaco leben, berichten von einer ständigen Wassernot.”
“Das habe ich doch nicht gemeint!” sagte Mutter nun ihrerseits etwas ärgerlich. “Und wo sollen wir denn schlafen, Abram? Komm, Anna, bringe deine Sachen her. Was gibt’s denn weiter, Abram?”
“Wir besteigen morgen den Schmalspurzug, der uns ins Innere des Landes bringen wird.”
“Und dann sind wir endlich da?”
“Nein, nein! Von dort sollen uns die Kanadier abholen. Dann geht es noch mehrere Tagereisen weit auf Ochsenwagen. Kommt.”
“Es wird mir hier schon gefallen!” sagte ich, noch immer ganz begeistert. “Es ist wunderschön hier!”
Ohne weitere Antwort nahmen die Eltern ihr Gepäck und gingen los. Ich folgte ihnen. Plötzlich blieb Papa stehen, und da ich nicht aufgepasst hatte, stieß ich mit ihm zusammen.
“Uppla!” lachte ich, während wir auf einmal alle im Halbkreis standen und uns etwas verdutzt anschauten. Ich wiederholte: “Paraguay ist eigentlich schöner, als ich erwartet hatte. Es ist eine wunderschöne Heimat, nicht wahr?” Meine Freude wollte sich nicht dämpfen lassen. Die Ankunft in Paraguay war doch ein zu großes Ereignis für mich.
Aber Papa schaute mich nur streng an. “Du halt deinen Mund, Anna”, sagte er. “Kaum sind wir am Ufer, dann schwatzt du schon Dummheiten!” Er trat etwas näher an mich heran und sagte ganz leise: “Paraguay ist schlimmer als ich erwartete! Wir werden durch diese Ansiedlung fünfzig bis hundert Jahre zurückgesetzt.”
Obwohl er ganz leise gesprochen hatte, fühlte ich seinen Tadel und seine Entrüstung. Wie vom Blitzt getroffen kauerte ich zusammen.
“Du musst blind sein, wenn du meinst, dass du hier vor Freuden springen kannst!”
“Wo sind Klaus und Maria?” fiel Mutter ihm hier ins Wort, indem sie ängstlich ihren Blick von einem zum anderen gleiten ließ.
“Bleibe hier!” bat sie Vater.
Aber Papa schritt ärgerlich davon. “Ochsen!” murmelte er vor sich hin.
“Bitte, suche Klaus und Maria!” rief Mutter ihm nach, aber er wandte sich nicht um.
Ich wartete, bis Papa außer Sehweite war. “So”, schmollte ich, “wir sind doch im Chaco, nicht wahr?”
“Aber Papa will nicht hier sein. Er glaubt immer noch, wir hätten nach Kanada auswandern können.” Mama rückte ihr Kopftuch zurecht.
“Ja, aber…”
Mama legte ihren Arm um meine Schulter. “Wir sind alle erschöpft”, sagte sie seufzend. “Warten ist viel schwerer als arbeiten. Gerade das Warten macht mich so müde.”
Man hat mir zuweilen gesagt, dass ich meiner Mutter ähnlich sei. Wir hatten die gleiche Größe; meine Augen hatten dieselbe grünlich blaue Farbe. Auch Mund und Lippen waren den ihrigen ähnlich breit und voll. Auch unsere innere Verfassung war dieselbe lebendig, dramatisch.
Und doch konnte ich mich nicht in der Frau sehen, die vor mir stand. Ich war sechzehn Jahre alt, schlank und blond. Sie war sechzig Jahre alt, etwas korpulent und schwerfällig mit gelblichem nicht sehr anziehendem Haar. Ihr müdes Gesicht zeigte die ersten Runzeln, als ob die Gesichtsmuskeln nicht mehr imstande waren, die Haut straff zu ziehen.
Und doch zeigte Mama noch immer die Spuren einer einstigen Schönheit, die ich nicht besaß. (Darin war meine Schwester Maria ihr ähnlich.) Noch immer war sie peinlich genau in ihrer Kleidung. Reinlich und zierlich musste sie sein. Besonders in der Öffentlichkeit trug sie sich wie eine vornehme Dame. Ich musste darüber lächeln. Ich konnte mir Mama nie als eitel vorstellen.
“Warten und reisen”, sagte Mutter nun wieder, “ist keine gute Lebensweise. Ich sollte mich schon der Ruhe und der Entspannung hingeben können. Jetzt reise ich in der Weltgeschichte herum. Wozu? Um wieder ganz von vorne anzufangen?”
“Aber Mama…”
“Sieh, Anna, wenn du so töricht daherredest, machst du die Sache nur schwerer für Papa. Wir haben hier noch keine Arbeit verrichtet. Warte doch, bis wir ein Haus über unserem Kopf haben, etwas mit unseren Händen geschafft haben. Dann sage Papa, wie schön es ist. Du weißt doch, dass Papa nicht auf Überschwang und Gefühlsduselei hält.”
“Das ist es doch gar nicht!” protestierte ich. “Man muss sich doch etwas auf die neue Heimat freuen!”
“Sich freuen!” erwiderte Mama in verächtlichem Ton.
“Ja, sich freuen”, wollte ich sagen, “dann wäre auch das Warten erträglicher; aber du und Papa denkt immer nur daran, wie es früher war.” Ich sagte aber nichts.
Ja, ich wusste, wie ungerne Papa und Mama unsere schöne alte Heimat verlassen hatten. Fast wäre uns die Flucht schon nicht gelungen. Bald wären wir entweder zu spät oder zu früh in Moskau angekommen. Hatten wir nicht unseren Nachbar, Hein Martens, gesehen, wie er wieder zurückgefahren war? Unsere Züge fuhren einander vorbei. Klar erkannten wir ihn in seinem Zugabteil, als unsere Fenster einen Augenblick lang sich gegenüber waren. Er sah müde und traurig aus. Erst später erfuhren wir, dass er “freiwillig” zurückgefahren war.
Wir waren aber gerade zur rechten Zeit in Moskau angekommen. Wir durften ausreisen. Wir gehörten zu den wenigen Glücklichen. Und doch hingen unsere Eltern an der alten Heimat mit allen Fasern ihrer Wesen.
So war ich aber nicht gesinnt. Mein Leben lag vor mir. Für mich war diese Ankunft in Paraguay nicht so viel das Ende eines Lebensabschnitts, sondern vor allen Dingen der Anfang von etwas Neuem. Konnten meine Eltern das nicht sehen und verstehen? So empfand ich den Boden Paraguays fast als heiligen Boden. Russland sollte für mich Vergangenheit sein - ein Land ohne Verheißung, ohne Gott, ohne Freude. Ich wollte nicht mehr an die alte Heimat denken. Wenn Papa und Mama nicht anders konnten, sollten sie mich nicht mit hineinziehen.
Nur zu gerne hätte ich Mama aber auf meiner Seite gehabt. Wie könnte ich es ihr nur deutlich machen, wie mir zumute war? Da fiel mir eine kleine Begebenheit ein, die sich gerade vor unserer Grenzüberfahrt zugetragen hatte. Man hatte uns in Moskau streng verboten, Geld aus Russland ins Ausland zu bringen. Gerade vor der Grenze hielt unser Zug. Wir sollten noch einmal untersucht werden. Viele unserer Leute hatten noch russisches Geld bei sich. Wie sollten sie es los werden? Da erschien vor den Zugfenstern ein zerlumpter Bettler. Er hielt seinen zerrissenen Hut in der Hand, in den unsere Leute nun alle ihre Rubel und Kopeken hineinwarfen. Dieser konnte sein Glück kaum fassen.
“Das größte Glück seines Lebens”, bemerkte jemand in unserem Abteil.
“Er wird sicherlich glauben, dass er einen Engelbesuch empfangen hat”, sagte ein anderer.
Diese kleine Begebenheit löste die Spannung beim Passieren des Roten Tores. Erst an der westlichen Seite atmeten wir frei auf.
“Er hat nun alles, und wir haben nichts”, hatte Mutter damals wie zu sich selber gesagt. “Aber wir sind besser dran; er muss bleiben, und wir dürfen in die Freiheit.”
Nun erinnerte ich Mama an diese Begebenheit. “Weißt du noch, was du über den Bettler sagtest, Mama? Dass wir es besser hätten?”
“Ja, mein Kind, du hast recht”, antwortete sie versöhnlich. “Wir haben es wirklich besser.”
Wie froh war ich nun! Verstohlen drückte ich ihre Hand, während wir in dem hereinbrechenden Dunkel warteten.
2
Wir übernachteten in mehreren großen Notbehausungen mit offenen Eingängen und Lehmfußböden. Ich hatte einen unruhigen Schlaf. Es war warm, unbequem und sehr eng. Die ganze Zeit hatte ich das Empfinden, als ob Käfer und Wanzen über meinen ganzen Körper krochen; es muss aber nur Einbildung gewesen sein, denn ich konnte sie nicht verscheuchen.
Noch vor Sonnenaufgang erwachte ich. Augenblicklich munter, griff ich gleich nach meinen Kleidern im Gepäck und kleidete mich an, so schnell das unter der Bettdecke möglich war. Dann schlich ich mich auf Zehenspitzen hinaus, um Mutter und Schwester nicht zu stören.
Draußen war es kühl und erfrischend. Meine Freude und Unternehmungslust hatte sich noch nicht gelegt. Wir waren im Chaco; heute wollten wir ins Innere dieses Landstrichs fahren. Bald würden wir wieder ein Dach über dem Kopf haben, das Land bearbeiten und zu Hause sein dürfen.
Papa war auch schon auf; er saß auf einer roh gezimmerten Bank ohne Lehne. Sein Kopf war nach vorne gebeugt und er starrte vor sich hin auf den Boden. Einen Augenblick lang beobachtete ich ihn wortlos. Mein Vater war von hoher, hagerer Gestalt. Kopf, Arme, Körper alle Glieder waren lang und schmal. Seine Gewohnheit, die Schultern leicht nach vorne zu drücken, wie auch sein volles, immer noch dunkles Haar, ließen seine Körperlänge nur stärker hervortreten.
Eigentlich war ich nicht überrascht, ihn zu sehen, denn Papa war, wie ich, Frühaufsteher. Aber in diesem Augenblick war ich etwas bestürzt; ich musste an seine Worte vom vorigen Abend denken. Wir hatten seither noch kein Wort miteinander gesprochen. Aber jetzt konnte ich ihm kaum ausweichen, und so ging ich auf ihn zu.
“Guten Morgen, Papa”, sagte ich.
“Anna! Ja, guten Morgen!” Jetzt hob er seinen Kopf und schaute mich an. “Setz dich, Kind.” Ich gehorchte ihm. Dann schauten wir uns beide den Sonnenaufgang an. Sehr rasch erhob sich Sonne über den Horizont, etwa so, wie ein fleißiger Bauer an seine Arbeit geht.
“Hast du gemerkt, wie schnell die Sonne hier auf- und niedergeht?” fragte er plötzlich. “Hast du gemerkt, dass der abnehmende und zunehmende Mond hier umgekehrt am Himmel steht? Weißt du, dass wir hier im Sommer Weihnachten feiern?”
Er erwartete keine Antwort. Seine Fragen waren Feststellungen.
Wieder beugte er sich nach vorne und wollte mit dem Finger ein Zeichen auf der Erde machen. Diese war aber zu hart, um seinem Finger nachzugeben. Dann ging Vater nach einem kleinen stacheligen Busch und brach einen kleinen Ast los. Mit diesem konnte er ein Dreieck auf dem harten Boden zeichnen. Mit dem kleinen Ast zeigte er nun auf die rechte Seite seiner Skizze.
“Dieses Dreieck”, so erklärte er mir nun umständlich, “mit der breiten Seite im Norden ist der Teil des Chaco‘s, der in Paraguay liegt. Oben ist Bolivien, links und rechts Argentinien und Brasilien.” Er zeigte auf die drei Nachbarländer Paraguays. “Wir sind flussaufwärts gekommen und befinden uns nun hier bei diesem Hafen, Puerto Casado. Auf dieser Schmalspurbahn fahren wir in das Innere des Landes.” Dabei machte Papa einen geraden Strich in den Westen. Dann bewegte sich sein Finger noch etwas weiter in den Westen. “Hier haben die Kanadier angesiedelt, weißt du die Mennoniten aus Kanada. Im Norden und Westen ihrer Ansiedlung ist unser Land.”
Vater ließ den kleinen Ast, mit dem er die Zeichnung gemacht hatte, nun fallen, setzte sich wieder aufrecht hin und sprach weiter.
“Im Vergleich zum ganzen Chaco ist diese Hafenstadt wie ein Saatkorn neben einem großen Baum. So klein; und auch so unähnlich. Ich habe noch nichts mehr als du gesehen, aber so viel weiß ich.”
Ich nickte nur. Obwohl ich nicht alles begriffen hatte, wusste ich, dass diese Erklärung versöhnlich gemeint war. Papa war streng und konnte auch manchmal heftig werden, aber er hatte mich gern. Ich war die Jüngste, sein Liebling. Aber seine Ansicht über den Chaco was dieselbe geblieben.
“Der Chaco ist nicht schön, Anna”, warnte er mich noch einmal. “Es ist kindisch, so zu reden.”
“Ja, Papa.”
Ich schaute nun wieder auf Papas Skizze auf der harten Erde und versuchte, sie zu behalten und zu verstehen. Gerade in dem Augenblick wurden wir von einem Nachbarn, Johann Walde, unterbrochen. Er und Papa begrüßten sich, und ohne weiteres setzte er sich zwischen uns beiden. Ich bot ihm einen höflichen Guten Morgen, aber er antwortete nicht darauf und fuhr nur mit seiner Unterhaltung mit Papa fort.
Walde, wie ihn jedermann nannte, etwa 25–30 jährig und von mittlerem Wuchs, hatte ein anziehendes Gesicht und ein gewinnendes Lächeln. Seine Nähe war mir zwar etwas ungemütlich, aber ich blieb sitzen.
Johann Walde und seine Frau Leni kamen aus derselben Gegend wie wir, Orenburg, obwohl wir sie drüben nicht gekannt hatten. Erst im Lager in Deutschland hatten Papa und Walde sich kennengelernt. Als sie dann erfuhren, dass sie in demselben Dorf ansiedeln sollten, waren sie trotz ihres Altersunterschiedes gute Freunde geworden. Diese Freundschaft war auf der langen Reise befestigt worden. Er sprach viel mehr als Papa, und zuweilen hatte ich den Verdacht, dass er Papa bevormunden wollte, obwohl er immer den guten Ton wahrte und höflich blieb. Aber Mama konnte ihm nicht recht trauen: “In jede Unterhaltung mischt er sich ein, ob er dazu aufgefordert wird oder nicht”, klagte sie einmal. “Dann wiederholt jedermann, was er gesagt hat, als ob er alles weiß!”
“Er weiß ja auch sehr viel”, entgegnete ich. “Jedenfalls gibt Papa sehr viel auf seine Ansichten.”
Johannes Frau, Leni, war noch sehr jung; ihr Gesicht trug aber schon die Spuren eines schweren Schicksals. Sie hatte drei kleine Mädels, kaum zehn Monate auseinander. Das jüngste Kind war ständig auf ihrem Arm. Es war ein herziges Mädchen, und mir schien es so, als müsste die Mutter es öfter liebkosen, statt immer nur über die Last zu klagen.
“Sie erwartet ihr viertes Kind!” In den Augen meiner Mutter erklärte das alles.
Erst nachdem wir hier angekommen waren, hatte Leni zum ersten Mal zu mir gesprochen: “Endlich sind wir angekommen”, hatte sie erleichtert gesagt. “Wie froh bin ich, dass keines meiner Kleinen in den Ozean gefallen oder in diesen elenden Fluss gesprungen ist!” Ganz überrascht war ich gewesen. Wer hätte in ihr diesen Sinn für Humor vermutet?
Ich musste jetzt an ihre Worte denken. Dann hörte ich wieder Johann sprechen, klug und überlegen. Recht stolz war ich, mit ihm und Papa auf einer Bank zu sitzen und Leni als Freundin zu haben.
“Ja”, sagte Johann eben, “die erste Gruppe kam hier am letzten Tag des Jahres 1926 an. Es war die heißeste Jahreszeit. Im Ganzen kamen 1770 Personen aus Kanada von der kanadischen Prärie nach diesem ‘Juwel des Südens’. Kannst du dir das vorstellen?”
Sie sprachen natürlich von den kanadischen Mennoniten, die vor vier Jahren in den Chaco gezogen waren. Ihre Eltern hatten Russland in den 1870er Jahren verlassen, weil sie unter sich bleiben wollten. Als dann ihre Privilegien in Kanada bedroht und beschränkt wurden, suchten sie ein anderes Asyl.
“Man sagt, ihre Schulfreiheiten seien beeinträchtigt worden”, sagte Johann. “Man wollte sie zwingen, die deutsche Sprache als Unterrichtssprache aufzugeben.”
“Für uns ist es jedenfalls gut, dass sie hier sind”, sagte Papa. In Gedanken verloren, löschte er mit dem Schuh seine Chacokarte aus.
“Wenn sie nicht eingewandert wären, wäre doch kein Mensch auf den Gedanken gekommen, hier anzusiedeln!”
“Ganz bestimmt nicht!”
“Nun, jede Sache hat eben ihre zwei Seiten”, meinte Johann, als ob er diese Weisheit erstmalig entdeckt hatte.
Mit einem Murmeln stimmte Papa ihm bei. Dann saßen die zwei ohne weitere Worte da. Schon wärmte die Sonne die Morgenluft. In den Notbauten fing es an geschäftig zuzugehen. Leute standen auf; in her Nähe machten einige Frauen ein Feuer, um Frühstück zu bereiten. Kleine Rauchzünglein erhoben sich in der Morgenluft, verschwanden wieder und ließen nur den angenehmen Geruch zurück.
“Nun, wir können den Kanadiern für das Privilegium danken, dass sie bei der paraguayischen Regierung ausgewirkt haben. Wir dürfen unsere eigenen Schulen haben, Religionsfreiheit, Befreiung vom Militärdienst für ewige Zeiten. Es gibt nicht mehr viele Regierungen, die solche Versprechungen machen.”
“Versprechungen können auch gebrochen werden”, sagte Papa mit einem Zug der Bitterkeit.
“Das schon”, gab Walde zu, “aber hör einmal, Abram, Paraguay wird dieses Versprechen nicht so bald brechen. Das Land braucht uns. Wir haben doch gesehen, wie arm es ist. Man braucht uns hier!”
“Wir sind ja auch arm”, entgegnete Papa.
“Ja, aber wir verstehen zu arbeiten! Obwohl die Paraguayer uns keine Hilfe zum Anfang bieten, werden wir ihnen nach Jahr und Tag helfen müssen. Du wirst es schon sehen!”
“Mag sein, mag schon sein! Aber ich bin 63 Jahre alt. Zum Neuanfang ist das zu alt. Und dazu ohne mein Söhne.”
“Du hast doch den Klaus”, entgegnete Johann.
“Ja, den Klaus!” lachte Papa bitter. Johann lachte mit ihm.
Meine fünf Brüder waren des Vaters Stolz gewesen. In seinen Augen war der Schwiegersohn nichts im Vergleich mit ihnen. Klaus war kein Bauer. Sein Vater war in Orenburg “Lauftje” Besitzer gewesen. Klaus selber hatte nur Büroarbeit getan. Es war durchaus fraglich, ob er sich je mit dem Bauernberuf abfinden würde.
“Ich bin zu alt, um ohne Söhne einen Neuanfang zu machen”, klagte Papa, fast wie hilfesuchend.
“Ich bin ja da, Papa!” rief ich aus, die beiden Männer zum ersten Mal unterbrechend.
“Ja, du hast ja die Anna”, fiel Walde ihm ins Wort, als ob er mich eben erst gesehen hätte. “So ein Fräulein wiegt wenigstens einen, wenn nicht zwei Söhne auf.” Er lächelte mich an.
“Es ist hier immer noch besser als in Russland”, sagte ich zu Walde.
“Recht hast du, ganz recht”, entgegnete Johann. “Wir sind aus einer Hölle befreit worden.” Er stand auf.
Ja, es war die Wahrheit. Unsere Ausreise war ein Wunder gewesen.
Warum klang Johanns Lachen denn so zynisch? Spottete er über mich?
3
Nach kurzem Aufenthalt in Puerto Casado ging unsere Reise weiter - zunächst auf der langsamen und primitiven Schmalspurbahn der Tannin Gesellschaft - die uns bis ins Innere des Chaco bringen sollte, von wo die Gesellschaft ihr rotes Quebracho Holz bezog, aus dem sie das Tannin, die wertvolle Gerbsäure, barg.
Für mich war diese Zugfahrt befremdend. Es ging über Märsche, die entweder mit Schilf und Rohr oder hier und da mit Palmen bewachsen waren. Die Schmalspurbahn durchschnitt diese Märsche, so dass wir die feuchte, grüne Welt an allen Seiten hatten. Ich aber hatte das Empfinden, als ob ich die ganze Landschaft entweder von der Höhe eines Berges oder aus großer Entfernung sah. Sie schien gar nichts mit mir zu tun zu haben. Und doch erweckte sie irgendwie meine Neugierde und mein Sehnen.
Die Palmen waren von unterschiedlichem Alter und verschiedener Größe. Da waren ganz junge Schösslinge, kaum über das Schilfgras hervorguckend und große herrliche Baum Riesen. Ganz oben war das Laub, oben grün und unten braun. Scheinbar wächst die Palme, indem sie die unteren Äste mit dem Laub absterben lässt und allen Nährstoff in den Stamm treibt.
Fremdartige aber wunderschöne Wasservögel erhoben sich aus den Märschen mit graziöser, scheinbar müheloser Bewegung ihrer Schwingen. Ich hielt meinen Atem an, während sie sich in die Luft hoben. Was hatte sie erschreckt? Was bedeuteten ihre geheimnisvollen Rufe?
Ach könnte ich doch ein schneeweißer Reiher sein! Dann könnte ich den Chaco von oben sehen, den ganzen Chaco, statt nur diesen kleinen Teil, durch den unser Zug sich langsam hindurch schlängelte.
“Auf Wiedersehen!” würde ich dann den anderen zurückrufen, “ich werde auf euch warten!”
Vielleicht würden die anderen mitfliegen wollen. Ach dass wir doch alle fliegen könnten! Ich versuchte es mir vorzustellen, wie die Männer aus den offenen Gepäckwagen auf einmal fliegend den Zug verlassen würden, und wie sie majestätisch der neuen Siedlung zu schwebten. Die Frauen und Kinder würden ihnen dann nachfolgen -Klaus, Maria, Mama…
Leise musste ich lachen. Was für ein abenteuerlicher Gedanke!
Dann musste ich daran denken, was Johann Walde uns über den Entdeckungsreisenden, Fred Engen, erzählt hatte. Herr Engen arbeitete für die Firma McRoberts in New York, die den kanadischen Mennoniten die Ansiedlung im Chaco ermöglicht hatte.
“Engen bestand darauf, in das Innere des Chaco zu dringen”, hatte Walde erzählt, um festzustellen, ob er besiedelbar sei. Er war begeistert von dem Gedanken hier einen friedfertigen Staat zu gründen. Es gelang ihm, den Weg durch die Märsche zu finden und bis zu den Grascampos zu gelangen. Dieses Areal müsste zur Landwirtschaft geeignet sein.”
“Als er dann nach Asuncion zurückkam, berichtete er seiner Firma: ‘Ich habe das verheißende Lande gefunden!”
Dieser Herr Engen hat seine Bibel gekannt, dachte ich bei mir selber. Er hat etwas über den Jordan, das auserwählte Volk und das verheißene Land gewusst. Leise wiederholte ich zu mir selber: “Ich habe das verheißene Land gefunden.”
Aber vielleicht hat der Engen auch nur sagen wollen, dass er seine ihm gestellte Aufgabe erfüllt hatte.
Was könnte er wohl gemeint haben?
Das hatte Johann Walde nicht weiter erklärt. Er hatte aber die Geschichte weiter erzählt. Eines hatte dem anderen die Hand gereicht, und nun seien wir hier als Folge der Entdeckungsreise des Fred Engen. Hier auf diesem Zug durch die Chacomärsche mit einer Geschwindigkeit kaum schneller als der rüstige Gang eins Mannes!
“Ich würde schon lieber zu Fuß gehen”, sagte jemand von den Unseren, “ich hätte dabei wenigstens etwas zu tun!”
Es würde wärmer. Unsere Leute wurden stiller. Kaum war man noch zu Späßen und Witzen aufgelegt. Meine Hände waren feucht und mein ganzer Körper triefte vor Schweiß. Ich trocknete meine Stirn, ich schlug nach den Fliegen, ich war erschöpft. Nur mit Mühe konnte ich meine Augen offen halten; die grüne Landschaft fing an, auf meine Nerven zu gehen. Ich hatte genug gesehen. Schon schien es mir, dass ich mein ganzes Leben lang nur den Chacobusch vor Augen gehabt hatte. Schon wurde ich ungeduldig auf ein Eckchen, das etwas anders aussehen möchte.
Dabei ertappte ich mich bei meinem ersten Zweifel über dieses ganze Unternehmen. Wie eine Versuchung oder eine Anfechtung trieb er mich um. Noch gestern hatte ich mich so gefreut, hatte so hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt. Jetzt hatte ich das Empfinden, als ob sich gar nichts geändert hatte. Wir waren nur noch eine Gruppe heimatloser Flüchtlinge auf der Suche nach einem Zuhause. Zuhause! Fast hatte ich schon vergessen, was das bedeutete.
Müde schloss ich meine Augen. Bald müssten wir doch einen Bahnhof erreichen. Dort versteckt im frostigen Nebel mit dem beschnurrbarten, stampfenden russischen Beamten, uns argwöhnisch betrachtend und barsch ausfragend…
Ich schnellte in die Höhe und riss meine Augen auf. Da sah ich wieder nur den grünen Busch in der heißen Chacosonne, den blassblauen Himmel und die schwirrenden Fliegen. Erleichtert atmete ich auf.
Aber meine Augen fielen doch wieder zu. Wieder kam der Traum vom Schnee und den russischen Beamten. Leise betete ich: “Ach Gott erbarme dich unser! Hilf uns! Sei uns gnädig! Erhöre uns! Ich darf nicht aufhören mit Beten.”
Wieder erwachte ich mit einem Ruck. Nein, hier brauchten wir uns nicht zu fürchten. Man hatte uns doch nach Paraguay eingeladen. Nein, auf diesem langsamen Zug durch die Chacowildnis brauchten wir nicht um Bewahrung zu beten. Gott hatte unser Gebet doch erhört. Ich konnte die Augen ruhig schließen und mich an Mama oder Maria lehnen…
Als ich wieder wach war, waren wir auf einem der Chacocampos. Campo ist das spanische Wort für eine Landebene. Hier war sie wie ein Park, der uns bewillkommnen wollte.
O wie schön! dachte ich.
Dann fiel mir ein, was Papa gesagt hatte: “Schön ist ein Wort für Kinder!”
“Ich werde es nicht sagen”, nahm ich mir vor, “aber Papa kann ja mir das Denken nicht verbieten!”
Und was waren das für Tiere, die flink wie ein Pferd von Baum zu Baum liefen? Zweibeinig mit langen Hälsen und langen Beinen?
Strauße! Ganz neu war mir das Wort; ganz neu vor allen Dingen diese seltsamen Vögel, die nicht fliegen aber wie der Wind laufen konnten. Es schien als ob sie den Wind auf der Ebene verursachten. Wieder schloss ich meine Augen, um mir das Bild zu verinnerlichen, aber auch um meine Tränen zurückzuhalten.
4
Endlich erreichten wir die Endstation. Weiter reichte die Schmalspurbahn nicht. Von hier sollten uns die Kanadier abholen. Sie warteten schon auf uns, barfuß mit breitrandigen Strohhüten, auf ihren Wagen mit Ochsengespannen. Mehrere Tagereisen entfernt war unser Ansiedlungsplatz. Noch tiefer in den Chaco sollte unsere Reise westwärts gehen.
Jede Stunde jedes Tages sollte uns nun näher zu unserer neuen Heimat bringen. Die Fahrstraße war lediglich eine zweispurige Schneise durch den Busch. So langsam ging die Fahrt, dass es mir so war, als machten wir gar keinen Fortschritt.
Aber die Landschaft hatte sich verändert. Ein dichter grau-grüner Dornbusch umgab uns hier. Kaum konnte man dieses Gebüsch einen “Wald” nennen. Unsere Vorstellungen von einem Wald waren aus Europa. Hohe Bäume, kühle Schatten und geheimnisvolle Weiten hatten dort den Wald gekennzeichnet. Nein, dieses war kein Wald. Hier genügte der Name “Busch” vollkommen. Zudem war er außerordentlich trocken.
Aus einer gewissen Entfernung erweckte dieser Busch den Eindruck einer verwirrten Masse von Dornen, Zwergbäumen und Kakteen. Aus der Nähe freilich merkten wir einen geradezu verwirrenden Reichtum von Gattungen. Alle Pflanzen waren dem schweren Boden, der subtropischen Hitze und den sehr wechselhaften Niederschlägen angepasst. Alle Pflanzen schienen durch Ranken miteinander verwoben zu sein.
Johann Walde war wieder einmal der “Allwissende.” Alles konnte er erklären, während wir qualvoll langsam durch den Busch schaukelten. “Ist es nicht merkwürdig, wie viel Staub die langsamen Ochsen aufwirbeln können?” bemerkte er bei einer Gelegenheit. Er hatte recht. Der Staub blieb in der Luft hängen, und wir mussten mitten durch die Staubwolken, die immer wieder Husten Salven verursachten.
Viel wollten unsere Leute von den Kanadiern wissen. Immer wieder fragten sie unseren Fahrer, Martin Toews, über die Witterungsverhältnisse, Niederschlagsmengen und dergleichen. Man wollte vieles über die Aussaaten wissen, die hier gediehen. Mama wollte wissen, ob man hier Hühner und Schweine halten könne, ob es hier Gärten und Obstbäume gäbe. Der etwas schweigsame Toews antwortete geduldig und vorsichtig, gab aber ohne Fragen keine Auskunft über unsere neue Heimat.
Für mich waren die Unterhaltungen von zweitrangigem Wert. Ich beschäftige mich mit meinen Gedanken und mit dem, was ich vor mir sah. Ich vertraute meinen Eltern und versuchte, mir selber ein Bild unseres zukünftigen Lebens zu machen. So vieles hatte sich schon verändert, seit wir bei Puerto Casado landeten. Die Veränderungen waren aber so langsam gekommen, dass ich die Variationen kaum noch behalten hatte. Schon hatte ich vergessen, wie der Hafen ausgesehen hatte.
Endlos schien unsere Fahrt zu sein. Immer wieder mussten wir Halt machen. Die Ochsen mussten trinken, grasen. Wir mussten essen und schlafen, und wieder essen und schlafen. Beim Sonnenuntergang hatte ich den Eindruck, dass wir im Laufe des Tages kaum einen Schritt vorwärts gekommen wären. Unser Nachtlager schien dasselbe zu sein, das wir am Morgen verlassen hatten.
Ab und zu durchfuhren wir einen Campo, völlig menschenleer, aber wir fuhren weiter. Wir könnten ja hier bleiben und dieses Land bearbeiten, dachte ich dann, aber die Wagen rollten weiter. Warum mussten wir so weit ab ansiedeln?
Die scheinbar stillstehende Sonne und die äußerst langsame Ochsen wollten mir fast den Glauben an eine etwaige Ankunft rauben. Alles blieb dasselbe! Keine besonderen Erkennungszeichen konnten wir finden. Nichts war uns bekannt; Nichts kannten wir bei Namen. Nur der staubige Krüppelbusch verbarg den Horizont. Darbende Zwergbäume spotteten meiner. Vögel schrien heiser. Ich habe keinen Vogel singen hören.
5
Wilhelm Fröse‘s Unterhaltung interessierte mich zunächst nicht im Geringsten; nur allzu bekannt war mir das Gesprächsthema schon. Immer wieder drehte sich die Unterhaltung der Männer um die Erfahrungen des letzten Jahrzehnts in Russland. Es war wie bei einem Dorfs Brunnen: Immer wieder konnte man aus den jüngsten Erfahrungen schöpfen, und nie wurde der Inhalt erschöpft. Am Abend beim Lagerfeuer; am Tage bei den vielen Stunden des erzwungenen Nichtstuns - immer wieder kam man zurück auf das Furchtbare, das Schwere, das sie aus der Heimat vertrieben hatte. Natürlich konnte man dabei ausgiebig auch die entferntesten Verwandtschaftsgrade “nachfädmen”, so dass die Geschichte jedes Einzelnen zur gemeinsamen Erfahrung aller wurde.
Mich fesselten vielmehr Fröse‘s große, stark hervorstehende Ohren. Wenn er sprach oder gestikulierte, bewegten sie sich kaum, sondern standen steif, als ob sie Wachtposten wären. Seine Tochter Susi, ein Jahr älter als ich, hatte diesen Körperzug von ihrem Vater geerbt. Aber sie konnte ihn mit ihrem langen Haar bedecken, indem sie es straff über die Ohren zog und es hinten zu einem festen Schopf zusammenzog. Nur eine kleine Wölbung an jeder Seite ihres Kopfes verriet das Erbe des Vaters. Ich hatte mir keine besondere Mühe gemacht, mich mit Susi zu befreunden. Sie war zu still und zurückgezogen für meinen Geschmack.
Aber gerade an diesem Tag war mir ihr älterer Bruder Hans aufgefallen. Bis dahin hatte ich kaum auf Jungen Acht gegeben. Wie Vögel von Baum zu Baum flattern, so ging es mir mit Jungen. Auf den Hans wurde ich erst aufmerksam, als ich merkte, mit welchem Geschick und welcher Leichtigkeit er vom Wagen gesprungen war. Er gefiel mir ganz gut, und ich hätte gerne gewusst, was er von mir dachte. Nicht dass er mich ansprechen würde; die ganze Familie war schüchtern und zurückgezogen die Eltern und auch die Kinder, Hans, Kornelius, Susi, Greta und die drei jüngsten Kinder. So kam es mir ganz unerwartet, dass Fröse auf einmal ins Erzählen geraten war. Ich hörte eigentlich nur hin, weil der Hans mich in dem Moment interessierte.