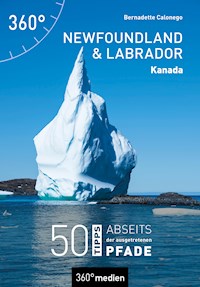5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sonja braucht endlich Klarheit. Was passierte wirklich, als ihr Mann vor drei Jahren mit einem Wasserflugzeug in Kanada abstürzte? Was verschweigt ihr die Polizei? Und warum ist auch ihre beste Freundin seitdem verschwunden? So kommt es ihr ganz recht, dass sie im Auftrag ihres Museums nach British Columbia reisen muss: Auf den Spuren der Dichterin Else Seel und zugleich getrieben von Trauer und Eifersucht begibt sich Sonja auf eine gefährliche Abenteuerreise durch das Land.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Für meine Mutter
ISBN 978-3-492-98176-7 © für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © 2007 Berlin Verlag GmbH, Berlin Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © frantisekhojdysz/shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Prolog
Jetzt war er mitten drin. Seine Beaver sackte plötzlich ab. Als ob Blei darauf läge. Dann bäumte sie sich auf wie ein verzweifelter Mustang. Ein wildes Rütteln und Schütteln.
Dazu dieser Regen. Eine graue Wand und dahinter nichts.
Der Ozean war viel zu nah.
Nur nicht in dieser Scheiße abstürzen.
Er zog die Beaver hoch. Das Wasserflugzeug vibrierte wie ein Pressluftbohrer.
Er hatte schon viel erlebt, war schon durch schreckliche Böen geritten, nur eine Haaresbreite von der Katastrophe entfernt. Aber heute – das war vom Schlimmsten, ein Albtraum.
Sein Adrenalinspiegel schoss hoch. Nur nicht in diesem Inferno untergehen.
Nicht er.
Er kam immer davon. Er kannte die Höllenkessel, wo sich die Winde ineinander verbissen wie tollwütige Hunde. Er kannte den Nebel, der sich anschlich und dann jäh alles verschluckte. Aber am besten kannte er sich selbst.
Er konnte abbrechen, wenn es sein musste. Er konnte sich zurückhalten mit der Maschine, am Boden bleiben. Er hörte auf sein Gefühl, wenn es sagte: Mit diesem Sturm legst du dich nicht an. Der ist stärker als du. Der radiert dich und die Beaver aus, in Sekundenschnelle.
»GQC an JPX … Verdammtes Karussell, so ein verdammtes Karussell, sag ich dir, da kommt keiner durch.« Die Stimme kam aus dem Kopfhörer. »Ich geh zurück durch den Otter-Kanal und dann bei Pitt Island außen rum.«
Noch eine Beaver da draußen. Noch so ein Verrückter, der sein Leben aufs Spiel setzte.
Er blickte auf den Schirm seines Global Positioning System. Gelbes Land, blaues Wasser.
»JPX an GQC … Okay … Ich versuche es durch den Grenville-Kanal, obwohl es von hier aus wie ein fieser Brei ausschaut.« Ruheloses Knistern in der Hörmuschel. Dann wieder die Stimme.
»Ich hab ein ziemlich starkes ELT-Signal hier.«
Auch er konnte das Funknotrufgerät der Unglücksmaschine hören, noch schwach zwar, aber unaufhörlich.
»Wo bist du jetzt?«, fragte er.
»Ich stecke etwa auf der halben Höhe von McCaulley Island, zwischen Hevnor Inlet und Newcombe Harbour. Es ist wie in einer Waschmaschine hier, verdammt starker Wind.«
»Okay. Ich hab’s nicht durch den Grenville-Kanal geschafft, ich musste hinten rum und dir nach. Meld dich sofort, wenn du was siehst.«
»…’kay.«
Die Beaver tanzte. Ein Tanz mit dem Teufel. Die Maschine konnte keine Höhe gewinnen. Er beschleunigte.
Du willst doch nicht baden gehen, kleine Schnecke. Halt dich gerade. Halt dich schön gerade. Das Wasser da unten ist kalt wie gefrorener Stahl. In zwei Minuten stockt das Blut, in zehn Minuten schreit das Herz um Hilfe. In neunzig Minuten ist alles aus.
Der andere Pilot donnerte Worte in seinen Kopfhörer.
»Ich bin nah dran, das ELT heult wie eine Hyäne. Meine Niere sagt mir, dass es irgendwo da unten ist. Dieses Loch saugt alles nach unten.«
»…’kay.«
Die meisten ertrinken, gefangen im Wrack. Er hatte es oft erlebt. Wenn sie sich nicht noch ein Bein gebrochen haben oder den Rücken. Den Schädel eingedrückt. Blut, das rausquillt.
»Ich seh was!« Der Schrei ließ ihn zusammenzucken. »Wrack im Wasser, direkt vor Captains Cove. Ich guck mal, ob ich wassern kann und reinmanövrieren.«
»Siehst du Leute im Wasser?«
»Ich werd total gehämmert, schwer zu sagen von hier aus. Ich geb dir Bescheid, ob ich wassern kann.«
Ein Knattern im Kopfhörer, dann wieder ein Schrei.
»Heiliger Josef, da ist was vor mir!«
»Kannst du tiefer gehen?«
»Ich bin schon tief, verdammt tief.«
»Flieg nicht zu langsam, hörst du?«
Der soll bloß aufpassen. Sonst landet er auch im Wasser.
»… da sind sie! Madonna! Da sind sie! Ich kann sie sehen, Mann!«
»Was kannst du sehen?«
»… die Maschine … auseinandergebrochen, alles auseinandergebrochen. Mannomann!«
»Siehst du Menschen?«
»Ich muss nach unten, Mann, ich muss nach unten.«
»Ist die See nicht zu wild? Ich seh Wellen.«
»Ich glaub, ich schaff’s.«
»Vorsichtig, hörst du, vorsichtig!«
Die Stimme blieb weg. Er wartete.
Hoffentlich dreht er nicht durch. Bei dem, was er sieht. Hoffentlich behält er die Nerven.
Der andere Pilot war gut, das wusste er. Fast so gut wie er selbst. Siebentausend Flugstunden auf dem Buckel. Die meisten zwischen Alaska und Prince Rupert. Diese Küste war eine Todesfalle. Eine Todesfalle für schlechte Piloten.
»Ich bin unten, Mann, ich bin unten. Ich hab in Captains Cove gewassert und bin jetzt nah dran. Ein Schwimmer liegt vertikal auf dem Wasser, ich glaub, da hängt jemand dran.«
Die Stimme war aufgeweicht, als hätten die Stimmbänder zu lange im Wasser gelegen.
»Gut gemacht, ich bin gleich da.«
»… Jeff steigt jetzt aus und klettert rüber.«
Er hatte also einen Mann mitgenommen. Warum sagte er ihm das erst jetzt? Egal. Jede Hand zählte. Vor allem, wenn die See immer noch so rollte. Er selbst wollte keinen mitnehmen, keinen in Gefahr bringen.
»… oh mein Gott!«
»Was ist los?«
»Die sind tot, Mann, die sind alle tot!«
»Tot oder bewusstlos? Könnt ihr das sehen?«
»Mausetot, Mann. Alle mausetot.«
Er blieb ruhig. Musste ruhig bleiben.
Er schaute auf sein GPS. Ihn trennten noch wenige Minuten von der Unglücksstelle.
»Ich bin gleich da. Wartet, bis ich komme.«
Der Wind erschlaffte plötzlich, als hätte er sich endgültig ausgetobt.
Da sah er sie. Die Beaver seines Kumpels. Sie dümpelte wie eine Plastikente in der Badewanne. Dann sah er die andere Maschine daneben. Ein geknickter Flügel. Das Cockpit in Schräglage. Ein regloser Körper auf dem linken Schwimmer, die Beine im Wasser.
Er brüllte ins Mikrophon.
»Kannst du mich sehen? Ich komme runter. Kannst du mich sehen?«
Keine Antwort.
Er setzte zur Wasserung an. Da schrie die Stimme im Kopfhörer auf.
»… Himmel! Der lebt! Einer bewegt sich! Der lebt!«
Er konzentrierte sich auf die Wasserung. Er hielt die Beaver fest unter Kontrolle. Komm schon, kleine Schnecke. Komm, komm.
Er musste bei leichtem Seitenwind wassern, parallel zu den Wellen. Da vorne war eine ruhige Stelle. Die Schwimmer klatschten aufs Wasser.
Als er auf die beiden Maschinen zuglitt, hatte er nur einen Gedanken.
Hoffentlich lebt der Richtige.
1
Drogen. Sie sah den Grenzbeamten an und wusste gleich: Das ist es, was er jetzt denkt. Drogen.
Ihre Augen waren so glasig wie bei einem Yuppie auf Koks. Das war immer so, wenn die Allergie zuschlug. Eine ihrer Allergien. Das Gesicht, ihr ganzer Körper fühlte sich schweißbedeckt an, und ihr Kopf dröhnte.
Der Beamte war jung, und er musterte sie mit unverhohlenem Misstrauen.
Sie hatte sich vor dem Zwölfstundenflug von Zürich über Toronto nach Vancouver so mit Anti-Allergie-Mitteln vollgepumpt, dass sie jetzt sicher schwankte wie ein Sumo-Ringer. Wenn dieser Beamte sie doch bloß rasch durchwinkte. Eine Allergieattacke war an sich schon schlimm genug. Kombiniert mit Übermüdung war sie ein Albtraum.
Der junge Mann schaute in ihren Schweizer Pass, dann in ihr rot glänzendes Gesicht. Er tippte Daten in den Computer und wartete. Dann wies er sie knapp an, zum Büro der Einwanderungsbehörde zu gehen. Sein Arm zeigte auf die rechte Seite, dort, wo bereits eine Schlange von Menschen mit Gepäck wartete.
Das war es also: Sie galt als verdächtig. Eigentlich hätte sie es wissen müssen. Schon immer hatte man es ihr ansehen können, wenn sie ein Geheimnis verbarg.
In der Gruppe, der sie sich nun anschloss, war sie die einzige Weiße. Männer mit Turbanen, Frauen in schimmernden Saris, asiatische und schwarze Gesichter, dazwischen eine Schar Kinder, die weder quengelten noch versuchten, die Abschrankung mit den beweglichen Sockeln umzustürzen. Kinder, denen man den Ernst der Situation nicht erst erklären musste.
Sonja setzte sich neben eine Frau, deren Sari so blau war wie der Pazifische Ozean, den sie vom Flugzeug aus gesehen hatte. Die werden mich nie herein lassen, dachte sie. Sie werden alles herausfinden und mich zurückschicken. Oder mich gleich verhaften.
»Passagiere aus Europa?«
In einiger Entfernung stand eine Beamtin und sah sich suchend um. Sonja erhob sich und folgte ihr zum Ende eines Korridors, Rucksack und Koffer auf dem Gepäckwagen.
»Warten Sie hier«, sagte die Beamtin freundlich. Sonja stellte sich folgsam vor den Schalter. Kurze Zeit später erschien dahinter ein Mann.
»Kann ich Ihre Reisedokumente sehen?«
Während er die Papiere in Empfang nahm, sah er sie aufmerksam an.
Er kann meine Angst riechen.
Ja, Mister, es ist die pure Angst, die Sie riechen. Schauen Sie mich nur an. Ich habe Angst vor diesem unbekannten Land. Angst vor dem, was ich hier entdecken könnte. Noch mehr Angst, ich könnte nichts entdecken.
»Sonja Werner.« Ihr Name hörte sich seltsam mit diesem kanadischen Akzent an. »Sie wollen also hier arbeiten?«
»Nein, ich will nicht arbeiten, ich möchte nur ein paar Recherchen für ein Schweizer Museum machen, für eine Ausstellung«, sagte sie mit belegter Stimme. »Ich bin Historikerin«, fügte sie rasch hinzu.
Er musste alles in den Dokumenten gelesen haben, die sie ihm rübergeschoben hatte, in den Genehmigungen und Empfehlungsschreiben. Aber er wollte sie sicher testen, Widersprüche aus ihr herauslocken.
»Worüber forschen Sie denn?«
»Über eine deutsche Dichterin, Else Lübcke Seel. Sie ist 1927 von Berlin nach Kanada ausgewandert. Ich möchte Leute befragen, die Else Seel gekannt haben.«
Diese Erklärung kam ihr locker über die Lippen, dutzendfach in Gedanken geübt. Ihr Englisch war gut, sie hatte zwei Jahre in London studiert.
»Wo hat denn diese Dichterin gelebt?« Er schien interessiert.
»Im Norden von British Columbia, in der Nähe von Burns Lake. Sie hat einen Trapper geheiratet und mit ihm in der Wildnis eine Blockhütte geteilt.«
»Burns Lake. Wollen Sie da ganz allein hinreisen?«
Sonja sah ihn unschlüssig an. War das eine der Fangfragen, vor denen sie gewarnt worden war? War es verdächtig, allein zu reisen?
»Ich habe eine Bekannte in Vancouver, die mich begleiten wird.« Sie versuchte, trotz der Lüge ganz unbefangen zu klingen.
Der Beamte legte ihr einen Zettel hin. »Schreiben Sie doch bitte den Namen der Bekannten und die Adresse und Telefonnummer auf.«
Sie kramte ihr Adressbuch aus dem Rucksack und notierte die Anschrift von Diane Kesowsky.
»Sie sind also Deutsche, aus Berlin?«
Warum fragte er das, er hatte doch ihren Pass gesehen.
»Nein, ich bin Schweizerin, aber das Museum, in dem ich arbeite, liegt an der Grenze zu Deutschland, wir haben viele deutsche Besucher.«
War ihr die Nervosität anzuhören? Sie konnte sich nicht vorstellen, dass dieser junge Mann die europäische Landkarte im Detail kannte. Er wollte sie sicher nur testen, beobachtete ihre Körpersprache.
Sie musste Diane unbedingt eintrichtern, dass sie nun bei den Behörden als ihre Reisegefährtin galt. Nicht, dass sie vorhatte, mit Diane zu reisen, das stand gar nicht zur Debatte. Ihre wirklichen Absichten würde sie niemandem mitteilen, weder Diane noch diesem jungen Mann, der nicht aufhören wollte, ihr scheinbar belanglose Fragen zu stellen.
Plötzlich knallte der Beamte einen Stempel in ihren Pass, kritzelte etwas daneben und schob ihr die Papiere mit einem aufmunternden Lächeln hinüber.
»Viel Erfolg bei Ihren Recherchen. Und willkommen in Kanada.«
2
In der Warteschlange am Taxistand hielt sie ihr fiebriges Gesicht in die kühle Nachtluft. Vancouver im September. Hatte es auch sanft geregnet, damals, als Toni ankam? Sicher hatte er nicht geahnt, dass er nie wieder hierher zurückkehren würde. Gefreut wird er sich haben. Gefreut auf die geheimen Treffen.
Wahrscheinlich war er dieselben Straßen entlanggefahren wie sie jetzt, auf dem Weg vom Flughafen zur Innenstadt, an den kleinen Läden mit den Flachdächern vorbei, den bunten Neonreklamen, chinesischen Schildern, offenen Waschsalons. Alles beleuchtet, obwohl es schon nach Mitternacht war.
Irgendwann fuhr das Taxi über eine mächtige Brücke. Wasser glitzerte weit unten im Licht der Wohntürme am Ufer. Durch unverhüllte Fenster konnte sie in hellen Räumen Menschen vor Computern sitzen sehen. Eine Frau radelte auf einer Maschine. Fitness – mitten in der Nacht!
Überall Glas, überall Licht, riesige Fensterfronten, transparente Bauten.
Eine Stadt, in der man sich nicht verstecken konnte.
Als das Taxi vor einem großen Gebäudekomplex hielt, bat sie den Fahrer zu warten, sie wollte nicht allein zurückgelassen werden. Wieder kroch ihr die Angst in den Nacken.
Sie tippte Dianes Türcode in die Tasten neben dem Eingangsportal. Klicken. Rauschen. Dann eine weibliche Stimme. »Sonja!«
Minuten später wurde sie von einer unbekannten Frau mit entschlossener Wärme umarmt.
»Wie schön, dass du endlich hier bist! Komm rein. Ich habe alles für dich vorbereitet«, sagte Diane strahlend und griff sich den Koffer. Sonja war gerade noch wach genug, um ihre großen dunklen Augen und den weichen vollen Mund wahrzunehmen. Lippen wie Angelina Jolie.
»Lass mich raten«, sagte Diane, »du willst nicht essen, du willst nicht reden, du willst einfach nur ins Bett und schlafen.«
»Ja«, sagte Sonja und lächelte dankbar.
Um vier Uhr morgens war sie hellwach. Straßenlicht drang durch die dunkelblauen Gardinen ihres Schlafzimmers. Sonja lag unter schweren Decken, die vielen Kissen hatte sie an die Bettkante gedrängt. Ihre Kehle war trocken. Sie tappte in das angrenzende Bad und trank einen Schluck Wasser. Es schmeckte nach Chemikalien. Auf der Kommode entdeckte sie eine kleine Flasche Mineralwasser. Diane hatte an alles gedacht. Sie legte sich wieder ins Bett, doch an Schlafen war nicht mehr zu denken. Seufzend holte sie das Buch mit dem grünen Leineneinband aus ihrem Rucksack und schlüpfte zurück unter die Decke.
An Else zu denken war tröstlich. Else war Vergangenheit, irgendwo weit weg, sicheres Territorium. Solange sie an Else dachte, blieb sie von anderen bedrohlichen Gedanken verschont.
Mit dem Ozeandampfer Empress of Australia war Else von Hamburg nach Montreal gereist, dann vier Tage mit dem Zug nach Vancouver. Damals hieß sie noch Else Lübcke. Eine Dichterin aus dem Berlin der 1920er Jahre. Einst Gutsbesitzertochter. Nachts die heimliche Bohemienne. Tagsüber Sachbearbeiterin im Archiv einer Bank.
Und dann reiste sie plötzlich nach Vancouver, um diesen Mann zu treffen. Einen Trapper. Fallensteller. Pelzhändler. Goldsucher. Einen Mann mit rauen Sitten und animalischem Instinkt. Georg Seel, siebenunddreißig Jahre alt, ein gebürtiger Bayer, der seit fünfzehn Jahren in der kanadischen Provinz British Columbia lebte und eine Frau suchte. Warum, fragte sich Sonja zum hundertsten Mal, warum ausgerechnet Georg Seel?
Else war ihr immer noch ein Rätsel, obwohl sie die Fakten inzwischen in- und auswendig kannte. Else Lübcke, dreiunddreißig Jahre alt, arbeitete auf einer Bank. Sie sortierte Zeitungsausschnitte. Da sah sie Georg Seels Annonce. Eine Bekanntschaftsannonce, Single sucht Single sozusagen. Irgendetwas musste in Else klick gemacht haben. War es Abenteuerlust? War es die Sehnsucht nach der Fremde, dem Exotischen? Das Gefühl von Enge? Flucht aus einem abgestandenen Leben?
»Da steckt was dahinter«, hatte Inge gesagt, als sie davon erfuhr. »Da muss was geschehen sein. Die geht doch nicht einfach Knall auf Fall aus Berlin weg. Dazu noch ans Ende der Welt! Ohne Theater und Lesezirkel. Da steckt was dahinter, glaub mir!«
Sonja kannte Inges Sinn für Dramatik. Für das Museum wirkte er Wunder. Seit Inge dort Kuratorin war, kamen die Besucher scharenweise in die Ausstellungen. Sonja war für die historische und sachliche Richtigkeit zuständig, Inge für die Phantasie. Und Else Lübcke Seel beflügelte ihre Phantasie; sie war nicht vom Glauben abzubringen, dass es in Elses Leben ein dunkles Geheimnis gegeben hatte, das sie nach Kanada führte.
»Vielleicht hat sich Else nur gelangweilt«, hatte Sonja eingewandt.
Sie sah das prosaischer. Else, das hatte sie gelesen, ernährte mit ihrer Arbeit auch die Mutter und eine alte Tante. Dabei war sie Dichterin, Träumerin, eine Künstlernatur. Vielleicht spürte sie, dass in Berlin bald andere Zeiten anbrechen würden. Berlin, das war ein frivoler Zirkus kurz vor dem Abbruch. Ein rauschender Ball, bevor das Feuer ausbricht.
Else reiste also 1927 nach Vancouver und stieg im Hotel St. Francis ab, in einem Zimmer, das Georg Seel für sie reserviert hatte. Jemand klopfte. Else rief Herein. Die Tür öffnete sich. Jetzt sah sie zum ersten Mal den Mann, den sie bereits am folgenden Tag heiraten würde. Ihr gefiel, dass er groß und kräftig gebaut war, ihr gefiel auch sein braunes welliges Haar, sein kluges Gesicht.
Sonja las nochmals die Stelle in Elses Kanadischem Tagebuch, das die Dichterin 1964 veröffentlicht hatte. Ich sah ihn an. Er lächelte scheu. Und wieder frustrierten sie diese knappen Sätze. Else schrieb nichts über ihre Gefühle. War sie aufgeregt? War es Liebe auf den ersten Blick? Schmetterlinge im Bauch? Weiche Knie?
Nichts.
Toni kam ihr in den Sinn. Sie ließ das Buch sinken.
Wie lange hatte sie jenen Sommertag im Wallis verdrängt. In einem Dorf namens Ruhetal. Ausgerechnet. Ruhetal wollte gar keine Ruhe. Es wollte Tourismus, progressiven Tourismus. Soft Adventure. Riverrafting. Mountainbiking. Alles englisch, alles cool. Eine große Schanze für Mountainbiker sollte auf dem Martinshügel gebaut werden, und diesen Hügel kannte sie sehr gut, aus historischer Sicht natürlich. Ein Ort, von dem die Menschen seit Jahrtausenden glaubten, dass von ihm eine übernatürliche Kraft ausgehe, dass er das Zentrum eines Kraftfeldes bilde. Sie hatte darüber eine Abhandlung geschrieben. Zuerst war es eine heidnische Kultstätte, dann wurde eine christliche Kapelle gebaut, dann eine große Kirche, die aber in der Reformation zerstört wurde. Dann wieder eine Kapelle. Und jetzt also eine Sprungschanze für Radler. Es gab Opposition dagegen.
Toni saß damals während einer Diskussionsrunde neben ihr. Toni Vonlanden, Tourismusunternehmer und Experte für Mountainbiking, Bungeejumping, Freeride und Canyoning.
Kraftfelder, hatte Toni Vonlanden gelacht, was denn das für ein Aberglaube sei. Aber er hatte freundlich gelacht, mit weiß schimmernden Zähnen im gebräunten Gesicht. Sonja hatte seine muskulösen Unterarme betrachtet, die Finger stark und sehnig. Ein Sportsmensch durch und durch. Sonja hasste Sport.
»Ich bin nicht stur«, hatte Toni Vonlanden den Dorfbewohnern im Saal erklärt, »ich lasse mich gern überzeugen.« Und zu Sonja gewandt: »Sie dürfen mir die Wirkung von Kraftfeldern zeigen. Heute Abend, wenn’s sein muss.« Das Publikum hatte gelacht.
Sonja nahm ihn beim Wort, und so saßen sie bei Einbruch der Dunkelheit auf dem Martinshügel im Gras, und Sonja erzählte ihm von der früheren Kirche, einem großen Gotteshaus, zu dem im 11. und 12. Jahrhundert verzweifelte Eltern ihre tot geborenen Säuglinge und Embryonen brachten. Es war ihre letzte Chance, die Kinder taufen zu lassen und damit vor der ewigen Hölle zu retten, da die katholische Kirche keine toten Körper taufte. Die Priester legten die kleinen Leichen auf eine warme Platte, steckten ihnen eine Feder in den Mund, und wenn sich diese durch die Erwärmung bewegte, galt das als Zeichen von Leben, und das Kind wurde schnell getauft. Rund um den Martinshügel waren Tausende von Säuglingen begraben, winzige Skelette unter der Erde.
Sie saßen zusammen und redeten, bis die Sonne unterging. Später erzählte Toni seinen Freunden, dass er das Kraftfeld gespürt habe. Und wie! Gewaltig. Unerklärlich. Prachtvoll. Er habe sich an jenem Abend in eine Historikerin aus St. Gallen verliebt, die noch nie in ihrem Leben einen Skilift berührt hatte.
Vielleicht hätte ihn das warnen sollen. Dann wäre das alles nie passiert. Er wäre nicht unter mysteriösen Umständen umgekommen. Und sie wäre heute nicht hier, in diesem Zimmer, in Vancouver.
3
Von:
Gesendet:
2. September, 13:36
An:
Inge Stollrath
Betreff:
Feindesland
Liebe Inge,
ich bin sicher angekommen, und du wirst es bestimmt schätzen, dass ich dir als Erster eine E-Mail schreibe. Nachdem du schon gefürchtet hast, mein allergischer Anfall würde all deine Pläne zunichte machen. Ich fühle mich direkt heroisch.
Jetzt sitze ich also hier in einem Internetcafé, mitten im Zentrum von Vancouver. Ich hätte nie gedacht, dass es so kompliziert sein kann, einen Milchkaffee zu bestellen. Was die alles wissen wollen. Die Größe des Pappbechers, den Fettgehalt der Milch, biologisch oder nicht, welche Kaffeebohnen, ob koffeinfrei oder normal … Meine Koffer wurden nicht durchsucht, und Diane wird all die verbotenen Leckereien erhalten, die mir ihre Verwandten aus Deutschland mitgegeben haben; die denken offenbar, dass es in Kanada nichts zu kaufen gibt. Ich habe Diane heute noch nicht gesehen, sie war schon weg, als ich aufstand (ich war nachts wach und schlief dann bis zum Mittag –
mein Rhythmus ist völlig durcheinander). Du hast übrigens recht, sie spricht kein Wort Deutsch.
Du solltest Dianes Wohnung sehen: Die Wände meines Schlafzimmers sind orange, im Wintergarten steht ein rotes Sofa vor einer senfgelben Wand, das Bad ist violett und silbern, im Wohnzimmer schlammgraue Wände und eine hellgrüne Polstergruppe mit bunten Kissen. Viel asiatische und indianische Kunst. Die Küche ist ein Spiegelkabinett, Spiegel an den Wänden, an der Decke, Spiegel als Tablare für die Gläser, Spiegeltüren, überall dunkel getönte Spiegel. Ich kann dem Anblick meiner rot geränderten Augen nicht ausweichen. Die Sammelwut und der Sinn für Exzentrik muss in eurer Familie liegen! Ich staune, dass diese Veranlagung selbst in die fernen Verästelungen deiner Verwandten geflossen ist, die sich vor Generationen aus Deutschland nach Kanada abgesetzt haben. Diane ist übrigens deine Cousine wievielten Grades?
Von ihrem Appartement aus kann ich einen Zipfel Pazifik sehen, Diane wohnt in der Nähe des False Creek, eines Meeresarms, der in die Innenstadt reinfließt. Wenn jemand die Tür aufstößt, rieche ich Salzluft. Ich höre Möwen kreischen und es fischelt!
Viele asiatische Gesichter hier. Alle laufen mit Kaffeebechern herum, alte Leute tragen High-Tech-Turnschuhe, viele junge Gesichter, ich hab schon lange nicht mehr so viele junge Menschen auf einmal gesehen. Mit meinen sechsunddreißig Jahren fühl ich mich direkt im reifen Alter!
Ganz deine
Sonja
»Ich bin ein bisschen verwirrt«, sagte Diane und kuschelte sich in den hellgrünen Diwan. »Was hat deine Reise mit dieser Ausstellung zu tun?« Sie strich sich über ihr schwarzes, kurz geschnittenes Haar.
In diesem Augenblick überfiel Sonja wieder die Müdigkeit. Oh, wie sie diesen Jetlag hasste. Inge hatte ihr das alles eingebrockt, Else Seel und die Reise durch Kanada. Schon die letzte Ausstellung über die Geschichte der Unterwäsche hatte Sonja fast zum Wahnsinn getrieben; nicht der historische Aspekt natürlich, sondern dass Inge immer alles so übertreiben musste. Understatement ist der Tod eines Museums, pflegte sie zu sagen.
Dabei war Sonja von Inges jüngster Idee recht angetan gewesen. »Frauen, die auswandern, aber allein, ohne Mann, ohne Familie, verstehst du?« Und dann hatte sie das Kanadische Tagebuch von Else Seel triumphierend auf den Tisch geknallt. »Das gibt den Deutschland-Bezug – eine Dichterin aus Berlin.« Inge hatte immer die Besucherzahlen im Hinterkopf. Als Nächstes war sie Sonja mit dem Plan für eine Kanada-Reise gekommen. »Ich will Photos und Ausstellungsobjekte von Else und möglichst viele Zeugen.«
Sonja hatte versucht, die Reise auf Inge abzuschieben. Vor allem, als sie den geheimen Verdacht hegte, dass das alles vielleicht kein Zufall war. Plötzlich war sie unsicher geworden. Vielleicht wusste Inge von der Tragödie in Kanada. Von Toni und Nicky. Vielleicht sogar von Odette. Doch dann verwarf sie den Gedanken. Es war unmöglich, dass Inge etwas ahnte. Sie hatte sich nie etwas anmerken lassen. Nie eine Andeutung gemacht oder eine Frage gestellt. Sie konnte nichts davon wissen. Inge war so transparent wie ein Wasserglas.
»Warum gehst denn nicht du? Du bist doch die Globetrotterin von uns beiden.« Es war Sonjas letzter Versuch gewesen, das Verhängnis abzuwenden. Aber Inge hatte abgewinkt. »Du weißt doch, die Konferenzen mit dem Kulturrat. Wir brauchen diese Zuschüsse. Ich muss jetzt dranbleiben, sonst schwimmen uns die Felle davon.«
Sie hatte natürlich recht. Und Sonja fühlte sich schuldig. Sie hatte Inge im vergangenen Jahr häufig mit der ganzen Arbeit allein gelassen. Wie oft hatte sie angerufen: Heute geht es nicht, du weißt, das Übliche. Schaffst du es alleine?
Das Übliche. Es waren Panikattacken. Aber das verriet sie nicht, nannte es Allergien.
Es hatte mit Albträumen begonnen. Ganz plötzlich, ohne Vorwarnung. Sie saß im Flugzeug. Mit der Gewissheit, dass sie gleich abstürzen werde. Sie sah die Wasseroberfläche, sah sie näher kommen, aber unheimlich langsam, eine endlose Qual. Dann Leichen, die im Wasser driften. Sie schwamm in den eiskalten Fluten. Schwamm auf eine Leiche zu, die mit dem Rücken nach oben trieb. Wenn sie nur das Gesicht sehen könnte. Das Gesicht. Zeig mir dein Gesicht!
Die Ärztin hatte ihr Ruhe verordnet. Und kleine rosa Tabletten verschrieben. Damit sie von der Panik nicht überschwemmt werde.
Sonja trug die Tabletten immer bei sich. Sie, die doch früher immer auf homöopathische Notfalltropfen geschworen hatte. Jetzt waren Psychopharmaka ihr Rettungsring. Sie schämte sich dafür, schämte sich, dass ihr wohlgeordnetes Leben aus den Fugen geraten war.
Drei Jahre war es schon her, seit sie die Leichen gefunden hatten. Vor drei Jahren hatte sie keine Albträume gehabt. Keine Panik. Keine Schweißausbrüche. Kein Herzflattern und keine Platzangst.
Damals empfand sie nur dumpfe Leere. Schmerz. Und Wut. Nachdem sie die Briefe gefunden hatte, vor allem Wut.
Mein liebster Tonio, ich vermisse Dich so sehr, dass es mir wehtut. Mein Körper schreit vor Sehnsucht. Meine Haut glüht immer noch, dort, wo wir uns berührten …
Inge hatte ihr nie die häufigen Krankheitstage vorgehalten. Ruh dich aus, es wird schon werden, sagte sie immer.
Sonja stand in Inges Schuld. Sie musste reisen.
4
»Komm, lass uns eine Runde drehen.« Sonja erschrak ein wenig, als sie Diane in ihrem pflaumenfarbenen hautengen Jogginganzug sah. Sie federte in ihren Laufschuhen ab, als sei Hydraulik eingebaut, und an ihrem Gürtel hing eine Wasserflasche. Würde sie hinter ihr herhasten müssen, den Hafen im False Creek entlang? Die frische Luft brannte heiß in ihren entzündeten Nasengängen. War sie nun auch auf Meersalz allergisch? Diane schritt energiegeladen aus.
»Weißt du, wem du ähnlich siehst?«, fragte sie.
Sonja wusste es.
»Du siehst aus wie Cate Blanchett im Film Der Herr der Ringe«, sagte Diane.
Natürlich. Sonja wusste nie, ob es als Kompliment gemeint war. Ja, sie glich der australischen Schauspielerin ein wenig. Das blonde feine Haar, die Stellung der hellblauen Augen, der breite Mund, die weiße Haut, die feinen Gesichtszüge. »Ätherisch« nannte es Inge. Aber Cate Blanchett war schön; Sonja dagegen sah sich wie ein Bild aus Wasserfarben, keine Konturen, alles zerfloss in hübsche, aber irgendwie bedeutungslose Formen.
Toni hatte das zwar nie so empfunden. Er mochte das Elfenähnliche, Wasserfarbenhafte an ihr. Als er sie einmal auf einem alten Foto sah, geschminkt und aufgetakelt für eine Theaterrolle an der Universität, war er schockiert. Verrucht sehe sie da aus, und das behagte ihm gar nicht. Sonja hatte sich über seine Reaktion amüsiert und ihm frech eine Grimasse geschnitten. Von da an schminkte sie sich täglich die Lippen. Sie fand, einem Mann wie Toni musste man ab und zu Widerstand entgegensetzen. Instinktiv spürte sie, dass er das mochte. Widerstand erzeugte Reibung, Reibung ließ die Funken sprühen, und die Funken entfachten Feuer zwischen ihnen.
»Schau, ein Drachenboot!« Diane zeigte auf ein langes Kanu, an dessen Bug ein roter Drache mit goldener Zunge wie ein Feuerstrahl übers Wasser schoss, angetrieben von einem Dutzend Männer und Frauen, die im Rhythmus eines Zurufers ihre Holzruder ins Wasser stachen.
»Was, die trainieren schon?«, rief Diane überrascht aus. Und zu Sonja gewandt: »Weißt du, das Rennen mit Drachenbooten findet immer im Juni auf dem False Creek statt, es ist ein chinesischer Brauch.«
Sie gingen einen Holzsteg entlang, neben dem Boote und Jachten auf dem Wasser schaukelten. Glastürme glitzerten auf der anderen Seite der Bucht. Auf einer Penthouse-Terrasse entdeckte Sonja einen Baum. Er wirkte wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten.
Längst vorbei und doch nie vergangen.
Was, wenn Toni ihr jetzt plötzlich entgegenkäme? Wie würde er reagieren? Würde er auf sie zukommen und sie in die Arme nehmen? Oder nur verlegen mit den Händen in den Jackentaschen vor ihr stehen? Wie ein Fremder in einer fremden Stadt?
Reiß dich zusammen. Er ist tot, es gibt ihn nicht mehr. Weder in Vancouver noch sonst wo.
»Ist dir nicht gut?«
Diane fasste sie am Arm. Sonja bemerkte, dass sie sich am Geländer des Holzstegs festgeklammert hielt.
»Doch, doch, nur ein bisschen schwindlig, wahrscheinlich immer noch eine Folge der Allergie.«
»Du hast auch nicht richtig gefrühstückt. Komm, wir essen erst mal was.«
Sie zog Sonja ins Getümmel der Markthalle von Granville Island, an Pyramiden aus Äpfeln und Eisbecken voll frischer Meeresfrüchte vorbei. Minuten später saßen sie an einem der Holztische mitten in der lärmigen Halle, und Diane stellte kleine Schalen vor sie hin: Garnelen an Erdnusssauce, Spieße mit mariniertem Fleisch, parfümierter Reis, nach exotischen Gewürzen riechendes Gemüse.
»Iss, so viel du kannst, wir haben noch viel vor heute.«
Sonja fühlte sich jetzt tatsächlich hungrig. Wenn das kein gutes Zeichen war. Sie stopfte sich mit kleinen Leckerbissen voll, die zwar nicht der biologisch-dynamischen Diät entsprachen, die sie zu Hause befolgte, aber als Historikerin musste sie sich schließlich auch kulinarisch weiterbilden. Diane erzählte ihr aufgeräumt von den Vorteilen des Lebens in Vancouver. Doch Sonja hörte ihr nur mit halbem Ohr zu. Sie schwamm wie eine Seerose auf der Flut von Geräuschen und Düften um sie herum.
»Kommen Sie, wir machen Platz für Sie«, sagte Diane plötzlich zu einem Mann, der mit seinem Tablett hilfesuchend durch die voll besetzten Tischreihen irrte, und schob die Schälchen zusammen. Der Mann bedankte sich erfreut und stellte seinen Teller auf den Tisch. Wurst, Zwiebeln, Sauerrahm und Teigtäschchen – das musste vom ukrainischen Essstand hinter ihnen kommen.
»Ganz schön voll um diese Zeit«, sagte der Mann und lächelte Diane an. Er trug ein blaues Sweatshirt und darüber eine ärmellose Weste mit vielen Taschen. Sonja musterte ihn verstohlen. Mitte dreißig, schätzte sie. Das war nun also ein Kanadier, ein homo canadiensis. Breiter Schädel, kräftige Zähne, gesunde Ausstrahlung, muskulöse Arme, offenes, freundliches Gesicht. Blonder Schnurrbart.
Diane knüllte die Papierservietten zusammen und warf sie in eine der leergegessenen Schalen.
»Sie sollten im Sommer hier sein, mit all den Touristen, dann ist es unmöglich, einen leeren Tisch zu finden.«
»Ich komme aus Calgary«, sagte der Mann. »Meine Bekannten sagten mir, ich müsste unbedingt Granville Island besuchen. Tolle Läden und Galerien hier, muss ich schon sagen. Da kann ich gleich ein paar Geschenke kaufen. Am liebsten würde ich das Meer mitnehmen.«
»Ja, das möchte ich auch«, entfuhr es Sonja.
»Ich handle nämlich mit Fischen«, sagte der Mann und sah sie neugierig an.
»Sie kommt aus der Schweiz, da gibt es auch kein Meer«, erklärte Diane.
Der Mann lächelte und schaute Sonja weiter unverwandt an. Sein Schädel war fast kahl rasiert, wie bei einem Militärkadetten, sein Blick direkt. Sonja fand seine Wimpern zu dicht und zu lang.
»Die Schweiz soll sehr schön sein, hab ich gehört. Machen Sie Urlaub hier?« Er häufte saure Sahne auf seine Teigtaschen.
»Ja«, sagte sie und hoffte, er würde aufhören zu fragen.
»Wie lange wollen Sie hierbleiben?«
»Ich weiß es noch nicht genau.« Es war eine nette, harmlose Unterhaltung, trotzdem war sie auf der Hut.
»Sonja ist Historikerin«, warf Diane ein. »Sie interessiert sich für die Geschichte der Einwanderer in Kanada.«
Es schien, als hätten sich die beiden verbündet. Wieder dieser neugierige Blick zwischen zwei dunklen Lagen Wimpern.
»Sie sollten nach Calgary fahren. Dahin wandern Leute in Massen aus. Es gibt viel Arbeit in Calgary, und noch mehr im Norden, auf den Ölfeldern.«
Sonja nickte, entschuldigte sich und trug das Pappgeschirr zum Müllsack.
»Es war schön, Sie kennengelernt zu haben«, sagte der Mann aus Calgary zum Abschied. Sonja wiederholte den Satz, froh um die höflich-unverbindliche Formel.
Als sie mit dem Aquabus die Meerenge überquerten, hatte sie den Fremden schon wieder vergessen. Das kleine bunte Schiffchen wich einem mächtigen Lastkahn flink aus und tuckerte an zwei Kajaks vorbei. Auf der anderen Seite des False Creek kamen ihnen auf dem asphaltierten Strandweg Rollschuhfahrer und Jogger entgegen. »Fluchttiere« nannte Sonja diese Spezies heimlich. Sie selbst sah sich eher als Schildkröte: Kopf einziehen, sich in den Panzer flüchten.
Im Autoladen lief Diane zielstrebig auf die Gebrauchtwagen zu. Vor einem länglichen roten Vehikel blieb sie stehen.
»Ich denke, das ist genau das Richtige für dich, was meinst du?«
»So ein Ding fahr ich niemals, das ist ja ein halber Lastwagen, ich bin doch kein Cowboy«, protestierte Sonja.
Eine halbe Stunde später unterschrieb sie den Kaufvertrag für einen roten Ford Pick-up Truck, zwölf Jahre alt, mit neuen Bremsklötzen und Scheibenwischern, die gedeckte Ladefläche so groß wie der Schlund eines Buckelwals. Sie langte in ihren Rucksack, um die Rechnung zu bezahlen.
Nichts.
Ihre Brieftasche war weg!
Alles ging sehr schnell. Der Autoverkäufer fuhr sie zur Anlegestelle des Aquabusses. Die Überfahrt mit dem bunten Schiffchen kam Sonja diesmal wie eine Ewigkeit vor. Sie rasten zur Markthalle von Granville Island. Der Tisch war leer. Nichts auf dem Boden, nichts neben der Mülltonne.
Panisch liefen sie von einem Essstand zum nächsten. »Ja, ja, eine Brieftasche«, sagte eine ältere Frau am asiatischen Stand. Ein Mann mit blondem Schnurrbart und blauem Sweatshirt habe sie gefunden und zur Polizeistation in der nächsten Straße gebracht. Ja, er habe ihr vorher Bescheid gegeben.
»Der Mann aus Calgary«, sagte Sonja.
5
Später erinnerte sich Sonja, wie schnell Diane den Vorfall beiseite legen konnte. Sie erwähnte ihn gar nicht mehr. Als ob nichts geschehen wäre. Während sie noch innerlich zitterte, redete Diane schon wieder vom Pick-up Truck und wie günstig der Preis sei, und dass Sonja diesen Kauf nie bereuen werde.
Natürlich war die Sache glimpflich abgelaufen. Ihre Brieftasche fand sich tatsächlich auf der Polizeistation, auch Personalausweis Kreditkarten, Bankomatkarten und Schecks. Nach Ausfüllen eines Formulars wurde ihr alles ausgehändigt, ohne viele Fragen, weil sie ihren Pass vorweisen konnte.
Für Diane war die Sache damit erledigt, man konnte sich wieder wichtigeren Dingen zuwenden: dem Pick-up Truck, den Sonja am folgenden Tag abholen wollte.
»Du kannst ihn am Ende deiner Reise vielleicht sogar mit Gewinn verkaufen. Dann hast das Geld wieder raus!«
Das sagte sie, als sie schon am Canada Place angelangt waren, wo die weißen Zeltdächer des Konferenzzentrums wie Segel in den blassen Himmel stachen. Sie standen an der Reling, die sich um das Hotel Pan Pacific bog, und schauten aufs Meer hinaus und zur schneebedeckten Bergkette am Horizont. Unter ihnen lag ein monumentales Kreuzfahrtschiff am Pier. Staunend beobachteten sie, wie Tonnen von Klopapier, Fruchtsaftkartons und Cornflakes in den Unterleib des Schiffes geschoben wurden. Passagiere plauderten auf den Balkonen ihrer Kabinen, Angestellte in weißen Schürzen und blauen Blusen stellten künstliche Blumen in die Fenster.
Diane zog sie weiter. »Komm, ich zeig dir den Bahnhof, wo die deutsche Dichterin angekommen ist. Er ist gleich hier um die Ecke.«
Das dekorative Gebäude stand immer noch. »Und das Hotel St. Francis gleich gegenüber, wo sie sich getroffen haben?« Sonja sah sich suchend um.
»Das ist weg. Abgerissen. Wenn ich mich nicht täusche, stand es an der Stelle dieses Parkhauses.«
Sonja war enttäuscht. Aber was hatte sie erwartet? Das Zimmer zu sehen, in dem Else ihren künftigen Mann Georg zum ersten Mal sah?
»Sie kannte ihn nur zwei Tage, da hat sie ihn schon geheiratet.«
Diane war nicht beeindruckt. »Ja, früher ging das oft so mit den Frauen, die aus Europa kamen. Die mussten sofort heiraten, damit alles schicklich war.« Sie lachte. Sonja hätte sie gerne gefragt, ob es einen Mann in ihrem Leben gab, aber dann hätte Diane bestimmt zurückgefragt, und das wollte sie um keinen Preis.
Diane nahm sie spielerisch am Arm. »Hat er ihr denn gefallen? Was steht dazu in deinem Buch?«
Sonja schlug Elses Kanadisches Tagebuch auf und übersetzte, so gut sie konnte. Ich packte meine Koffer aus, als Georg herein kam. Ich sah ihn an. Er lächelte scheu. Als ich deutsch zu ihm sprach, entschuldigte er sein schlechtes Deutsch, da er ja bereits seit fünfzehn Jahren nur englisch spreche. Dann sagte er weiter nichts mehr. Eine Pause trat ein.
Sonja verzog das Gesicht. »Romantisch, nicht wahr? Und weißt du, was sie nachher getan haben? Else sah, dass er eine neue Krawatte brauchte, und so kauften sie eine Krawatte. Am Abend gingen sie ins Kino und dann zum Essen.«
»Und dann? Jetzt wird’s doch erst spannend!«
»Georg sagte zu ihr, dass am nächsten Tag geheiratet werde, und das haben sie auch getan.«
Diane ließ nicht locker. »Wie sah er denn aus? Sah er gut aus?«
»Ich glaube schon. Er war groß und schlank und so ein kräftiger Typ. Dunkles Haar und …, ich würde sagen, ein männliches Gesicht.«
»Na, dann konnte sie ja zufrieden sein.«
»Das weiß ich eben nicht genau. Sie gibt nicht viel Persönliches preis, wenigstens nicht in diesem Buch.«
Diane legte ihr den Arm um die Schultern. »Ich liebe deinen Schweizer Akzent. Die kanadischen Männer werden dich anbeten.«
Sie lachten beide.
Sonja wurden die Augenlider schwer. Spätnachmittags-Jetlag. Diane sah ihr die Erschöpfung an.
»Nimm ein Taxi und leg dich ein wenig hin. Ich geh noch eine Runde joggen.« Sie drückte ihr den Wohnungsschlüssel in die Hand, und weg war sie.
Sonja saß schon im Taxi, da kam ihr plötzlich etwas in den Sinn.
»Zum Hotel Lionsgate Place, bitte.«
Es war größer und unpersönlicher, als sie erwartet hatte. Eine kahle, nüchterne Fassade, dafür war der Eingang pompös.
Sie beugte sich vor. »Können Sie hier rasch warten? Ich bin in zwei Minuten zurück.«
»Okay, okay«, sagte der Fahrer.
Sie ging durch die Drehtür und warf einen Blick auf den Hotelempfang. Nur drei Leute, sie konnte es wagen. Eine Angestellte lächelte ihr zu.
»Mein Mann war vor drei Jahren hier, vom 6. bis 10. September. Können Sie das feststellen? Können Sie ihn im Computer finden?«
Die junge Frau schüttelte den Kopf. »Nein, wir dürfen solche Informationen nicht herausgeben, es geht hier um Datenschutz.«
Natürlich. Wie dumm von ihr.
Sie wollte sich schon umdrehen. Dann sagte sie spontan: »Mein Mann war hier im Urlaub und ist dann tödlich verunglückt. Ich wollte einfach sehen, wo er war, bevor es passierte.«
Die junge Frau zögerte. Sie schien betroffen. »Das tut mir leid«, sagte sie.
Sonja hatte die Abrechnung der Kreditkartenfirma gesehen, den Namen des Hotels dort gelesen. Hatte er Odette hier getroffen? Hatte sie sich nach ihm erkundigt, wie sie jetzt?
»Unser General Manager ist gerade in einer Sitzung, vielleicht …«
»Mein Taxi wartet draußen. Ich kann ja noch mal vorbeikommen.«
»Lassen Sie doch Ihre Telefonnummer hier. Ich werde ihm Bescheid sagen. Wir können Sie anrufen.«
Alles Höflichkeitsfloskeln, sie wusste es. Dennoch schrieb sie ihre Handynummer auf einen Zettel, dazu ihren und Tonis Namen und die Daten. Eine Verzweiflungstat. Es würde zu nichts führen.
Sie eilte zum Taxi zurück. Der Druck in ihrem Kopf hatte zugenommen.
Wenn Odette damals bei ihm gewesen war, was hatten sie dann mit Nicky gemacht? Wusste er es oder konnten sie es vor ihm verheimlichen? Wofür genau hatte Nicky mit seinem Leben bezahlt?
6
»Wie grausam.« Toni war richtig zornig geworden, damals, auf dem Martinshügel. »Wie grausam, Eltern glauben zu lassen, ihr totes Kind sei für ewige Zeiten zur Hölle verdammt, nur weil es nicht getauft wurde.«
Trotz der Sonnenbräune konnte sie die Röte sehen, die in sein scharf geschnittenes Gesicht getreten war.
In jenem Moment begann sie zu ahnen, dass er nicht nur ein eindimensionaler Sportsmensch war. Nicht nur ein Adrenalinjunkie, süchtig nach dem Kitzel, den extreme Sportarten produzierten. Was wusste sie denn schon damals von ihm. Nur, was ihr die Organisatoren des Streitgesprächs im Wallis mitgeteilt hatten. Dass Toni Vonlanden Mitbesitzer einer Alpinschule war, ein Meister des Freeclimbing, er hatte offenbar auch mehrere Gipfel im Himalaja bestiegen, oder es zumindest versucht. Einer dieser Verrückten, dieser Lebensmüden, hatte sie damals gedacht.
»Den Leuten Angst einzujagen, darum geht es doch immer. Sie in Angst und Schrecken leben zu lassen. Damit kann man sie schön manipulieren.«
Angst fand Toni, das sollte sie bald herausfinden, ein ganz und gar überflüssiges Gefühl. »Es gibt doch überhaupt keinen Grund zur Angst.« Diesen Satz hatte sie später immer wieder von ihm gehört. Sie selbst hielt es für legitim, sich manchmal zu fürchten. Und es gab einiges, das sie aus Furcht unterließ. Nicht nur zu ihrem Schaden. Aber für Toni war Angst lächerlich, reine Zeitverschwendung, etwas, das man mit der flachen Hand vom Tisch wischte. Deshalb verschwieg sie ihm in den folgenden Jahren, wenn er zu einem seiner gefährlichen Abenteuer aufbrach, dass sie Angst um ihn hatte.
Auch Else Seel hatte das getan. Oft war Georg wochenlang unterwegs, beim Fallenstellen im Gebirge, mitten im schrecklichen kanadischen Winter, oder auf der Suche nach Gold und Silber. Nie wusste sie, ob er lebend zu ihrer Blockhütte zurückkehren würde. Einmal kam er schwer verbrannt bei ihr an. Eine Benzinlampe hatte den Unterstand, in dem er im Gebirge schlief, in Brand gesetzt. Im Verschlag befand sich Sprengstoff für die Goldminen, die er zu finden hoffte. Er konnte sich gerade noch aus der Hütte retten, bevor sie in die Luft flog. Else schrie, als sie ihn aus dem Boot steigen sah. Es gab keinen Arzt, deshalb pflegte sie ihren schwerverletzten Mann, so gut sie konnte. Er überlebte, doch am Hals blieben große Narben zurück.
Blieben große Narben zurück.
Diane breitete die Landkarte auf dem Esstisch aus. »British Columbia, fast eine Million Quadratkilometer groß und nicht mal fünf Millionen Menschen.« Sie klang ein wenig stolz. Sonja hatte in ihrem Reiseführer gelesen, dass die westlichste kanadische Provinz so groß war wie Deutschland, Frankreich und die Schweiz zusammen. Diane strich mit dem Finger über grüne und braune Flächen.
»Es gibt weite Gebiete, in die noch nie jemand je einen Fuß gesetzt hat. Ist das nicht faszinierend?«
Sonja verdrehte die Augen. »Es ist einschüchternd.«
Sie wollte nicht dorthin gehen, wo noch nie jemand gewesen war. Sie wollte nicht Neuland erobern wie die Pioniere in Kanada. Dieser Georg Seel mochte ein solcher Typ gewesen sein. Was sagte der gute Mann zu seiner frischgebackenen Ehefrau, als Else vor der Blockhütte am Ootsa-See Wäsche aufhängte? »Hier hängt zum ersten Mal Wäsche, solange die Erde steht.«
Als ob die Erde auf diese Wäsche gewartet hätte.
Diane legte die Hand auf Sonjas Arm, wie es ihre Art war.
»Es wird schon alles gut gehen, du wirst sehen. Die Kanadier sind freundliche Menschen und hilfsbereit. Es wird dir Spaß machen.«
Sonja bemerkte den glitzernden Anhänger an Dianes Halskette. Ein transparenter Stein funkelte im Morgenlicht. Es konnte kein echter Diamant sein, der hätte ein Vermögen gekostet, aber sie wagte nicht zu fragen. Inge hatte ihr erzählt, dass Diane mit Edelsteinen zu tun hatte – Schmuckdesignerin oder so was.
Ihr Blick wanderte zur Karte zurück. Wie sollte sie das nur schaffen, so ganz allein? Else Seel hatte wenigstens ihren neuen Ehemann bei sich, als sie wenige Tage nach ihrer Ankunft mit dem Schiff von Vancouver nach Prince Rupert reiste.
Wo ist es passiert?
In der Nähe von Prince Rupert.
Prince Rupert? Wo ist das? Ich verstehe nicht, was hat Toni dort nur gemacht?
Das würden wir gerne von Ihnen erfahren.
»Hör zu, Sonja, du nimmst also diesen Highway, eine gute Straße, kein Problem. Der Rest wird sich ergeben.« Sie faltete die Landkarte zusammen. »Die kannst du mitnehmen. Wolltest du nicht noch Inge eine E-Mail schreiben? Du kannst meinen Computer benutzen.« Sonja nickte. Inge hatte nur kurz zurückgeschrieben. Sie sei sehr beschäftigt, fiebere aber in Gedanken mit ihr. Fiebere, das fand Sonja, die immer noch mit ihrer Allergie kämpfte, eher komisch. In ihren Augen war Inges Antwort völlig unangemessen. Konnte Inge denn nicht ermessen, wie viel Mut sie dieses Unterfangen kostete? Nein, natürlich nicht, sie war ja ahnungslos.
Schlecht gelaunt hämmerte sie ihre Nachricht in den Rechner.
Von:
Gesendet:
4. September, 10:01
To:
Inge Stollrath
Betreff:
Elses Sohn
Liebe Inge,
in zwei Tagen breche ich zu meiner großen Reise auf. Du kannst dir vorstellen, wie nervös ich bin. Glücklicherweise habe ich noch einen Platz auf der Fähre von Vancouver Island nach Prince Rupert erwischt. Meinen Besuch im Else-Seel-Archiv in Victoria muss ich auf später verschieben, das Archiv wird gerade neu organisiert und ist für eine Woche geschlossen.
Aber etwas wird dich freuen: Ich habe Elses Sohn, Rupert Seel, in der Nähe von Vancouver aufgespürt und werde ihn besuchen. Frag mich nicht nach meiner Gemütsverfassung. Wenn ich von dieser Reise zurück bin (falls ich lebend heimkomme), werde ich frühzeitig ergraut sein. Und unser Museum bankrott. Besser, du bewirbst dich schon jetzt um doppelte Zuschüsse.
Schön, dass ich dir fehle. Hast du zwar nicht geschrieben, ich schließe es aber aus der Tatsache, dass du in Arbeit versinkst.
Herzliche Grüße
Sonja
Sie sandte die Nachricht ab und wollte die Verbindung bereits abbrechen, besann sich dann aber anders und tippte einen Namen in die Suchmaschine. Sie kam sich dabei ein bisschen wie ein Dieb vor. Eigentlich durfte sie gar nicht im Besitz dieses Namens sein. Wenigstens nicht in den Augen der Polizeibeamtin, der sie gestern Nachmittag gegenübergestanden hatte. Einem plötzlichen Impuls folgend, war sie nach ihrem Hotelbesuch nochmals zur Polizeistation auf Granville Island gelaufen. Sie wollte dem ehrlichen Finder eine Belohnung schicken. Am Morgen war sie so durcheinander gewesen, dass es ihr gar nicht in den Sinn gekommen war. Und niemand hatte sie in jenem Moment daran erinnert.
Als sie der Beamtin den Fall erklärte, schien zuerst alles ganz einfach. »Hier, ich notiere die Angaben für Sie«, hatte die junge Frau gesagt. Aber kaum hielt sie Sonja den Zettel hin, zog sie ihn gleich wieder errötend zurück. »Ach, das darf ich gar nicht, Personenschutz, entschuldigen Sie.« Sie zerknüllte den Zettel. »Der Finder will nicht kontaktiert werden, wir haben einen Vermerk in den Akten. Er will auch keinen Finderlohn, sehe ich gerade.«
Aber ein Wort auf dem Zettel hatte Sonja erhaschen können, und es hatte sich ihr eingeprägt, weil es sie an den Roman Die Kameliendame erinnerte: Kamelian Inc.
Das, was sie nun auf dem Bildschirm sah, war weniger literarisch. Kamelian – Ihr Firmensicherheitsdienst. Was war denn das? Verdacht auf Wirtschaftsspionage? Sorge um die Sicherheit Ihrer Transporte? Um den Schutz Ihrer Firmenanlagen? Sind Ihre Daten vor Unbefugten sicher? Fühlen Sie sich von fremden Interessen bedroht? Wir kümmern uns um alle Sicherheitsfragen. Sonja klickte auf das Stichwort »Tätigkeitsbereiche«: Erdölindustrie, Bergbau, Minen, Edelmetalle, Diamanten.
Merkwürdig, hatte der Mann in der Markthalle nicht erzählt, er handle mit Fischen? Deshalb wollte er doch im Scherz das Meer nach Calgary mitnehmen.
Sie musste den Namen falsch gelesen haben, bevor ihr die Beamtin den Zettel entzog.
Plötzlich hörte sie Stimmengewirr. Besuch? Sie löschte den Bildschirm und verließ das Arbeitszimmer. Im Wohnzimmer unterhielt sich Diane angeregt mit zwei Frauen. Als Sonja hereinkam, schaute Diane auf.
»Sonja, das sind meine Freundinnen Holly und Suzy.«
Die beiden Frauen begrüßten sie mit einem munteren »Hi«.
»Das ist Sonja, sie ist ist aus der Schweiz und Historikerin. Sie erforscht das Leben einer deutschen Dichterin, die in den zwanziger Jahren nach Kanada ausgewandert ist.«
»Ach, wie interessant! Ist sie hier in Kanada bekannt?«
»Nein, das nicht. Sie hat vor allem auf Deutsch geschrieben«, sagte Sonja und glitt in einen der Armsessel. »Aber sie wurde nie berühmt. Sie war von allem zu weit weg. Sie lebte in der Wildnis bei Burns Lake.«
»Burns Lake. Wo ist denn das?«
»Irgendwo im Norden oben«, warf Diane ein. »Sie versauerte in einer einsamen Blockhütte, stellt euch vor, dabei hat sie vorher in Berlin gelebt!«
»Ja, die Wildnis gefällt den Deutschen, denen kann es nicht abgeschieden genug sein«, sagte Holly und schüttelte ihre roten Locken. »Mein Onkel lebt im Yukon, und dort gibt es jede Menge Deutsche und Schweizer.«
»Da fällt mir ein … Da war doch schon mal eine Schweizerin hier, wann war denn das? Die war doch auf einer deiner Partys, Diane.«
»Keine Ahnung. Wie hieß sie denn?«
»Weiß ich nicht mehr. Aber sie wollte ein Jahr lang allein in der Wildnis leben.«
Sonja horchte auf. Ihr Herz schlug schneller.
»Ich kann unmöglich alle Gäste auf meinen Partys kennen.« Diane erhob sich. »Wenn wir schon dabei sind, soll ich Essen beim Thai bestellen?«
»Gute Idee. Bestell dasselbe wie letztes Mal, das war so gut.«
Während Diane zum Telefonieren ins Arbeitszimmer verschwand, wandte sich Sonja an Holly. »War ihr Name Odette? War sie schlank, so ein bisschen knabenhaft? Und athletisch? Dunkles, dickes Haar? Länger als meines?«
Holly zog die Augenbrauen hoch. »Kann schon sein. Aber so genau weiß ich es nicht mehr.«
»War das vielleicht vor drei Jahren?«
»Drei Jahre? Gut möglich. Es war hier, in dieser Wohnung. Ich weiß, dass sie Schweizerin war, weil wir über die Schweizer Alpen gesprochen haben.«
Die Schweizer Alpen. Berge. Vielleicht ihre erste Spur von Odette.
Sonja zitterte innerlich.
7
Es regnete in Strömen, als Sonja die Lions Gate Bridge nach West Vancouver überquerte, und sie fand die Tatsache, dass die Scheibenwischer an ihrem Wagen neu waren, höchst bedeutungsvoll. Vorsichtig, wie sie war, hatte sie die Strecke von der Innenstadt zum Fährhafen von Horseshoe Bay am Tag zuvor abgefahren. Toni hätte darüber gelacht. Am Morgen hatte sie sich, wie immer vor wichtigen Terminen, von zwei Reiseweckern gleichzeitig aus dem Schlaf holen lassen. Sie hielt das für eine praktische, nervenschonende Maßnahme. »Du forderst damit ein schreckliches Schicksal heraus«, hatte Toni sie immer geneckt. Und dann etwas ernster gesagt: »Überlass dich doch einfach dem Leben.« Sie ließ das natürlich nicht auf sich sitzen, sondern erinnerte Toni daran, dass er schließlich auch Sicherungen einbaue. Sie fragte ihn, warum er denn seine Bungeejumping-Kunden nicht ohne Seil von der Brücke hüpfen lasse. Dann könnte man doch mal empirisch feststellen, ob »das Leben« unten ein Sprungtuch aufspanne. Solche Diskussionen beendete Toni meistens, indem er sie umarmte und küsste und ihr sagte, was für eine kluge Frau sie doch sei.
Während sie in Horseshoe Bay auf die Fähre wartete, ließ der Regen etwas nach. Von der Bucht sah sie im Wageninnern nur schwarze Felsen und einen winzigen Streifen Ozean. Sie goss sich koffeinfreien Kaffee aus der Thermosflasche ein und schloss die Augen.
Was für ein Glück, dass sie Rupert Seel noch rechtzeitig erwischt hatte, bevor er für drei Wochen verreiste. Und dass er überhaupt mit ihr, einer unbekannten Historikerin aus der Schweiz, über seine Mutter sprechen wollte. Ob Else Seel ihren Sohn nach der Hafenstadt Prince Rupert benannt hatte?
Wo? Das hatte sie den Polizeidetektiv als Erstes gefragt. Wo ist es passiert?
In der Nähe von Prince Rupert.
Prince Rupert? Wo ist das?
Eine Hafenstadt an der Nordwestküste Kanadas.
Toni hatte Prince Rupert nie erwähnt. Auch nicht, als er sie in jenem September zum letzten Mal anrief. Er sprach von Vancouver Island, von einem phantastischen langen Sandstrand, Long Beach, sagte er, bei Tofino. Vielleicht würde er den Westcoast Trail abwandern, wenn das Wetter mitspiele. Sie hatte schon vom Westcoast Trail gelesen, einer kräftezehrenden Wanderroute an der wilden Küste entlang. Das werde Nicky gefallen, der Junge brauche eine Herausforderung, hatte Toni gesagt.
Keine Rede von Prince Rupert. Kein Wort von einem Flug in den Nordwesten.
Wasserflugzeug, hörte sie den Detektiv sagen.
Ein Wasserflugzeug?
Ja, er war der Pilot. Er hat es geflogen.
Woher … Ich meine, er hatte einen Flugschein für Kleinflugzeuge, aber wie kommt er dazu … Warum würde er ein Wasserflugzeug in Kanada …?
Das würden wir gerne von Ihnen erfahren. Es gehörte ihm anscheinend.
Das muss ein Irrtum sein. Dafür hatte er doch gar kein Geld! Dafür hatte er unmöglich Geld.
Sie hätte den Polizeidetektiv schütteln wollen. Er blickte auf seine Unterlagen.
Ihr Mann hat die Maschine in Prince Rupert erworben.
Sonja verstand das alles nicht. Ihr fehlte eine Erklärung.
Die Kontoauszüge der Bank. Die Papiere der Investmentgesellschaft. Toni hatte ihr nichts verheimlicht, nichts beschönigt. Sie waren immer offen zueinander gewesen. Es musste alles ein riesiges Missverständnis sein.
Zu Hause hatte sie alles nochmals durchsucht. Jede Schublade. Jeden Ordner.
Da fand sie die Briefe.