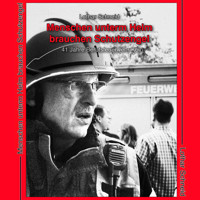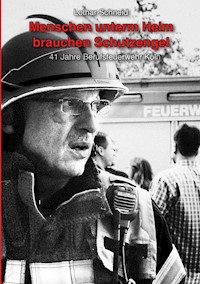Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
41 Jahre Berufsfeuerwehr. Das ist eine gefühlte Ewigkeit, doch im Rückblick verflogen, wie nichts. Jeden Tag Adrenalin, Schweiß, Wut, Lachen, Tränen, Leben retten und manchmal auch gerade so das eigene. Lebensgefährliche Situationen und kameradschaftliche Momente. Viel Action und ein bisschen Langeweile. Handwerk und Bürokratie. Und die Erkenntnis: Unter jedem Helm steckt nur ein Mensch. Menschen mit denen man manchmal zusammen arbeiten MUSS und oft zusammen arbeiten möchte. Menschen - und das klingt wie ein altes Klischee - auf die man sich verlassen können muss, weil es einem manchmal das Leben retten kann. Dieses Buch berichtet nicht nur von täglichen Action-Einsätzen, es beschreibt vielmehr die Feuerwehr als Ganzes. Mit all ihren Stärken und Schwächen. Mit all ihren Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Werdegang
Ich bin kein Held
Feuer Kegelbahn
Die Institution Feuerwehr
Vati
Taucheinsatz Sommer
Tagesablauf auf einer
Feuer- und Rettungswache
P-TUER
Wolfsstunde
Statistik
Stahlrolle
Glück gehabt?
Technik und ihre Anwendung
Der schiefe Turm von Köln
Was für ein Tag
Suizid
Silvesterdienst
Abkürzungen
Als ich mit diesem Buch begann, wurde schnell klar, dass ich ohne Unterstützung niemals zu einem Ende, geschweige denn zu einem fertigen Buch gelangen würde.
Damit ich niemanden vergesse. Ich möchte mich bei ALLEN bedanken, die mich von der ersten Idee bis zur letzten Zeile unterstützt und begleitet haben.
Aber ganz besonders bei Andreas!
Feuerwehrmänner/ Feuerwehrfrauen
Ich verwende in diesem Buch überwiegend den Begriff „Feuerwehrmann“.
Auf keinen Fall ist das in der heutigen Zeit politisch korrekt. Da ich 80 Prozent meiner Dienstjahre nur mit Männern als Kollegen verbracht habe, leiste ich mir dieses „Fehlverhalten“.
Ich habe höchsten Respekt vor Feuerwehrfrauen, habe schon einige ausgebildet und auch in Köln gibt es Feuerwehrfrauen in allen Ebenen bei der Berufsfeuerwehr. Bei der Freiwilligen Feuerwehr wäre der Einsatz ohne Frauen nicht möglich.
Also, liebe Frauen, die ihr dieses Buch in den Händen habt. Ich verneige mich vor Euch und werde Euer Können oder Gleichwertigkeit niemals in Abrede stellen. Ihr seid auch mit dem Begriff Feuerwehrmann gemeint.
1976 Bild: Feuerwehr Köln
2017 Bild: Miklos Laubert
Mein Werdegang in Kurzform
Von Januar 1976 bis Oktober 2017 bei der Berufsfeuerwehr Köln.
Im mittleren Dienst (mD) als Feuerwehrmann-Anwärter begonnen, als Zugführer und Einsatzleiter im gehobenen (gD) Dienst in Pension gegangen.
Die wichtigsten Ausbildungen:
Rettungsassistent, Notarztassistent, (eingesetzt auch auf Ambulanzflugzeugen und Rettungshubschraubern)
Rettungs- und Bergungstaucher
Kranführer
ABC (Gefahrgut) Fachausbilder
26 Jahre FW 1 (Innenstadt)
8 Jahre FW 10 und Löschbootstation (Köln Deutz)
5 Jahre Leitstelle (Köln Weidenpesch)
2 Jahre Branddirektion (Köln Weidenpesch)
Kurzzeitig FW 3 (Köln Lindenthal), FW 9 (Köln Mülheim)
Ich bin kein Held!
Die arbeiten in Altenheimen, Krankenhäusern oder Hospizen.
Ich bezeichne mich selbst als halbwegs normalen Menschen - was ist normal? Mit Macken, nicht immer souverän, der in seinem Berufsleben viel erlebt hat.
Meine Psyche und Physis sind vielleicht etwas angegriffen.
Rücken, Knie, Schulter sind betroffen. Meine Augenbrauen sind nur noch unsichtbare Stoppeln, da sie irgendwann „den Flammen zum Opfer“ gefallen sind. Die Haut am Kopf, den Beinen und Armen, dort wo früher alle Gifte wegen mangelhafter Schutzkleidung direkten Zugang zum Körper hatten, ist überempfindlich und bedarf intensiver Pflege. Daraus einen Anspruch herzuleiten, würde meine Lebenszeit weit überschreiten. Kölner Grundregeln besagen: „Et es, wie et es“ (sieh den Tatsachen ins Auge) oder „et kütt, wie et kütt (hab keine Angst vor der Zukunft). Es ist alles auszuhalten.
In mir gibt es aber keinen Zweifel. Der Beruf erfüllte mich mit großer Freude. Ich habe Spaß am Leben, widme mich der Familie und meinen Hobbys, reise gerne. Wie sagt man? „Alles gut!“
Mein Beruf war der eines Feuerwehrbeamten in einer Großstadt. Das, was diesen Beruf ausmacht, versuche ich in diesem Buch zu beschreiben.
Die ehrenwerte Arbeit der freiwilligen Feuerwehren in Köln kommt dabei etwas zu kurz. Die Mitglieder der Löschgruppen mögen mit das verzeihen.
Mit vielen habe ich sehr gut und effektiv Einsätze absolviert. Auch menschlich hat es gepasst. In Köln würden ohne die Mitarbeit der freiwilligen Feuerwehren (27 Löschgruppen) die Sicherheit und der Schutz der Bürger zusammenbrechen.
Es werden auch interne Abläufe der Feuerwehr Köln beschrieben, damit man sich ein Bild davon machen kann, aus welchen Menschen sich diese Großstadtfeuerwehr zusammensetzt und welche Arbeit Tag für Tag geleistet wird, um Sicherheit und Schutz zu garantieren.
Wie in jedem großen städtischen Amt, läuft auch bei uns nicht alles glatt. Fehlentscheidungen, Fehleinschätzungen, Fehlbesetzungen von Stellen, Selbstüberschätzung eigener Fähigkeiten.
Sicher wäre es einfach, allein durch die vielen Jahre meiner Berufserfahrung, nur über dramatische Einsätze zu berichten. Der Fundus ist nach über 41 Berufsjahren sehr groß.
Doch das ist mir zu wenig. Die Menschen, die diesem Beruf nachgehen, ihre Handlungsweisen, Ansichten, Ausdrucksweisen, geben mehr Stoff, als nur der Einsatz allein.
Es werden keine fiktiven Geschichten zu lesen sein. Namen habe ich hier und da verändert. Natürlich werden sich Kollegen hier wiederfinden. Das bleibt nicht aus. Sollte sich jemand auf den Schlips getreten fühlen…ich kann es nicht ändern.
Feuer Kegelbahn
Mal wieder nachts unterwegs zu einem Feuer
Wir hatten tagsüber bereits zwei kleinere Brände zu löschen. Ich trage meine dritte Garnitur Unterwäsche und die persönliche Ausrüstung - Schutzmantel, Handschuhe, Atemschutzmaske, Helm - ist auch auf Vordermann gebracht worden.
Es brennt in einem benachbarten Wachbezirk im Kölner Westen. Der Einsatzleiter vor Ort hat die Alarmstufe erhöht und wir sind zur Unterstützung unterwegs.
Durch den Funkverkehr bekommen wir in etwa mit, was dort brennt. Ein Feuer auf der Kegelbahn im Keller einer Gaststätte. Kein gutes Gefühl. Alles voller Holz, meist enge Zugänge und damit auch schwer wieder herauszukommen, wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht.
Kaum habe ich den Gedanken im Kopf, hören wir eine Blitzmeldung im Funk.
Es werden ein RTW und ein NEF angefordert, da sich ein Kollege verletzt hat. Meine Mitstreiter aus dem Angriffstrupp und ich schauen uns an. Wortlos! Jeder hat unsichtbar „Scheiße“ auf der Stirn stehen und jeder denkt: „Wer ist es, kenn ich den? Wie schwer hat es ihn erwischt?“ Die Gedanken bleiben, aber jetzt muss Professionalität die Oberhand haben.
Auf der engen Sitzbank im LF machen drei Mann die gleichen Handgriffe.
Sitzt die Atemschutzmaske richtig? Ist der Kragen vom Schutzmantel zu?
Lässt sich der Sperrriegel, der das Atemschutzgerät in seiner Halterung hält, frei bewegen? Sitzt die Vergurtung vom Atemschutzgerät und vom Sicherheitsgurt richtig? Alle Handgriffe einstudiert und schon so oft gemacht. Trotzdem gehen die Hände immer an die gleichen Stellen.
Jeder Mensch handelt in bestimmten Situationen so. Man weiß genau, dass alles stimmt, alles passt und trotzdem wird alles mehrmals überprüft.
Unser Zugführer, „Vati“ mit Spitznamen, hat im Funkverkehr mitbekommen, dass der Brand sich ausbreitet und ein dritter Löschzug angefordert wurde. Wie es so seine Art ist, meint er: „Ihr geht runter und macht den Mist aus! Vorher kommt ihr nicht raus. Wir sind 1er!“
Welche Arroganz! Als wenn wir besser wären, als Kollegen von anderen Wachen.
Ja, sind wir! Wir fahren die meisten Einsätze, wir löschen mehr Feuer als die Kollegen auf anderen Wachen. Wir sind 1er! Wir sind die Ledernacken.
Nein, sind wir ganz bestimmt nicht! Wir sind genauso gut oder schlecht, wie alle anderen Kollegen auf den Kölner Feuerwachen. Wir haben nur mehr Einsätze und damit mehr Erfahrung und Routine. Sich das „Ledernacken-Denken“ einzureden hilft aber, das Selbstbewusstsein zu stärken. Wir müssen gleich irgendwo reingehen, wo andere raus laufen.
Fast die ganze Straße ist voller Rauch. Wir begeben uns im Laufschritt- so gut das eben mit fast 30 Kilogramm Ausrüstung geht - zur Einsatzstelle. Vati hat sich mit dem Einsatzleiter abgesprochen.
„Ihr könnt entlang der Schlauchleitung gehen, das Strahlrohr liegt an der Treppe“. Mehr nicht. Warum auch? Er hat ja auf der Anfahrt alles gesagt.
Selbst aus dem dritten Stockwerk dringt Rauch. Oh Mann, da geht auf der Kegelbahn aber einiges ab. Als Truppführer gehe ich hinten. Peter ist Strahlrohrführer, Dietmar geht in der Mitte.
Der Zugang zur Kegelbahn ist nur durch die Gaststätte zu erreichen. Alles heiß, alles schwarz verqualmt, alles eng. Ich weiß genau, wenn wir hier raus gehen, sind unsere Ohren und der Nacken wieder knallrot. Wenn es gut geht. Wenn es schiefgeht, hängt die Haut runter, weil wir uns verbrüht haben oder man spürt diesen dumpfen Schmerz an den Ohren, der von einer Verbrennung zeugt.
Jetzt setzt bei uns Dreien etwas ein, was keiner erklären kann.
Wir wollen da runter und den Brand löschen. Ohne Erfolgserlebnis gehen wir nicht raus!
Kurze Absprache: „Wir gehen die Treppe rückwärts kriechend runter, erst mal orientieren“
Am Ende der Treppe geht es 5 Meter geradeaus, dann ein etwa 20 Meter langer Gang rechts in Richtung Kegelbahn.
Peter will um die Ecke Richtung Gang kriechen und prallt sofort zurück. „Zu heiß“ höre ich ihn undeutlich durch die Atemschutzmaske sagen. OK, dann schaue ich mir das mal selber an. Ich krieche nach vorne, schaue um die Ecke und pralle zurück. Peter hat recht, zu heiß!
Ich bin versucht, meinem Zugführer über Funk zu sagen, dass wir an den Brand nicht herankommen. Kommen wir das wirklich nicht?
Ich spreche mich mit meinen Truppmännern nochmals ab.
„Mach das Strahlrohr auf und wir versuchen, auf dem Boden kriechend vorwärts zu kommen. Der Wasserdampf müsste über uns abziehen. Vielleicht können wir dadurch alles etwas abkühlen“
Drei Mann, ein Trupp. Wenn Peter oder Dietmar auch nur leicht gezögert hätten, hätte ich den Rückzug angetreten und die Kollegen oben müssten sich was anderes einfallen lassen. Aber wir drei zusammen haben schon gut 160 Brandeinsätze hinter uns. Keine Hektik, kein unüberlegtes Handeln, keine Angst. Wir wissen was wir können. Noch verjagt uns diese „höllische“ Umgebung nicht.
„Probieren wir es!“
Meine Sicht ist plötzlich eingeschränkt. Das Kunststoffvisier am Helm hat sich durch die Hitze verformt und ist nach unten gerutscht. Bei den anderen beiden sieht es auch nicht besser aus. Was machen wir hier bloß? Gehen wir doch raus und andere sollen den Keller einschäumen. Aber das dauert seine Zeit und wir sind kurz vor dem Ziel.
Das Strahlrohr auf gemacht und erst mal um die Ecke gehalten. Eine Menge Wasserdampf zieht über uns hinweg und die Ohren fangen zu kribbeln. Durch so ein C- Strahlrohr fließen hundert Liter in der Minute. Peter schließt das Strahlrohr und schraubt das Mundstück ab. Somit fließen 200 Liter in der Minute Richtung Feuer. Viel hilft viel!
Bilder: Lothar Schneid
In diesem Gemisch aus Wasserdampf, Brandrauch und dem Wasser aus unserem Strahlrohr können wir uns langsam weiterbewegen. 20 Meter sind verdammt lang in dieser Situation.
Erst schemenhaft, dann immer deutlicher sehen wir Flammenschein. Peter hält das Strahlrohr in Richtung Flammen. Dietmar und ich liegen etwas hinter ihm. 80 Prozent des Raumes über uns ist mit schwarzem Rauch gefüllt. Keine Sicht und sehr heiß. Wir kriechen durch warmes Löschwasser. Habe ich noch eine saubere Garnitur Unterwäsche auf der Wache? Ein absurder Gedanke hier und jetzt.
Mein Funkgerät plärrt, aber ich kann nichts verstehen. Es ist zu laut um uns herum. Ein offenes Strahlrohr, das Atemgeräusch von den PA und der heftiger Brand machen ziemlich Lärm. Ich kann mir aber denken, warum mein Funkgerät Töne von sich gibt. Vati will wissen, wie es aussieht. Ich sage nur kurz: „Wir sind am Feuer“. Zweckoptimismus.
Ich weiß nicht, wie lange wir dort gelegen haben. Die einzige Zeitbegrenzung in diesen Situationen ist der Rückzugswarner des Atemschutzgerätes. Dies ist ein durchdringendes Pfeifen, das je nach körperlicher Anstrengung nach 20 bis 30 Minuten Einsatzzeit ertönt.
Der Flammenschein wird weniger. Offensichtlich haben wir mit unserer Vorgehensweise einen „Treffer“ erzielt. Ich habe auch keine Lust mehr. Der ganze Körper schmerzt. Sei es durch die Hitze, die schwere Ausrüstung oder die Körperhaltung. Ist mir egal, ich will hier raus. Dietmars Atemschutzgerät fängt an zu pfeifen. Da hat Peter noch eine Idee. Er findet einige Stühle und Tische und fängt an, das Strahlrohr mit dem Schlauch durch zusammenstellen der Möbel festzuklemmen. Klasse Idee. Wir geben nochmal alles, um das hinzubekommen. Es klappt. Jetzt löscht das Strahlrohr halt alleine. Raus, nichts wie raus. Der nächste Trupp muss anrücken. Am Schlauch entlang getastet und die Treppe rauf. Noch im Hausflur reißen wir uns die Atemschutzmasken vom Gesicht. Luft wollen wir, kühle Umgebungsluft. Unsere Körper kochen.
Vati erwartet uns. „Wie sieht’s aus da unten?“ Ich gebe einen kurzen Bericht ab, erwähne, dass das Strahlrohr festgeklemmt wurde und irgendwann die Kegelbahn wohl unter Wasser stehen wird.
„Gut“. Mehr sagt er nicht. Warum auch. Wir haben unseren Auftrag, seinen Auftrag, erledigt. Wir haben das gemacht, was ein Feuerwehrmann machen muss. Ich gebe meine Kenntnisse an den uns nachfolgenden Trupp weiter, sage ihm dann: „Da unten steht alles unter Wasser, aber es ist warm“. Der Truppführer lächelt mich gequält an. „Wollte heute eh noch duschen“. Ein Klaps auf die Schulter. Jetzt muss dieser Trupp dort unten kämpfen.
Ausrüstung ablegen. Helm, PA, Lederhandschuhe, Schutzmantel. Wir „untersuchen“ uns gegenseitig. Wir drei sind völlig durchnässt, haben knallrote Ohren und Nacken die brennen, die Knie werden wohl auch was abbekommen haben. Da, wo die Schutzkleidung eben nicht geschützt hat, sind wir vom Brandrauch schwarz. Körperlich erschöpft. Aber stolz! Nicht, weil wir vielleicht größeren Schaden abgewendet oder den Job eines Feuerwehrmannes gemacht haben. Nein, wir haben Vatis Auftrag erledigt. Wir haben nicht aufgegeben. Wir sind 1er!
Bilder: Feuerwehr Köln
Bild: Helmut Jüliger
Wohnungsbrand
Die Institution Feuerwehr
Bei vielen Menschen, die ich im Einsatz kennen gelernt habe, war unsere Begegnung eine einseitige Sache.
Sie waren tot, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe.
Die Altersspanne der toten Menschen in meinem Berufsleben umfasst alle Stadien, die man kennt.
Der tote Säugling - auch im Mutterleib - sowie der über hundertjährige Mensch sind mir begegnet.
Ich hatte bei der Idee zu diesem Buch immer wieder den Gedanken, ob es sich eventuell um eine Maßnahme zur Verarbeitung persönlicher Erlebnisse handelt. Von der Hand zu weisen ist das nicht. Meine Berufserfahrung zeigt, dass negative, wie auch positive Erlebnisse sich durch Mitteilung an die Umwelt abschwächen können.
Die Feuerwehr wird als Institution angesehen. Es kommen nicht die Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen, sondern "Die Feuerwehr". Viele Menschen vergessen: Unter jedem Helm steckt nur ein Mensch!
Die Feuerwehr ist die letzte Instanz bei Notfällen. Nach der Feuerwehr kommt nichts mehr. Wir gehen rein, wenn andere raus laufen.
Doch woraus besteht diese "Institution"?
Aus Menschen. Großen, kleinen, guten, schlechten, intelligenten, schlauen - ja, da mache ich einen Unterschied. Wir sind ein Querschnitt der Bevölkerung. Menschen mit einem außergewöhnlichen Beruf.
Ein Vorgesetzter sagte mal zu mir: „Wir sind alle grün! Manche sind hellgrün, manche dunkelgrün“
Warum übte ich diesen Beruf aus? Nein, nicht unbedingt wegen der Floskel: „Ich will Menschen in Not helfen“. Der Gedanke spielte eine Rolle, doch andere, selten in der Öffentlichkeit genannte Dinge, sind ausschlaggebend gewesen für meine Berufswahl. Teilweise Mythen - die Realität hat mich relativ schnell eingeholt.
Die Alarmfahrt.
Bild: Michael Breuning FW 10
In erster Linie war es die Vorstellung, dass es doch ein tolles Gefühl sein muss, mit Blaulicht und Signalhorn durch die Straßen zu fahren. Alles muss zur Seite fahren. Platz da, jetzt komm‘ ich.
Nach wenigen Jahren hatte ich allerdings schon das Gefühl, dass der ewige Stress der Alarmfahrt und das laute Geräusch des Signalhorns mich krank machen. Die Erkenntnis kommt bei vielen meiner Berufskollegen nach einiger Zeit. Es macht definitiv keinen Spaß und birgt ein immens hohes Unfallrisiko.
Bild: Lothar Schneid
Verunfalltes Notarzteinsatzfahrzeug
Die Technik.
Technik bei der Feuerwehr ist so ziemlich das Schönste, was ein Technikfreak sich vorstellen kann. Die Handhabung der Fahrzeuge, Gerätschaften, das ewige Lernen, um neue Technik zu beherrschen. Das Gefühl ist bis zum Schluss geblieben.
Pumpen - Bedienfeld Löschfahrzeug
Bilder: Lothar Schneid
Wärmebildkamera
Hydraulischer Rettungsspreizer mit
Rückentragegestell
Die Arbeitszeit.
Mir gefiel es von Anfang an, im 24-Stunden-Dienst zu arbeiten, an Sonn- und Feiertagen meine Sachen zu packen, um auf die Wache zu fahren. Warum, das habe ich bis heute nicht begriffen.
Heute weiß ich aber auch, dass diese Arbeitszeiten das Privatleben extrem beeinträchtigen. Und es braucht eine sehr tolerante Familie, um das dauerhaft zu akzeptieren.
Der Kick.
Als erster vor Ort zu sein, alles zu sehen, Gaffer weg zu schicken, abzusperren, mit der Nase ganz dicht dabei zu sein, wo der "Normalmensch" nicht hinkommt. Ja, auch das hat mich lange gereizt und auch fasziniert.
Bild: FW 1
Die Uniform.
"Gib dem Buckligen eine Uniform und er wird gerade stehen."
Der Stolz, eine Uniform mit Dienstrangabzeichen zu tragen, ist unbeschreiblich. So war es bei mir. Es hebt einen von der Masse ab. Heute sehe ich auch das differenzierter. Einige Kollegen sind zu sehr der Meinung, dass ihre Uniform oder ein hoher Dienstrang einen „besseren“ Menschen aus ihnen macht. Genau die braucht keiner.
Die Kollegen.
Bild: Miklos Laubert
Ich kenne keinen Beruf, bei dem Kollegen so eng zusammenarbeiten, wie bei der Feuerwehr. Es ist ein Miteinander – im Guten wie im Schlechten - das kaum beschrieben werden kann.
Bild: Frank Kirsch FW 1
Bild: Miklos Laubert
Bild: FW 1
Bild: FW 10