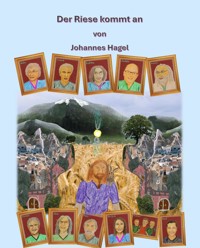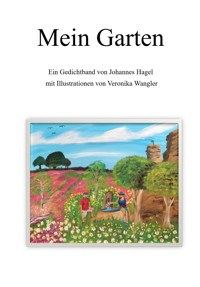1,99 €
Mehr erfahren.
Die vorliegende Novelle schildert das äußerst seltsame Erlebnis eines Kindes von neun Jahren aus dessen Sicht und in der Zeit der Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts. Genauer gesagt, geht es um die Schilderung der Ereignisse rund um den Muttertag des Jahres 1965, am 9. Mai. Die Geschichte beruht auf Tatsachen und Erinnerungen des Autors, die relativ präzise sind und dennoch Erlebnisse enthalten, die unmöglich sind und sich der Normalität klar entziehen. Aber auch die intensiv religiöse Erziehung des Jungen im Sinne einer fundamentalen Auslegung des Katholizismus, spielt eine entscheidende Rolle. Und schließlich ist da noch die beginnende naturwissenschaftliche Begeisterung des Kindes, das sich unwissentlich in größte Gefahr begibt. Die unmittelbare Folge dieser Neugierde führt den Jungen schließlich in die größte Gewissenskrise seiner Kindheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Prolog
Die vorliegende Novelle enthält verschiedene Aspekte.
Zum einen Teil ist sie der Versuch, mein Heimatland der späteren Nachkriegszeit aus der Sicht eines neunjährigen Kindes zu beschreiben und zu verstehen. Die Geschichte spielt im Mai des Jahres 1965. Der Krieg war zwanzig Jahre zuvor zu Ende gegangen und Österreich war vor zehn Jahren unabhängig und politisch neutral geworden. Die Wirtschaft hatte sich erholt und es ging allgemein aufwärts. Und dennoch war es eine Zeit und eine Gesellschaft, die mit unserer Gegenwart wenig gemein hatte.
Andererseits geht es um die Beziehung des kindlichen Protagonisten zur Religion. Für ein Kind mit viel Fantasie, war es damals nicht immer leicht. Dies zeigte sich vor allem, wenn Fragen gestellt wurden zu den tradierten religiösen Vorstellungen des österreichischen Katholizismus jener Zeit. Fragen oder gar kritische Fragen zu diesem Komplex sollte ein Kind besser nicht stellen, und wenn es doch geschah, so wurde dem Fragesteller von klerikaler Seite oft große Angst gemacht vor den Qualen der Hölle, die jeden treffen würde, der es wagte, abzuweichen von der einen Wahrheit, die die angeblich einzig wahre, römisch-katholische Kirche, für sich gepachtet zu haben schien.
Und schließlich geht es um das früh erwachte Interesse des Erzählers an der sich entwickelnden Technik und den Naturwissenschaften. Das nicht auf Glaubenssätzen basierende Wissen über die Naturgesetze war stets ein willkommener Gegenpol zu all den diffusen und vor allem bedrohlichen religiösen Ansichten zum Sein und zum Sinn des Lebens. Welcher sich weder dem Kind noch später dem Erwachsenen je erschließen sollte, allen Bemühungen zum Trotz. Das Experimentieren und Probieren von Zusammenhängen hingegen, die Verlässlichkeit, die von der Reproduzierbarkeit der Experimente ausging, gab Sicherheit.Von diesem Zwiespalt her ist es zu verstehen, dass das Kind der Gelegenheit und Versuchung, die aus Uranglas gefertigte Vase seines Großvaters spielerisch zu untersuchen, nicht widerstehen konnte. Diese Versuche waren in mehrfacher Hinsicht gefährlich und glücklicherweise geschah kein Unglück. Dennoch führte ein unvorhergesehener Zwischenfall, eine unmittelbare Folge der übergroßen Neugierde, das Kind in eine große Gewissenskrise.
Die Rettung daraus erfolgte überraschenderweise sowohl von religiöser als auch von physikalischer Seite. Genau an diesem Punkt aber wird jede Erklärung der Ereignisse unmöglich und niemand wird jemals genau wissen, was sich damals, am Muttertag des Jahres 1965 ereignete.
Uranglas
Die Ereignisse, von denen ich euch hier berichte, geschahen in meiner Kindheit. Zeitlich sind sie in der Mitte der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts einzuordnen. Bis heute kann ich mir kein auf Sicherheit beruhendes Urteil darüber bilden, was sich damals tatsächlich ereignete und wie das Geschehen, von dem es zu erzählen gilt, zu deuten ist. Allzu groß sind die Ungereimtheiten, die allen Vorstellungen eines geordneten Ablaufes trotzen, und zu lange liegen die Geschehnisse zurück, als dass ich mich noch vollkommen auf mein Gedächtnis verlassen könnte. Dies sei dem geneigten Leser als Warnung vorangestellt, bevor ich zu berichten beginne, was meine Erinnerung mir erzählt.
Es waren warme, sonnige Tage im Mai, zwischen dem ersten des Monats und dem zweiten Sonntag desselben, der traditionsgemäß der Muttertag war. Gewidmet also diesen emsigen, wie geschlechtslos wirkenden Müttern, die sich, entsprechend dem von Gesellschaft und Kirchen festgelegten Wertekodex dieser Epoche, für Ehemann und Familie aufzuopfern hatten, ohne Recht auf ein Leben, in dem auch die eigenen Wünsche zählten. Umso wichtiger war er, dieser eine Tag im Jahr, an dem die Mütter geehrt wurden, auch wenn es selbstverständlich war, dass der Braten zur Feier des Tages, wie immer, von ihnen selbst gefertigt wurde. Ebenso wie das benutzte Geschirr danach von ihnen gewaschen und weggeräumt wurde nach dem Fest. Bei mir hinterließen diese Beobachtung und vor allem die emotionslosen Gesichter der betroffenen Mütter einen stets befremdlichen Eindruck, wenn ich auch damals, als Kind mit neun Jahren, die Hintergründe nicht verstand.
Und dann hatte der Mai für alle Gläubigen der katholischen Kirchen noch eine ganz besondere Bedeutung. Es war der Marienmonat, also auch eine Art „Muttermonat“, übertragen auf die abstrusen religiösen Vorstellungen dieser Gemeinschaft: Die Mutter eines Predigers namens Jesus, von Gott gezeugt, aber nicht etwa so, wie ein Mann einer Frau zu einem Kind verhilft, sondern jungfräulich, vermittelt über eine dritte göttliche Person, die Maria durch ungeschlechtliche Fortpflanzung zu ihrem ebenfalls göttlichen Sohn verhalf. Und das Ganze nur, weil ein gewisser Papst des neunzehnten Jahrhunderts auf die Idee gekommen war, diese unglaublich prüde Version des Geschehens zu einem Dogma zu erklären. Maria selbst, die man im Himmel zu verorten hatte, wurde von frommen Gläubigen übernatürliche Kräfte zugeschrieben. Und zwar in dem Sinne, dass sie Wunder wirken könnte, wenn man nur fest daran glaubte und ausreichend demutsvoll, wenn auch hartnäckig, um etwas bat. Dabei war es gleichgültig, ob man sich das Bestehen einer Prüfung erbat oder die Gesundung eines von den Ärzten aufgegebenen geliebten Angehörigen. Und um all diese Bestrebungen geordnet zu kanalisieren, gab es seit je her die Einrichtung der Wallfahrt, einer Pilgerreise also, zu einem der Orte, die Maria geweiht waren. Und natürlich fanden diese Veranstaltungen hauptsächlich im Mai statt, wie gesagt, dem Marienmonat. Etwa 130km in nordöstlicher Richtung von meiner Heimatstadt entfernt befand sich ein großer, wichtiger und auch sehr berühmter Wallfahrtsort mit einer imposanten dreischiffigen Kirche, voll von dem barocken schwülstigen Reichtum religiöser Symbole. Da meine Eltern beide streng gläubig waren und – vor allem meine Mutter – diesem Glauben damals mit geradezu abgöttischer Liebe anhing, ließen sie es sich nicht nehmen, an einer dieser Wallfahrten, die normalerweise drei Tage in Anspruch nahmen, teilzunehmen. Da auf solchen Fahrten auch große Teilstrecken zu Fuß zurückgelegt wurden, durften Kinder nicht daran teilnehmen und mussten in diesen Tagen in irgendeiner Weise beaufsichtigt werden.
Ich habe keine Erinnerung daran, wer meine beiden Geschwister hütete. Vor allem mein jüngerer Bruder war damals noch ein in Windeln gewickeltes Kleinkind. Ich selbst wurde von meiner Mutter für die drei Tage vertrauensvoll in die Obhut meiner Großmutter gegeben. Und es muss gesagt sein, dass ich darüber sehr erfreut war, da meine Oma, die „Großmama“, wie ich sie liebevoll nannte, bei aller eigenen religiösen Strenge und Beharrlichkeit, eine wahrhaft liebevolle Person war. Eine temporäre Erziehungsperson also, die meine vollkommene Zustimmung fand, von der ich niemals ein böses Wort hören musste, selbst wenn ich, wie ich mir eingestehen muss, nicht immer einfach zu handhaben war.
Großmama nahm mich auch mit sichtbarer Freude auf und ich erhielt den mir schon von früheren Gelegenheiten bekannten Schlafplatz im alten Schlafzimmer meiner Großeltern. In dem antiken, aus massivem Holz gefertigten Bett, das so hoch war, dass, wenn ich an dessen Rand saß, meine kleinen Füße vom Boden noch gute 20cm entfernt waren. Und es gab diese weichen, mit Entendaunen gefüllten Decken, die sich so wohlig und schwer um den kindlichen Körper schmiegten und ihn in erholsamen tiefen Schlaf zu versetzen vermochten. An der Wand hing eine aus gleichem Holz bestehende uralte Pendeluhr, wohl schon ein Erbstück aus der urgroßväterlichen Generation. Ich kann heute noch mühelos ihr akzentuiertes, dunkles „Tick Tack“ hören und die Tatsache, dass ich es auch heute noch liebe, wenn in meinem Arbeitszimmer Uhren ticken, geht wahrscheinlich auf diese alten Erinnerungen zurück. Zu jeder halben Stunde ertönte ein melodischer einzelner Glockenschlag und zur vollen Stunde waren es immer 4 helle Schläge, einer für jede viertel Stunde und so viele tiefe, volle Gongs, wie es der gerade erreichten Stunde entsprach. Im Zimmer hallten die Schläge noch mehrere Sekunden nach und manchmal konnte man ihr Echo noch in dem leisen Klirren der Gläser in der alten Vitrine an der gegenüberliegenden Wand hören, wenn diese nahe genug beieinanderstanden und sich eben leicht berührten.