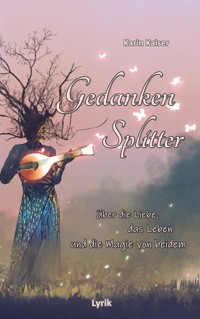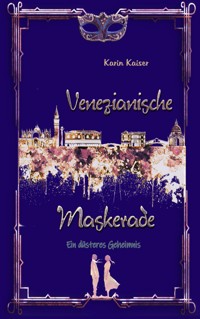1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dana erfährt an ihrem achtzehnten Geburtstag von ihrer todkranken Mutter, dass sie ein Halbvampir ist und ihr seit langem verschwundener Vater von der Strigoi-Fürstin Erzebet an einem seltsamen Ort festgehalten wird - in der Schattenwelt. Als ihre Mutter im Sterben liegt, fasst sie sich ein Herz und sucht trotz unbekannter Gefahren die fremde Welt auf, um ihren Vater zu befreien, der mit seinem heilenden Vampirblut die Mutter vor dem sicheren Tod retten kann. Unerwartete Hilfe erhält Dana dabei vom attraktiven Vampir Francis, dessen leuchtende meerblaue Augen tausend Geheimnisse zu bergen scheinen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Karin Kaiser
Vampirherz
Schattenberührt
Inhaltsverzeichnis
Wirre Träume und ein trauriger Geburtstag
Begegnung mit einem alten Bekannten
Im Schattenland aufgeschlagen
Schmerz und Liebe
Schattenstadt
Düsterer Fund
Die Fürstin
Erlösung
Elysion
Heilung
Wiedersehen
Impressum
Wirre Träume und ein trauriger Geburtstag
Ängstlich wich Dana zurück, bis sie schmerzhaft mit dem Rücken an die kalte Wand des Parkhauses stieß. Ihr rötlich-blondes Haar klebte mit Angstschweiß bedeckt an ihrem Kopf, und in ihren weit aufgerissenen bernsteinfarbenen Augen stand die blanke Panik. Auf dem rattenähnlichen Gesicht ihres Verfolgers lag ein siegesgewisses Lächeln, das Dana eine eiskalte Gänsehaut über den Rücken jagte. Sein Gesicht war weiß wie ein Bettlaken, seine Augen leuchteten stählern und der blutrote Ring, der um seine Iris lag, tat ihr in den Augen weh und verstärkte noch sein furchterregendes Auftreten.
»Jetzt entkommst du mir nicht mehr«, sagte er mit einer unangenehm leisen, rauen Stimme, und über sein Gesicht glitt ein noch grausameres Grinsen.
»Komm mit mir.« Auffordernd streckte er die Hand aus.
»Ich gehe nicht mit Fremden«, antwortete Dana mit einem trotzigen Blick auf den Fremden.
»Dann muss ich dich zwingen«
Er trat jetzt noch näher heran, so nahe, dass Dana vor Grauen schauderte. Sie fühlte seinen heißen, fauligen Atem auf ihrer Wange und fühlte wie der Mut sie mehr und mehr verließ. Sie war ihm wehrlos ausgeliefert. Auf einmal sah sie aus dem Augenwinkel etwas Silbernes auf sich zufliegen. Mit einem Aufschrei ließ sie sich fallen und kurz darauf hörte sie noch einen markerschütternden Schrei, bevor es dunkel um sie wurde.
Als Dana es wieder wagte, die Augen zu öffnen, blickte sie direkt in zwei lang gezogene Augen, die so blau leuchteten wie das Meer an seiner tiefsten Stelle. Diese Augen lagen in einem markanten, aber dennoch fein geschnittenen alabasterfarbenen Gesicht. Seine vollen, geschwungenen Lippen verzogen sich zu einem erleichterten Lächeln.
»Alles in Ordnung?«, fragte er mit einer dunklen, vertrauenerweckenden Stimme und strich Dana sanft über die Wange. Ein feiner Duft nach Blüten, Leder und Rauch umfing sie, ein Duft, den sie niemals vergessen sollte. Benommen richtete Dana sich auf.
»Wer - wer bist du?«, fragte sie heiser.
»Ich bin Francis.«
»Du - du hast mir das Leben gerettet.«
»Ist doch selbstverständlich. Komm, ich bringe dich nach Hause, Kleine.«
»Ich bin schon acht!«
»Verzeihung. Da kann man natürlich nicht mehr »Kleine« sagen« lachte er und hielt ihr seine Hand hin.
Als Dana stand, waren ihre Knie immer noch erschreckend weich und sie fing an zu zittern wie Espenlaub. Ihr Körper sank gegen Francis und sie fing an, haltlos zu weinen. Seine Hand strich immer wieder tröstend über Danas Haar, bis die Schluchzer weniger wurden.
»Lass uns gehen«, sagte er leise. Er legte den Arm um ihre Schultern und sie verließen das Parkhaus. Davor stand ein alter cremefarbener Mercedes, ein Taxi, auf dessen Leuchtschild nur noch das T und das X leuchteten. Francis öffnete die Beifahrertür und ließ Dana einsteigen. Dann setzte er sich hinter das Lenkrad und startete den Motor. Mit einem sanften Dieselbrummen setzte das Auto sich in Bewegung.
Obwohl dieses schreckliche Erlebnis jetzt vorüber war, spürte Dana noch immer die Angst tief in ihren Knochen sitzen. Immer wieder sah sie dieses schreckliche Gesicht vor sich, spürte diesen heißen, fauligen Atem auf ihrer Haut. Angestrengt blickte sie durch das Autofenster und konzentrierte sich auf die Neonreklamen der Clubs, an denen sie vorbeifuhren, damit sie nicht wieder weinen musste.
»Alles in Ordnung?«, holte Francis besorgte Stimme sie wieder zurück in die Wirklichkeit. Erschrocken zuckte Dana zusammen und blickte auf. Wie seltsam, dass seine Augen im Dunkeln leuchteten, so blau wie die Edelsteine, deren Namen ihr gerade nicht einfielen. Genauso wie die Augen des Mannes, der sie überfallen hatte, mit dem Unterschied, dass in Francis Augen nicht diese Kälte und Grausamkeit stand, Francis Blick war warm und schien alle ihre Ängste zu verschlucken. Und der schreckliche rote Ring um seine Augen fehlte.
»Dieser Mann war so seltsam«, antwortete sie nachdenklich. »Was war das für ein Mensch?«
Francis warf Dana einen schnellen Blick zu, bevor er abbog.
»Das war kein Mensch. Es war ein Strigoi.«
»Was ist das?«
»Das ist ein Vampir, der andere Vampire und Wesen der Nacht aussaugt, um deren Kräfte zu erreichen.« Dana wurde blass. »Aber warum wollte er mich entführen? Ich bin doch kein Vampir.«
Francis seufzte. »Das ist eine lange Geschichte, und sie ist nicht für Kinderohren bestimmt. Es wäre zu schrecklich für Dich. Am besten vergisst du dieses Erlebnis so schnell wie möglich.«
Ein eindringlicher Blick traf Dana, und sofort versank sie wieder in einer leuchtenden Flut aus Blau. Sie betrachtete Francis nachdenklich.
»Deine Augen leuchten so wie die von diesem Mann. Bist du auch ein Sti-, Stri-...?«
Francis sandte ihr ein beruhigendes Lächeln zu.
»Nein, das bin ich nicht. Ich bin ein Vampir, aber ich gehöre nicht zu den Bösen.«
Dana runzelte die Stirn. Hielt er sie zum Narren, weil sie ein Kind war? Sie betrachtete ihn von der Seite. Obwohl sie noch ein Kind war, konnte sie sich seiner Schönheit nicht entziehen. Sein Profil war gerade und fein, und aus seinem dunklen, zusammen gefassten Haar hatte sich eine Strähne gelöst, die ihm jungenhaft ins Gesicht fiel. Aber es lag kein verräterisches Lächeln auf seinen Lippen. Noch bevor sie den Kopf wegdrehen konnte, traf sie sein Blick. Er lächelte.
»Du glaubst mir nicht?«
Dana wurde rot und schüttelte den Kopf.
»Mama sagt, es gibt keine Vampire«, antwortete sie zögernd. Ein herausfordernder Blick trat in Francis Augen. Er hielt an der nächsten roten Ampel und öffnete den Mund. Sofort schnellten ein Paar Fangzähne aus seinem Oberkiefer. Mit einem spitzen Schrei drückte Dana sich an die Beifahrertür. Francis fuhr die Fangzähne wieder ein und lächelte amüsiert.
»Nun?«
Dana schüttelte sich. »Mann, wenn ich das in der Schule erzähle...«
»...wird dir niemand glauben« vollendete Francis ihren Satz. »Behalte es besser für dich.«
Viel zu schnell standen sie vor dem mehrstöckigen Gebäude im Stil der Gründerzeit, in dem Dana mit ihrer Mutter wohnte.
»Wir sind da«, sagte Francis.
Mit klopfendem Herzen sah Dana hinauf in den dritten Stock, wo sie mit ihrer Mutter wohnte.
»Was ist? Willst du nicht nach Hause?«
Dana seufzte. »Mama wird bestimmt ziemlich wütend sein.«
»Helena wird sich große Sorgen um dich machen«, antwortete Francis.
»Woher kennst du ihren Namen?«, fragte Dana misstrauisch. Francis lächelte.
»Ich kenne deine Eltern ganz gut. Auf, du musst gehen.«
Dana zögerte noch, die Tür des Taxis zu öffnen. Noch einmal warf sie Francis einen Blick zu.
»Francis, glaubst du, dass mich noch einmal so ein Monster angreift?«
»Das kann schon sein«, antwortete er.
»Bitte, kannst du mit hinauf kommen? Ich habe Angst.« Bittend sah sie ihn an. Francis seufzte ergeben.
»Wie du willst.«
Er stieg aus und begleitete Dana die Treppe hinauf. Vor der Wohnungstür verkroch Dana sich ängstlich hinter Francis Rücken, sodass er klingeln musste. Die Türe öffnete sich und sie sah die roten Locken ihrer Mutter aufleuchten. Ihre grünen Augen blickten Francis erstaunt an.
»Was tust du hier?«
»Ich bringe dir deine Tochter zurück«, antwortete er und zog Dana mit sanfter Gewalt hinter seinem Rücken hervor. Wie müde und traurig Helenas Gesicht aussah! Dunkle Schatten lagen unter ihren Augen und sie waren gerötet, als hätte sie geweint. »Oh, Dana, Gott sei Dank geht es dir gut. Ich habe mir solche Sorgen gemacht!«, rief sie aus, zog Dana an sich und drückte sie so fest, dass diese kaum noch Luft bekam.
»Wo hast du sie gefunden?«, fragte sie zu Francis gewandt.
»Beim alten Parkhaus.«
»Oh Dana, du hast wieder Papa gesucht, stimmt es?«
Dana löste sich von ihrer Mutter und nickte.
»Das wäre fast ins Auge gegangen«, mischte Francis sich ein.
»Mein Gott, ich bin so froh, dass du da warst. Komm herein, Francis.«
Sie machte Platz und ließ Dana und Francis herein.
»Setze dich erst einmal ins Wohnzimmer, Francis. Ich bringe nur Dana noch ins Bett.«
Francis steuerte das Wohnzimmer an, und Helena nahm Dana an der Hand und führte sie in ihr Zimmer. Sie half ihr beim Umziehen wie damals, als Dana noch ganz klein gewesen war, und packte sie fürsorglich ins Bett.
»Versuche ein wenig zu schlafen, Dany,« sagte Helena und drückte Dana einen liebevollen Kuss auf die Stirn.
»Du bist nicht böse, Mama?«, fragte Dana schüchtern.
»Ich bin viel zu froh, dass dir nichts passiert ist, Dana. Bitte tu so etwas nie wieder.«
Dana traten Tränen in die Augen.
»Aber ich muss Papa finden! Ich weiß genau, dass er irgendwo da draußen ist und uns braucht.«
Helena setzte sich wieder an die Bettkante und streichelte sanft das Gesicht ihrer Tochter. Wie ähnlich sie Daniel war! Sie hatte die gleichen dunklen Haare und diese großen honigfarbenen Augen, die so warm leuchteten. Sie konnte nicht verhindern, dass ihr ein Seufzer entwich. Sie vermisste ihn so sehr, dass es wehtat. Überall hatte sie ihn schon gesucht, aber er blieb verschwunden. Aber zum Glück war zumindest Francis jetzt nach vielen Monaten endlich aufgetaucht. Sie musste unbedingt wissen, ob er eine Spur von Daniel gefunden hatte.
»Aber du bist noch ein Kind, Dana. Wenn du groß bist, kannst du ihn meinetwegen so lange suchen, wie du willst. Aber bitte lauf nicht mehr weg. Ich habe doch nur noch dich.«
Dana schluckte schwer, als sie die Tränen in den Augen ihrer Mutter sah. Sie legte ihre kleine Hand auf die ihrer Mutter. »Nein, Mama, ich laufe nicht mehr weg, ich verspreche es dir. Aber wenn ich groß bin, werde ich Papa finden und ihn dir wieder bringen, das verspreche ich auch.«
»Alles klar.«
Helena lächelte und streichelte sanft Danas Wange. »Schlaf jetzt.«
Sie stand auf und wollte die Nachttischlampe ausmachen, aber Dana hielt sie zurück.
»Lass sie an, Mama.«
»Ist gut.«
»Mama?«
»Was ist?«
»Darf ich heute Nacht zu dir ins Bett, wenn ich Angst habe?«
Helena lächelte. »Aber sicher, Dana.«
Sie winkte noch kurz und verließ dann den Raum. Dana war allein. Sie kuschelte sich unter ihre Decke und versuchte einzuschlafen, aber es ging nicht. Egal wie sie sich drehte, alles war unbequem. Und wenn sie die Augen schloss, sah sie wieder diese schrecklichen Augen mit dem roten Ring um die Iris vor sich. Nach einer gefühlten Ewigkeit schlug sie entschlossen die Decke zurück und beschloss, zu Mama ins Bett zu gehen. Sie tappte durch den dunklen Flur in Richtung Schlafzimmer, als sie noch Stimmen aus dem Wohnzimmer hörte. Francis war noch da. Leise schlich Dana zum Wohnzimmer und lugte hinein. Helena und Francis saßen auf der Couch; Francis hatte tröstend den Arm um Helena gelegt und strich beruhigend über ihren Rücken, der unter ihren Schluchzern bebte.
»Ich will mir gar nicht vorstellen, dass Daniel tot sein könnte. Was soll ich ohne ihn tun?«
»Er ist nicht tot, Helena, das weiß ich. Ich werde nach ihm suchen. Aber zuerst ist es wichtig, das Portal in eure Welt wieder zu schließen. Eure Welt wäre verloren, wenn die Strigoi hier eindringen würden. Und Dana braucht dich und deine Liebe. Sie wird euch vor den Strigoi schützen.«
»Wahrscheinlich hast du Recht.«
Helena blickte auf und sah Dana in der Tür stehen.
»Dana, wieso bist du noch wach?,« fragte sie und putze sich die Nase. »Ich kann nicht schlafen. Darf ich mich zu euch setzen?« »Klar, komm her.«
»Darf ich mich zu dir setzen, Francis?«
Helena hob erstaunt die Augenbrauen. Doch dann lächelte sie.
»Jetzt verdrehst du schon kleinen Mädchen den Kopf.«
Er lächelte Dana aufmunternd zu.
»Komm her.«
»Francis, ist das wirklich in Ordnung für dich?«
Statt einer Antwort lächelte er nur. Dana kletterte auf die Couch und ließ sich neben ihm nieder. Er legte den Arm um sie, als würde er jeden Tag kleine Mädchen trösten. Sofort umfing sie wieder ein schwerer Duft nach Blüten, nach Leder und Rauch, dieser Duft war so tröstlich, dass ihr klopfendes Herz schnell wieder einen normalen Rhythmus fand.
Dana erwachte erst wieder, als jemand sie in ihr Bett legte.
»Habe ich dich doch geweckt?«, fragte Francis und strich ihr sanft eine wirre Haarsträhne hinter die Ohren.
Dana richtete sich auf.
»Willst du schon gehen?«
»Ich muss gehen. Es gibt viel Arbeit in der Schattenwelt.«
»Kommst du uns wieder besuchen?«
Er lächelte.
»Bestimmt. Schlaf jetzt, Dana.«
Seine Hand strich über ihre Wange, und er stand auf.
»Francis?«
Er drehte sich um und sah sie fragend an.
»Beschützt du uns vor diesen Strigoi?«
»Ich versuche es«, antwortete er. Auf einmal fiel ihm etwas ein. Er kam zurück an Danas Bett und setzte sich wieder auf die Bettkante. Dann nahm er das große silberne Kreuz mit den geheimnisvoll leuchtenden blauen Edelsteinen von seinem Hals und legte es Dana um.
»Das ist für dich, Dana. Es wird dich beschützen, wenn ich nicht da sein kann. Bis bald, Dana.«
Er beugte sich über Dana und drückte ihr einen leichten Kuss auf die Stirn. Das letzte, was sie noch mitbekam, bevor der Schlaf die Vorherrschaft übernahm, war, dass er sanft seine Hand von der ihren löste.
Ein eigentümliches Rasseln schob sich in Danas Bewusstsein. Die Traumszene verschwand und sie fand sich in ihrem Zimmer wieder. Ihr Blick fiel auf den Wecker, der unbeeindruckt weiter rasselte. Mit einem gezielten Fausthieb brachte Dana ihn zum Schweigen. Sie richtete sich auf und gähnte herzhaft. Langsam schälten sich die gewohnten Umrisse ihrer Möbel aus der Dunkelheit. Ihr Mund war staubtrocken; anscheinend hatte sie in ihrem Traum auch noch die Sahara durchquert. Sie griff neben sich auf den Nachttisch und angelte sich die Wasserflasche. Angenehm kühl lief das Wasser ihre Kehle hinunter. Dana ließ sich mit einem Seufzer wieder ins Kissen fallen und schloss die Augen. Aber einschlafen konnte sie nicht mehr. Grummelnd schälte sie sich wieder aus ihrer Bettdecke. Ein bisschen frische Luft tanken würde sie ein wenig ablenken. Sie stand auf und tastete sich im Dunkeln vor zum Fenster. Auf einmal stieß sie mit dem Knie schmerzhaft gegen die Kante ihres Schreibtisches. Verdammter Mist! Dana hatte ganz vergessen, dass sie gestern ihren Schreibtisch an dieses Fenster gestellt hatte. Er war aus weichem Kiefernholz, das sich aber trotzdem verdammt hart anfühlte. Sie tastete sich an ihrem Kleiderschrank vorbei zum anderen Fenster neben ihrem Bett. Leise zog sie den Rollo hoch und öffnete das Fenster. Das helle Tageslicht blendete Dana. Obwohl die Sonne schien, war die Luft draußen kühl und feucht. Weißer Novembernebel lag auf den Bäumen auf der anderen Straßenseite. Die Erinnerung an ihren Traum kehrte zurück und jagte Dana einen Schauer über den Rücken. Was sie gerade geträumt hatte, war wirklich passiert. Sie hatte damals wie verrückt nach ihrem Vater gesucht. Wenn Francis damals nicht gewesen wäre, wäre das das Letzte gewesen, was sie in ihrem Leben getan hätte. Seit er ihr vor zehn Jahren dieses Kreuz geschenkt hatte, hatte sie ihn nicht mehr gesehen. Auch ihr Vater blieb verschwunden. Danas Erinnerung kehrte zu jenem Zeitpunkt zurück, als sie ihren Vater das letzte Mal gesehen hatte. Entgegen seiner bisherigen Gewohnheit hatte er sie damals noch spät abends in ihrem Zimmer besucht. Aus irgendeinem Grund war sie wach gewesen. Er hatte sich an ihr Bett gesetzt, ihr mit den Fingern die wirren Haare geglättet und ihr erzählt, dass er ein paar Tage fortgehen müsse. Natürlich wollte Dana ihn unbedingt begleiten, aber er hatte ihr gesagt, dass dies zu gefährlich für ein kleines Mädchen sei. Dann hatte er sie auf die Stirn geküsst.
»Egal, was passiert, ich werde dich immer lieb haben«, hatte er gesagt. Dann hatte er ihre Wange gestreichelt und war aus dem Zimmer gegangen.
Mit einem Seufzen tauchte Dana wieder aus der Vergangenheit auf und spürte verwundert, dass ihre Wangen tränennass waren. Es tat noch immer weh, dass er einfach nicht mehr zurückgekommen war. Niemand wusste, was mit ihm geschehen war. Aber gerade jetzt, als ihre Mutter mit Leukämie im Krankenhaus lag, hätte sie ihn dringend gebraucht. Dana spielte zwar die Tapfere und hatte ihrer Mutter, wie schon so oft in letzter Zeit, versichert, dass sie klar kam. Die Wahrheit war aber, dass sie eigentlich gar nicht klar kam. Okay, in der Schule war sie abgelenkt, genau wie während des Kochens oder bei der Hausarbeit. Sie traf sich oft mit Vivi, ihrer besten Freundin, die mit ihren Eltern in der Wohnung gegenüber ihrer eigenen wohnte. Sie waren eine große Hilfe für Dana, aber sie wollte diese Leute nicht dauernd mit ihrer Trauer und ihrer Hilflosigkeit nerven. Und so saß sie abends oft im grünen Lieblingssessel ihrer Mutter und starrte vor sich hin. Manchmal spielte sie auch auf dem Klavier ihres Vaters, das noch immer im Wohnzimmer stand. Ihre Mutter hatte es nicht übers Herz gebracht, es zu verkaufen. Aber je öfter sie spielte, desto mehr vermisste sie ihren Vater. Vor allem seit der Diagnose im Krankenhaus. Sie seufzte und ging an ihren Schreibtisch. In der Schublade dort hütete sie die paar Schätze, die sie von ihrem Vater hatte. Den kleinen Teddybären hatte sie zu ihrem fünften Geburtstag von ihm bekommen, die silberne Kette mit dem Herz zu ihrem siebten Geburtstag, das wertvollste aber war das Foto. Es zeigte ihre Mutter und ihren Vater; er hatte Dana auf dem Schoss. Damals war sie fünf Jahre alt gewesen. Seine fein geschwungenen Lippen lächelten Dana entgegen. Das Einzige, was sie noch von ihm hatte, war dieses Foto, das zu einer Zeit gemacht wurde, als sie noch eine glückliche Familie gewesen waren. Warum konnte man nur nicht die Zeit zurückdrehen? Sie seufzte und ging ins Bad. Ein Blick in den Spiegel zeigte ein schmales, blasses Gesicht, das umrahmt wurde von dunkelbraunen Haaren, die dringend eine Wäsche nötig hatten. Ihre großen honigfarbenen Augen waren rot gerändert von den Tränen, und das rote Schlafanzugoberteil schlackerte nur so um ihren Körper. Aber seit ihre Mutter so krank war, hatte sie einfach kaum noch Appetit. Das musste sich unbedingt ändern. Wenn sie krank und klapprig war, war sie ihrer Mutter keine Hilfe. Entschlossen schaufelte sie sich eine Ladung Wasser ins Gesicht und machte sich auf den Weg in die Küche. Nach einem sehr reichhaltigen Frühstück verließ sie fast gut gelaunt die Wohnung, um ihre Mutter im Krankenhaus zu besuchen.
Mit einem leisen Surren öffneten sich die Glastüren des Krankenhauses, als Dana auf den Kontakt im Boden trat. Sofort strömte der scharfe antiseptische Geruch von Desinfektionsmitteln in ihre Nase. Sie unterdrückte den Würgreiz, der sie an diesem Ort immer wieder überfiel und trat ein. Die feuchten Kunststoffsohlen ihrer Chucks quietschten unangenehm auf dem blank gewienerten taubenblauen Linoleum, mit dem der Eingangsbereich ausgelegt war. Die einzigen Farbtupfer in dem sauber weißen Gebäude waren die modernen Bilder an den weiß verputzten Wänden und die bunten Türrahmen. Auf ihrem Weg durch den langen Flur bis zu den Aufzügen kamen ihr weißgekleidete Schwestern und Pfleger, die Krankenbetten vor sich her schoben, ein paar ältere Leute im Bademantel und müde, abgehetzte Besucher entgegen. Als Dana schon vor dem blau gestrichenen Aufzug stand, beschloss sie, heute die Treppe hinauf zu gehen. Sie bog nach links ab und lief die Treppe hinauf, in den ersten Stock zur Krebsstation. Ein paar bleiche, abgezehrte Frauen begegneten ihr, als sie zum Zimmer ihrer Mutter ging.
Sie klopfte an die Tür und als sie keine Antwort hörte, trat sie ein. Am Bett ihrer Mutter saß eine noch recht junge, blonde Frau im Arztkittel, die bei Danas Eintreten lächelnd aufblickte.
»Hallo«, sagte sie zur Begrüßung.
Ihre Rockstar-Stimme stand in krassem Gegensatz zu ihrem zarten Äußeren.
»Störe ich?«
»Aber nein. Wir sind hier fertig«, antwortete die Ärztin und stand auf.
»Wir sehen uns morgen wieder, Frau Meining.«
Sie nickte Dana und ihrer Mutter noch freundlich zu.
Heute lag ihre Mutter zur Abwechslung einmal nicht kraftlos im Bett, sondern hatte sich aufgesetzt. Natürlich war ihr Gesicht müde und abgezehrt, aber ihr langes rotes Haar war frisch gewaschen und fiel in weichen Locken über ihre Schultern. Und sie hatte eine schicke Bluse und eine Jeans an. Ihr Haar war immer noch voll, kein einziges war ihr während der starken und kräftezehrenden Chemotherapie ausgefallen. Ihr Gesicht war totenblass und unter ihren grünen Augen lagen tiefe schwarze Ringe, aber sie strahlten, und ihre blassen Lippen lächelten.
»Hallo, Geburtstagskind!«, begrüßte sie Dana und klang fast fröhlich. Vor lauter Sorgen hatte Dana glatt ihren eigenen Geburtstag vergessen. Sie setzte sich an das Bett ihrer Mutter und ließ sich liebevoll umarmen.
»Meine Güte, ich kann kaum glauben, dass mein kleines Mädchen schon 18 ist.«
Helena wirkte so stolz und glücklich, dass Dana sich heftig beherrschen musste, um nicht zu weinen.
»Alles Liebe zum Geburtstag.«
»Danke, Mama.«
»Ich habe ein Geschenk für dich, Dana.«
Erstaunt schossen Danas Augenbrauen nach oben. Ihre Mutter war doch gar nicht aus dem Krankenhaus herausgekommen. Sie lächelte, als hätte sie Danas Gedanken erraten. Aber sie sagte nichts, sie beugte sich nur in Richtung ihres Nachttisches, zog die obere Schublade aus und holte ein kleines Päckchen hervor. Dies drückte sie der erstaunten Dana in die Hand.
»Pack es aus. Ich bin so neugierig, wie es dir gefällt«, forderte Helena ihre Tochter auf. Dana tat ihr den Gefallen und riss das Geschenkpapier auf. Zum Vorschein kam ein Schmuck-Schächtelchen.
»Was ist das?«, fragte sie überrascht. Helena lächelte.
»Das wirst du gleich sehen.«
In der kleinen Schachtel lag ein silberner Armreif, der mit kunstvollen Ornamenten verziert und mit Edelsteinen besetzt war, die in einem geheimnisvollen honigfarbenen Feuer leuchteten. Vorsichtig nahm Dana den Armreif heraus, um ihn zu betrachten. Bewundernd strich sie über die seltsamen, aber schönen und kunstvollen Gravuren und die leuchtenden Steine.
»Wo hast du das her, Mama?«
»Es war Francis‹ Geschenk zu deiner Taufe, Dana. Er hat mich gebeten, es dir zu geben, wenn du groß genug bist. Sieh nur, die Steine haben die gleiche Farbe wie deine Augen.«
Dana legte den Armreif so vorsichtig an, als könnte er jeden Moment in tausend Teile zerbrechen.
»Er ist so schön«, hauchte sie beeindruckt.
»Und dass er von Francis ist, macht ihn noch wertvoller, nicht?«
Nicht mal in diesem Zustand konnte Helena es sich verkneifen, Dana aufzuziehen. Danas Wangen brannten wie Feuer und sie senkte den Blick. Die letzten paar Jahre hatte sie häufiger an ihn denken müssen, als ihr lieb war. Wo war er? Seit er sie vor zehn Jahren vor diesem Strigoi gerettet hatte, hatte sie ihn nie wieder gesehen. Die einzige Erinnerung, die sie an ihn hatte, war die Silberkette mit dem großen silbernen Kreuz, das besetzt war mit dunkelblau leuchtenden Edelsteinen. Und ihren Traum. Seit ihre Mutter krank war, träumte sie jede Nacht diesen Traum. Sie hatte sich so wohl und sicher bei Francis gefühlt, dass sie ihn jedes Mal fast schmerzlich vermisste, wenn sie erwachte.
»Da ist was dran. Danke, Mama.«
Sie drückte ihrer Mutter einen liebevollen Kuss auf die Stirn.
»War Vivi schon da?«
Dana lächelte. »Ich habe heute noch gar nichts von ihr gehört. Ich glaube, die brütet noch was aus.« »Schön, dass du mal wieder lächelst. Ach, Dana, es tut mir so leid, dass du in deinem Alter so viel durchmachen musst«, sagte Helena leise.
Dana nahm ihre Hand. »Mama, es ist nun mal so wie es ist. Da müssen wir beide eben durch.«
Sie seufzte.
»Es wäre natürlich vieles einfacher, wenn Papa da wäre.«
»Da hast du Recht. Aber wir sollten heute keinen trüben Gedanken nachhängen. Komm, wir gehen in die Cafeteria, ich habe dort noch eine kleine Überraschung.«
Dana half ihrer Mutter aus dem Bett und hakte sie unter.
In der Cafeteria war schon ein Tisch hergerichtet, auf dem Danas Lieblingstorte, ein Strauß mit kleinen roten Rosen und ein Piccolo standen.
»Sie haben mir heute ausnahmsweise erlaubt, ein Gläschen Sekt mit dir zu trinken«, sagte Helena lächelnd, als sie sich setzten.
Es war so schön, endlich für kurze Zeit die Sorgen zu vergessen. Doch bereits nach einer halben Stunde sah Dana, dass ihre Mutter völlig erschöpft war. Aber wenigstens strahlten deren Augen wieder ein wenig. Dana seufzte. Wenigstens hatten sie eine Zeitlang einen Hauch von Normalität. Sie wollte so lange wie möglich daran festhalten und ihre Mutter anscheinend auch. Doch nach einer weiteren halben Stunde musste Dana ihre Mutter wieder nach oben bringen, damit sie sich ausruhen konnte.
»Danke für die schöne Überraschung, Mama. Wenn sie auch ziemlich anstrengend für dich war«, sagte sie und blickte ihre Mutter sorgenvoll an. Helena lächelte.
»Für mich war es auch schön, mal kurz dieser verdammten Krankenhausroutine zu entfliehen. Ich hoffe, sie lassen mich bald endlich nach Hause.«
Dana strich ihrer Mutter liebevoll über die Wange.
»Bestimmt, Mama. Du musst dich jetzt ausruhen. War wohl doch keine so gute Idee mit dem Sekt.«
Helena seufzte schwer.
»Wir müssen langsam der Wahrheit ins Auge sehen.«
Ein trockener Husten schüttelte den ausgemergelten Körper ihrer Mutter.
»Ich hätte gerne noch mehr Zeit mit dir verbracht. Aber das ist nun mal der Lauf der Welt. Mir wird wahrscheinlich nur noch ein Wunder helfen.«
Tränen traten in Danas Augen
»Sag doch nicht so etwas, Mama.« Ihre Mutter streichelte sanft ihre Wange und sah sie fest an. Wie grün ihre Augen leuchteten! Und es stand noch immer so viel Kraft in ihnen.
»Sei nicht verzweifelt. Robert und Anita haben mir versprochen, dass sie dich zu sich nehmen, wenn ich es doch nicht schaffe.«
Dana wollte noch ein paar ermutigende Worte sagen, aber in ihrem Hirn herrschte gähnende Leere, genau wie in ihrem restlichen Körper.
»Ich will aber nicht, dass du jetzt schon abtrittst. Es muss doch noch eine Möglichkeit geben, dir zu helfen.«
»Dann musst du den lieben Gott fragen, ob er noch ein Wunder übrig hat. Oder du musst deinen Vater finden.«
»Aber selbst wenn ich ihn finden würde, glaubst du, er kann dir helfen?«
Helena lächelte schwach.
»Dein Vater ist kein gewöhnlicher Mensch.«
Natürlich war Danas Vater kein gewöhnlicher Mensch; er schrieb außergewöhnliche Geschichten, also konnte er kein null-acht-fünfzehn Normalbürger sein. Stets hatte ein Hauch Geheimnis um ihn geweht. Das Schreiben war nicht seine Hauptarbeit gewesen, was er sonst noch machte, behielt er für sich.
»Das weiß ich, Mama.«
»Irgendwann einmal war dein Vater ein Mensch, aber als ich ihn kennen lernte, war er keiner mehr.«
Dana runzelte die Stirn. Normalerweise sprach ihre Mutter nicht in Rätseln.
»Aber was ist er dann?«
»Ein Vampir.«
»Mama, du sollst mir keine Märchen erzählen«, sagte sie und sah ihre Mutter streng an.
Doch der Blick in Helenas Augen war ernst und aufrichtig. Und sie hatte Dana noch nie angelogen.
»Das ist die Wahrheit.«
Auf einmal schoss wieder die Erinnerung an diesen Traum durch Danas Kopf, in dem Francis sie vor dem unheimlichen Fremden gerettet hatte. Und dass Francis ein Vampir war, hatte er ihr deutlich gezeigt. Es schauderte Dana immer noch, als sie daran dachte, wie diese langen, weißen Zähne aus seinem Oberkiefer geschossen waren. Und wenn Francis ein Vampir war, warum sollte ihr Vater dann nicht auch einer sein? Sie erschauerte beim Gedanken daran, ein solches Wesen um Hilfe zu bitten. Aber er war nun mal ihr Vater und sie liebte ihn, egal, was er war. Zudem hätte er ihr nie im Leben etwas zuleide getan.
»Dana, bist du noch da?«, riss die Stimme ihrer Mutter sie aus ihren Gedanken.
Sie zuckte zusammen.
»Ich - ich, es fällt mir ziemlich schwer, das zu glauben.«
»Es ist aber so. Und du weißt, dass das, was du vor zehn Jahren erlebt hast, wirklich passiert ist.«
»Ich hätte mir aber gewünscht, es wäre nicht passiert.«
»Du wolltest unbedingt mitten in der Nacht nach Papa suchen. Wärst du zu Hause geblieben, hättest du das nicht miterleben müssen.«
»Er hat mir aber so gefehlt«, sagte Dana leise.
»Ich weiß. Mir fehlt er noch immer so sehr. Und nur er kann dafür sorgen, dass ich vielleicht noch gesund werde.«
Es lag so viel Hoffnung in Helenas Stimme, dass Dana irritiert hoch sah.
»Aber wie kann er dir helfen? Soll er dich verwandeln?«
»Nein, aber Vampirblut wirkt heilend. Deshalb heilen die Wunden eines Vampirs auch sehr schnell.«
»Mama, woher weißt du das?«
Langsam wurde Dana diese Geschichte unheimlich. Helena lächelte versonnen.
»Deine Großmutter hat es mir gesagt.«
»Aber woher wusste sie so etwas?«
Helena lächelte.
»Sie war eine Hexe.«
»Echt? Warum hast du mir das nie erzählt?
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: