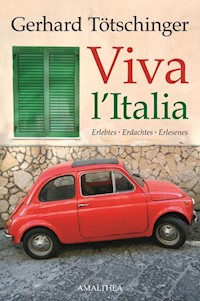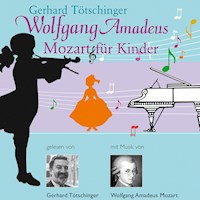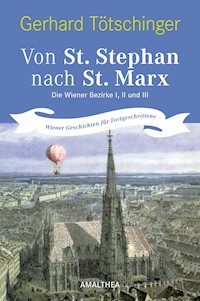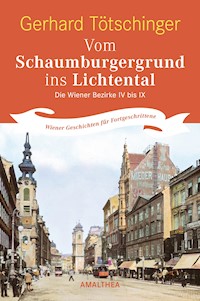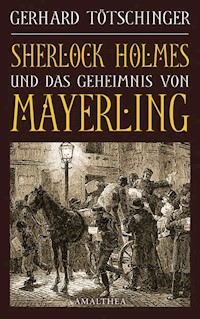Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Fortsetzung der erfolgreichen Venedig-Reihe Kurzgeschichten, die allesamt in Venedig handeln, die von Venezianern erzählen und von ihren Besuchern. Sie führen zu berühmten Stätten, zu den Pavillons der Biennale, dem Arsenal, der Seufzerbrücke, dem Cimitero San Michele, nach Murano und Torcello. Geschichten zu allen Jahreszeiten - Frühling im Hotel Cipriani, Herbst auf der Friedhofsinsel, Weihnachten mit Santa Lucia. Geschichten, die in den Alltag der Serenissima führen, und alle haben eine Pointe. Der Autor von "Nur Venedig ist ein bissl anders" und von "Venedig für Fortgeschrittene" schickt in seinem neuen Buch seine Fantasie zum Spaziergang an die Lagune.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GERHARD TÖTSCHINGER
VENEZIANISCHEKURZGESCHICHTEN
AMALTHEA
GERHARD TÖTSCHINGER
VENEZIANISCHE KURZGESCHICHTEN
GERHARD TÖTSCHINGER
VENEZIANISCHE KURZGESCHICHTEN
MITILLUSTRATIONENVONKLAUS SEITZ
www.amalthea.at
© 2009 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenIllustrationen und Buchgestaltung: Klaus SeitzHerstellung und Satz: Wilhelm MissauerGesetzt aus der 10/13,5 pt Walbaum AntiquaProduktion: Grasl Druck & Neue Medien, Austriawww.grasl.eu
ISBN 978-3-85002-701-4
eISBN 978-3-902862-47-1
INHALT
Man sieht nur, was man weiß
In arte voluptas
Ultimo
Stürzt die Paläste in die Kanäle!
Torcello
Amor vincit omnia
Buon Natale!
Biographien
FürChristiane Hörbiger
Man sieht nur, was man weiß
Der Tag hat schon nicht gut angefangen. Sie bekamen aus irgendeinem blödsinnig lächerlichen Anlass einen Streit, wurden boshaft, beide, fanden nicht mehr heraus.
Sie legte ihm später beim Frühstück die Hand auf den Arm, und setzte zu einem ehrlich gemeinten Lächeln an, nicht zu einem von der Art, die nur beweisen sollte, wie sehr man nicht schuld an der unerfreulichen Situation war.
Aber das Lächeln kam zum falschen Zeitpunkt an, kam also im doppelten Wortsinn nicht an. Denn er hatte sich in diesem Moment ebenfalls zu einem Lächeln entschlossen, das aber nicht ihr, sondern der rundlichen Serviererin mit dem hellblond gefärbten Haar gelten sollte. Ihre Hand auf seinem Arm, in gerade diesem Augenblick, machte seine casanoveske Phase zunichte. Hektisch entzog er ihr den Arm, und nun war er wirklich endgültig im Unrecht.
Auch die rundliche Serviererin hatte einen unerfreulichen Tagesbeginn zu beklagen. Ihr Ältester war nicht nach Hause gekommen, das kam eben vor bei einem Achtzehnjährigen, aber er hatte versprochen gehabt, die Zwillinge in den Kindergarten zu bringen. Dazu kam es nun also nicht, so musste die Geplagte um halb sieben, so lange hatte sie auf den Sohn gewartet, die beiden Fünfjährigen bei der verschlafenen und schlecht aufgelegten Nachbarin abgeben.
Der Bus fuhr ausnahmsweise pünktlich und daher ihr vor der Nase davon, so blieb nur, zum Bahnhof zu laufen, tatsächlich zu laufen, und sie erreichte zwar den Zug um 6.51 ab Mestre, aber sie kam trotzdem zu spät an ihren Arbeitsplatz.
Für einen Flirt mit einem rundlichen Hotelgast ohne Haare, ob mit oder ohne Ehefrau, hatte sie schon deshalb keinen Sinn, weil sie leise hoffte, dass der unbeweibte Nachtportier sich endlich erklären würde. Seit ihr Ehemann nach Kalabrien zurückgegangen war, ohne eine Adresse zu hinterlassen, und der Vater der Zwillinge den Aufenthalt in Mestre mit einem in Norddeutschland, in irgendeinem Gefängnis, getauscht hatte, war sie alleine.
Der Nachtportier hatte noch gut und gerne zehn Jahre bis zur Rente, sah auch nett aus, aber er schien den Sinn ihrer Blicke und Andeutungen nicht zu begreifen. Auch der Nachtportier war an diesem Morgen in einer Weise missgelaunt, die für ihn nicht typisch war. Er hatte seinen Dienst zum guten Teil mit einer Flasche Rotwein verbracht, deren Ende er noch eine halbe folgen ließ, war gegen fünf Uhr eingeschlafen, hatte den Gast von 115 nicht geweckt, und alles, weil dieser undankbare Luigi schon den dritten Tag nicht heimgekommen war. Sie lebten nun seit elf Monaten zusammen, waren beide nicht mehr sehr jung, da war es schwer, einen neuen Partner zu finden. Er war mit Luigi glücklich, aber diese Ausfälle alle fünf, sechs Wochen, das ging über seine Kraft. Und diese dicke Serviererin, die ihm dauernd zuzwinkerte, fiel ihm auch auf die Nerven.
Herr und Frau Schäfer hatten ihr Frühstück mit Schweigen verbracht, nun musste geredet werden, das Tagesprogramm war noch nicht klar.
„Also, Marianne, was befiehlst du? Kultur, teure Auslagen?“
„Friedrich, lass uns den Tag retten. Was möchtest du denn unternehmen?“
Er wusste es genau – zum Friseur, die waren hier viel besser als in Schaffhausen, und danach in diese Werft oder was das war, vom Schiff aus hatte er sie gesehen.
„Gut, einverstanden. Geh zum Friseur, ich laufe ein wenig herum und danach suchen wir gemeinsam die Werft.“
Und wegen dieser zweiten Waffenstillstandserklärung, und weil die gewisse Serviererin nicht mehr zu sehen war, gab er ihr einen Kuss und alles war wieder gut. Sie vereinbarten, sich vor dem Hotel mit dem deutschen Namen zu treffen – „Ach ja, Bauer, richtig! Friedrich, Ciao!“
„Ciao!“
Marianne spazierte durch Paradiese der Mode, kokettierte hier mit einem Kauf, da mit ihrem Alter – „Das kann ich ruhig noch tragen!“ – und entschied sich am Ende für eine Krawatte.
Sie war zu früh am vereinbarten Treffpunkt, erschrak angesichts der Preise für die herrlichen Murano-Gläser in der Auslage gegenüber dem Hotel, und dann sah sie einen Mann vor sich, der schütteres, sofern vorhanden dunkelbraunes, leicht gekräuseltes Haar trug, und eine rote kurze Jacke aus einer Art Ballonseide. Er stand mit ausgebreiteten Armen vor ihr, lächelte verführerisch – oder was er eben dafür hielt – und drehte sich einmal rundherum.
Marianne Schäfer starrte ihren Mann an, in seiner neuen – halt, er würde das nun nicht Aufmachung nennen, das war ein Outfit. Sie wagte nicht, ihm die Krawatte zu geben, immerhin Hermés, aber wahrscheinlich zu wenig mutig. Und sie wagte ebenso wenig, fertig zu denken, was ihr durch den Kopf ging. Vielleicht konnte ja Friedrich ihre Gedanken erraten … Jedenfalls sah er nun aus wie fünfundfünfzig und nicht mehr wie fünfundvierzig, mit der weißen Kopfhaut, die durch den dunklen Haarrest schimmerte, und der merkwürdigen Jacke. Sie verbarg ihre Gedanken, indem sie ihre Brille aus der Tasche nahm, dann entschloss sie sich zu einem Kompliment.
„Toll! Und in der kurzen Zeit!“
Er hielt sich für sehr italienisch, das gab ihm Auftrieb, und weil Marianne ihn so nett gelobt hatte, war er nun guter Dinge und gab sich verliebt.
Friedrich legte den Arm um Mariannes Schultern, drückte sie an sich, und sie spazierten vorbei an Armani, Laura Biagiotti, Valentino, Missoni, schüttelten den Kopf der hohen Preise wegen, dabei geriet ihnen manchmal der Franken mit dem Euro durcheinander. Sie schlenderten unter den Arkaden der Piazza von San Marco und der Tag sah ganz anders aus als am Morgen. Im Vormittagssonnenschein drängte sich der europäische Tourismus über den Ponte Paglia, von dem man einen Blick auf eine ganz andere Brücke werfen konnte, den Ponte dei Sospiri.
Menschen aus aller Herren Ländern fotografierten ein ihnen gänzlich gleichgültiges Bauwerk, umlagert von anderen Menschen aus zumeist südlichen, auch afrikanischen Ländern, die ihnen tanzende Püppchen, robbende Soldaten aus Plastik mit einem Schießgewehr, Donald Duck zum Aufziehen verkaufen wollten. Die Händler der Taschenimitationen von Louis Vuitton bis Prada hatten ihren Standort am Fuß der Brücke, kurz vor den Karikaturisten, die auf porträtsehnsüchtige Fremdlinge warteten, und die Drogenhändler waren ganz woanders, aber eigentlich überall.
Vor dem Gedränge, das einzig an Tagen von überdurchschnittlicher acqua alta Pause machte, lagen am Ufer des Bacino, dicht an dicht, Gondeln, Lastkähne, Vaporetti, Wassertaxis, ein ständiges Anlegen und Abfahren.
Auf der anderen Seite der Riva degli Schiavoni, an der Mauer des Hotels mit dem Namen Londra, London also, saß ein Herr, noch im Schatten der Hauswand. Er trug einen hellen Anzug, eine dunkelblaue Krawatte, braune Schuhe aus feinem, dünnen Leder, einen Sonnenhut der berühmten Marke Borsalino – alles erworben in guten Geschäften rund um San Marco. Hier war natürlich alles teurer, als in Mestre, aber den älteren Herrn und seine Neigung, sich so gut anzuziehen, wie das früher allgemein üblich war, kannten die Besitzer und die Verkäufer der fünf, sechs Herrengeschäfte, die für seinen Geschmack in Frage kamen.
Der Herr, er hieß Ruggero Tinacci, lehnte in seinem bequemen Sessel, hatte den Gazzettino zwar vor sich, aber nur zur Tarnung, um nicht von Ahnungslosen für einen Touristen von Distinktion gehalten zu werden, er las ihn nicht.
Als die Sonne mit fortschreitender Stunde die Hauswand erreicht hatte, nahm er seinen eleganten Hut vom Nebensessel und setzte ihn auf. Ohne Unterlass glitt sein Blick über das Treiben auf der Riva, das ihm, in allen seinen Veränderungen in den Jahrzehnten, sehr vertraut war.
Hin und wieder blieb sein Blick hängen – an einer jungen Familie mit Kindern zwischen zwölf und siebzehn, an einem eindeutig amerikanischen Paar, einer Gruppe älterer Damen aus einer anderen Gegend Italiens.
Herr Tinacci irrte sich niemals. Das Erraten der verschiedenen Herkunftsländer war ihm allerdings mehr als ein Steckenpferd. Es war die Grundlage eines tatsächlichen Steckenpferds, dem er schon seit etlichen Jahren nachging. In der warmen Jahreszeit saß er beinahe täglich, zumindest an vier, fünf Tagen der Woche, in einem der Straßencafés der Riva degli Schiavoni, im Winter freilich war das schwierig. Acqua alta, manchmal der von den Besuchern Venedigs so geliebte Schnee, kalte Tage, machten weite Spaziergänge unmöglich.
So saß Herr Tinacci also auch heute in einem seiner bevorzugten Lokale, freute sich des Lebens und suchte ein Opfer. Einzelgänger lehnte er ab, die waren wahrscheinlich wie er selbst, sie führten innere Dialoge, suchten die Sehenswürdigkeiten mit Hilfe von Reiseführern und Büchern, auch mit Hilfe des Internet, Gottbehüte ...
Ein Paar unter den vielen Spaziergängern fiel Herrn Tinacci auf – nicht mehr ganz jung, die Frau mochte etwas über vierzig Jahre alt sein, der Mann war offenbar bemüht, sein Alter mit seiner Kleidung zu kaschieren, er war, schwer zu sagen, zweiundfünfzig Jahre alt? Das Paar gefiel ihm, auch wenn es ein wenig, nun, spießbürgerlich wirkte. Sie waren so nett zueinander, das sieht man nicht so oft. Meistens trotten sie gleichgültig nebeneinander her, dem Reiseleiter nach, aber diese beiden Touristen, denn das waren sie jedenfalls, sprachen miteinander, jetzt blieben sie stehen, auf der Brücke, und blickten nicht zur Seufzerbrücke, sondern in die Gegenrichtung. Der Mann schien der Frau ein Schiff zu erklären und sie hörte ihm zu.
Herr Tinacci erhob sich – „Luigi, a presto!“, das galt dem Kellner ...
Die Schäfers aus Schaffhausen hatten tatsächlich ihren Tag gerettet, wie Marianne es am Morgen vorgeschlagen, worum sie gebeten hatte. Sie freute sich, ihrem Mann beim Mittagessen die Krawatte heimlich unter die Serviette zu legen, sie hörte ihm bei seinen Erklärungen zu, auch wenn da nicht viel Neues zu erfahren war. Aber er hatte Freude, das war ihr wichtig.
Sie liebte ihn auch nach zweiundzwanzig Jahren Ehe, und wenn bei ihnen der Haussegen schief hing, war sie traurig. Das bemerkte Friedrich, es tat ihm leid, ja, es tat ihm weh, und flugs war die Stimmung wieder im Lot.
„Sieh mal, Marianne, die singenden Gondolieri, das ist hier eine alte Tradition, die haben immer schon gesungen! Das hatten wir im Theater, diese Tourneeaufführung, diese Nacht in Venedig!“
Sie gingen die Stufen des Ponte Paglia abwärts, blickten über das Wasser, und Marianne fragte nach diesem anderen schmalen hohen Turm, den man dort sah, neben der Kirche, und da waren auch Schiffe -?
„Ja, das, dieser Turm, neben der Kirche, der – “, sagte Friedrich, „der ist, dort, bei den Schiffen, auf der Insel, jetzt fällt mir der Name nicht ein …“
„San Giorgio Maggiore“, sagte eine angenehme leise männliche Stimme.
Friedrich, dankbar für seine Rettung aus der Verlegenheit, lächelte den älteren Herrn an, der seinen Satz vollendet hatte.
„Gerade wollte ich es sagen! Danke, Sie verstehen Deutsch?“
„Ich spreche es auch. Ich habe zwei Jahre in Berlin gelebt. Sie kommen aus Deutschland?“
„Wir kommen aus der Schweiz, aus Schaffhausen.“
„Mit dem großartigen Rhein – Wassersturz! Das kenne ich, da war ich.“
„Rheinfall, nicht Rheinwassersturz! Herr – ? Ich heiße Schäfer, meine Frau auch, hahahaha.“
„Und ich heiße Tinacci, Ruggero.“
Die drei schüttelten einander die Hände, und Ruggero Tinacci registrierte wieder einmal, dass der Trick mit dem Fehler einer sehr guten Idee entsprang. Der andere korrigiert, steht vor sich selbst gut da, das Eis ist gebrochen – wenn es denn zu brechen war. Manchmal ließ es sich nicht brechen, die Menschen wehrten ab, sofort, misstrauisch. Oft war es aber gar nicht notwendig, mit einem Trick eine Basis zu schaffen.
Sie gingen weiter, auf das Denkmal von Vittorio Emanuele II. zu.
„Wo haben Sie denn gewohnt, wie Sie in Schaffhausen waren? Unser Schwiegersohn ist Direktor des größten Hotels, das er bald selbst übernehmen wird, vom Onkel seiner Frau.“ Friedrich Schäfer war stolz, wurde jedoch im anhebenden Triumph unterbrochen. Ein Herr ging auf Herrn Tinacci zu, lüftete kurz seinen Strohhut, und stellte eine Frage, die für die beiden Schweizer unverständlich war. Dass es sich um eine Frage handelte, ließ sich nur an der Sprachmelodie erkennen, der Sprecher bekam eine Antwort, und die kleine Gruppe spazierte weiter.
„Ein Freund, wir treffen uns jeden Donnerstag, also heute Abend. Verzeihen Sie, jetzt habe ich Sie mit meinem Gespräch gestört, ich werde – “
„Nein, nicht gestört!“, unterbrach Frau Schäfer, die den informierten Begleiter nicht so schnell verlieren wollte. „Kommen Sie doch noch ein Stück mit uns, und bitte, was haben Sie da gesprochen? Einen Dialekt? Wir Schweizer können doch alle zumindest ein wenig Italienisch, ich habe nichts verstanden, Herr Ti – Ti -.“
„Tinacci. Das war kein Dialekt, das ist eine Sprache, Venezianisch. Übrigens, hier sind wir beim Denkmal für den König, unter dem es zur italienischen Einigung kam, wir waren ja bis dahin eine große Zahl von Staaten auf nicht so großer Fläche, Toskana, Vatikanstaat, die Lombardei, Modena, alles selbständig. Und alle hatten ihre Sprache.“
Aber, meinte Herr Schäfer, gerade so sei es auch in der Schweiz.
„Nicht ganz – ein Berner und ein Basler können miteinander in ihren Idiomen sprechen – ein Venezianer, der venezian spricht, wird von einem Neapolitaner nicht verstanden, und auch er könnte den Neapolitaner nicht verstehen, wenn der napoletan zu reden anfängt.“
So war die Unterhaltung schnell in Schwung gekommen, und sie sprang und taumelte von einem Thema zum nächsten, von der Sprache zur Politik; von der Reiselust zur Familie –
„Haben Sie Kinder, Herr Tinacci?“
„Ja, Frau Schäfer, einen Sohn, eine Tochter, beide leben in Milano. Ich habe auch drei Enkel, ich kann sie oft sehen, man ist schnell in Milano. Leider ohne meine Frau, sie ist vor neun Jahren gestorben.“
Die drei machten eine Station beim Arsenal und setzten sich vor dem großen Tor an einen Tisch im Freien.
„Ich habe meine Brille vergessen“, sagte Herr Schäfer. „Könnten Sie uns bitte etwas von der Speisekarte empfehlen?“ Aber er hatte sie nicht vergessen. Er hatte nur weitgehend sein Schulitalienisch vergessen, und mochte nicht falsch aussprechen, was da auf der Karte stand. Dem gastronomischen Kurzvortrag folgte der historische.
„Das Arsenal von Venedig ist, nein, war, Basis seines Reichtums, seiner Kampfstärke. Es gehört auch heute der Marine, militärisches Sperrgebiet. Sie sehen die vielen Matrosen und Seeoffiziere in ihren unverwechselbaren Uniformen.“
„So deutlich musst du diesem Kapitän nicht nachschauen, Marianne! Wenn ich so etwas anhabe, sehe ich ebenso gut aus!“
„Kein Kapitän, Herr Schäfer, ein Schiffsarzt, dort kommt ein Kapitän, nein, halt, ein Admiral! Kein häufiger Anblick.“
Und voll Andacht verfolgten die Schäfers den Weg des Admirals, der von irgendwelchen Adjutanten, Ratgebern, maritimen Würdenträgern nicht erkennbaren Ranges begleitet, durch das von steinernen Löwen bewachte Tor schritt.
Herr Tinacci beglich die kleine Zeche, drei Café corretto, den seine beiden Gäste nach dem ersten Schluck als etwas Vertrautes erkannt hatten – „Kaffee fertig!“
Der elegante ältere Venezianer und die beiden frohgemuten Schweizer flanierten vom Arsenal zu einer Werkstatt, in der die Forcole hergestellt werden, jene geheimnisvollen Gondelteile von großer Ästhetik, ohne die eine Gondel einfach ein schlankes Ruderboot wäre wie alle anderen auch.
Der Weg führte die drei zum Campo Bandiera e Moro, und während der Venezianer beim Arsenal die Österreicher gelobt hatte – „Sie haben die Reste der Flotte Venedigs und ihre große Geschichte bewahrt!“, erzählte er hier von den drei Helden, die im 19. Jahrhundert gegen die österreichische Herrschaft gekämpft hatten, weshalb der Campo ihre Namen bekommen hat.
Verwinkelte Gassen, Durchhäuser, kleine Plätze, immer wieder verlegen kichernde Touristen oder andere Ortsfremde, die aus Sackgassen zurückkamen, und dann standen sie auf einem großen weiten Campo. Dankbar nahmen Herr und Frau Schäfer das Angebot an, hier eine längere Station zu machen.
„Herr Tinacci, wir stehlen Ihre Zeit! Sie sind mit uns seit dreieinhalb Stunden unterwegs!“
„Ich bin Pensionist, Herr Schäfer. Ich habe Zeit, Sie stehlen mir nichts.“
Man bestellte Getränke, entschied sich für einige Speisen aus der Vitrine, und als die Schweizer wieder an ihrem Tisch saßen, war ihr Guide nicht da.
Schäfers warteten, hielten Ausschau, er hätte ja abermals einen Bekannten treffen und an einem anderen Tisch sitzen können, oder sich mit dem Padrone zum Thema „Was Neues am Rialto?“ unterhalten können, aber alles vergeblich.
Friedrich kontrollierte alle Tische, innen und im Freien, erfolglos. Nach rund einer halben Stunde gaben Schäfers ihre Suche auf, ratlos, und verlangten die Rechnung.
Mit dem winzigen Rechnungszettel kam ein Buch auf den Schäferschen Tisch.
„Per Lei!“ Das war der einzige Kommentar des Kellners, den das Ehepaar Schäfer leider nicht verstehen konnte.
Aber das Buch, mit farbenfrohem Titel, war Erklärung an sich. Es hieß „Venedig, wie es wirklich ist!“ Der Titel stand hier in drei Sprachen, italienisch, englisch, deutsch, von Ruggero Tinacci.
Marianne schlug die erste Seite auf, und las FÜR HERRN UND FRAU SCHÄFER, denen ich für einen schönen Spaziergang danke.
„Friedrich!“, sagte Frau Schäfer, „Und er hat gar nichts verlangt!“
Schweigend nahm Friedrich das Buch zur Hand, schlug es auf, blätterte, und las, gedruckt:
„Seit dem Tod meiner Frau, die Venedig so innig geliebt hat wie ich, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Menschen zu Freunden der Serenissima zu machen, mit diesem Bändchen, mit Vorträgen, mit Führungen, die auch mein unvollkommenes Wissen verbessern werden. Wann immer ich Zeit habe, bitte ich Menschen zu einer kleinen Führung durch unsere tausendjährige Geschichte, aus Liebe zu meiner Stadt. Ruggero Tinacci.“
„Da haben wir aber Glück gehabt, nicht wahr, Friedrich? Ein so netter Herr!“
„Ja, da haben wir Glück gehabt, Marianne. Hoffentlich finden wir zum Hotel zurück.“
In arte voluptas
Ich muss den Baumeister kommen lassen, die Fassade ist ja in einem merkwürdigen Zustand.“ Der alte Herr betrachtete seinen Palazzo, als kenne er ihn erst seit wenigen Minuten und nicht schon seit beinahe achtzig Jahren. Und weil ihm beim Anblick der Fenster, die den Zimmermann, und der Dachrinnen, die den Spengler brauchten, bang wurde, zog er die dicke Wolljacke noch etwas enger um seine schmal gewordenen Schultern.
Die zweireihige, dunkelblaue Strickjacke, erworben in einem vornehmen, der englischen Mode geweihten Geschäft im ansonsten von dem alten Herrn nach Möglichkeit gemiedenen Zentrum zwischen San Marco und dem Rialto, trug nach Art der Blazer ein Wappen. Das war nicht irgendeines der Wappen, wie man sie eben auf Kleidungsstücken dieser Art bekommt, ohne gefragt zu werden, die Wappen der königlich-britischen Militärzahnärzte-Klinik oder, im glücklichen Fall, jenes der Queen’s First Dragoons. Es war das Wappen der uralten venezianischen Familie, nein, des Hauses Barbarigo. Doch der alte Herr war kein Barbarigo, das konnte er auch nicht sein, denn der letzte dieses Namens ist ja schon vor Jahrhunderten gestorben. Und auch das steinerne Wappen über dem breiten Portal des Palazzo war nicht jenes der Barbarigo. Das Wappen verkündete, dass dieses Haus den Braga d’Inzeo zueigen war. Diese Familie war zwar schon seit dem späten sechzehnten Jahrhundert in Venedig angesiedelt, aber sie kam aus dem Süden der Emilia, und ihr Adel war nicht nur sehr jung, sondern auch noch österreichisch. Das war dem feinen alten Herrn nicht angenehm. So trug er zwar seinen schönen Namen – Emilio Ermenegildo Francesco Federigo Bonaventura Braga d’Inzeo, aber er deutete doch lieber auf manche Weise an, dass das Blut in seinen Adern von der klugen Familienpolitik mehrerer seiner Vorfahren zeugte, die sich rechtzeitig mit den Barbarigo vermählt und verschwägert hatten, bevor auch diese sich, knapp vor der Serenissima selbst, aus der Geschichte verabschiedeten.
Der Graf betrachtete seinen Palazzo, er strich sich, das hilft bekanntlich beim Denken, über die gerunzelte Stirne, was in seinem Falle eine schon etwas längere Handbewegung brauchte.
Er hatte das Gefühl, dass sei doch gerade erst gewesen, da habe man das ganze Haus restauriert, er war im Garten gesessen und hatte mit angehaltenem Atem den Dachdeckern zugesehen, und später mit seinen Geschwistern Halma gespielt und dieses andere, dieses alte Spiel … Aber alle drei Schwestern waren schon ebenso nicht mehr am Leben wie der jüngere Bruder, er war der letzte der fünf jungen und für ihre Schönheit nicht nur in der Stadt selbst, sondern auch in den Villen an der Brenta, ja im gesamten Veneto berühmten Geschwister Braga d’Inzeo.
Diese Arbeiten am Elternhaus mussten jetzt doch schon länger her sein … „Ciao Zio! Ein herrlicher Tag!“
Mit dieser, für seinen so jungen Neffen Agostino ungewöhnlichen Bemerkung, denn derartige meteorologische Betrachtungen stellen sich für gewöhnlich erst ab dem dreißigsten Lebensjahr ein, bis dahin ist fast jeder Tag herrlich, mit diesem verspäteten Morgengruß also erschien der Neffe im Garten seiner Ahnen. Der Onkel saß gedankenverloren in dem schon mehrfach in letzter Minute mit einigen Schrauben vor dem Zusammenbruch bewahrten dunkelgrünen hölzernen Pavillon, dem der Malermeister ebenso bevorstand wie der Fassade.