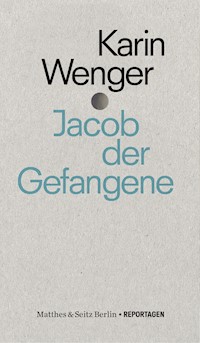26,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stämpfli Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Afghanische Frauen erhielten das Wahlrecht acht Jahre vor den Schweizerinnen. In den siebziger Jahren war Kabul eine Metropole, wo Frauen in kurzen Röcken und ohne Kopftuch durch die Strassen flanierten. Jetzt ist alles anders. Wie wurde der ehemalige Sehnsuchtsort Afghanistan zu einem Land, geprägt von Krieg und Hoffnungslosigkeit? Karin Wenger sucht auf ihren Reisen durch das Land nach Antworten. Sie erzählt von der einst angesehenen Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Mina, die sie seit zehn Jahren begleitet. Minas Leben war voller Hoffnung und Musik – bis sie ihre Heimat verlor. Die SRF-Korrespondentin berichtet auch von ihren Einsätzen mit der US-Armee und ihren Erlebnissen in den Drogenanbaugebieten – Afghanistan ist weltweiter Hauptlieferant von Opium. Der NZZ-Journalist Andreas Babst war vor Ort, als die Taliban im August 2021 die Macht in Afghanistan erneut übernommen haben. Im Nachwort schildert er seine Eindrücke vom Leben in diesem «neuen» Afghanistan.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Vorspann
Cover
Titel
Karin Wenger
VERBOTENE LIEDER
Eine afghanische Sängerin verliert ihre Heimat
Mit einem Nachwort von Andreas Babst
Stämpfli Verlag
Impressum
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
www.dnb.de.
© Stämpfli Verlag AG, Bern, www.staempfliverlag.com · 2022
Lektorat: Benita Schnidrig, Stämpfli Verlag AG
Gestaltung und Karten: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Bern
Umschlag: Severin Raeber, Bern, www.kontur.ch
Bilder: Alle Fotos stammen aus dem Familienalbum von Mina Amaniund ihren Geschwistern beziehungsweise von Karin Wenger, sie hat Mina in Herat und Istanbul und Minas Bruder Djamal in Olten getroffen. Porträt Karin Wenger: Pia Zanetti; Porträt Andreas Babst: Saumya Khandelwa
ISBN (E-PDF) 978-3-7272–6155-8
ISBN (Epub) 978-3-7272–6154-1
ISBN (Print) 978-3-7272-6977-6
Widmung
Für Raha und Kasra
und alle anderen Flüchtlingskinder –mögen ihre Träume in Erfüllung gehen
Inhalt
Inhalt
Sehnsuchtsort Afghanistan
Minas Kindheit zwischen Afghanistan und Iran
Das schwarze Gold
Mina wird Schauspielerin
Die Angst
Mina: Sängerin, Moderatorin, Ehefrau
Unterwegs mit den US-Truppen
Mina und der heilige Krieg
Tee mit dem Talib
Minas Fall
Besuch im Frauenschutzhaus
Mina auf der Flucht
Zu Besuch bei Djamal
Epilog
Die Rückkehr der Taliban: Nachwort von Andreas Babst
Quellen
Zeittafel
Karten
Bilder
Glossar und Personenverzeichnis
Sehnsuchtsort Afghanistan
Vor nicht allzu langer Zeit war Afghanistan ein Sehnsuchtsort. Die schneebedeckten, majestätischen Berge des Hindukusch locken Bergsteiger und Naturfreunde ins Land. Hippies reisen nach Kabul, um dort ihre erste Opiumpfeife zu rauchen. Damals, in den siebziger Jahren, ist Kabul eine Metropole, wo Frauen in kurzen Röcken, das lange Haar unbedeckt, durch die Strassen flanieren. Afghanistan ist in einigen Dingen gar fortschrittlicher als manches europäische Land. So erhalten die Frauen das Wahlrecht bereits 1964 – sieben Jahre vor den Schweizerinnen. Auch touristische und kulturelle Perlen hat es zu bieten. Denn das Land ist aufgrund seiner geografischen Lage von jeher ein Schmelztiegel von Kulturen, Ethnien und ein Durchgangsland für kriegerische Eroberer sowie Händler und Missionare verschiedenster Religionen. Es ist Teil der Seidenstrasse, der Haupthandelsroute zwischen West und Ost, vom Abendland nach China und umgekehrt. Nicht nur Seide, Gewürze, Tee, Porzellan und Teppiche gelangen auf langen Karawanen durch Afghanistan nach Europa, sondern auch die neusten wissenschaftlichen, kulturellen und religiösen Errungenschaften verbreiten sich so am Hindukusch. Die in Stein gemeisselten mächtigen Buddhastatuen in Bamian, die zu den grössten der Welt gehört haben, erinnern lange Zeit an seine buddhistische Vergangenheit. Erst im frühen 8. Jahrhundert, mit der ersten islamischen Eroberungswelle, werden der Buddhismus und andere Religionen aus Afghanistan verdrängt, und der Islam wird vorherrschende Religion. Noch heute kann man die Blaue Moschee, ein architektonisches Meisterwerk aus dem 15. Jahrhundert, in Mazar-e Sharifbesichtigen. Die Stadt Herat im Osten Afghanistans gilt mit ihren Glasbläsern und ihrer langen literarischen und musikalischen Tradition als älteste Kulturstadt des Landes. Diese Stadt will ich besuchen, als ich 2011 zum ersten Mal als Korrespondentin nach Afghanistan reise, um für Radio SRF über das Land zu berichten. Damals wird Afghanistan bereits nicht mehr mit landschaftlicher Schönheit und kultureller Vielfalt, sondern mit Zerstörung und islamischem Fundamentalismus in Verbindung gebracht. Jahrzehntelange Kriege haben die kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaften zunichte gemacht. Trotzdem will ich mich auf die Suche machen nach diesen Keimen von Schönheit, Kunst und geistigem Widerstand. Ich finde sie überall im Land: im Panjshir-Tal, wo ich die wagemutigen Reiter auf ihren Pferden beim Buzkashi-Spiel bestaune, in Kabul, wo ich einen Musik- und Literaturabend besuche, und in Herat, wo ich die herrschaftliche und frisch restaurierte Zitadelle bewundere. In der einstigen Kulturhauptstadt Herat will ich auch Musikerinnen und Musiker treffen, die für ihre Künste im ganzen Land und oft über die Landesgrenzen hinweg bekannt sind. So besuche ich mit meinem Übersetzer Nematullah Hosainzadeh, den Sänger, Comedian und Direktor des Musikvereins der Stadt. In seinem Tonstudio serviert er uns stark gesüssten Grüntee und erzählt: «Als ich ein Kind war, war Herat noch immer eine weltberühmte Kulturstadt, und Frauen tanzten vor Publikum. Damals schlich ich mich jedes Mal aus dem elterlichen Laden, wenn ich hörte, wie unser Nachbar die Laute stimmte.» Hosainzadeh träumt davon, Musiker zu werden. Doch dann kommen die Sowjets und später die Taliban. Sie zerschlagen alle Träume. «Trotz des Verbots spielten viele Musiker im Geheimen weiter. Wenn sie erwischt wurden, malten ihnen die Taliban das Gesicht schwarz an, hängten ihnen ihr Musikinstrument um den Hals und führten sie so als Abschreckung für andere durch die ganze Stadt.» Herat wird kulturlos, Hosainzadeh und mit ihm Hunderttausende mehr fliehen in den Iran. Seit dem Einmarsch der Amerikaner ist er zurück und singt wieder. «Männer dürfen das jetzt wieder», sagt er, «für Frauen ist es immer noch gefährlich.» Er steht auf und führt uns in einen anderen Raum, wo er uns auf einem Bildschirm ein Musikvideo vorspielt. «Dokhtare Baba», die Tochter ihres Vaters, heisst das Lied. Auf dem körnigen Video erkenne ich Hosainzadeh, wie er in ein palastähnliches Haus eintritt und dort eine junge Frau, seine Tochter, die traurig zu Boden blickt, vorfindet. Die beiden singen im Duett, sie, wie sie sich selbst ihren Ehemann aussuchen will, er von der Liebe zu seiner Tochter. Die junge Frau im Video ist Mina Amani. «Das Lied hat sie berühmt gemacht, aber der Erfolg kommt sie teuer zu stehen», sagt der Sänger, «aber am besten erzählt sie euch ihre Geschichte selbst.» So kommt es im April 2011 zu meiner ersten Begegnung mit Mina. Noch ahne ich nicht, dass damit eine lange Freundschaft beginnen und ich diese junge, mutige Frau und ihre Familie über verschiedene Kontinente und viele Jahre begleiten werde. Eine Reise, die auch heute, mehr als zehn Jahre später, noch nicht zu Ende ist und von der Mina und ich in diesem Buch erzählen, genauso wie vom Heimweh nach einem Land, das von überwältigender Schönheit ist, aber voller Narben.
Minas Kindheit zwischen Afghanistan und Iran
Mina erwartet mich an diesem Morgen des 22. April 2011 in einer Ecke des Hotelempfangsraums, eingehüllt in einen schwarz-weissen Tschador mit einem Muster, das an eine Tapete erinnert. Neben ihr steht ein Mann, etwas grösser als sie, in weisser, traditioneller Kleidung. Er eilt uns mit langen Schritten entgegen, sie aber rührt sich nicht vom Fleck. Den Tschador hat sie eng um den Körper gewickelt, über den Kopf und bis unters Kinn gezogen. Trotz dieser Verhüllung ist ihre Schönheit sofort erkennbar, ihre fein geschnittene Nase, das kleine Grübchen unter dem sanft geschwungenen Mund und ihre dunklen Augen, die Entschlossenheit ausstrahlen. Als ob die mädchenhafte Leichtigkeit noch nicht ganz gewichen und die Ernsthaftigkeit des Frauseins noch nicht ganz in ihr Leben eingezogen wären. Sie hebt den Kopf, nickt, sagt: «Salam», Frieden. Ein kriegsversehrtes Land, in dem man sich nichts mehr wünscht als das, es bei jeder Begrüssung wiederholt: Frieden.
Erst im kleinen Restaurant dieses unscheinbaren Hotels in Herat legt Mina ihren Tschador ab. Jetzt kommt ihr lockiges, schwarzes Haar, das ihr fast bis zur Taille reicht, unter dem bunten Kopftuch zum Vorschein. Sie trägt enganliegende Jeans und spitze Schuhe, staubig von Herats Strassen. Der Mann hat ihr einen Stuhl vor einen Tisch gerückt, ausser Hörweite von anderen Gästen. Er heisst Mustafa. Die beiden haben erst vor kurzem geheiratet. Mustafa sagt wenig, sitzt still da und schaut seine Frau bewundernd an, als sie mit sanfter, melodiöser Stimme ihre Geschichte zu erzählen beginnt.
Ich heisse Mina Amani, bin Schauspielerin, Sängerin und Fernsehmoderatorin. Geboren bin ich am 21. August 1989, aber wie viele Afghaninnen und Afghanen habe ich keinen Geburtsschein. In meinem Pass steht deshalb der 31. Dezember 1988 als Geburtsdatum. Viele Afghanen kennen ihr Geburtsdatum gar nicht. Sie sagen einfach: «Ich bin im Jahr der grossen Flut geboren» oder «als der grosse Schnee kam». Schon als ich fünf Jahre alt war, stand ich oft vor dem Spiegel und stellte mir vor, ich sei Fernsehmoderatorin. Ich sagte dann zu meinem Spiegelbild: «Hallo, erfreut, Sie hier begrüssen zu dürfen, bitte stellen Sie sich vor.» Ich träumte davon, auf der grossen Bühne Theater zu spielen, Fernsehshows zu moderieren und zu singen wie die Sängerin Googoosh. Im Iran ist sie die Popikone schlechthin, eine mutige Frau mit einer traurigen Kindheit und einem Leben voller Schwierigkeiten. Nach der iranischen Revolution 1979 durfte sie zwanzig Jahre lang nicht singen und auftreten, weil das Frauen verboten war. Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr gesungen und bin nicht mehr aufgetreten. Aber ich denke immer an Googoosh, wie stark und unbesiegbar sie war, wie sie alles still durchlitten hat und am Ende wieder auf der Bühne stand. Ich bin sicher, dass ich irgendwann wieder singen werde. Genau wie Googoosh wusste auch ich schon früh, dass ich es eines Tages schaffen werde. Doch was ich als kleines Mädchen noch nicht ahnte, war, dass Frauen in Afghanistan immer einen Preis für ihren Erfolg zahlen. Davon kann ich ein Lied singen.
Meine Eltern wurden beide in Herat geboren, ich jedoch kam in der iranischen Stadt Mashhad zur Welt, im Mehrabad-Viertel, in der Nähe des heiligen Schreins. Meine Mutter Rahima wollte mich unbedingt Mina taufen, aber mein Vater Ghollam Sarwar erlaubte das nicht. Er sagte, ich müsse einen Namen aus dem Koran bekommen. Deshalb steht in meiner Geburtsurkunde Ameneh, was etwa bedeutet: jemand, der einen tiefen Glauben hat. Dabei bin ich nicht besonders religiös, bete selten und lese nur ab und zu im Koran. Trotzdem glaube ich an Gott und spreche mit ihm. Immer wieder frage ich ihn, was er mit mir vorhabe, aber noch hat er mir nicht geantwortet. Seit ich mich erinnern kann, nennt mich niemand Ameneh. Mein Vater hat zwar bestimmt, welcher Name in meinem Pass steht, aber am Ende waren es meine Mütter, die meinen Rufnamen bestimmten. Ich habe zwei Mütter, eine leibliche und die, die mich aufgezogen hat. Beide sind stark, und beide hatten ein schwieriges Leben. Starke Frauen mit grossen Leidensgeschichten gehören zu meinem Leben, ja wahrscheinlich gehören sie ganz einfach zu Afghanistan und dem Iran. Manche Lebens- und Leidensgeschichten wiederholen sich von Generation zu Generation. Als ob wir willenlos die Spur verfolgten, die andere für uns gezogen haben, unfähig, unseren eigenen Weg zu finden. Manchmal frage ich mich, ob es nur meiner Familie nicht gelingt, diesen Kreislauf zu durchbrechen, oder ob das auch anderen so geht.
Als meine Grossmutter meine Mutter in Herat zur Welt brachte, war ihr Mann Soldat in der afghanischen Armee. Damals herrschte kein Krieg in Afghanistan, aber mein Grossvater war ein Hitzkopf, und bei einem Streit mit anderen Soldaten wurde er erschossen. So wurde meine Mutter, kaum geboren, zur Halbwaise. Die Schwiegereltern duldeten meine Grossmutter mit ihrem Baby noch eine Weile, aber dann sagten sie zu ihr: «Du bist jung und hast ein Kind, wir haben keinen Platz mehr für dich in unserem Haus. Geh und such dir einen anderen Ort.» Es gab viele verwitwete Frauen, weil es schon damals viele Konflikte gab. Und es gab auch genügend verwitwete Männer, weil Frauen oft bei der Geburt ihrer Kinder starben. Nach dem Tod ihrer Männer dauerte es oft nicht lange, bis die Frauen wiederverheiratet wurden. So war das auch bei meiner Grossmutter. Der Witwer, der ihr Mann wurde, war viel älter als sie und hatte bereits Kinder. Als meine Mutter noch ein Mädchen war, sagte ihr Stiefvater zu ihr: «Du bist ein Waisenkind und brauchst einen Mann. Du heiratest jetzt meinen Sohn.» Sie wollte das nicht, doch die Hochzeit stand bereits fest. Mit elf Jahren wurde meine Mutter die Frau ihres vierzehn Jahre älteren Stiefbruders, als 13-Jährige brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. Das war 1979, kurz nach dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan, dem Beginn von jahrzehntelangen Kriegen. Mein Vater war zuerst Regierungssoldat, doch dann schloss er sich den Mudschaheddin an und kämpfte gegen die Eindringlinge. Das Paar zog in den Iran nach Mashhad, und mein Vater pendelte zwischen dem Iran und Afghanistan hin und her. Im Iran fuhr er Lastwagen, um Geld zu verdienen, in Afghanistan kämpfte er. Als meine Mutter 22 Jahre alt war, wurde sie mit mir schwanger. Sie wollte längst keine Kinder mehr und schlug sich immer und immer wieder auf den Bauch. Doch es half nichts, ich wollte auf diese Welt. Der Arzt fragte sie: «Wie viele Kinder haben Sie?» – «Sechs.» – «Sechs Kinder in Ihrem Alter, das ist doch Selbstmord!», empörte er sich und sterilisierte sie, ohne ihr Einverständnis.
Im Dezember 1979 marschieren sowjetische Truppen in Afghanistan ein. Das Land wird zum Opfer im Stellvertreterkrieg zwischen der Sowjetunion und anderen Staaten wie den USA und Saudi-Arabien. Die sowjetische Besatzung dauert ein Jahrzehnt. In dieser Zeit werden verschiedene islamistische Rebellengruppen, die sogenannten Mudschaheddin und ihre Kriegsfürsten, im Kampf gegen die Sowjets von den USA, anderen NATO-Staaten, Saudi-Arabien und Pakistan unterstützt. Auf den Abzug der Sowjets 1989 folgt jedoch nicht Frieden, sondern ein jahrelanger und grausamer Bürgerkrieg, in dem die unterschiedlichen Kriegsfürsten und Mudschaheddin-Gruppen um die Vorherrschaft im Land kämpfen. Dabei legen sie Kabul und andere Städte zu grossen Teilen in Schutt und Asche, sie treiben das Land in den Ruin und die Menschen in bittere Armut oder ins ausländische Exil.
Der Bürgerkrieg in Afghanistan war für mich weit weg. Wir lebten ja im Iran. Mein Alltag war von einer anderen Art Bürgerkrieg geprägt – dem Krieg zwischen meinen Eltern. Es war, als hätte sich mein Vater ein neues Schlachtfeld, einen neuen Gegner gesucht, nachdem er den Krieg in seinem Heimatland hinter sich gelassen hatte. Das Schlachtfeld war unsere Wohnung, meine Mutter war der Gegner, sie versteckte sich jedes Mal, wenn Vater nach Hause kam. Sie bat ihre Eltern immer wieder, sich scheiden lassen zu dürfen, aber weder meine Grosseltern noch mein Vater willigten ein. Erst nach sechs Kindern und mehr als zehn Jahren Ehe, als sie drohte, sich umzubringen, trennten sich meine Eltern. Ich war damals ein Jahr alt. Natürlich wollte uns Mutter bei sich behalten, welche Mutter gibt ihre Kinder schon freiwillig her? Sie flehte ihn an: «Nimm alle anderen Kinder, aber lass mir wenigstens Mina, sie ist so klein.» Aber mein Vater verliess Mashhad und nahm uns alle mit.
Ich glaube, die Gerüchte über ihn und die Scheidung haben ihn aus der Stadt vertrieben. Wir zogen nach Ahvaz, nicht weit weg von der Grenze zu Kuwait. Doch Vater konnte nicht auf sechs Kinder aufpassen, so heiratete er kurz nach der Scheidung die 17-jährige Fateme, eine Iranerin. Sie hatte noch keine Kinder und sollte sich um uns kümmern. Von nun an lebten wir in ihrer Heimat, einer kleinen Stadt in der Nähe von Ahvaz. Wir nannten Fateme Mutter, da sie es war, die uns grosszog, unsere richtige Mutter verschwand ganz aus unserem Leben. Mein Vater arbeitete für die staatliche iranische Ölfirma und fuhr Tanklaster von Ahvaz nach Mashhad. Wir sahen ihn nur selten, meist war er unterwegs. Als wir Jahre später nach Afghanistan zurückkehrten, war er dankbar, dass er gelernt hatte, grosse Lastwagen zu fahren.
Vater sagte uns immer, er werde nicht zulassen, dass wir unsere richtige Mutter jemals wiedersehen würden. Doch auch wenn er ihren Namen nicht mehr aussprach und sie unter unserem Dach nicht mehr dulden wollte, war sie immer präsent wie ein dunkler Geist, der bei allen möglichen Gelegenheiten aus seinem Verlies kroch. Mein Vater war äusserst reizbar, und wenn ich ihn ärgerte, brüllte er mich an: «Du bist genau wie deine Mutter!», und das bedeutete nichts Gutes. So war denn auch ein Wiedersehen mit meiner Mutter keineswegs eingeplant, als wir einmal für eine Einkaufstour nach Mashhad fuhren und dort Vaters Bruder übergeben wurden. Ich war sieben oder acht Jahre alt. Meine Eltern waren ja Stiefgeschwister, und mein Onkel hatte den Kontakt zu meiner Mutter stets aufrechterhalten. Als sie von ihm hörte, dass wir nach Mashhad kommen würden, flehte sie ihn an, ein Treffen zu arrangieren. So kam es, dass wir mit unserem Onkel in ein Einkaufszentrum gingen und er uns dort «einer Freundin» vorstellte. Ich erinnere mich noch gut, wie sie uns umarmt und geküsst hat und wie seltsam mir das vorkam, weil uns meine Stiefmutter Fateme nie in den Arm nahm. Fateme war eine gute Frau, fleissig, passte auf uns auf, erledigte die Hausarbeiten, kochte und wusch. Aber sie hat uns nie gestreichelt, umarmt oder uns ihre Gefühle gezeigt. Meine Mutter war ganz anders. Sie war sanft, liebevoll und aufmerksam. «Was für ein süsses Mädchen», sagte sie zu mir, «aber du bist ja erkältet! Sag deiner Mutter, sie soll dich zum Arzt bringen.» Und dann umarmte sie mich wieder, und ich dachte: «Wer ist diese Frau? Wieso umarmt und küsst eine Fremde Kinder, die nicht die ihren sind?» Weil ich nicht wusste, wen ich da vor mir hatte, vergass ich die fremde Frau bald wieder.
Meine fünf Jahre ältere Schwester Shahla ersetzte mir die Mutter. Wenn ich in ihren Armen einschlafen konnte, war die Welt in Ordnung, und lange Zeit waren wir unzertrennlich. In unserer Stadt gab es nicht viele Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten, und so verbrachten wir Mädchen unsere Zeit mit Näh- und Webunterricht, hie und da gingen wir ins Theater. Musik und Kunst werden im Iran geschätzt, dennoch durfte niemand von uns Geschwistern in den Musikunterricht.
Erst Jahre nach dem Wiedersehen mit meiner Mutter in jenem Einkaufszentrum von Mashhad sah ich sie regelmässig. Das verdankte ich vor allem meiner ältesten Schwester Zahra. Sie war ein sehr wildes Mädchen, sie liebte und vermisste unsere Mutter am meisten. Mit unserer Stiefmutter kam sie überhaupt nicht zurecht, die beiden stritten sich ständig. Als schliesslich ein Mann um Zahras Hand anhielt, stimmte mein Vater sofort zu. Zahra wurde an ihrem zwölften Geburtstag mit einem zwanzig Jahre älteren Mann verheiratet. Nach der Hochzeit lebte sie mit ihm in Ahvaz. Jeden Sommer verbrachte ich die Ferien bei ihr, und so sah ich auch meine Mutter wieder, die aus Mashhad nach Ahvaz gezogen war, um näher bei ihren Kindern zu sein. In Ahvaz heiratete auch sie wieder, einen Iraner. Er hatte nichts gegen unsere Treffen, unser Vater und unsere Stiefmutter aber erfuhren nie davon. Später trafen wir Mutter auch an den Wochenenden oder wann immer mein Vater weg war. Wir erfanden Ausreden wie «Wir gehen in den Park» oder «Wir gehen spielen», aber nie waren wir alle gemeinsam bei ihr. Es musste ein Geheimnis unter uns Geschwistern bleiben. Doch obwohl wir jeden Sommer viel Zeit miteinander verbrachten und uns nahe waren, nannte ich sie nie Mutter. Für mich war und ist sie bis heute Rahima, die Barmherzige. Als wir 2001 nach Afghanistan umzogen, traf mich der Schmerz wie ein scharfes Messer. Zum zweiten Mal verlor ich meine Mutter.
Auf den Abzug der Sowjets 1989 und den Bürgerkrieg folgen die Taliban, angeführt von Mullah Omar, der bis dahin in einer Koranschule in einem Dorf gelehrt hat. 1994 treten die Taliban im südlichen Kandahar erstmals auf. Damals soll ein Milizführer zwei Mädchen entführt und vergewaltigt haben – Mullah Omar und seine Anhänger erhängen daraufhin den Vergewaltiger. Für die Bevölkerung ist dies ein Hoffnungsschimmer: Die Taliban versprechen der kriegsmüden afghanischen Bevölkerung, Ruhe und Ordnung zu schaffen. Sie erhalten immer mehr Zulauf, auch Überläufer von Mudschaheddin-Gruppen schliessen sich ihnen an, vor allem aber rekrutieren sie ihre Kämpfer in den Koranschulen in Pakistan, die von afghanischen Flüchtlingen besucht werden. Pakistan unterstützt die Taliban, um selbst wieder mehr Einfluss in Afghanistan zu gewinnen. Mit militärischer und finanzieller Unterstützung aus Pakistan und Saudi-Arabien formieren sich die Taliban zu einer schlagkräftigen Bewegung und bringen immer mehr Gebiete unter ihre Kontrolle. Im September 1996 marschieren sie schliesslich in Kabul ein, um das Islamische Emirat Afghanistan auszurufen. In Afghanistan wird von nun an islamisches Recht, die Scharia, durchgesetzt, nach puristischer Gelehrsamkeit interpretiert und mit dem Paschtunwali, dem Rechts- und Ehrenkodex der Paschtunenstämme, vermischt. Die Taliban legen Religion ähnlich konservativ aus wie die Saudis, deren Staatsreligion der Wahhabismus ist.
Unter den Taliban haben Frauenrechte, Toleranz und religiöse Vielfalt keinen Platz mehr in der Gesellschaft. Sie zerstören die historisch bedeutenden Buddhastatuen in Bamian, plündern das Museum von Kabul und verbieten Fotos von Menschen und Tieren. Musik, Fernsehen und die meisten Sportarten sind nicht mehr erlaubt, und selbst Kinder dürfen keine Drachen mehr steigen lassen. Männer müssen Bärte tragen, und Frauen dürfen das Haus nur in der alles verhüllenden Burka verlassen. Die Taliban schaffen das Frauenwahlrecht ab, Mädchen wird es verboten, in die Schule zu gehen, Frauen dürfen nicht mehr arbeiten. Sie verschwinden aus dem öffentlichen Leben. Durchgesetzt werden die Vorschriften mit einer Religionspolizei, ähnlich jener in Saudi-Arabien. Wer die Regeln nicht befolgt, wird ausgepeitscht, ins Gefängnis gesperrt oder öffentlich hingerichtet. Dieben werden Hände und Füsse abgehackt, «Ehebrecherinnen» werden zu Tode gesteinigt.
Das Islamische Emirat Afghanistan wird international geächtet, so dass die Wirtschaft fast vollständig zum Erliegen kommt und die Bevölkerung Hunger leidet. Nur Pakistan, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate anerkennen das Emirat und unterstützen es mit privaten oder staatlichen Geldern. Unter der Herrschaft der Taliban errichten auch unterschiedliche Dschihadisten-Gruppen ihre Trainingslager in Afghanistan, unter ihnen die Al Kaida von Osama bin Laden, der zum Gast der Taliban wird.
Am 11. September 2001 verübt die Al Kaida Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon. Die USA fordern von den Taliban die Auslieferung bin Ladens, doch Taliban-Führer Mullah Omar weigert sich. Wenige Wochen später greift eine von den USA angeführte Koalition von Staaten unter der Bezeichnung Operation Enduring Freedom und im Rahmen des Kriegs gegen den Terror Afghanistan an. Das Taliban-Regime wird gestürzt, die Führung flieht nach Pakistan, wo sie in Quetta den Widerstand gegen die Amerikaner und ihre Verbündeten organisiert.
Der Umzug nach Afghanistan war wie ein Schock für mich. Er kam schnell und unangekündigt. Ich war zwölf, und die Amerikaner waren eben in Afghanistan einmarschiert. Eines Morgens sagte mein Vater: «Die Taliban sind weg, der Krieg ist zu Ende, es wird Zeit, dass wir in unser Heimatland zurückkehren.» Wir Kinder wollten alle im Iran bleiben, aber gegen Vater kam niemand an. So zogen mein Vater und Fateme, meine Schwester Shahla, meine drei Brüder und ich mit Sack und Pack nach Herat. Zahra und ihre Familie kamen erst ein Jahr später zu uns. Sie gebar zwei Söhne und eine Tochter, doch glücklich wurde sie nie mit ihrem Mann. Die Lebensgeschichten wiederholen sich von Generation zu Generation in unserer Familie. Meine Grossmutter, meine Mutter, meine Schwester … Wenn ein Leben von allem Anfang an im Treibsand angesiedelt ist, kann man kein solides Fundament bauen, und der Zerfall ist absehbar.
Von Afghanistan wusste ich nichts anderes, als dass dort Krieg und Armut herrschten. Werde ich in die Schule gehen können, fragte ich mich vor unserem Umzug. Ich fühlte mich durch und durch als Iranerin, den iranischen Gepflogenheiten und der iranischen Kultur verbunden. Als wir in Herat ankamen, war ich eine Fremde, eine Aussenseiterin. Auch wenn das Farsi, das im Iran gesprochen wird, dem Dari in Afghanistan sehr ähnlich ist, hatte ich anfänglich Mühe, die Umgangssprache in Herat zu verstehen. Meine Klassenkameraden hänselten mich: «Schaut sie euch an. Da war sie kurz im Iran, und jetzt gibt sie mit ihrem Akzent an. Geh doch zurück, und nimm deine komische Sprache mit!» Es war schwierig für mich, Freunde zu finden. Ich war ein stilles Kind und zog mich immer mehr zurück. Auch der Schulstoff war anders und bereitete mir Mühe. Wir mussten Paschtu lernen, eine Sprache, die ich noch nie gehört hatte. Im Iran war ich in Arabisch, Koranstudium und anderen Fächern unterrichtet worden, in Herat aber dominierte der Religionsunterricht den Stundenplan, und das ärgerte mich. Ich wollte nicht mehr zur Schule gehen, doch meine Schwester Shahla liess das nicht zu.
In Herat fand Vater eine Stelle als Busfahrer. Obwohl wir nun zurück in seiner Heimat waren, blieb er launisch. Vater hat viele Fehler in seinem Leben begangen. Zahra so jung zu verheiraten war einer davon, doch ich entdeckte auch Seiten an meinem Vater, die mir im Iran verborgen geblieben waren. Er war viel weltoffener als der Rest der Familie, die Herat nie verlassen hatte, und erlaubte mir etwas, was keiner unserer Verwandten seiner Tochter gestattet hätte.