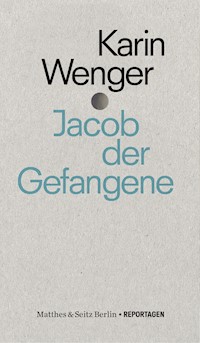35,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stämpfli Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hier bricht ein Gebäude ein, da herrscht Krieg, sonst wo wütet eine Drogenbande – wir lesen die Schlagzeilen und hören die News. Die Berichte machen uns betroffen, und trotzdem vergessen wir sie schnell, denn da sind ja schon die nächsten. Die Asienkorrespondentin Karin Wenger hat vor Jahren angefangen, Personen, denen sie bei ihrer Newsberichterstattung begegnet ist, erneut aufzusuchen. Die so entstandenen Reportagen zeigen die Folgen von Krieg, Korruption, Fundamentalismus und billiger Kleiderproduktion drastisch auf. Wie lebt jemand weiter, der nur knapp überlebt hat? Woher nehmen Menschen die Kraft, weiterzumachen, ohne zu zerbrechen – weder physisch noch psychisch –, obwohl sie Grausames erlebt haben? Wer überlebt einfach? Wer schöpft Kraft aus dem Erlebten und entdeckt die Welt neu, und was hilft ihm dabei?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Vorspann
Cover
Titel
Karin Wenger
Bis zum nächsten Monsun
Menschen in Extremsituationen
Stämpfli Verlag
Impressum
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: www.dnb.de
© Stämpfli Verlag AG, Bern, www.staempfliverlag.com · 2022
Der Stämpfli Verlag wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
Lektorat: Benita Schnidrig, Stämpfli Verlag AG, Bern
Gestaltung Inhalt: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Bern
Gestaltung Umschlag: Thierry Wijnberg, total italic, Berlin
Umschlagbild: Alexander Kiermayer
ISBN (E-PDF) 978-3-7272–6157-2
ISBN (Epub) 978-3-7272–6156-5
ISBN (Print) 978-3-7272–6094-0
Widmung
Für Serge
und alle anderen, die Grenzen überwinden
Inhalt
Inhalt
Vorwort
Überlebender in der zerbrochenen kambodschanischen Gesellschaft
Wenn du wie ein Opfer lebst, gibst du alle Macht den Tätern. Ich aber lasse nicht zu, dass die Roten Khmer mein Leben bestimmen, dass sie mich von der Welt isolieren, deshalb habe ich meine Opferidentität abgestreift.
Die Näherin aus Bangladesch, die sich freikämpfte
Ich kann froh sein, dass ich meinen Arm im grössten und schlimmsten Fabrikunfall unserer Geschichte verloren habe. Hätte ich einen Autounfall gehabt, hätte sich niemand um mich gekümmert. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich schlafe in einem Bett mit meinen zwei Töchtern. Das ist mehr, als viele Leute haben.
Ein burmesischer Journalist leistet Widerstand
Wut und Anspannung verlassen mich keine Sekunde, nie. Aber wie Snoop Dogg einmal rappte: «Ich bin hier, um meine Leute aus ihren Träumen aufzuwecken, die Dämonen zu töten und die Schlangen, auch wenn mein Leben voller Probleme ist.» So schreibe ich weiter, schreibe an gegen die Diktatur, auch wenn mir das inzwischen ziemlich unnütz erscheint.
Der Handlanger und das Opfer im philippinischen Drogenkrieg
Einem Priester habe ich nie gebeichtet. Man weiss nie. Er könnte mich verraten. Nur Gott bitte ich: «Lass mich alles vergessen. Lass mich einschlafen und aufwachen mit komplettem Gedächtnisschwund. Dann kann ich von vorne beginnen.»
Manchmal spreche ich mit meinem ermordeten Mann: «Sag Gott, dass er mich noch nicht holen soll. Die Enkel brauchen mich noch!» Ich bin zwar nicht sehr gläubig und gehe lieber ins Kino als in die Kirche.
Die Geisel der philippinischen Stadt Marawi
Was mich durchhalten liess? All die Erinnerungen und Gedanken an meine Tochter Queeny und meine Frau April. Das machte mich stark. Andere Geiseln, die keine Familie hatten, knickten schneller ein, verzweifelten oder schlossen sich dem IS an und warfen sich in die Schlacht. Sie hatten nichts zu verlieren. Viele starben.
Ein englischer Schlagzeuger und Junkie wird buddhistischer Mönch in Thailand
Es ist einfach, Mitgefühl für die Schwachen und die Opfer zu empfinden. Die wirkliche Herausforderung ist, dasselbe Mitgefühl für die Täter aufzubringen. Diese Art von Mitgefühl ist die Voraussetzung, wenn wir die endlosen Gewalt- und Konfliktspiralen in der Welt beenden wollen.
Epilog
Dank
Zur Autorin
Vorwort
Es gibt Ereignisse, die unser Leben verändern: ein Unfall, ein Erdbeben, die Begegnung mit einem anderen Menschen. Wir alle kennen solche Ereignisse aus unserem eigenen Leben.
Für mich ist der Umzug von Zürich nach Neu-Delhi ein solches, dort nahm ich im Herbst 2009 als Südasienkorrespondentin für das Schweizer Radio SRF meine Arbeit auf. Auf einmal lebte ich in einer Megametropole, in der Millionen von Menschen um ihr Überleben kämpften. Indien und Neu-Delhi wurden für mehr als sechs Jahre mein Zuhause, der Ort, von dem aus ich nach Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und in die anderen südasiatischen Länder reiste, um Geschichten zu sammeln und sie danach zu erzählen. Im Frühling 2016 zog ich weiter nach Bangkok, seither berichte ich von hier aus über Südostasien.
Oft habe ich in diesen vergangenen zwölf Jahren über Grossereignisse wie die Flut in Pakistan 2010, das Erdbeben in Nepal 2015, den jahrelangen Krieg in Afghanistan, die wiederkehrenden Proteste in Bangkok, die Besetzung der südphilippinischen Stadt Marawi 2017 durch Islamisten oder die Vertreibung der Rohingya in den Jahren 2016 und 2017 berichtet. Immer wieder traf ich dabei auf Menschen, die Schreckliches überlebt hatten, und jedes Mal fragte ich mich: Wie lebt jemand nach einer so extremen Grenzerfahrung weiter? Woher nehmen Menschen die Kraft, weiterzugehen, ohne zu zerbrechen – weder physisch noch psychisch –, obwohl sie grausame Erfahrungen gemacht haben? Wer überlebt nur, und wer schöpft Kraft aus dem Erlebten und entdeckt die Welt neu? Was hilft ihm dabei?
Die Sehnsucht nach mehr Tiefe und Komplexität sowie der Wunsch, Menschen länger zu begleiten, statt sie nur in News-Flashs zu Wort kommen zu lassen, haben mich dazu bewogen, meine Protagonistinnen und Protagonisten in den Jahren nach den ersten Begegnungen immer wieder aufzusuchen und schliesslich dieses Buch zu schreiben.
Da ist zum Beispiel Rozina, eine Näherin aus Bangladesch. Sie arbeitet im Rana-Plaza-Gebäude, wo internationale Modeketten ihre Kleider produzieren lassen, als dieses am 24. April 2013 einstürzt. 1134 Menschen sterben, mehr als 2500 werden verletzt. Es ist die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der Kleiderproduktion von Bangladesch. Rozina überlebt nur durch einen Akt der Verzweiflung. Der Fabrikunfall erschüttert Bangladesch und die Welt und dominiert tagelang die internationale Berichterstattung. Doch schon wenige Wochen später rücken wieder andere News in den Vordergrund: Ein Tornado verwüstet Moore in Oklahoma; in Ägypten wird Präsident Mohammed Mursi vom Militär gestürzt; vor Lampedusa ertrinken 366 Bootsflüchtlinge. Als ich Rozina Monate nach dem Unfall in Bangladesch kennenlerne, ist Rana Plaza längst aus der internationalen Berichterstattung verschwunden. Ihr Leben jedoch ist durch den Fabrikeinsturz für immer verändert. Traumatisiert und verwundet, lebt sie mit ihrer Tochter in einem Slum. Ihr Mann ist mit allen Spendengeldern, die sie bekommen hat, abgehauen. Zurück in Neu-Delhi, denke ich immer wieder an diese Frau, die durch die Arbeit in der Fabrik ein Stück Freiheit gewonnen hat und dann alles verliert. Oft frage ich mich, wie ihr Leben weitergeht, und so kehre ich ein Jahr später zu ihr zurück. Ich begleite Rozina über manche Jahre, meine erst, sie werde von Schmerzen und ihrer Depression zugrunde gerichtet, und merke beim nächsten Treffen, dass sie ihrem Leben eine ganz neue Richtung gegeben hat.
Rozina ist nicht die Einzige, deren Schicksal ich weiterverfolge, nicht die Einzige, die dem Tod nur knapp entkommen ist.
In Thailand treffe ich Peter, einen ehemaligen Schlagzeuger, der beinahe an einer Überdosis Heroin stirbt, dann im Kloster eine Entziehungskur macht und Mönch wird. Wie er es schafft, sich mit viel Ehrlichkeit und radikalen Schritten aus seinem eigenen Lebensdrama zu befreien, ist mir bis heute eine grosse Inspiration – obwohl seine Geschichte und unsere Freundschaft eine so ganz und gar unerwartete Wendung nehmen. Auch mit vielen anderen Protagonisten in diesem Buch sind im Lauf der Zeit Freundschaften entstanden.
Die Menschen, die ich hier porträtiere, kommen aus sechs verschiedenen Ländern. Ihr Leben wurde durch politische Ereignisse, persönliche Entscheidungen oder Katastrophen aus der Bahn geworfen. Doch eines haben sie gemeinsam: Sie sind Überlebende oder waren es, zwei sterben in der Zeit meiner Recherchen. Der eine wird, kurz bevor ich ihn wieder treffen will, erschossen, der andere setzt seinem Leben selbst ein Ende.
Die Recherche für dieses Buch hat vor zehn Jahren begonnen. Was am Anfang eine vage Idee für einen längeren Artikel war, ist mit der Zeit zu einem Buchprojekt mit immer mehr Protagonisten geworden. Bei den wiederkehrenden Begegnungen führte ich jeweils lange Interviews mit ihnen und manchmal auch mit Personen in ihrem näheren Umfeld. Die Transkriptionen ergänzte ich mit Notizen über meine Beobachtungen und die Veränderungen im jeweiligen Land. So entstanden Hunderte von Textseiten. Und bald merkte ich, dass ich vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen stand. Allein schon das Sprachproblem: Nur für Peter, den Mönch, war Englisch die Muttersprache, und mit Serge sprach ich Schweizerdeutsch, bei den meisten anderen arbeitete ich mit Übersetzern zusammen. Es gab sprachliche und inhaltliche Details, die ich im Nachhinein klären musste, was oft eine grosse organisatorische Herausforderung war. Die Protagonisten lebten in anderen Ländern, manche waren schwierig zu erreichen, manchmal tauchten sie ab.
Nach den Recherchen versuchte ich die vielen Seiten transkribierter Interviews zu einem Konzentrat zu verdichten. Obwohl ich dabei nach journalistischen Grundsätzen vorging, ist mir bewusst, dass wohl kaum eine Übersetzung zu hundert Prozent den exakten Aussagen der Interviewpartner entspricht. Mehrfache Übersetzungen und Lücken, die ich anhand von Zweit- oder Drittquellen zu schliessen versuchte, machen dies schlicht unmöglich. Bei der Übersetzung ins Deutsche und in der Anordnung der Aussagen meiner Interviewpartner nahm ich mir zudem eine gewisse Freiheit, um die Lesbarkeit zu gewährleisten.
Doch es gab noch ganz andere Herausforderungen, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Bei jedem wiederkehrenden Treffen stellte ich meinen Protagonisten und auch den Personen in ihrem Umfeld Fragen, die ich bereits beim letzten Mal gestellt hatte – eine normale journalistische Vorgehensweise. Obwohl ich überzeugt bin, dass mich keiner meiner Interviewpartner bewusst angelogen hat, merke ich später beim Lesen, dass sich Wahrnehmungen, Erinnerungen und damit auch die Geschichten selbst mit der Zeit verändern und auch von unterschiedlichen Personen unterschiedlich wahrgenommen werden. Wie sehr sind wir Herrin unseres eigenen Narrativs, unserer Lebenswege und unserer Wahrnehmung, und inwiefern können wir sie beeinflussen? Was ist wahr? Sind es die Fakten, die wir im Laufe der Zeit zusammentragen, oder sind es die emotionalen Erinnerungen, die sich verändern und gelegentlich den sogenannten objektiven Wahrheiten oder früheren Wahrnehmungen widersprechen?
Objektivität wird oft als eines der wichtigsten Kriterien im Journalismus genannt. Doch es wäre naiv, zu glauben, unsere eigenen Lebenswelten, unsere Vergangenheit und unser kultureller Hintergrund hätten keinen Einfluss auf unsere Wahrnehmung und damit auch auf unsere Berichterstattung. Im Bewusstsein, dass alles, was wir erleben, beobachten und berichten, immer auch eine Reflexion unserer eigenen Wahrnehmung ist, halte ich mich in diesem Buch nicht als neutrale Erzählperson im Hintergrund, sondern lasse meine eigenen Gedanken, Beobachtungen, Emotionen, Erfahrungen und Fragen einfliessen. Anders als in meinen Radioreportagen lasse ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, damit an der Geschichte hinter der Geschichte teilnehmen, dem Making-of. Zudem erzähle ich, wie die Geschichten anderer mein Leben als Berichterstatterin verändern und prägen. Ich versuche dabei nichts zu beschönigen, sondern vielmehr aufzuzeigen, in welchen Zwiespälten und manchmal Abgründen wir uns als Beobachtende selbst befinden.
Diese persönlichen Zwischenkapitel, aber auch historische und politische Notizen sowie Kurzreportagen sollen Ihnen als Brücke in diese fremden Welten in Asien dienen. Denn die Erzählungen sind nicht nur persönliche Lebensgeschichten, sondern widerspiegeln auch die grösseren politischen, wirtschaftlichen, sozialen und religiösen Gegebenheiten und Veränderungen in den jeweiligen Ländern. Sie zeigen die Folgen von Krieg, Korruption, Fundamentalismus oder Ausbeutung drastisch auf und machen sie nachfühlbar. Dieses Buch soll als Inspiration dienen, unsere eigenen kleineren oder grösseren Lebensdramen mit anderen Augen zu betrachten. In einer Welt, die so viel komplexer ist als eine Schlagzeile und in der wir alle verbunden sind, möchte es zudem eine kleine Verständnishilfe sein.
Karin Wenger
Bangkok, im Februar 2022
Überlebender in der zerbrochenen kambodschanischen Gesellschaft
Wenn du wie ein Opfer lebst, gibst du alle Macht den Tätern. Ich aber lasse nicht zu, dass die Roten Khmer mein Leben bestimmen, dass sie mich von der Welt isolieren, deshalb habe ich meine Opferidentität abgestreift.
Youk Chhang
Am 17. April 1975 beginnt die Schreckensherrschaft der Roten Khmer in Kambodscha. Deren Regime unter der Führung von Pol Pot will das Land in einen Bauernstaat verwandeln, autark und kommunistisch. Die Roten Khmer idealisieren das Landleben und beseitigen Intellektuelle, Ärzte und Künstler. Familien werden auseinandergerissen, Mönche ihrer Roben beraubt. Religion, Kunst und Kultur haben keinen Platz in diesem Weltbild. Unter ihrer Herrschaft sterben schätzungsweise zwei Millionen Menschen, ein Viertel der damaligen Bevölkerung. Sie werden gefoltert, getötet, sterben an Erschöpfung oder verhungern in den Arbeitslagern. Angka, so heisst die Führungsriege der Roten Khmer, verteilt die Menschen über das ganze Land und lässt sie auf Feldern schuften und Dämme bauen. Als die Vietnamesen Ende Dezember 1978, drei Jahre, acht Monate und zwanzig Tage nach der Machtübernahme, ins Land einmarschieren, liegt Kambodscha in Trümmern. Es folgt ein jahrelanger Bürgerkrieg, in dem auch die USA und China die Roten Khmer gegen die Vietnamesen und die neue kambodschanische Regierung unterstützen. Es ist die Zeit des Kalten Krieges, Vietnam soll isoliert werden. Erst 1991 unterzeichnen die Kriegsparteien ein Friedensabkommen. Doch die Roten Khmer anerkennen es nicht. Aus den Grenzregionen zu Thailand führen sie ihren Guerillakrieg weiter – bis zu ihrem Zerfall 1998. Was die Anführer das grösste soziale Experiment in der Geschichte der Menschheit nannten, ist gescheitert. Ein diffuses Gefühl der Angst lastet jedoch bis heute auf den Menschen, selbst jenen, die die Roten Khmer gar nie erlebt haben.
Alles nur für die Mutter
Eine schmale Treppe führt zu Youk Chhangs Büro empor. Licht flutet durch die grossen Glasfenster auf gut bestückte Bücherregale. Hinter dem Schreibtisch hängt ein Gemälde: ein Buddha im Lotussitz, die Hände im Schoss ineinandergelegt. Youk Chhang schaut auf. Ein Lächeln breitet sich über sein rundes Gesicht, die Augen sind leicht zusammengekniffen, darüber ein voller, aber grauer Haarschopf. Später werde ich mich fragen, wie es möglich ist, dass einer, der so viel Leid erfahren hat, eine so gütige Stimme, ein so warmes Lächeln hat. Noch später werde ich merken, dass seine Antworten einen gehässigen Unterton bekommen, wenn er glaubt, die Kontrolle zu verlieren oder zu viel preisgegeben zu haben.
Youk Chhang ist ein Überlebender der Schreckensherrschaft der Roten Khmer, Journalist, Politologe und Direktor des Dokumentationszentrums von Kambodscha seit dessen Gründung Mitte der neunziger Jahre in Phnom Penh. Damals war das Zentrum, auch DC-Cam genannt, Teil des Kambodscha-Genozid-Programms der US-amerikanischen Yale University. Seit 1997 ist es unabhängig, wird aber weiterhin auch durch Regierungsprogramme der USA, andere Länder und private Spender finanziert. Über fünfzig Forscherinnen und Forscher arbeiten im Zentrum zu Themen rund um den Völkermord in Kambodscha.
Youk Chhang steht auf und tritt zur Begrüssung vor seinen grossen Schreibtisch. Besucher zu empfangen und ihnen Geschichten zu erzählen, seine wie auch die von anderen Überlebenden, gehört fest zu seinem Alltag. Denn wer sich mit der Geschichte Kambodschas und der Roten Khmer auseinandersetzt, besucht früher oder später das Dokumentationszentrum und Youk Chhang. So auch ich an diesem Tag im Oktober 2016. Kaum jemand sonst weiss so viel über den Genozid, hat ihn selbst erlebt und überlebt, wie er.
Ich wurde 1961, im Jahr des Büffels, in Phnom Penh geboren. Ich bin ein Überlebender der Roten Khmer, aber ein Opfer bin ich nicht mehr. Das sage ich allen, die in mir das Opfer sehen wollen. Ein Opfer zu sein, bedeutet, dass du eine unüberwindbare Barriere, eine Mauer zwischen dir und den anderen, errichtest. Wie aber willst du leben, andere verstehen, Beziehungen aufbauen, wenn du dich einmauerst? Wenn du wie ein Opfer lebst, gibst du alle Macht den Tätern. Ich aber lasse nicht zu, dass die Roten Khmer mein Leben bestimmen, dass sie mich von der Welt isolieren, deshalb habe ich meine Opferidentität abgestreift. Ich habe meinem Leben einen Sinn gegeben.
Aber vielleicht sollte ich anders beginnen, denn alles, was ich mache, tue ich für meine Mutter. Meine Mutter war ein Bauernmädchen. Lesen und Schreiben hat sie nie gelernt. Aber sie kann Tabak zu Zigaretten rollen, Fisch zubereiten und Stoffe weben. Das hat uns später das Leben gerettet. Sie erlebte den Zweiten Weltkrieg, den Vietnamkrieg, den Staatsstreich, den Völkermord, die vietnamesische Invasion. Sie lebte in Armut, und als ihr Leben endlich stabiler wurde, kam die Globalisierung. Heute ist sie isoliert von dieser modernen Welt. Aber noch immer lebt sie, seit fast einem Jahrhundert. Glücklich war sie wohl nie wirklich. Selten habe ich sie lächeln sehen. Sie hatte zehn Kinder, ich war das jüngste. Als ich ein kleiner Junge war, schlief ich in ihrem Bett. Jeden Morgen schaute ich ihr nach, wenn sie wie alle Frauen ihren blauen Korb nahm und mit dem Bus zum Markt fuhr. Zuerst kaufte sie Fisch, dann Gemüse, dann einen kleinen Kuchen für die Kinder. Wenn sie zurückkam, rannte ich ihr entgegen, um den Kuchen in Empfang zu nehmen. Während des Monsuns bereitete sie frischen Fisch für mich zu. Früchte versteckte sie in den grossen Gefässen, in denen sie auch Reis aufbewahrte. Wenn ich aus der Schule nach Hause kam, suchte ich nach ihnen. Manchmal versteckte sie auch ihren Geldbeutel irgendwo in einer Ritze in der Wand. Sie wusste genau, dass ich danach suchen und ein paar Münzen rausnehmen würde. Meine Mutter und ich waren uns nahe, aber die Nähe war flüchtig und kurz. Ich habe mich oft gewundert, wieso sie so wenig Zeit mit mir verbrachte. Als ich sie viel später danach fragte, antwortete sie: «Sorge dich nicht um deine Zukunft. Als ich mit dir schwanger war, hatte ich einen Traum. Ich verlor dich im Wald, weinte und rief nach dir, bis ich dich schliesslich auf einer Bergspitze entdeckte. Du sassest dort oben und hast nach Osten geschaut. Da wusste ich: Irgendwann würdest du eine wichtige Person werden, aber dafür musste ich dich verlassen und im Wald verlieren.» Meine Mutter glaubt an die Kraft ihrer Träume, so wie alle Kambodschaner. Ich aber musste als Kind lernen, alleine zurechtzukommen. Ich wuchs in der Stadt auf, bastelte Drachen, pflanzte Blumen und war ein ziemlich unabhängiges Kind. Doch im Nachbarland Vietnam herrschte Krieg. Davon blieben auch wir nicht verschont.
Der kambodschanische Albtraum beginnt auf der anderen Seite der Grenze in Vietnam, oder präziser in Washington D. C. Der Vietnamkrieg ist schon seit den 1950er Jahren in vollem Gang, ohne die amerikanischen Kriegshandlungen hätte es die brutale Herrschaft der Roten Khmer wohl nie gegeben. Die Amerikaner schaffen es nicht, den Vietcong in Vietnam zu besiegen. An einem Sonntag im März 1969 nach dem Kirchgang beschliessen Präsident Nixon und sein Sicherheitsberater Henry Kissinger, ihre Angriffe auf Kambodscha auszuweiten. So wollen sie die Versorgungsrouten und die Verstecke des Vietcongs zerstören. Die geheime Bombenkampagne, von der nicht einmal der Kongress etwas weiss, trägt den Codenamen Menu, aufgeteilt in Frühstück, Mittagessen, Snack, Abendessen und Dessert. Ein Jahr lang bombardieren amerikanische B-52 den Osten Kambodschas fast flächendeckend. Doch der Erfolg bleibt aus. Deshalb ruft Präsident Nixon am 9. Dezember 1970 Kissinger an. Das Gesprächsprotokoll wurde inzwischen freigegeben und ist auf der Website des National Security Archive zugänglich. Nixon befiehlt seinem Sicherheitsberater Folgendes:
Nixon: Ich will, dass alles, was fliegen kann, in Richtung Kambodscha startet und ihnen die Hölle heiss macht. Es gibt kein Limit bezüglich Meilen oder Kosten. Ist das klar?
Kissinger: Verstanden, Herr Präsident.
Nixon: Ich will, dass sie auf alles schiessen. Sie sollen die grossen Flugzeuge nehmen und die kleinen und alles, was wir haben. Wir müssen ihnen einen kleinen Schock versetzen. (…) Das ist unsere Chance, diesen gottverdammten Krieg zu gewinnen, denn am Konferenztisch werden wir nichts erreichen.
Die US-Luftwaffe bombardiert weite Teile Kambodschas. Lange kann diese Kampagne nicht geheim gehalten werden. Deshalb wendet sich Präsident Nixon am 30. April 1970 in einer Fernsehansprache an die Nation – mit einer Lüge: «Guten Abend, liebe Landsleute. (…) Um unsere Männer in Vietnam zu schützen und einen erfolgreichen Abzug zu garantieren, habe ich beschlossen, dass jetzt die Zeit reif ist zum Handeln. (…) Kambodscha ist ein kleines, neutrales Land mit sieben Millionen Menschen. Als Amerikaner haben wir die Neutralität von Kambodscha immer respektiert. Nicht so die Nordvietnamesen. Sie haben in den letzten fünf Jahren militärische Stützpunkte entlang der gesamten kambodschanischen Grenze errichtet, auch auf kambodschanischer Seite.» Deshalb habe er beschlossen, die Verstecke des Feindes anzugreifen und zu zerstören.
Kambodscha ist auf einmal mitten im Krieg – mit katastrophalen Folgen. Der Vietnamveteran Micheal Clodfelter schreibt in seinem Buch «Vietnam in Military Statistics: A History of the Indochina Wars, 1772–1991», dass die Amerikaner von Oktober 1965 bis August 1973 rund 7,7 Millionen Tonnen Bomben auf Südostasien abgeworfen hätten – mehr als im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg zusammen. Laut einer Studie von Taylor Owen und Professor Ben Kiernan im Rahmen des Yale Genocide Studies Program an der Yale University bombardieren die Amerikaner im selben Zeitraum mehr als 100 000 unterschiedliche Orte in Kambodscha mit 2,7 Millionen Tonnen Bomben – viel mehr Bomben, als auf Nordvietnam abgeworfen werden. Die Bombardierung von Kambodscha begann laut der Yale-Studie lange vor Nixons Präsidentschaft, unter Präsident Lyndon Johnson. Nach Schätzungen sterben Hunderttausende im amerikanischen Bombenhagel. Die Landwirtschaftsproduktion des Landes wird weitgehend zerstört. Die Bevölkerung hungert. Der kambodschanische König Sihanouk, der das Land seit 1953, seit der vollständigen Unabhängigkeit von der französischen Kolonialmacht, regiert, wird 1970 von einer proamerikanischen Regierung gestürzt. Diese schafft die Monarchie ab, verbreitet jedoch nicht Hoffnung, sondern Korruption. Die Frustration über die neue Regierung und die amerikanischen Bomben sind der Nährboden, auf dem die Roten Khmer und ihre Guerillabewegung, die bislang aus dem Untergrund agiert, gedeihen und immer mehr Unterstützung in der Landbevölkerung finden. Die Flächenbombardements der USA hinterlassen auch Zehntausende von Kriegswaisen, die von den Roten Khmer aufgenommen und zu Kindersoldaten ausgebildet werden. Sie und weitere ihrer Anhänger werden im Kampf gegen kambodschanische Regierungssoldaten eingesetzt – ein Kampf, der in einen grausamen Bürgerkrieg mündet, der die Stadt- und Landbevölkerung zerreisst und das Land zerstört. Wer aber alles verliert, wie viele in Kambodscha, wird anfällig für Heilsversprechen, für Ideologien, für Diktatoren. Die Roten Khmer und ihr Anführer Pol Pot, oder Saloth Sar, wie er mit richtigem Namen heisst, bieten all das.
Mit dem Ende des Vietnamkriegs am 30. April 1975 verändert sich auch die Machtdynamik in Kambodscha. Zwei Wochen vor Kriegsende verlässt ein Helikopter mit den letzten Amerikanern Phnom Penh. Damit steht dem Vormarsch der Roten Khmer auf die kambodschanische Hauptstadt nichts mehr im Wege.
Am 17. April 1975, ich war vierzehn Jahre alt, marschierten die Roten Khmer in Phnom Penh ein. An jenem Tag war ich allein zuhause. Die Soldaten blockierten den Verkehr und zwangen mich, das Haus zu verlassen und aus der Stadt zu marschieren, bevor meine Mutter und meine Geschwister zurück waren. Die Strassen waren voller Menschen, aber niemand sprach ein Wort. Totenstille lag über Phnom Penh, und unter der Stille lag die Angst. Auch ich konnte sie spüren, und trotz all der Menschen, die mit mir aus der Stadt drängten, fühlte ich mich so einsam wie nie zuvor. Noch ahnte ich nicht, wie lange es dauern würde, bis ich meine Mutter wiedersehen würde.
Zu jenem Zeitpunkt hatten die meisten Ausländer Kambodscha bereits verlassen. Nun schlossen die Roten Khmer die Türen zur Aussenwelt und verkündeten, die Amerikaner würden die Städte bombardieren, deshalb müssten sie Phnom Penh evakuieren. Sie befahlen uns, in unsere Heimatdörfer auf dem Land zu gehen. Ich aber kannte nur meine Stadt Phnom Penh, sie war meine Heimat. Wo also sollte ich hin? Vage erinnerte ich mich an das Dorf meiner Grosseltern, das auf dem Land ausserhalb von Phnom Penh lag und wohin wohl auch meine Mutter gehen würde. Ich brauchte Wochen, bis ich es endlich fand, dabei hatte ich weder Essen noch Trinken bei mir, und kaum jemand wollte etwas mit mir teilen. Manchmal bat ich Soldaten der Roten Khmer um ein Stück Reiskuchen oder etwas Wasser. Manchmal fand ich etwas Essbares auf der Strasse. Als ich endlich im Dorf meiner Grosseltern ankam, war meine Mutter nicht dort.
Es fallen keine amerikanischen Bomben auf Phnom Penh, so wie das die Roten Khmer angekündigt haben. Die aber nisten sich in der leergeräumten Stadt und allen anderen Städten ein, nachdem sie die Stadtbewohner in die Dörfer getrieben haben. Es ist, als wollten sie die Welt von innen nach aussen drehen, die Spielregeln ändern und die Machtverhältnisse.
Lange nachdem ich das Dorf meiner Grosseltern erreicht hatte, kamen auch meine Mutter, meine Schwestern, mein Onkel und noch ein paar andere Familienmitglieder. «Wieso habt ihr so lange gebraucht, um hierherzukommen?», fragte ich meine Mutter, und sie antwortete: «Wir versuchten nach Vietnam zu entkommen, aber wir schafften es nicht, da wir kein Vietnamesisch sprechen und an der Grenze aufgehalten wurden.» Da wurde mir schmerzlich bewusst: Sie war nicht meinetwegen ins Dorf gekommen. Sie glaubte an ihren Traum, der ihr gesagt hatte, sie müsse mich verlieren, damit ich eine wichtige Person werden könne. Ich aber wusste damals noch nichts von diesem Traum. Ihre Entscheidung brach mir das Herz.
Dann kamen die Soldaten der Roten Khmer und forderten uns auf, das Dorf zu verlassen und weiterzuziehen. Das war Teil ihres grossen Plans der Massenverschiebung: Menschen wurden von Ort zu Ort geschickt. Uns steckten sie in einen Zug. Das war der Anfang der Verbrechen, des Mordens, des Hungers, des Genozids.
Wir waren etwa hundert Personen in einem Waggon. Niemand wusste, wohin uns der Zug bringen würde. Da war nur das gleichmässige Rattern. Eines Nachts zeigte mein Onkel auf den vorbeiziehenden Nachthimmel und sagte: «Der Schwanz des Krokodil-Sterns kann uns die Richtung verraten, in die wir fahren.» Der Schwanz zeigte gen Norden. Sie brachten uns nach Battambang.
Battambang sei der Ort der Geister, wurde mir gesagt, bevor ich meine Recherchereise nur wenige Tage vor meinem Treffen mit Youk Chhang in den Osten Kambodschas angetreten habe. Mehr als zehntausend Menschen starben hier in der Zeit der Roten Khmer, viele von ihnen wurden umgebracht. Die Schädel und Knochen der Toten sind längst ausgegraben und liegen hinter Glas in einem Mahnmal auf einem Feld hinter dem buddhistischen Kloster Samrong Knong. An diesem Abend sehe ich keine Geister, nur die Silhouetten der Mönche, die überlebt haben und die jetzt im Kloster beten. Sie tun es die ganze Nacht, denn es ist Pchum Ben, das Festival, mit dem die Kambodschaner ihrer Toten gedenken. Wie monotone Klangschuppen gleiten die Gebete durch die Dunkelheit. In dieser Nacht, so heisst es, seien die Geister besonders aktiv, da sich die Pforten der Hölle öffnen würden. Deshalb haben die Lebenden den Toten schmackhaftes Essen hingestellt, damit sie kommen können, um es sich zu holen, um im Reich der Geister ein Festmahl der Lebenden zu verzehren. Könnte man die Geister sehen, wären der Himmel über Battambang und die Strassen der Stadt jetzt schwarz von ihren Schatten. Aber ich sehe nichts. Oder hat vielleicht einfach nur das Schwarz der Nacht ihre Schatten verschluckt?
Nein. Denn auch am Nachmittag habe ich die Geister bei meinem Besuch im Kloster nicht gesehen. Nur gefröstelt hat es mich immer wieder. Aber das war wohl wegen der Geschichten, die die Toten bei den Lebenden zurückgelassen haben. Niemand kann so abgestumpft sein, um davon unberührt zu bleiben. Das Kloster wurde unter den Roten Khmer zum Gefängnis, das Feld dahinter zum Richtplatz. Am Nachmittag habe ich dort Yun Sopheak getroffen. Er ist 32 Jahre alt, zu jung, um die Roten Khmer erlebt zu haben. «Hier starben so viele Menschen. Eigenartige Dinge passierten danach. Die Bauern sagen, man könne noch heute das Wasser der Kokosnüsse nicht trinken, weil es nach Leichen rieche. Ich habe nie einen Geist gesehen, aber ich bete für die Seelen der Toten.» Yun Sopheak arbeitet für die Organisation Jugend für den Frieden. Er glaubt, es sei wichtig, die Vergangenheit zu verstehen, um nicht von ihr eingeholt zu werden, gerade deshalb führt er Besucher durchs Kloster und erzählt Geschichten aus der Vergangenheit, die bis in die Gegenwart nachhallen.
Viele, die hierher ins Kloster kommen, hören zum ersten Mal von den Gräueltaten der Roten Khmer. Dann entwerfen sie Zeichnungen, die jetzt an den Wänden der ehemaligen Folterkammer hängen. Schwarz gekleidete Männer schiessen darauf auf Kinder. Ich schaue genau hin, doch je genauer ich dies tue, desto verschwommener werden die Bilder, als ob die Augen nicht sehen wollten, was da an Grauen in Pinselstrichen auf Papier festgehalten wurde.
Nicht weit vom Tempel entfernt lärmt eine Motorsäge. Duong Sakum stellt sie auf den Boden, als er mich sieht. Er hat mich erwartet. Yun Sopheak hat mich zu ihm geschickt, weil er ein besonders eifriger Freiwilliger im Tempel und besonders aktiv zur Zeit der Roten Khmer gewesen sei.
An den Wänden von Duong Sakums traditionellem Holzhaus hängen die Porträts der politischen Köpfe Kambodschas. Als die Roten Khmer an die Macht kamen, war Duong Sakum Kommandant in der Regierungsarmee. «Ich dachte, die Roten Khmer werden mich umbringen, wenn sie herausfinden, dass ich Soldat war. Als sie mich nach meiner Vergangenheit fragten, sagte ich: Ich habe nichts Schlechtes getan. Ich habe einfach gearbeitet, hart gearbeitet», seine Stimme hat noch immer einen flehenden Unterton. Wie alle musste Sakum auf dem Feld arbeiten, Reis pflanzen, mithelfen, Dämme und Bewässerungsanlagen zu bauen. Dafür sei er respektiert worden. Die Roten Khmer hätten ihm immer mehr Verantwortung übertragen. Doch wieso haben sie ihn, einen ehemaligen Kommandanten der Regierungsarmee, einen Feind, am Leben gelassen? Was musste er dafür tun? Er zögert einen Moment. Dann sagt er: «Mitmachen. Irgendwann war ich einer von ihnen.» Und dann, als es endlich gesagt ist, er, ein Mitglied der Roten Khmer, will er nicht mehr aufhören zu erzählen. Fünfzig Leute, die Reis anbauten, habe er überwacht. Wenn sie etwas Unrechtes getan hätten, habe er sie auf dem Ochsenkarren zum Gefängnis transportiert. «Manchmal schenkte mir die Frau des lokalen Chefs der Roten Khmer in der Nacht Süssigkeiten – bis ich auch ihre Familie zum Gefängnis karren musste.»
Ich denke an meinen Besuch im S21. Das Gymnasium mit den gelben Mauern und braun-weissen Kachelböden in Phnom Penh wurde von den Roten Khmer in ein Gefängnis umfunktioniert und ist jetzt ein Museum mit dem Namen Tuol Sleng Genozid Museum. Tausende wurden dort eingesperrt und an Eisenstangen angekettet: Mönche, Studenten, aber immer mehr auch Leute aus den Reihen der Roten Khmer selbst, Führungskader und einfache Soldaten. Den Gefangenen wurden mit Elektroschocks Geständnisse abgerungen, sie wurden in Wasserbottiche getaucht, an Galgen aufgehängt und mit Säure malträtiert. Sie sollten vorerst nicht getötet werden, sondern sie sollten gestehen, dass sie sich an der Sache der Roten Khmer vergangen hatten. Wer so brutal andere unterdrückt, der lebt selbst in ständiger Angst, ständigem Misstrauen. Schnell wird dabei ein Freund zum Feind zum Gefangenen. Wer gestand, der wurde vor den Toren der Stadt auf den «Killing-Fields» erstochen oder mit Schaufeln erschlagen. Keine Schüsse sollten fallen, keine Munition sollte an Verräter vergeudet werden. Daran denke ich, als Duong Sakum nun sagt: «Nein, ich wusste nicht, dass so viele getötet wurden. Ich hatte einfach Angst, deshalb habe ich für sie gearbeitet. Jeder hatte Angst vor jedem. Ich wurde ein Roter Khmer, um zu überleben.»
Am Abend sitze ich am schweren Holztisch in meinem Hotelzimmer mit Blick auf den Garten und führe Tagebuch. Gräueltaten werden nicht weniger schlimm, wenn man sie aufschreibt, aber sie werden erträglicher, als ob man sich von ihnen befreien, sie abstreifen würde, indem man sie dem Papier übergibt. Ich höre noch immer vereinzelte Gebetsfetzen, die durch den Garten gleiten und bis in mein Zimmer dringen. Das Gebäude stammt aus der französischen Kolonialzeit, wurde später von den Roten Khmer übernommen, dann kamen die Vietnamesen und schliesslich ein ausländisches Paar, das den Kolonialcharme wiederherstellte und das Gebäude in ein Hotel verwandelte. Mein Zimmer hat braun-weiss gemusterte Bodenfliesen, ein Himmelbett, dessen Moskitonetz bis auf den Boden reicht, und alte Landkarten an den Wänden. Bereits um 21 Uhr sinkt das Hotel in tiefe Dunkelheit und Stille.
Mitten in der Nacht werde ich aus dem Schlaf gerissen. Was war das für ein Lärm? Als ob ein schwerer Gegenstand mitten in meinem Zimmer aufgeschlagen wäre. Habe ich geträumt? Habe ich die Tür geschlossen? Ist da jemand? Der Mond scheint hell durch die offenen Fenster. Und da, neben meinem Bett: gleichmässige, lange Atemzüge. Der Mond aber scheint auf nichts und niemanden. Nur das Moskitonetz wirft einen langen Schatten.
Meine Mutter glaubt nicht nur an ihre Träume, sondern auch an Geister. Alle Kambodschaner glauben an sie. Auch ich glaube daran, aber an Kirchen, Moscheen oder Pagoden glaube ich nicht. Vergangene Nacht träumte ich, dass mich die Roten Khmer bedrohen. Doch dann sagte ich mir im Traum: «Mach dir keine Sorgen. Es gibt zwei Millionen Geister, all diese toten Seelen, die können dir jetzt zu Hilfe eilen.» Das habe ich auch immer meinem Sohn gesagt, wenn er Albträume hatte.
Das Dorf
Ob ich seine Lebensgeschichte wirklich hören wolle, fragt mich Youk Chhang. Seit zwei Stunden sitze ich in seinem Büro und höre ihm zu. Sie sei lang. Natürlich will ich.
Im Zug in die Provinz Battambang hörte ich den älteren Leuten zu. In unserer Kultur müssen die Jungen still sein, wenn die Alten sprechen. Mein Onkel, meine Mutter, meine Grossmutter sprachen alle ganz leise, als ob das Rattern nicht laut genug gewesen wäre, um alle Stimmen zu übertönen. Es war ein Tag irgendwann Ende des Jahres 1975. Der Tag, an dem der Zug in Battambang Stadt, in der Nähe der thailändischen Grenze, hielt. An dieser Bahnstation, und an allen weiteren wie an jenen zuvor, holten sie jeweils hundert Leute aus den Waggons. Sie rissen Familien und Paare auseinander. Wenn du die Nummer 100 warst und deine Schwester die Nummer 101, wurdet ihr getrennt, und der Zug fuhr weiter. Wir hatten Glück und blieben zusammen. Nachdem sie uns rausgeholt hatten, wurden wir auf Ochsenkarren in ein Dorf gebracht. Es hiess Trapaeng Veng. Einfache Hütten wurden unser neues Zuhause und sollten es bleiben, solange die Roten Khmer unser Land beherrschten. Das Dorf war der Ort, wo ich mich daran gewöhnte, dass Morde zum Alltag gehörten. Sie haben Paare umgebracht, die sich liebten, denn Liebe war in der Zeit der Roten Khmer ein Verbrechen. Liebe war einzig Angka, der Partei und der Führung, vorbehalten. Angka war von nun an unsere Mutter und unser Vater, nur Angka durfte geliebt werden.
Das Dorf lag in Region 5. Diese war etwa sechzig Quadratkilometer gross, ein riesiges Gebiet aus lauter Feldern. Die Roten Khmer nannten es die Experimentierzone. Stadtleute sollten hier Not leiden. Das Dorf war neblig und kalt. Wir besassen zwar Kleider, aber keine Schuhe, deshalb wärmten wir uns an kleinen Feuern. Wenn du in der Trockenzeit das Essen, das sie dir gaben, nicht schnell genug verschlangst, wurde es dir von Tausenden von Fliegen gestohlen. Es war der schmutzigste Ort der Welt, als ich dort lebte, doch das war nicht immer so gewesen.
In den 1960er Jahren wurde dort so viel Reis angepflanzt, dass man ihn sogar nach Afrika exportierte. Auch als ich im Dorf lebte, erstreckten sich die Reisfelder in der Erntezeit Anfang Dezember bis zum Horizont. Doch die Roten Khmer liessen uns den Reis zwar pflanzen, bewachen, pflegen und ernten, aber essen durften wir ihn nicht. Wer es wagte, ein Reiskorn aufzuheben und zu essen, forderte den Sühnetod heraus. Wir sahen dem Reis also zu, wie er wuchs, wir ernteten und bewahrten ihn auf, und dann trugen sie ihn aus unserem Dorf davon.
Wir erhielten ein paar Löffel Wasser pro Tag und wässrigen Reisbrei, manchmal Bananenstiele. Wenn dich der Anführer nicht mochte, kriegtest du gar nichts. In der Trockenzeit verdursteten viele, aber auch in der Regenzeit war der Tod unser ständiger Begleiter.
Das Dorf war bereits mit Angst infiziert, und diese steckte uns alle wie ein Virus an. Ich sah, wie ein Junge, der Zuckerrohr mit anderen Lebensmitteln tauschen wollte, verprügelt wurde. Wir wussten alle: Entweder du stellst dich gegen sie und stirbst, oder du wirst einer von ihnen und lebst. Diese Entscheidung musste jeder für sich treffen. Und wir wussten: Wenn sie wollen, kriegen sie uns alle dran, denn jeder würde irgendeinen Fehler machen. Ich zum Beispiel klaute Essen. Andere starben dafür.
Im Dorf wurde meine Mutter an ihren Traum erinnert. Es lag neben einem Berg, und dieser sah aus wie im Traum meiner Mutter. Der Berg hiess Aya-Buddha. Meine Mutter erwartete, dass etwas Schlimmes passieren würde – sie sollte Recht bekommen. Die Roten Khmer kannten keine Gnade.
Um zu verstehen, wer die Roten Khmer und ihr Anführer Pol Pot waren, erzählt mir Youk Chhang etwas über Pol Pots Familie. Er hat lange nach dem Zerfall der Roten Khmer Saloth Roeung, Pol Pots Schwester, und seine zwei Brüder interviewt.
Ich wollte wissen, wer Pol Pot wirklich war. Als ich Saloth Roeung traf, war sie schon fast achtzig Jahre alt und immer noch hübsch. Ihre ältere Cousine hatte in den 1920er Jahren im königlichen Ballett getanzt, war so mit der Königsfamilie in Kontakt gekommen und zur Konsortin von Prinz Sisowath Monivong geworden. Sie holte auch Saloth Roeung als junges Mädchen ins königliche Ballett und damit in den Königspalast. Prinz Sisowath Monivong wurde 1927 König und Saloth Roeung eine seiner Geliebten. Sie erzählte mir, wie sie den König herausgefordert hatte, indem sie ihr Haar kurz schnitt, sich weigerte, mit ihm zu tanzen, sie ging dann aber mit ihm auf die Jagd. König Sisowath Monivong starb zwar bereits 1941, aber sein Enkel Norodom Sihanouk, der den Thron erbte und auch als Premierminister regierte, wurde unter den Roten Khmer zu Hausarrest verknurrt. Das königliche Hofleben war vorbei, für den König, aber auch für Pol Pots Schwester. Als ich sie später traf, war sie verärgert über die Roten Khmer und über ihren Bruder, nicht weil diese Millionen von Menschen getötet, sondern weil sie ihrem schönen Leben im Palast ein Ende bereitet hatten.
Pol Pots Brüder waren immer noch Bauern, als ich sie traf. Auch Pol Pot hätte Bauer werden können, hätte dann vielleicht zwei, drei Kühe gehütet, den Boden beackert und hätte nie eine Bewegung wie die der Roten Khmer angeführt. Aber er war anders als die anderen Dorfjungen, die nach Kuhscheisse rochen. Er verliess das Dorf, als er noch ein Junge war, und lebte mit seiner Schwester im Palast. Er war nie ein Bauernbub, sondern lebte ein privilegiertes Leben, reiste, trug Schuhe und weisse Hemden. Er lebte ein Jahr in einem buddhistischen Kloster und ging dann in einem französischen Gymnasium in Kambodscha zur Schule. In den 1950er Jahren studierte er in Frankreich. Dort entdeckte er den Kommunismus und traf jene Männer, die seine engsten Verbündeten bei den Roten Khmer werden sollten. Als er nach Kambodscha zurückkehrte, arbeitete er als Lehrer, wurde dann Teil der kommunistischen Untergrundbewegung und floh in den 1960er Jahren vor der Regierung in den Urwald. Dort begannen die Roten Khmer, ihre Guerillatruppe aufzubauen und die Bauern für ihre kommunistischen Ideen zu begeistern. Und von dort dirigierte Pol Pot die Roten Khmer, liess seine Guerilla gegen die Regierungstruppen kämpfen und nahm schliesslich im April 1975 Phnom Penh ein. Viele freuten sich damals, endlich die korrupte Elite los zu sein. Pol Pot schaffte Privatbesitz, Geld und den freien Handel ab. Er proklamierte die Gleichheit aller Menschen und einen Bauernstaat, autark und radikal kommunistisch. Er idealisierte das bäurische Leben und wollte ins Dorf zurück – aber nicht als Bauerntölpel, sondern als jemand, den man schätzt und achtet. Die Privilegien der Macht hatte er im Königspalast kennengelernt. Diese Macht wollte er in einer Lebensart verwirklichen, nach der er selbst nie gelebt hatte und die er nun verherrlichte. Von jetzt an sollten die Bauern die Helden sein, denen die Intellektuellen, die Städter, die Brillenträger zu gehorchen hatten. Deshalb wurden wir wie Vieh aus den Städten aufs Land vertrieben, wo wir für die Partei keine Gefahr mehr waren. Sie formten uns, schnitzten uns nach ihrem Gutdünken zurecht, verbogen uns. Wen immer sie verfolgten und folterten, der war in ihren Augen kein atmendes Lebewesen, sondern ein schlechtes Element. Sie mussten uns entmenschlichen, denn wir waren alle Kambodschaner, alle aus demselben Holz geschnitzt, von derselben Rasse, derselben Nation, deshalb mussten sie uns in Gegenstände verwandeln. Nur wenn wir nicht mehr Teil von ihnen, ihrer Welt waren, konnten sie uns zerstören. Wie sonst hätten sie rechtfertigen können, was sie taten, was sie uns allen antaten?
Es gab Widerstand, aktiven und stillen. Wer stillen Widerstand leistete, liess nicht zu, dass ihm genommen wurde, was wir alle besitzen: die Gabe, zu lieben, zu träumen und zu denken. Auch ich habe mich in meine Fantasiewelt geflüchtet. Ich litt Hunger, aber niemand konnte mir verbieten, von Essen zu träumen oder an Coca-Cola zu denken. Mit diesen Gedanken habe ich mich in den Schlaf geträumt. Ich schaute in die Sterne und stellte mir eine Welt vor, in der meine Lieblingsgerichte, mein Zuhause und meine Schule immer noch existierten. Tagsüber betrachtete ich die Reisfelder, von deren Reis ich nie würde essen dürfen. Doch ich freute mich an der Schönheit der Ähren, die sich im Wind wiegten. Ich leistete Widerstand, indem ich den Roten Khmer nicht erlaubte, mich blind und dumpf zu machen. Als sie mich folterten, weinte ich nicht, keine einzige Träne. Ich wusste, wenn ich weinte, würden sie mich umbringen und gewinnen. Ich aber wollte mich ihren Regeln entziehen und mich mit aller Kraft an meiner Fantasie festhalten. Sie trug mich durch diese Zeit, und sie heilte mich später.
Im Dorf überlebte ich dank meiner Mutter und meiner Freundinnen, der Bauernmädchen. Meine Mutter war die einzige Frau im Dorf, die Seide weben konnte. Sie webte für die Roten Khmer, im Gegenzug bekam sie ab und zu eine Extraportion Brei. Manchmal schlich ich mich nachts aus der Hütte, um zu fischen. Die Moskitos umschwärmten und stachen mich. Wenn ich etwas fing, ass ich den kleinsten Fisch und brachte die anderen nach Hause. Den grössten gab ich immer meiner Mutter. Sie sollte stolz auf mich sein. Auch Krebse versuchten wir mit Bambuskörben in den Reisfeldern zu fangen. Wie glücklich war ich, wenn ich einen fing, um ihn ihr zu bringen! Meine Mutter pflanzte Chili, der in dieser zunehmend farblosen Welt rot leuchtete. Auch Tabak baute sie an. Jeden Tag betrachtete ich die Tabakpflanzen und beobachtete ihr Wachstum. Später trocknete sie den Tabak und brachte ihn dem Chef des Dorfs. Auch das war eine Art von Bestechung: Tabak im Tausch gegen einen kleinen Fisch. Und dann waren da die Süsskartoffeln, die wir in der Kommune anpflanzten. Jeden Morgen, wenn ich die Furchen im Feld betrachtete, sah ich, wie die kleinen grünen Blätter gewachsen waren. Ich versuchte, zu erraten, wie gross die Kartoffel darunter sein würde. Ich konnte bereits das Glück fühlen, eine grosse Kartoffel aus dem Boden zu ziehen. Diese Kartoffeln mag ich immer noch. Wenn meine Schwester heute zum Markt geht, kauft sie mir manchmal welche. Aber fischen tue ich nicht mehr.
Als Stadtkind hatte ich anfangs keine Ahnung von der Arbeit auf dem Land. So freundete ich mich mit drei Mädchen an, Kindern von Roten Khmer. Frühmorgens um fünf Uhr schlich ich mit ihnen aus dem Dorf. Sie zeigten mir, wie man Kartoffeln stiehlt und sie über dem Feuer röstet. Sie schafften es, Süsskartoffeln auszugraben, ohne eine Spur zu hinterlassen. Sie lehrten mich auch, von welchen Bäumen und Sträuchern ich die Früchte und Beeren essen konnte und von welchen nicht. Damals waren diese Diebestouren ein grosser Spass für uns. Wenn wir fertig waren, rannten sie zurück zu ihren Einheiten. Ich schaute ihnen nach, wie sie lachend im Nebel verschwanden. In diesen Momenten dachte ich immer an einen Film. Die Kartoffelfelder, die Hügel, die hohen Bäume und die Kinder, die im Nebel verschwanden, all das war so wunderschön wie in einem Film. Diese Erinnerung habe ich all die Zeit wie einen kostbaren Schatz aufbewahrt.
Als ich Jahre später ins Dorf zurückkehrte, suchte ich nach meinen Freundinnen und fand sie alle. Sie waren jetzt verheiratet, führten kleine Geschäfte, verkauften Orangen und zogen Kinder gross. Noch immer lachten sie wie damals, und alle erinnerten sich an mich, denn ich war der Junge aus der Stadt mit der hellen Haut, der nicht wusste, wie man auf dem Feld arbeitet, und dem sie jetzt ein paar Orangen schenkten. Aber die Rollen waren nun vertauscht. Jetzt wusste ich Dinge, von denen sie keine Ahnung hatten. Ich wusste, wie man einen Computer bedient, sie nicht. Doch dann waren da die Erfahrungen, die uns verbanden: Ich war im Gefängnis gewesen und hatte Familienmitglieder verloren, genau wie sie. Aber darüber sprachen wir nicht. Wir hielten uns an den schönen Erinnerungen fest und lachten über die komischen. Den Hunger und die Toten erwähnten wir nicht.
Der Hunger war unser ständiger Begleiter im Dorf. Als ich fünfzehn war, arbeitete ich auf dem Reisfeld, bewacht von den Roten Khmer. Ich war ein magerer Teenager, und meine Schwester war schwanger und noch hungriger als wir alle, also pflückte ich ein paar Pilze, doch jemand sah mich und schrie: «Dieb! Dieb!» Sofort verhafteten sie mich und brachten mich auf den Dorfplatz. Dort schlugen sie gnadenlos auf mich ein. Die gesamte Dorfgemeinschaft musste bei solchen Bestrafungen anwesend sein, und alle mussten jubeln, selbst die eigene Mutter. Ich fühlte ihre Anwesenheit, wie sie mitten in der Menge stand und zusah, wie ich erniedrigt und geschlagen wurde.
Jahrzehntelang sprachen wir nicht über jenen Tag. Ich hatte gestohlen, war im Gefängnis gelandet und hatte Schande über meine Familie gebracht. Ich war gepeinigt worden, und meine Mutter hatte mich nicht beschützt. Dieser Tag und was an ihm geschah, bohrte sich wie ein Keil zwischen mich und sie. Meine Wut gärte in mir.
Im Dorfgefängnis verhörten sie mich immer und immer wieder. Ich war der jüngste Gefangene. Jeden Abend mussten wir antreten, unsere Vergehen beichten und um Vergebung bitten. «Vergangene Nacht dachte ich an Soda-Wasser und ein gebratenes Hühnchen, bitte vergebt mir», sagte ich, oder: «Vergangene Nacht habe ich meine Mutter vermisst und geweint, bitte vergebt mir.» An die eigene Mutter zu denken, war ein Verbrechen, zu weinen auch. Es war der Laune des Gefängnisvorstehers überlassen, ob er uns vergeben oder uns zum Tod verurteilen wollte. Jeden Abend mussten wir so eine neue Geschichte erzählen, wie wir der Revolution geschadet hatten. Die Roten Khmer zwangen uns zum Lügen, um ihre Todesurteile zu rechtfertigen. Nach den abendlichen Bekenntnissen schickten sie uns zurück in unsere Zelle. Dort lagen wir angekettet auf einem Boden, auf dem uns die Insekten langsam entgegenkrochen.
Nach einigen Wochen gingen mir die Lügen aus. Ich hatte sie alle erzählt und aufgebraucht. Ich bat einen älteren Gefangenen um Hilfe. Was könnte ich noch sagen, um den Gefängnisvorsteher zufriedenzustellen? Der alte Mann flehte den Vorsteher an: «Das ist doch bloss ein Junge. Er hat seine Lektion gelernt. Bitte entlassen Sie ihn!» Und wahrhaftig, sie entliessen mich. Erst ein Jahr später erfuhr ich, dass sie den Alten an meiner Stelle getötet hatten. Bis heute suche ich nach seinen Verwandten.
Der Tod war nicht etwas, was nur anderen widerfuhr. Eine meiner Schwestern wurde getötet, ihr Bauch aufgeschlitzt, weil sie eine Gurke gestohlen hatte. Mein Schwager wurde zu Tode geprügelt, weil er Essen gestohlen hatte. Eine andere Schwester verhungerte, ein Onkel wurde umgebracht, die gesamte Familie meiner Mutter ausgelöscht. Ich weiss nicht, wie viele Familienmitglieder ich verloren habe. Es müssen um die sechzig gewesen sein, aber sicher bin ich nicht. Ich war zu jung, um mir all die Namen zu merken. Wir hörten auf, die Toten zu zählen. Es ist einfacher, die Lebenden in unserer Familie zu zählen. Es sind vier.
Aber weisst du, woran ich mich am besten erinnere aus jener Zeit? Es sind nicht die Toten, nicht das zehrende Gefühl im Magen, sondern die Blumen. Nachdem sie den Reis weggeschafft hatten, wuchsen kleine gelbe Blumen im Stroh der Felder. Zuerst waren es nur ein paar wenige, doch dann wurden es Tag für Tag mehr, bis sich der schönste Garten der Welt vor uns ausbreitete. Diese Schönheit überdeckte das Grauen und liess mich das Gefühl der Liebe nie vergessen. Ich war verliebt in diesen Garten. Er gab mir die Kraft, ein Jahr länger durchzuhalten, bis zur nächsten Ernte zu überleben, bis zum Ende dieser Schreckensherrschaft. Das Ende kam, als die Roten Khmer im Dezember 1978 entschieden, in Vietnam einzumarschieren. Der Gegenangriff kam sofort, und den vietnamesischen Truppen, die Ende Dezember 1978 über die Grenze kamen, konnten die Truppen der Roten Khmer nichts entgegensetzen. Am 7. Januar 1979 war die Herrschaft der Roten Khmer beendet.
Sehnsuchtsland USA
Was mir überall auffällt: Die Kambodschaner hassen die Vietnamesen noch heute, denn für viele waren sie nicht Befreier, sondern Besatzer. Wo immer ich hinkomme, wann immer das Gespräch auf die Vietnamesen kommt, sie sind die Sündenböcke. Sie werden verantwortlich gemacht für zu viel oder zu wenig Regen, einen kranken Büffel, den schwindenden Fischbestand im Tonle-Sap-See. Über die Roten Khmer aber spricht niemand, nicht freiwillig.
Nach dem Einmarsch der Vietnamesen floh ich mit meiner Schwester und vielen anderen aus Kambodscha. Meine Mutter aber blieb zurück. Erneut wurde ich von ihr getrennt und sollte sie erst viele Jahre später wieder treffen. Zuerst flohen wir in den Urwald, dann über die Grenze nach Thailand. Thailand wurde damals überrannt von Flüchtlingen, so dass wir auf verschiedene Länder verteilt wurden. Zusammen mit meiner Schwester kam ich 1986 auf die Philippinen. Dort lebten wir mit Bootsflüchtlingen aus Vietnam und Flüchtlingen aus Laos ein Jahr lang in einem Lager etwa zwei Stunden ausserhalb von Manila.
Auf den Philippinen fühlte ich mich zum ersten Mal frei. Ich konnte an den Strand gehen, ohne befürchten zu müssen, dass ich verhaftet oder verhört wurde. Ich konnte endlich wieder atmen.
Ich erinnere mich an den Mangogarten, wo wir jeweils am Abend Eis kauften, wenn wir etwas Geld als Hilfslehrer verdient hatten. Es gab auch ein Hamburger-Restaurant in der Nähe einer amerikanischen Militärbasis ausserhalb des Lagers. Ich wünschte mir so sehr, einmal einen Hamburger essen zu können, und eines Tages nahm mich meine Lehrerin dorthin mit und kaufte mir meinen ersten Hamburger. Er kostete 5 Dollar, unglaublich viel Geld, und er war so riesig, dass ich nicht wusste, wie ich ihn essen sollte. Danach träumte ich davon, für McDonald’s zu arbeiten, um billig Hamburger essen zu können. Ich war achtzehn und auf der Warteliste, um in die USA auszuwandern.
Die Widersprüche und Ungereimtheiten fallen mir erst später auf, zurück in Bangkok, wo ich die Interviews transkribiere, die Fakten vergleiche und überprüfe. Youk Chhang sagt, er sei achtzehn gewesen, als er darauf wartete, in die USA ausreisen zu können. Doch wie ist das möglich, da er auch sagte, er sei 1986 auf die Philippinen gereist und 1961 zur Welt gekommen? Das geht nicht auf. Es ist nicht das erste Mal, dass Zeit- und Jahresangaben nicht stimmen, wenn ich sie nach einem Interview überprüfe. Ist es unser lückenhaftes Gedächtnis, das die Zahlen durcheinanderbringt? Ist es, weil Zahlen selten mit Emotionen verknüpft sind, dass wir uns nicht an sie erinnern können? Wie funktioniert Erinnerung? Wieso sehen wir im Rückblick manche Details unserer Geschichte so glasklar, und andere vergessen wir? Erinnerungen, die mit starken Emotionen verbunden sind, sitzen besonders tief im Gedächtnis. Das sagt zumindest die Wissenschaft, für meine eigene Karte der Erinnerung gilt es auch. So kann ich mich im Detail an jenen Moment erinnern, als ich mich am Erez-Checkpoint bis auf die Unterhose ausziehen musste – nicht einmal, sondern dreimal. Israelische Soldaten nötigten mich dazu. Damals, 2006, wollte ich nach mehrmonatigem Aufenthalt aus dem Gazastreifen ausreisen, die Soldaten standen über mir, die Waffe im Anschlag, die Schweinwerfer auf mich gerichtet. Danach weinte ich vor Wut, aber auch aus Scham und Hilflosigkeit. Ich war erniedrigt worden, und diese Emotionen waren stärker als viele Wochen voller anderer Erlebnisse, die heute nur noch als Nebel in meinem Gehirn existieren. Und doch frage ich mich heute: War es wirklich so, dass ich die Soldaten gesehen habe, oder habe ich sie nur gehört? Wurde ich mit Scheinwerfern angeleuchtet, oder fügte ich dieses Detail vielleicht später hinzu, nachdem ich andere Bilder gesehen und Erzählungen von Checkpoints gelesen hatte?
Eine Erinnerung abzurufen, sei ein aktiver Prozess. «Es erfolgt jedes Mal ein erneuter Speicherprozess. Wir erinnern uns nicht an die Originalversion, sondern an deren Überarbeitung durch das Gehirn», sagt die Hirnforscherin Daniela Schiller. Wenn wir eine Erinnerung in unserem Gehirn abrufen, ergeben sich also subtile Veränderungen. Ist damit zu erklären, dass ich auf so viele unterschiedliche Versionen von Youk Chhangs Geschichte stosse, wenn ich ihm zuhöre, aber auch nachher, wenn ich im Internet stöbere? Hat er nun Reis oder Pilze gestohlen? War er fünfzehn oder vierzehn, als er verhaftet wurde? Ich habe ihn lange nach unseren Interviews danach gefragt. Habe ihm eine lange Liste von Fragen geschickt, um die Ungereimtheiten zu erklären, zu klären. Er reagiert unwirsch, geantwortet hat er nie. Ich bin mir nicht sicher, ob er einfach keine Lust hatte, sich die Zeit zu nehmen, um die Fragen zu beantworten, oder ob er sich in unbequemer Weise ertappt fühlte. Und doch frage ich mich: Welcher Wahrheit verpflichten wir uns, wenn selbst die persönlichen Wahrheiten sich unbemerkt verändern? Oder ist Wahrheit vielleicht gerade das: ein sich ständig veränderndes Wesen, das wächst und sich anpasst, je nach Erfahrung, Umfeld und Wille, genau wie der Mensch? Und ist nicht das vielleicht unser grosses Glück, dass wir selbst bestimmen können, wie wir uns erinnern wollen und wie unsere Vergangenheit unser Leben prägen soll? Ein traumatisches Erlebnis ist demnach nur eine Version einer Geschichte. Es liegt in unserer Hand, eine neue zu schreiben, eine, die unser Leben leichter, unsere Vergangenheit erträglicher macht. Ein erniedrigender Moment an einem Checkpoint kann so zu einem Moment werden, in dem man lernt, wieder aufzustehen und gestärkt weiterzugehen. Die Tyrannei der Roten Khmer zu überleben, kann bedeuten, dass man sein Auge selbst in den dunkelsten Momenten für Lichtblicke zu schulen gelernt hat. Youk Chhang hat das, seine Geschichte selbst zu schreiben, hervorragend verstanden.
Amerika war eine neue, verheissungsvolle Welt für mich. Alles, was ich über die USA wusste, war, dass dort eine Frau namens Jacqueline Kennedy lebte. Ich hatte ihr Bild in der Zeitung gesehen. Sie war so jung und so schön. Ihr Mann sei ein Held, der Schwarze und Weisse vereint habe, sagte man mir. Doch er war ermordet worden, und ich dachte oft daran, wie mutig und stark seine Frau nun sein musste. Das waren für mich die USA, nicht George Washington oder Abraham Lincoln, sondern Jacqueline und der ermordete John F. Kennedy.
Dann war es endlich so weit. Texas, Dallas sollten meine neue Heimat werden, just diese Stadt also, wo John F. Kennedy 1963 ermordet worden war. Ich gehörte zu einer Gruppe von Flüchtlingen, etwa zwölf Familien aus Vietnam und Kambodscha, die in den USA ein neues Leben beginnen sollten. Da ich der Einzige war, der inzwischen Englisch gelernt hatte, beauftragte mich die Internationale Organisation für Migration, IOM, die Gruppe zu leiten. Die anderen folgten mir wie ein Fischschwarm. Die wenigsten sprachen ein Wort, aber alle starrten auf diese neue, fremde Welt, die sich Stück für Stück vor uns auftat. Im Flugzeug musste ich sicherstellen, dass alle ihre Sitzgurte umgeschnallt hatten. Ich warnte sie: «Stehlt keine Messer oder Gabeln! Die Leute sprechen über uns, und wir wollen nicht in Verruf kommen.» Im Lager war uns erzählt worden, dass andere Flüchtlinge Besteck gestohlen hätten – nicht weil sie sie brauchten, sondern weil sie so schön glänzten.
Als wir in Dallas landeten, war es Mitternacht. Niemand war da, um uns abzuholen, und so warteten wir stundenlang. Um zwei Uhr morgens sprach ich einen Polizisten an, der daraufhin einige Anrufe tätigte, aber nichts geschah. Erst um acht Uhr morgens kam ein Mitarbeiter der Organisation, die uns betreuen sollte. Die Kinder in meiner Gruppe weinten, einige hatten auf den Boden gekackt. Er aber sagte bloss: «Ihr seid so spät in der Nacht gelandet, da konnte ich nicht mehr kommen.»
Die Wohnung, die mir zugewiesen wurde und die ich mit anderen teilte, lag an der Bryan Street in einer ziemlich gefährlichen Gegend im Osten der Stadt. Aber ich hatte ja noch keine Ahnung, wo es gefährlich war und wo nicht. Alles war neu für mich. Die erste Nachbarin, die ich sah, war eine Laotin. Das beruhigte mich. Sie war wie ein Stück Heimat, ein bisschen Vertrautheit in dieser fremden Welt.
In der Wohnung gab es ein paar Matratzen, die am Boden lagen, und einen Kühlschrank, in dem etwas Fleisch war. Was ich am meisten mochte an der Wohnung, war das Licht. Es war immer da, keine Stromausfälle, nichts. Ich liess die Lichter 24 Stunden brennen, die ganze Nacht hindurch. Ich hasse Dunkelheit, und ich hasse es, wenn der Strom plötzlich ausfällt. Noch heute beschleicht mich dann ein ungutes Gefühl. Aber in Dallas drückte ich auf den Schalter, und da war Licht, hell und beruhigend. Wie ich das liebte!
Nach der ersten Nacht machte ich mich früh bereit und erwartete, dass mich jemand abholen und zum Büro unserer Organisation bringen würde. Es klopfte an der Tür. Ich schaute durch den Türspion, genau wie ich das im Vorbereitungskurs im Lager gelernt hatte. Da stand ein dicker Mann mit einem riesigen Bart. Ich dachte, er sei ein Dieb. Ich holte mein Notizheft, in dem alle wichtigen Nummern notiert waren, und wählte den Notruf 911. Nach fünf Minuten war die Polizei da und wollte den Mann verhaften. Erst da stellte sich heraus, dass er Bob hiess und von der Organisation geschickt worden war, um uns Decken zu bringen. Später wurden wir Freunde, ja sind es bis heute geblieben.
Wenn ich mich jetzt an jene Zeit erinnere, denke ich: «Mein Gott, war ich verrückt!» Damals meinte ich, ich würde ankommen und bald darauf das Land regieren. Ich fühlte mich frei und unbesiegbar. Diese Sehnsucht nach Unabhängigkeit und Freiheit zieht sich durch mein ganzes Leben wie ein roter Faden. In der Zeit des Völkermordes wusste ich nicht, was Unabhängigkeit ist, danach brannte ich darauf, all die verlorenen Stunden der Freiheit nachzuholen und auszukosten. Freiheit und Schönheit sind mir das Liebste im Leben. Zu meinen Angestellten sage ich immer: «Je mehr ihr lernt, desto schöner und freier werdet ihr.» Und ich wollte lernen und frei sein. Mit der Ankunft in Amerika akzeptierte ich die USA als meine neue Heimat. Hier würde ich meine Ausbildung fortsetzen, arbeiten und leben.
Mit jedem Tag wurde ich vertrauter mit Dallas und meinem neuen Leben. Am Samstag ging ich immer in den Waschsalon, um für ein paar Cents meine Wäsche zu waschen. Dort traf ich andere Flüchtlinge, und wir tratschten ein wenig. Ich lernte Leute in meinem Quartier kennen, Mädchen, Drogendealer, Flüchtlinge. Ich streifte nachts furchtlos durch meine Nachbarschaft, machte sie mir zu eigen. Andere nannten die Gegend gefährlich, aber für mich war sie meine neue Heimat, «Home Sweet Home».
Mein Leben in den USA würde ein ganzes Buch füllen. Eine Geschichte über Jahrzehnte. Lass mich die Höhepunkte nennen. Die Ankunft in den USA war ein solcher und meine Freundschaft mit Bob, den ich für einen Dieb gehalten hatte und der eine Dachdeckerfirma führte und für die Organisation arbeitete. Ich selbst hatte verschiedene Jobs. Ich liebte das Schreiben und schickte so viele Texte an den «Dallas Herald», bis ich eine monatliche Kolumne bekam. Das ist es, was ich an Amerika liebe: Wenn du für etwas kämpfst, wenn du hart arbeitest, kommst du oft ans Ziel. Gibst du aber auf, ziehen die Leute schnell an dir vorbei und vergessen dich. In den USA musst du für alles kämpfen und es dir dann zu eigen machen oder dir etwas anderes suchen. Das lernte ich schnell. Ich bewarb mich für den Stadtrat – und verlor. Mich zu bewerben, war natürlich dämlich, aber ich hatte gekämpft. Das war, worauf es ankam.