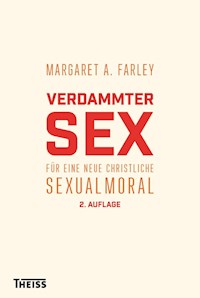
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ein Aufschrei ging durch den Vatikan, ein Prüfungsausschuss wurde gegründet, die Glaubenskongregation warnte vor einer »großen Gefahr für die Gläubigen«. Doch was war passiert? Eine Frau hatte ein Buch veröffentlicht, in dem sie eine neue, moderne christliche Sexualmoral entwickelt. Sie behauptet, dass es theologische Begründungen auch für homosexuelle Beziehungen, Masturbation und Wiederheirat gibt. Themen, die laut Vatikan mit katholischer Theologie nicht vereinbar sind. Umso ärgerlicher für die Kirche, dass die Autorin nicht nur Professorin an der Universität Yale ist, sondern auch Ordensschwester. Schwester Margaret A. Farley löste mit ihrem Buch ›Just Love. A Framework for Christian Sexual Ethics‹ weltweit Kontroversen aus. Sie behandelt darin die wichtigsten Fragen aus den Bereichen Körperlichkeit, Gender und Sexualität, um dann ausführlich ihr Konzept einer gerechten Sexualethik zu beschreiben. Ein Muss für alle, die an der aktuellen Diskussion zu Sexualität und christlichem Glauben interessiert sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Margaret A. Farley
Verdammter Sex
Für eine neuechristliche Sexualmoral
2. Auflage
Titel der Originalausgabe:Just Love: A Framwork for Christian Sexual Ethics.
Aus dem amerikanischen Englischvon Christiane Trabant
Impressum
Copyright © 2006 by Margaret A. FarleyTranslated from the English language: JUST LOVEFirst published by the Continuum International Publishing Co Inc.
Copyright © by Margaret A. FarleyTranslated from the English language:JUST LOVE: A Framework for Christian Sexual Ethics.First published by the Continuum International Publishing Group Inc
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitungdurch elektronische Systeme.
Der Konrad Theiss Verlag ist ein Imprint der WBG.
2., unveränderte Auflage© 2014 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtDie Herausgabe des Werkes wurde durchdie Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.Satz: fuxbux, BerlinEinbandgestaltung: Stefan Schmid Design, Stuttgart
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-3149-6
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:eBook (PDF): 978-3-8062-2392-7eBook (epub): 978-3-8062-2398-9
Für Patricia und Robert Hammell,John und Elizabeth Farley, Mary Farley Valentiund ihre geliebten Kinder und Enkelkinder
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Impressum
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1 Die Fragen
Der Weg
Wo wir stehen
Neue Landkarten
Probleme mit dem Terrain
Die Aufgabe
Kapitel 2 Die Vergangenheit
Sex, Moral und Geschichte
Michel Foucault: Die historische Konstitution des Begehrens
Catharine MacKinnon: Historisches Schweigen
Fortschrittsgeschichten
Eine kurze Geschichte der Sexualethik
Sexualität in der Antike: Griechenland und Rom
Das Judentum: Sexualität, Moral und Religion
Christliche Traditionen
Philosophie und Medizin
Vergangenheit und Gegenwart
Kapitel 3 Schwierige Übergänge
Interkulturelle Perspektiven auf die Sexualethik
Kolonialistische Forschung und ihre postkolonialen Kritiker
Die Lektion des »Orientalismus«
Die Lehren für eine Sexualethik
In der Südsee
Afrika
Sexualität und Gemeinschaft
Gender, Ehe und Familie
Nachhaltige Sexualität
Das Kamasutra
Die Welt des Islam
Unbegrenzte Vielfalt?
Kapitel 4 Sexualität und ihre Bedeutungen
Warum der Körper wichtig ist
Theorien des Körpers
Transzendente Verkörperung
Ist Gender wichtig?
Gender: Theorie und Praxis
Christliche Theologien
Biologie und Kultur
Intersexualität und Transgender
Wie wichtig ist Gender?
Die Bedeutungen der Sexualität
Elemente der sexuellen Erfahrung
Liebe, Begehren und Sexualität
Kapitel 5 Gerechte Liebe und gerechter Sex – Vorbereitende Überlegungen
Sexualität und Gerechtigkeit
Alternative Entwürfe
Die Quellen christlicher Sexualethik
Die heilige Schrift
Die Tradition
Die Wissenschaften
Die Erfahrung
Gerechte Liebe
Moralische Normen für eine gerechte Liebe
Liebe und Freiheit
Begehren
Kapitel 6 Gerechter Sex – Leitlinien für eine Sexualethik
Gerechtigkeit
Die konkrete Realität von Personen
Verpflichtende Merkmale der Personalität
Die Normen für gerechten Sex
1. Unversehrtheit
2. Einvernehmlichkeit
3. Gegenseitigkeit
4. Gleichheit
5. Verbindlichkeit
6. Fruchtbarkeit
7. Soziale Gerechtigkeit
Besondere Fragen
Nur für Erwachsene?
Sexuelle Beziehungen mit sich selbst
Das negative Potenzial von Sex
Charakter, Glauben und sexuelle Gerechtigkeit
Kapitel 7 Beziehungsformen – Kontexte der gerechten Liebe
Ehe und Familie
Historische und kulturelle Kontexte
Das Christentum und sein Einfluss
Beschreibende und normative Fragen
Gleichgeschlechtliche Beziehungen
Die kirchliche Tradition
Gleichgeschlechtliche Beziehungen und Gerechtigkeit
Ist die sexuelle Orientierung vorgegeben oder gewählt?
Scheidung und Wiederverheiratung
Das Eheversprechen: Geben, Halten, Ändern
Scheidung
Neuanfang
Danksagung
Anmerkungen
Personenregister
Vorwort
Ich hatte eigentlich nie die Absicht, ein Buch zur Sexualethik zu schreiben. Und als ich zu unterrichten begann, plante ich auch keine Kurse zu diesem Thema. Ethische Themenstellungen werden jedoch selten von Ethikern vorgegeben, sie folgen den Fragen, die von den Studierenden und im größeren gesellschaftlichen Umfeld aufgeworfen werden. Meine hier entwickelten Überlegungen zu einer »fairen Sexualität« sind in vielen Jahren des Zuhörens, Unterrichtens, Beratens, Forschens und Nachdenkens entstanden. Jedes Seminar, das ich gehalten habe, hat mich etwas gelehrt, und jedem Vortrag folgte ein Gedankenaustausch mit Menschen aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Zahllose Personen haben mich bei diesem Projekt unterstützt, indem sie mir ihre Fragen, Erfahrungen, Einsichten und Sorgen anvertraut haben.
Von Anfang an wurde deutlich, wie dringlich die aktuellen Probleme der Sexualethik sind und wie eng sie mit anderen akuten ethischen Problemen zusammenhängen. Was im sexuellen Bereich des menschlichen Lebens geschieht, ist nicht unabhängig von dem, was in anderen Bereichen geschieht – seien es Familie, Religion, Gesellschaft, Politik oder Wirtschaft. Ob sich Menschen frei entfalten können, ist nicht zuletzt eine Frage der Sexualität. Jeder weiß um die Erfüllung und Freude, welche die menschliche Sexualität verspricht, aber auch um die Verletzungen, die Gewalt, die Stigmata und die Ungerechtigkeiten, die unserem sexuellen Selbst zugefügt werden können. Vielleicht waren Worte des Heilens und der Hoffnung noch nie so notwendig wie heute, besonders vonseiten der Kirchen. Mein Buch hat in dieser Hinsicht den Charakter einer Aufforderung, denn es versucht, neue Möglichkeiten aufzuzeigen, wie wir als Individuen – oder wie unsere gesellschaftlichen Institutionen – über Sexualität nachdenken können.
Obgleich das Ziel dieses Buches damit eher praktisch als theoretisch ist, versuche ich zu zeigen, wie wichtig wirkliches Wissen und Verstehen, Urteilsvermögen und Abwägen sind, wenn wir angemessen über Sexualität sprechen wollen. Ein Blick in unsere eigene Geschichte, aber auch in die Geschichte anderer Völker und Kulturen wird uns dabei helfen, die vielen Bedeutungen des Körpers, von Gender und Sexualität zu verstehen. Es wird auch um den Zusammenhang von Liebe, Sex und Gerechtigkeit gehen und um die Bedeutung von Liebe und Begehren. Was für Menschen wollen und müssen wir eigentlich sein, um richtig zu lieben? Meiner Ansicht nach liegt der Schlüssel zu dieser Frage – im sexuellen wie in jedem anderen Bereich des menschlichen Lebens – in der Gerechtigkeit. In der Gerechtigkeit unserer Liebe, unserer Wünsche und unserer Handlungen.
Die Suche nach Weisheit im Zusammenhang mit Fragen des Geschlechts und der Sexualität ist ein schwieriges Unterfangen, und dieses Buch zielt nicht darauf ab, diese Suche zu vereinfachen – aber es will neue Perspektiven eröffnen und Leitlinien für eine christliche Sexualethik entwerfen. Christlich ist in diesem Zusammenhang keinesfalls exklusiv zu verstehen – es geht mir immer darum, diese Leitlinien als Teil einer allgemeinen Sexualethik verständlich und überzeugend zu gestalten. Der historische Ansatz wird deswegen von einem interkulturellen Ansatz begleitet. In den letzten Jahren hat meine Zusammenarbeit mit afrikanischen Theologinnen, die auf die AIDS-Pandemie reagieren, meine Überzeugung bestärkt, dass Fragen der Sexualethik trotz aller kulturellen Unterschiede in gewissem Maß allgemeinmenschlich sind. Was jedoch nicht heißt, dass die soziale und kulturelle Konstruktion von Körpern, Geschlecht und Sexualität zu vernachlässigen ist.
Die Komplexität dieser und anderer Fragen mag einige Leser ab schrecken, und ich möchte deshalb auf mögliche Abkürzungen hinweisen. Es ist etwa möglich, nach der Einführung in Kapitel 1 direkt zu den Vorschlägen von Leitlinien für eine Sexualethik in Kapitel 6 zu springen. Sollte jemand diesen Weg wählen, hoffe ich, dass sein Interesse so weit geweckt wird, dass er doch noch einen Blick in Kapitel 4 und 5 riskiert. Lesern, die gezielt Antworten auf Fragen zu sexuellen Beziehungsmustern suchen, empfehle ich, mit Kapitel 7 anzufangen. Auch wenn das Buch Schritt für Schritt vorgeht und jeder Schritt zum Verständnis des Ganzen beiträgt, ist es also möglich, an mehr als einer Stelle mit der Lektüre zu beginnen.
Es ist ebenso möglich, die zahlreichen Anmerkungen einfach zu ignorieren. Auch wenn die Anmerkungen bestimmte Punkte näher ausführen oder umfangreiches bibliografisches Material zur Verfügung stellen, steht der Text für sich. Um es kurz zu machen: Jeder hat das Recht, sich auf seine Art auf die Suche nach Einsicht in diese quälenden und interessanten Fragen zu machen.
Kapitel 1
Die Fragen
Die Frage nach der Bedeutung und Ethik der menschlichen Sexualität hat Tradition. Schon Platon erkundete das Verhältnis von Sex und Liebe und die Möglichkeiten sowohl homosexueller als auch heterosexueller Beziehungen. Die Stoiker plädierten dafür, die Sexualität der menschlichen Fortpflanzung unterzuordnen. Der Heilige Augustinus untersuchte die vermischten Motive, die zum ehelichen Sex führen. Martin Luther widersetzte sich einer Anschauung des sexuellen Begehrens, die bei Christen die Enthaltsamkeit gegenüber einer geregelten Bindung an Ehefrau und Familie vorzieht. Und Freud stellte mit seiner Interpretation der psychosexuellen Entwicklung des Individuums eine ganze Kultur radikal infrage.
Es ist also keineswegs neu, die menschliche Sexualität zu hinterfragen, ihre psychologische und soziale Bedeutung zu bewerten und darüber zu urteilen, was moralisch möglich oder erwünscht ist. Und doch unterscheidet sich unsere heutige Perspektive grundlegend von allen früheren. Nicht zuletzt dürfte dies daran liegen, dass mit der zunehmenden empirischen Erforschung der Sexualität seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zahlreiche neue Gesichtspunkte in Erscheinung getreten sind, die mit den poetischen Überlegungen in Platons Gastmahl, den abgewogenen Argumenten eines Seneca oder Mark Aurel oder gar der heftigen Polemik von Augustinus oder Luther nicht mehr viel zu tun haben. Selbst die Metapsychologie und klinische Theorie von Freuds Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie stehen unserer heutigen Sicht eher fern. Wir befinden uns in einer seltsamen Gemengelage. Über Sexualität wird zugleich kontrovers und gleichgültig gesprochen, trotzig und schüchtern. Traditionalisten stoßen mit Befürwortern einer modernen Sexualaufklärung zusammen, und diesen wiederum stehen postmoderne Stimmen gegenüber, die jeden Standpunkt ablehnen, der Objektivität und festgelegte Regeln für sich in Anspruch nimmt. Die Hitze des Gefechts zwischen »rechts« und »links« ist jedoch häufig nur lauwarm, weil sie von einem radikalen Skeptizismus gemildert wird, der sowohl traditionelle als auch nicht traditionelle Ansichten erfasst. All das ist ganz fraglos neu.
Der Weg
Die Geschichte der Sexualethik ist in westlichen Gesellschaften weit gehend eine Geschichte eindeutiger Regeln oder zumindest Ideale. Natürlich hat es auch in der Vergangenheit Uneinigkeit über sexuelle Sitten gegeben, und die Geschichte kennt zahllose Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis. Abhängig von Zeit und Ort wurden die ethischen Normen für sexuelle Beziehungen und Aktivitäten verschieden formuliert. Darüber hinaus spiegelten sich in ihnen stets kulturelle und klassenbedingte Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen ist die Entwicklung unserer Sexualmoral doch von Klarheit und augenscheinlicher Kontinuität gekennzeichnet.
In der westlichen Kultur (aber auch anderswo) werden heute jedoch die traditionellen Regeln für sexuelles Verhalten auf die eine oder andere Weise infrage gestellt. Lange anerkannte Verpflichtungen und Verbote werden beispielsweise von staatlicher Seite neu ausgehandelt, und religiöse Traditionen geraten zunehmend unter Druck. Das Problem ist nicht bloß im Gegensatz von Traditionalismus und radikalem Veränderungswillen begründet. Vielmehr hat eine umfassende Erschütterung der sexuellen und moralischen Sitten eine Verwirrung und den Wunsch nach Selbstversicherung in diesen quälenden menschlichen Fragen erzeugt. Lange für selbstverständlich gehaltene Überzeugungen sind wieder zu offenen Fragen geworden. Angefangen mit der Fortpflanzung über die destruktiven Elemente in sexuellen Beziehungen bis hin zur Frage, wie die Sexualität in unseren Alltag integriert werden kann und wie wir die gesunde psychosexuelle Entwicklung von Kindern gewährleisten. So intensiv wie niemals zuvor machen wir uns Gedanken über die Konsequenzen von sexueller Gewalt, die Sexindustrien, sexuelle Belästigung und genderbedingte Machtverhältnisse, die grassierende Bindungslosigkeit und die offenbar weitverbreitete Hilflosigkeit bei der Suche nach Vertrautheit. Obwohl einige Personen und Gruppen klare Antworten auf diese Fragen zu haben scheinen, trifft das auf viele andere nicht zu.
All dies hat vielfältige Gründe. Es geht ganz sicher nicht an, dem sogenannten Liberalismus und seinen vermeintlichen Nachkommen, dem Materialismus und Hedonismus, die gesamte Schuld in die Schuhe zu schieben. Und auch die sexuelle Revolution ist mitsamt ihren Widersprüchen nicht aus dem Nichts gekommen. Es waren die vielfältigen und tief greifenden ökonomischen, politischen und sozialen Veränderungen des 20. und 21. Jahrhunderts, die den Zugang zum Wissen verbreitert, die praktischen Möglichkeiten für eine sexuelle Selbstbestimmung geschaffen und damit das sexuelle Verhalten insgesamt beeinflusst haben. Ohne allzu stark zu vereinfachen, ist es möglich, einige maßgebliche Entwicklungen zu bestimmen. Eine Flut von Studien zur Sexualität (nicht nur naturwissenschaftliche, sondern auch philosophische, historische, psychologische, anthropologische und literarische) hat uns die gesamte Breite von Verhaltens- und Beziehungsmustern vor Augen geführt, und wir tendieren dazu, diese Entwicklungen für selbstverständlich zu nehmen. Dabei vergessen wir leicht, wie neu viele von ihnen sind und wie komplex sie die menschliche Erfahrung gestalten. Trotz der Gefahr, Bekanntes zu wiederholen, lohnt es sich, an einige dieser Entwicklungen zu erinnern.
Wo wir stehen
So ist zum Beispiel ein ganz erstaunlicher Fortschritt hinsichtlich der wissenschaftlichen Erkenntnis über sexuelle Reaktionen als solche und über den menschlichen Fortpflanzungsprozess zu verzeichnen. Während das Ovum schon (oder erst, je nachdem) 1828 entdeckt wurde, war noch bis ins 20. Jahrhundert unklar, wie der aktive physiologische Beitrag des weiblichen Partners im Fortpflanzungsprozess eigentlich aussieht. In den Jahrhunderten davor pflegte man das Bild eines männlichen »Samens« und eines weiblichen »Nährbodens«, was wiederum die Ansicht stärkte, der Mann sei bei der Fortpflanzung und ganz allgemein in sexuellen Beziehungen überwiegend aktiv, die Frau dagegen passiv.1
Im 20. und 21. Jahrhundert hat nicht nur die Biologie für neue Erkenntnisse gesorgt, sondern auch die Psychologie, Ethnologie und Soziologie2 – und das nicht nur in Bezug auf die Interaktion zwischen Mann und Frau, sondern auch in vielen anderen Punkten. In der neuen Disziplin der »Sexualwissenschaft«3 kamen viele traditionellere Disziplinen zusammen, um Bedeutung und Praxis der Sexualität sowie ihre ökonomischen und politischen Implikationen zu erforschen. Auf der Grundlage von Laborversuchen und Feldforschung, von psychiatrischen Fallanalysen und dem Zusammentragen von Daten zu sexuellen Praktiken hat die sozialwissenschaftliche Forschung stark zugenommen. Wie umstritten einige der Studien im Einzelnen auch sein mögen, sie haben vorherige pseudowissenschaftliche Anschauungen erfolgreich zurückgedrängt, zum Beispiel das Risiko des Wahnsinns durch Masturbation, die Unnatürlichkeit homosexueller Praktiken bei Tieren (und damit beim Menschen), die Fruchtbarkeit der Frau während ihrer Menstruation und so fort. Keine dieser Erkenntnisse konnte für sich genommen die traditionellen sexuellen Normen zu Fall bringen, aber ihre Geltung wurde entschieden geschwächt. Wenn zum Beispiel Alfred Kinsey recht (oder annähernd recht) hatte, dass 95 Prozent der männlichen Bevölkerung der Vereinigten Staaten und 70 Prozent der weiblichen Bevölkerung autoerotische Handlungen vornehmen, ist es schwer vorstellbar, dass Masturbation zu Krankheit und Wahnsinn führt (was zuvor geglaubt oder zumindest behauptet wurde). Und sofern William Masters und Virginia Johnson die physiologischen Reaktionen sowohl von Männern als auch von Frauen akkurat aufgezeichnet haben, ist das Ideal von männlicher Aktivität und weiblicher Passivität nicht mehr haltbar. Während die Biologie der menschlichen Fruchtbarkeit zunehmend besser verstanden wurde, ist die Behauptung, dass jegliche sexuelle Aktivität der Fortpflanzung zu dienen habe, zunehmend in Zweifel gezogen worden.
Interkulturelle Studien haben die große Variationsbreite sexueller Verhaltensmuster in den unterschiedlichen Kulturen festgestellt. Was in der westlichen Gesellschaft als abweichend angesehen wurde, erwies sich in anderen Gesellschaften als erlaubt und sogar akzeptiert. Berichte aus der Mitte des 20. Jahrhunderts zeigten zum Beispiel, dass in 49 von 76 Gesellschaften homosexuelle Aktivitäten verschiedener Art für bestimmte Angehörige der Gemeinschaft als normal betrachtet wurden. Masturbation gab es bei beiden Geschlechtern in fast jeder Gesellschaft überall auf der Welt. Es fanden sich keine einheitlichen Normen für vorehelichen oder außerehelichen Sex.4 Für sich genommen konnten solche Informationen die traditionellen westlichen Normen wiederum nicht zu Fall bringen, aber sie trugen dazu bei, etliche Normen, die zuvor als absolut und allgemein betrachtet wurden, zu relativieren. Mit jedem weiteren Jahrzehnt haben interkulturelle Studien den Glauben an die gesellschaftliche Konstruktion sexueller Normen weiter gestärkt: Unsere Normen sind nicht wesensmäßig mit uns verknüpft, sondern werden von den Kräften innerhalb einer gegebenen Gesellschaft geprägt.
Auch historische Studien haben dazu beigetragen, sexuelle Normen zu relativieren und zu schwächen. Allein die Enthüllung, dass sexuelle Vorschriften eine Geschichte haben, hat ihre Kontingenz aufgezeigt. Dass etwa die Ethik der Fortpflanzung ebenso auf der stoischen Philosophie basiert wie auf der Bibel, hat vielen Christen gestattet, ihre Gültigkeit infrage zu stellen. Die Belege für eine alternative Sexualmoral und die tatsächlichen Praktiken in vergangenen Gesellschaften führten zu der Erkenntnis, dass die sexuellen Sitten veränderlich sind.5 Mit dem Ziel, zeitgenössische Anschauungen besser zu verstehen, haben Historiker nach den Wurzeln und Entwicklungen dieser Anschauungen gesucht und sind dabei selten auf vernünftige oder logische Grundlagen gestoßen.
Zusätzlich zu den Entwicklungen in den theoretischen Disziplinen war die Stärkung des weiblichen Selbstbewusstseins – besonders in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts – ein signifikanter Faktor bei der Lockerung traditioneller Sexualnormen. Das neue Selbstverständnis von Frauen hat eine enorme Auswirkung auf die Wahrnehmung von sexuellen Normen gehabt. Viele Jahrhunderte, in denen eine von Grund auf falsche Weltwahrnehmung dem Sexismus – trotz gegenläufiger Tendenzen in allen großen religiösen und philosophischen Bewegungen – zur Blüte verhalf, ließen viele Frauen an der Gültigkeit fast aller früherer Lehren zu den Grundsätzen der Sexualmoral zweifeln. Frauen haben die Irrationalität sexueller Tabus unmittelbar erfahren; so meinte Freud in Bezug auf den Glauben, Menstruation, Schwangerschaft und Geburt stellten eine Verunreinigung dar: »… beinahe könnte man sagen, das Weib sei im Ganzen tabu.«6 Ökonomische und soziale Veränderungen haben mit verschiedenen Formen der Bewusstseinsbildung zusammengewirkt und damit Frauen neue Perspektiven auf alte Fragen vermittelt. Doppelmoral, repressive genderspezifische soziale und politische Strukturen, männliche Interpretationen der weiblichen Sexualität, die medizinische und soziologische Beschreibung von unerreichbaren Idealen und destruktiven Rollenbildern – all diese Erfahrungen haben viele Frauen dazu gebracht, traditionelle sexuelle Anschauungen und Verhaltensweisen radikal infrage zu stellen.
Neben der Frauenbewegung führte auch das Entstehen der Schwulenbewegung zu einer völlig anderen öffentlichen Wahrnehmung von sexuellen Praktiken, die zuvor für unannehmbar gehalten wurden. Was weitgehend verborgen war, ist sichtbar geworden, und das selbstbestimmte Outing von Schwulen und Lesben in Familien, Vereinen, Kirchen und am Arbeitsplatz trug zur nachhaltigen Stärkung einer Bewegung bei, die ansonsten möglicherweise klein geblieben wäre.7 Natürlich gibt es immer noch viele Unbelehrbare, aber die – wenn auch zögerlich vollzogene – öffentliche Anerkennung von Schwulenrechten (vom Recht auf Gleichbehandlung bis zu eingetragenen Partnerschaften und gleichgeschlechtlichen Ehen) spiegelt im Großen und Ganzen die Toleranz alternativer Ansichten zur menschlichen Sexualität und die Erschütterung früherer Überzeugungen zur Sexualmoral im Allgemeinen wider. Die Unbeständigkeit der öffentlichen Meinung in Fragen der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften enthüllt vielleicht sogar besser als alles andere, wie sehr die Dinge in Bewegung geraten sind.
Für all diese Entwicklungen kann die Bedeutung der naturwissenschaftlichen und medizinischen Forschung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die weitverbreitete Verfügbarkeit von wirksamen Kontrazeptiva erlaubte zum ersten Mal die Trennung von heterosexuellem Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft. Und trotz aller Rückschläge – vor allem aufgrund von AIDS – haben medizinische Entwicklungen in Prävention und Behandlung auch dazu geführt, sexuelle Aktivität und das Auftreten von Infektionskrankheiten weitgehend zu entkoppeln. Die Entwicklung reproduktiver Techniken hat vorher unfruchtbaren Paaren, aber auch fruchtbaren Einzelpersonen Möglichkeiten des Kindergebärens geschenkt, die bislang unvorstellbar waren. Viele Arten von sexuellen Funktionsstörungen sind durch Medikamente oder andere Therapien behandelbar geworden.
Wie interessant es auch ist, über den Beitrag dieser und anderer Faktoren bei der Relativierung von sexuellen Normen zu spekulieren: Die Probleme, vor die uns unsere Sexualität stellt, können sie nicht lösen. Genau genommen stellen sie uns sogar vor neue ethische Herausforderungen.8
Von den offensichtlich negativen Entwicklungen war damit noch gar nicht die Rede. Alle hier angesprochenen Entwicklungen haben das Potenzial, uns zu wirklicher Freiheit und Wohlbefinden in der sexuellen Sphäre zu verhelfen. Es ist schließlich eine gute Sache, von irrationalen Tabus erzeugte Angst und Scham zu überwinden und eine auf Unwissen beruhende Selbstgefälligkeit hinter sich zu lassen. Es ist auch gut, Klarheit über solche sexuellen Beziehungsmuster zu erlangen, die verletzend und ungerecht sind. Dennoch haben uns diese Entwicklungen zwangsläufig zu weiteren Fragen geführt. Wir brauchen die Erkenntnisse der Biologie und Psychologie, der Ethnologie, Soziologie, der Wirtschaftstheorie und Geschichte; und wir brauchen auch den befreienden Einfluss der sozialen Bewegungen. Aber wir brauchen noch mehr. Individuen und Gesellschaften stellen sich weiterhin drängende Fragen: Wie geht es von hier aus weiter? Wie gehen wir mit den noch existierenden Problemen im sexuellen Bereich um? Können wir unser neues Wissen und die vielen neuen Handlungsmöglichkeiten in jene Weltanschauungen integrieren, die unserem ganzen Leben einen Sinn geben? Wenn wir nicht mehr auf den Kompass traditioneller Normen zählen können, an wen wenden wir uns, wenn wir uns nach Rat und Führung sehnen? Nicht nur die Wissenschaftler haben über diese Fragen nachgedacht. Sie lagen auch in der Verantwortung von Gesetzgebern, Gerichten und Glaubensgemeinschaften. Letztere wurden wiederum stark von den Erkenntnissen und Argumenten der Philosophen und Theologen beeinflusst. Um zu verstehen, wo wir uns befinden und warum, müssen wir deshalb auch auf die Entwicklungen in diesen Disziplinen schauen.
Neue Landkarten
Besonders im letzten Viertel des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind zahlreiche wichtige philosophische und theologische Studien entstanden. Wie die Theologen und Philosophen in der Vergangenheit haben sich die zeitgenössischen Wissenschaftler an der Biologie orientiert – aber auch die Psychologie, die neuen Technologien und die sozialen Bewegungen haben wichtige Impulse für ihre theoretische Arbeit geliefert. In der Tat wird die Notwendigkeit interdisziplinärer Ansätze weithin anerkannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten Philosophen wie Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty und Simone de Beauvoir, die Bedeutung der menschlichen Sexualität nicht nur im Licht neuer wissenschaftlicher Daten, sondern auch neuer philosophischer Theorien der Freiheit und Liebe neu zu bestimmen.9 Am einflussreichsten für unser Verständnis von Sexualität und sexuellem Begehren war jedoch das Werk von Michel Foucault.10 Aber auch analytische Philosophen steuerten wichtige Studien zu Themen wie Gender, Ehe, Familie, Homosexualität und Pornografie bei.11 Insbesondere feministische Philosophinnen leisteten bahnbrechende Arbeit, nicht nur zum Verständnis der Sexualität im engeren Sinn, sondern auch zu den großen philosophischen Fragen der Verkörperung, der Genderidentität, der Natur des sexuellen Begehrens, der Gerechtigkeit in familiären Beziehungen und den Formen der Elternschaft.12
Auch die Theologie hat wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die menschliche Sexualität und das Sexualverhalten geliefert. Einige dieser Arbeiten entstanden in Nordamerika in den 1960er-Jahren mit der römisch-katholischen theologischen Debatte über die künstliche Empfängnisverhütung.13 Kurz darauf läuteten die wichtigen Publikationen von Anthony Kosnik und seinen Kollegen aus der römischkatholischen Tradition und James Nelson aus der protestantischen Tradition den Beginn einer ganz neuen Ära für eine christliche Sexualethik ein.14 Die Beiträge von Charles Curran, André Guindon, Philip Keane, Giles Milhaven, Lisa Sowle Cahill, Beverly Wildung Harrison, Carter Heyward, Christine Gudorf und vielen anderen waren zum Verständnis des Sexuellen innerhalb christlicher Gemeinschaften von unschätzbarem Wert.15 Bibelforscher wie Phyllis Trible, Mary Rose D’Angelo, William Countryman, Robin Scroggs, Richard Hays und Dale Martin haben sich mit Fragen der Sexualethik befasst.16 Und auch jüdische Theologen haben zu vielen dieser Fragen wichtige Untersuchungen beigetragen. Autoren wie Eugene Borowitz, David Feldman, David Novak, Judith Plaskow, David Biale und Elliot Dorff haben sich kritisch mit der Rolle der Sexualität in der jüdischen Gemeinschaft (und darüber hinaus) auseinandergesetzt.17
Viele der philosophischen und theologischen Forschungsbeiträge sind freilich umstritten, trotzdem haben sie zahlreiche neue Erkenntnisse generiert und Perspektiven eröffnet, die nicht mehr ignoriert werden können. Einige theoretische Analysen zur Bedeutung der menschlichen Sexualität sind genauso entscheidend für unser Verständnis wie die naturwissenschaftlichen Entdeckungen, die ihnen vorausgegangen sind. Die Einsicht in den Zusammenhang von Sex und Freiheit, Sex und Macht, Sex und Geschichte, von Gender und beinahe allem anderen, ist in mancher Hinsicht so wichtig, dass es einfach kein Zurück zu naiveren Betrachtungsweisen gibt.
Die theologische Kritik am anthropologischen Dualismus und an der Betonung von Sünde und Scham hat für die Schöpfungs- und Inkarnationslehre und die Eschatologie neue Sichtweisen auf die Sexualität ermöglicht. Kritische Bibelexegesen haben allgemein akzeptierte Sexualnormen destabilisiert und neues Licht auf die Stellung der Sexualität in der menschlichen Gemeinschaft geworfen. Die Kritik an religiösen Traditionen hat in einigen Fällen zur kreativen Neustrukturierung wichtiger Aspekte der Tradition geführt. Aber selbst dort, wo die neuen theologischen Sichtweisen der menschlichen Sexualität mit Skepsis betrachtet oder rundheraus abgelehnt werden, haben sie den theologischen Diskurs erheblich verändert. Die Theologie hat wie die Philosophie einen Weg eingeschlagen, der eine Umkehr unmöglich macht.
Obwohl die Schlüsselfragen erforscht sind und sich die Hauptrichtungen für eine zeitgemäße Philosophie, Theologie und Ethik der menschlichen Sexualität herauskristallisiert haben, ist die Diskussion alles andere als abgeschlossen. In den Kirchen und Synagogen wütet der Dissens, und es gibt viele Fragen (wie die nach der Bedeutung der menschlichen Sexualität, des Begehrens und der Verkörperung sowie der Strukturen menschlicher Beziehungen), die zur Gattung der »ewigen Fragen« gehören. Jede Generation wird sie immer wieder neu für sich erkunden müssen. Deshalb ist es wichtiger denn je, mit allen uns zur Verfügung stehenden Disziplinen die Diskussion fortzusetzen und ethische Leitlinien für den Bereich der Sexualität zu entwickeln.
Probleme mit dem Terrain
Ethische Analysen im sexuellen Bereich werden mit besonderer Skepsis betrachtet – was gewissermaßen in der Natur der Sache liegt: Da wären zunächst einmal die früheren Misserfolge. Wenn es so viele Jahrhunderte lang »falsch gemacht wurde«, wieso sollten wir es dann plötzlich richtig machen? Dieser Einwand geht davon aus, dass aus religiösen, philosophischen und kulturellen Traditionen keinerlei Wissen über die menschliche Sexualität zu gewinnen sei. Er geht auch davon aus, dass es wirklich »nichts Neues unter der Sonne« geben kann, keine neue Erkenntnis, der bedingungslos (oder auch nur für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort) zu trauen wäre. Offenbar handelt es sich um eine überzogene Absage sowohl an die Vergangenheit als auch an die Gegenwart. Selbst wenn es das »letzte Wort« nie gibt, ist der Versuch der Bergung und Rekonstruktion von Wissen der Mühe wert. Ob dem wirklich so ist, hängt nicht zuletzt davon ab, wie drängend wir unsere Probleme mit der Sexualität erfahren. Wenn wir damit fortfahren, uns in unserem Sexualleben zu schaden und zu verletzen, oder daran scheitern, das Potenzial des anderen anzuerkennen, wenn wir uns auf irgendeine Weise verantwortlich für zukünftige Generationen fühlen, wenn Angst und Verwirrung unsere sexuellen Optionen immer noch einschränken, wenn wir uns deren Verwirklichung gegenseitig nicht zugestehen und der eigenen Entscheidung sowie der Entscheidung der anderen nicht trauen können, wenn unsere Sehnsucht nach Freude oder Glück oder Erfüllung unnötig behindert scheint: Wenn dem so ist, muss die Sexualität erforscht werden – unabhängig davon, wie attraktiv skeptische Positionen zu sein scheinen.
Es gibt jedoch einen weiteren Grund, der uns zur Vorsicht mahnt. In der westlichen Kultur, zumindest in ihrer christlichen Prägung, hat es die ständige Tendenz gegeben, der Sexualmoral eine zu große Bedeutung zuzumessen. Das Sexuelle hat den moralischen Schwerpunkt ganzer Generationen von Menschen eingenommen. Alles »Sexuelle« wird als »moralisch« oder »unmoralisch« angesehen. »Moral« wird oft beinahe auf »sexuelle Moral« reduziert. Das geschieht zum Nachteil anderer wichtiger Anliegen, als da sind ökonomische Ungerechtigkeit, die Unterdrückung ganzer Völker, politische Unehrlichkeit, selbst Diebstahl und Mord. Ironischerweise fällt vielleicht ein Großteil dessen, was die sexuelle Sphäre ausmacht, gar nicht in den Bereich der Moral oder nur indirekt. Beziehungen – zu anderen, uns selbst, Gott – tragen immer moralische Elemente in sich; aber die Sexualität oder die Abwesenheit von Sex in ihnen kann von geringerer moralischer Bedeutung sein als Faktoren wie Respekt, Vertrauen, Ehrlichkeit, Fairness und Treue. Und doch verletzen oder verraten wir einander häufig als sexuelle menschliche Wesen. Trotz des Risikos, die moralische Bedeutung von Sex überzubewerten, kann deshalb die Notwendigkeit einer Sexualethik nicht gänzlich verworfen werden.
Die andere Seite der Tendenz, Moral mit Sex gleichzusetzen, besteht darin, den sexuellen Bereich als isoliert vom Rest des Lebens zu betrachten. Das bedeutet, dass wir einerseits der Sexualmoral zu viel Gewicht beimessen, andererseits jedoch zu wenig. Diese Art von Skepsis bemängelt, dass eine Sexualethik ein kleines, leichtfertiges Unterfangen oder eine Obsession ist, die von den wirklich drängenden moralischen Problemen wie Rassismus, Hunger, Obdachlosigkeit, Armut und Krieg ablenkt. Das ist plausibel, aber nur solange man die Verbindung zwischen sozialen Strukturen und sexuellen Beziehungen, zwischen politischen Kämpfen und Gender-Bias, zwischen sexuellen Sanktionen und sozialpolitischen Strategien außer Acht lässt. Feministinnen sind mit ihrer Behauptung, dass das »Persönliche politisch« sei, nicht immer auf Verständnis gestoßen; aber insbesondere in der Sphäre der Sexualethik ist das Private ebenso institutionell wie individuell bestimmt. In einem Jahrhundert, in dem Vergewaltigungen Teil der militärischen Strategie waren, Armut nicht selten das Ergebnis eines Mangels an selbstbestimmter Reproduktion ist, in dem Industrien auf sexueller Ausbeutung basieren und die Vergabe von Arbeitsplätzen von Rasse, Geschlecht und Klasse abhängen, kann die Entwicklung einer Sexualethik kein triviales Anliegen sein.
Eine letzte, aber zweifache Quelle der Skepsis entspringt einerseits der unüberschaubaren Breite des sexuellen Erlebnishorizontes und andererseits unseren wachsenden Zweifeln, dass moralische Normen überhaupt eine positive Auswirkung auf unser Sexualleben haben. Allein der Gedanke an ethische Standards für sexuelle Beziehungen und Aktivitäten setzt voraus, dass sie generalisierbar sind. Aber ist dem so? Von kulturellen Unterschieden einmal ganz abgesehen: Ist es möglich, eine allgemeingültige Ethik zu entwickeln, die unser Sexualleben bereichert? Nehmen wir nur die Erfahrung der romantischen Liebe, die das sexuelle Begehren prägt und von ihm geprägt wird. Wie viele Formen nimmt sie an? Gibt es wirklich moralische Kriterien, die sowohl auf schmerzhaft unerwiderte Liebe anwendbar sind wie auf Beziehungen, in denen die Leidenschaft in einem gemeinsamen und geordneten Leben allmählich zu reifer gegenseitiger Liebe wird? Können ethische Normen bestimmen, ob eine Liebe Erfüllung findet? Ob sich unerfüllte Liebe als tragisch oder einfach traurig oder als glückliche Möglichkeit eines Neuanfangs erweist? Können ethische Prinzipien und moralische Regeln den Weg zu einer möglichen und schönen Beziehung weisen? Oder verhindern, dass wir verletzt werden oder unser Leben aus der Bahn geworfen wird? Oder uns dabei helfen, die unsicheren Gewässer der Intimität zu befahren?
Gibt es ethische Perspektiven, die sowohl die erotische Liebe in romantischen Beziehungen als auch leidenschaftliches Verlangen nach Sex ohne Beziehung umfassen können? Wie sieht es mit Beziehungen aus, die weder romantisch noch leidenschaftlich sind? Kann es dieselben moralischen Grenzen für lang andauernde (oder im Laufe der Zeit bitter gewordene) Liebe geben wie für aufblühende, noch unsichere Liebe voller Macht und Gefahr? Stärkt es die ethischen Normen, wenn Sex und Liebe institutionell durch Strukturen von Ehe und Familie, Berufs- und Alterskategorien, stärkenden Traditionen, selbstgenügsamen Kulturen reguliert werden? Mit anderen Worten: Kann über die menschliche Erfahrung der Sexualität überhaupt genug gesagt werden, um universelle oder auch nur lokale Richtlinien zu erlassen? Was bedeutet die Erfahrung der moralischen Verpflichtung für die sexuelle Erfahrung? Kann diese geschützt oder befreit werden? Wenn sich Sex friedlich in die Ordnung des Lebens einfügt, wozu braucht es dann ethische Normen? Und wenn Sex Unruhe stiftet und unser Leben in Unordnung bringt, helfen sie dann überhaupt? Geht es lediglich darum, ob ethische Normen befolgt, oder vorrangig darum, dass sie überhaupt zur Kenntnis genommen werden?
Niemand würde argumentieren, dass ethische Standards alle möglichen Probleme der Sexualität lösen oder auch nur beleuchte können. Und nur wenige Menschen würden darauf bestehen, dass moralische Regeln sich immer positiv auf unser Sexual- und Beziehungsleben auswirken. Trotzdem sollten wir nicht zu dem Schluss kommen, dass unser Sexualleben nicht reflektiert und von ethischen Grundsätzen und moralischer Klugheit bestimmt sein soll. Wie grundverschieden unsere sexuellen Erfahrungen auch sind, wie vielfältig die Kontexte für unser sexuelles Begehren, wie gleichgültig unsere Sexualität gegenüber ethischen Standards auch erscheinen mag, wir fällen trotzdem moralische Urteile, entwickeln bestimmte Ansprüche als Reaktion darauf und erfahren uns in unserem Handeln als selbstbestimmte Menschen. All das mag sich als illusorisch erweisen, als illegitime Überbleibsel seit Langem bestehender Tabus. Und doch erleben wir echte moralische Verwirrung, suchen nach moralischer Führung und empfinden moralische Empörung über bestimmte sexuelle Aktivitäten, bestimmte sexuelle Beziehungen. Wie auch immer die Theorien über Sex und Moral beschaffen sind, unser Sexualleben ist untrennbar mit moralischen Fragen verbunden. Skepsis hin oder her: Die Anstrengung, eine Sexualethik zu entwickeln, ist unumgänglich.
Die Aufgabe
Inzwischen sollte klar geworden sein, dass die Entwicklung einer angemessenen zeitgemäßen Sexualethik erfordert, einer Reihe von verwandten Forschungsfeldern Aufmerksamkeit zu schenken. Interkulturelle und historische Studien müssen berücksichtigt werden; soziologische Erhebungen spielen ebenso eine Rolle wie eine Reihe meta-ethischer Fragen (also die »großen Sinnfragen«); die Bedeutung der Sexualität an sich, der Verkörperung und des sexuellen Begehrens oder des sozialen Geschlechts muss diskutiert werden, ebenso die Universalität oder Partikularität jeglicher moralischen Norm. Und weil ethische Leitlinien nicht aus einem moralischen Vakuum kommen, wird sich eine Sexualethik (ob positiv oder negativ) auf bestimmte philosophische, theologische, kulturelle Traditionen beziehen müssen. Eine Sexualethik kommt nicht umhin, menschliche Handlungen und Möglichkeiten zu bewerten, nach erkennbaren Widersprüchen oder Gefahren zu fragen und nach Beziehungsmustern zu suchen, die individuelles und gesellschaftliches Wohlbefinden fördern. Darüber hinaus ist es wichtig, nicht nur über Normen für Handlungen und Beziehungen nachzudenken, sondern auch über Fragen des Charakters oder der Tugend, soweit sie sich auf unser Sexualleben auswirken. Zweifellos ließe sich diese To-do-Liste fortsetzen.
Dieses Buch zielt nicht darauf ab, eine vollständige oder umfassende Sexualethik zu schaffen. Es wird sich nicht mit all den Fragen befassen, die für eine Sexualethik bedeutsam sind, und auch nicht mit allen vielversprechenden Konzepten. Es beschränkt sich weitgehend auf Probleme, mit denen sich die gegenwärtige westliche Kultur konfrontiert sieht (obwohl nicht davon auszugehen ist, dass sie für andere Kulturen irrelevant sind). Des Weiteren konzentriert sie sich auf die in christlicher Tradition wichtigen Ressourcen und zielt in erster Linie darauf ab, innerhalb dieser Tradition sinnvoll zu sein.
Selbst in dieser bescheideneren Version beinhaltet das Buch immer noch einige Elemente für eine umfassende Sexualethik. Die folgenden Kapitel befassen sich mit der Geschichte (Kapitel 2), den interkulturellen Differenzen (Kapitel 3) und einer Untersuchung der Bedeutung von Verkörperung, Gender und Sexualität (Kapitel 4). In Kapitel 5 widme ich mich einigen vorbereitenden Fragen in Bezug auf die Formulierung von Leitlinien für eine Sexualethik: Methoden und Quellen, alternative Konzepte und das Verhältnis von Gerechtigkeit und menschlicher Liebe. Kapitel 6 enthält meinen Vorschlag für eine menschliche und christliche Sexualethik. Im letzten Kapitel, Kapitel 7, betrachten wir drei wichtige »Beziehungsmuster«, die unsere Sexualität betreffen und anhand der Leitlinien der von mir vorgeschlagenen Sexualethik beleuchtet werden können.
Kapitel 2
Die Vergangenheit
Die Geschichte der Sexualethik ist wichtig, um die gegenwärtigen ethischen Fragen zur menschlichen Sexualität verstehen und kontextualisieren zu können. Entsprechende Studien haben jedoch mit einigen nicht geringen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie neuere kritische Untersuchungen zeigen.1 Während Gesetze, Kodizes, Abhandlungen, Predigten und andere Formen der moralischen Belehrung zum sexuellen Verhalten hervorragende Quellen für die normativen Aspekte der Geschichte abgeben, ist es sehr viel schwieriger – wenn nicht unmöglich –, herauszufinden, was die wirklichen Menschen glaubten und taten. Hier ist man auf oft fragmentarische und vorläufige Studien angewiesen. Zweitens wurden ethische Theorien über Sex überwiegend von der männlichen Elite in den untersuchten Gesellschaften formuliert. Die Erfahrungen, Anschauungen, Werte von Frauen sind größtenteils nicht dokumentiert und waren bis vor Kurzem fast ganz unzugänglich. Dasselbe trifft auf Männer zu, die nicht der herrschenden Klasse angehörten. Drittens hängt die Interpretation der Quellen immer von einem bestimmten Erkenntnisinteresse ab. Es macht einen großen Unterschied, ob man nach historischen Bewertungen des menschlichen Begehrens sucht oder aber nach den Leerstellen, wenn zum Beispiel über den sexuellen Missbrauch von Frauen geschwiegen wird.
Trotz all dieser Schwierigkeiten ist es (mit der gebotenen Vorsicht) möglich, eine Geschichte der Normen und Theorien der westlichen Sexualethik zu umreißen.2 Vor diesem Versuch können wir jedoch die damit verbundenen Schwierigkeiten und wunderbaren Möglichkeiten aufzeigen, indem wir kurz drei interpretierende Theorien betrachten, deren Interesse sich vorwiegend auf historische Quellen und Trends innerhalb der westlichen Kultur und einiger ihrer Subkulturen richtet. Diese Theorien liefern ganz unterschiedliche Sichtweisen nicht nur für die Geschichte des Denkens über Sexualität und ihre institutionalisierten Normen, sondern auch für das, was manchmal als Geschichte der Sexualität bezeichnet wird.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























