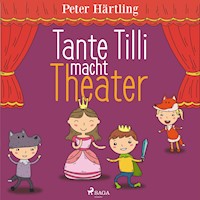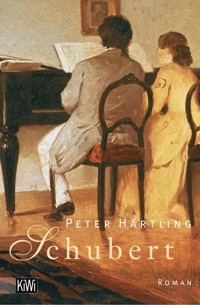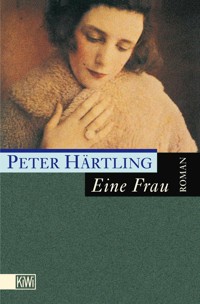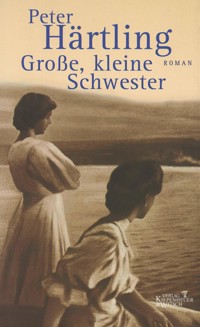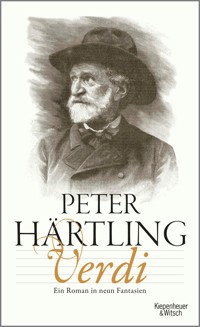
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verdi – ein musikalisch-melancholischer Künstlerroman Peter Härtling, profunder Musikkenner und Autor hochgelobter Künstlerromane von Schubert über Schumann bis zu Hölderlin und Fanny Mendelssohn, nähert sich dem alternden Verdi und lässt seine Fantasie schweifen. Die Geschichte beginnt auf der Höhe seines Schaffens und gleichzeitig an einem kritischen Punkt. Verdi hat mit »Aida« einen phänomenalen Erfolg gefeiert und versucht nun etwas Neues. Mit dem Streichquartett in e-Moll und dem Requiem überrascht er sich, sein Publikum und Peppina, seine zweite Frau und engste Vertraute. Und er beginnt, sich neben der Musik um anderes zu kümmern: seinen Landsitz Sant'Agata, in dessen Umgebung er ein Krankenhaus gründet, und die Casa di Riposi dei Musici, ein Altersheim für ehemalige Musiker in Mailand. Es folgen weltberühmte Kompositionen, besonders der »Otello« und der »Falstaff« in der spannungsreichen Zusammenarbeit mit dem Librettisten Arrigo Boito. Härtling erzählt von einem Mann, der immer auf der Suche ist – nach sich, der Liebe, der Erfüllung, dem künstlerischen Ausdruck. Einem Mann mit Erfahrung, der doch immer wieder von Neuem anfängt und am Vertrauten hängt, vor allem an seiner Peppina. Ein beglückender Roman, leicht erzählt, mit musikalischem Gespür für Dissonanzen, Zwischentöne und das große Finale.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
TitelMottoWidmungVorwortI. Accelerando a capriccioII. Andante con spiritoIII. AppassionatoIV. Andante giocosoV. Alla breveVI. AllegrettoVII. Allegro agitatoVIII. ParlanteIX. Allegretto mestoBuchAutorImpressumDie Wahrheit kopieren kann etwas Gutes sein, sie zu erfinden ist besser, weit besser.
GIUSEPPE VERDI
Für Mechthild
Vorwort
Eine Kopfnote statt mehrerer Fußnoten
Ich hatte nicht vor, eine Biografie zu schreiben. Es ging mir nicht darum, das Leben Verdis zu erzählen, Daten und Werke einzusammeln. Der Untertitel nennt neun Fantasien. Verdi hat nie eine geschrieben. Eine Fantasie folgt Motiven, Stimmungen. Es ist eine dem Alter angemessene Form (obwohl der junge Schubert unerhört »fantasieren« konnte). Ich nähere mich an Jahren dem Verdi, der mit einer unvergleichbaren Energie schon im »Otello« eine »neue Musik« fand, und ich wünschte mir waghalsig einen Austausch der Erfahrungen. Verdi ist zwar unantastbar in seinem Ruhm, aber er ist mir nah in seinen Schwächen und in seiner Furcht, aus der Fantasie zu stürzen, das Handwerk nicht mehr zu können. Ich erzähle meine Erfahrungen als seine und seine als meine, und es ist mir nicht wichtig, mich an die Chronologie zu halten. Der Kalender verliert an Bedeutung, doch die Schritte sind es, die Schritte. Wer nicht mehr gehen kann, ist nicht unterwegs. Es sei denn, er lässt seine Gedanken fliegen.
I. Accelerando a capriccio
I.
Accelerando a capriccio
Er war im Dunkeln aus dem Bett gestiegen, ein paar Schritte gegangen und hatte sich verirrt. Er hörte sich atmen und dachte, es ist wie der Atem eines Kindes.
Hilf mir, Peppina!, rief er in die schwarze Wand, blieb stehen und horchte. Er müsste das Zimmer doch kennen, in dem er bei jedem Neapel-Aufenthalt logierte. Aber es wies ihn ab. Er wagte keinen Schritt mehr.
Peppina, ich bitte dich!
Ihr Lachen hörte sich an, als käme eine Taube ins Zimmer geflogen. Er riss die Augen auf, es wurde noch dunkler.
Was ist mit dir, mein Verdi?, hörte er, und die Taube gurrte der Frage nach.
Hilf mir, bitte. Ich finde mich nicht zurecht.
Sie kam, ihre Schritte waren sicher. Er schüttelte sich etwas unwillig. Sie schob ihn vor sich her, bis er mit dem Knie gegen den Bettrand stieß.
Ich kann dir das alles nicht erklären.
Peppina half ihm, sich hinzulegen, deckte ihn zu.
Er rückte zur Seite: Leg dich zu mir.
Du nimmst dir zu viel vor. Ihre Wärme teilte sich ihm mit. Wir werden älter, sagte sie.
Er antwortete ihr nicht. Sie atmeten miteinander.
Er fürchtete, sie könnte einen Satz mit »damals« beginnen, und drehte sich zur Seite. Wieder gurrte die Taube.
Ich weiß schon, sagte er, ich bin kindisch und lächerlich alt.
Beides?, fragte sie.
Beides, gab er ernst zur Antwort.
Sie hatte die Abigail im »Nabucco« gesungen, und wenn sie so nahe war wie jetzt, hörte er sie, die Primadonna Giuseppina Strepponi. Sie war, als er sie kennenlernte, einunddreißig, berühmt und hochmütig, Mutter eines Sohnes, Camillo, und ihre Stimme hielt nicht mehr. Sie verschwand, versuchte sich, wie er später erfuhr, in Paris als Gesangslehrerin.
»Wir sind überzeugt, dass sich diese hervorragende Künstlerin in diesem Winter in der eleganten Welt von Paris großer Beliebtheit erfreuen wird.« Er wusste diesen albernen Satz auswendig. Ich kann ihn noch immer, sagte er und lachte vor sich hin.
Sie sendete ihre Wärme aus: Was kannst du noch immer?
Einen Satz, Peppina.
Sagst du ihn mir?
Nein. Du kennst ihn. Weißt du noch, wie ich dich in Paris besucht habe?
Ja. Ich habe die Stadt dann mit dir verlassen.
Du sagtest, und ich wollte es nicht glauben, ich werde nicht mehr singen. Doch in einer Pause, nach der Heimreise, sagtest du auch: Ich bleibe bei dir.
Und jetzt irrst du in dem uns seit Jahren vertrauten Zimmer in der Albergo delle Crocelle umher.
Sie schlüpfte aus dem Bett. Ich will noch etwas schlafen, Verdi, schlaf du auch. Warte, bis es hell wird.
Verdi war sechzig, als er sich vornahm, nach den Anstrengungen um »Aida« eine Arbeitspause einzulegen. Zwanzig Jahre jünger, als ich es bin. Er litt unter seiner Ungeduld, unter den Wünschen und Erwartungen anderer. Er versuchte, zu Atem zu kommen. Mit Peppina zog er sich, wann immer es möglich war, nach Sant’Agata, auf seinen Landsitz, zurück. Der Besitz wuchs durch Ankäufe. Manchmal begleitete sie Teresina Stolz, die, Jahre zuvor, die Leonore in der »Macht des Schicksals« gesungen hatte, eine Stimme, der Verdi zeitweilig verfiel und gegen die Peppina nur ihre Nähe zu ihm ausspielen konnte. Sie gewöhnten sich aneinander, nachdem eine wie die andere festgestellt hatte, dass der alte Mann sie nicht der jeweils anderen vorziehe. Er redete sich die Pause ein, blieb dennoch angespannt und unterwegs. Seine Opern wurden weiter aufgeführt, die Ricordis, seine Verleger, blieben ihm auf den Fersen, geliebte Plagegeister, bedrängten ihn mit Aufführungsterminen, Einladungen, erhofften Neues. Allein in seinem sechzigsten Jahr reiste er von der italienischen Erstaufführung der »Aida«, da strengte ihn die Regie an, nach Sant’Agata, von dort nach Mailand, weiter nach Paris, zurück über Turin nach Sant’Agata und Ende des Jahres nach Genua. Immer die langsamen Züge, die holpernden Kutschen, »gerädert«. Es ist schwer, ihm schreibend zu folgen, allen Personen, denen er unterwegs begegnete, die ihm gelegentlich wichtig wurden, einen Namen zu geben.
Er wollte sie alle überraschen, sein Publikum, die Musiker, Peppina und die Ricordis. Mit Peppina hatte er es nicht leicht, sie fragte ihn wiederholt, warum er noch an der Aida-Partitur korrigiere, und er erfand Ausreden, bei denen ihm die Stimmen der Sänger halfen. Die Waldmann war in dieser Partie noch nicht ganz sicher, erklärte er Peppina, und sie konnte es nicht lassen, ihm noch das Herzblut in den Hals zu jagen: Aber die Stolz kann alles bestens! Er beugte sich über das Blatt auf dem Sekretär und begann, mit dem Handrücken fahrig darüberzustreichen. Peppina wusste, dass er Teresina Stolz in seine Nähe wünschte, ihrer beider Nähe. Sie sang, was Peppina sang. Und dass sie sich scheiden ließ, seinetwegen, wie Peppina vermutete, ging ihr zu weit. Jetzt keine Rollen mehr, um die sich streiten ließ, keine theatralischen Rivalitäten. Er hoffte, Peppina verstand ihn, und wünschte, dass sie den vertrackten Zustand akzeptiere.
Schon im Juni des vergangenen Jahres hatte er in Genua mit dem ersten Satz eines Streichquartetts begonnen. In Neapel hatte er Zeit, da Teresina mit einer Indisposition nicht weiter an den Proben teilnehmen konnte, ihre Aida höre sich an wie ein durchgedrehter Kapaun, höhnte Peppina, und er fand das gemein.
Den ersten Satz, ein Allegro in Sonatenform, hatte er beinahe zu Ende gebracht, ein paar Erinnerungen an »Aida« waren ihm hineingeraten und um sicher zu sein, hatte er sich über Ricordi die letzten Quartette Haydns bestellt.
Giulio Ricordis Neugier war geweckt: Was haben Sie vor, Maestro?
Verdi hob die Schulter: Ich lese Haydn, um zu lernen, Giulio.
Womit er Ricordi erstaunte: Ich bitte Sie, von den wenigen Opern, die er komponierte!
Verdi bestand darauf, dass er die Noten besorge. Von Haydn kann unsereiner sowieso lernen. Und Sie, Giulio, sind von Berufs wegen ein Besserwisser.
Mit dem zweiten Satz, dem Andantino, antwortete er melancholisch den beiden Frauen, den beiden Stimmen, seiner Liebe zu beiden, einer ungeteilten, die es ihm schwermachte. Peppina wurde seine Arbeit, seine Noten-Abwesenheit, wie sie schimpfte, zu viel: Willst du mit Noten die Stimme der Stolz reparieren?
Er ließ sich nicht provozieren, dachte nicht daran, sich zu einer »Partei« zu schlagen: Sie ist schon wieder bei Stimme, Peppina, wir haben heute Vormittag geprobt, und es kann weitergehen.
Sie schickte ihrem Lachen das vertraute Gurren voraus: Und was reparierst du dann mit Noten?
Er könnte ihr erzählen, dass ihm das Prestissimo des dritten Satzes zu schaffen mache, denn es drängte ihn zu einem Cantabile, und um die Geheimnistuerei nicht zu übertreiben, gab er wenigstens preis, was ihm durch den Kopf ging: Ich bekomme ein Motiv für Cello nicht los, es geht mir nach und singt im Schlaf weiter. Hörst du? Er sang.
Das gefällt mir, Verdi. Wer soll es singen? Nur du?
Wenn es nach mir geht, Peppina, dann schon.
Sie lehnte sich gegen ihn, machte sich schwer: Womöglich vergisst du es, schreib es lieber auf. Vorsichtig, um ihre Leidenschaft nicht zu wecken, legte er den Arm um sie: Du hast recht, Peppina, das werde ich nicht versäumen, das nicht.
Draußen vorm Hotel stritten zwei Kutscher lauthals über ihre Warteposition auf der Gasse. Peppina machte sich los, küsste ihn flüchtig auf den Hals, lief zum Fenster, lachte, wie nur sie lachen konnte, den Anfang einer Arie: Den Kerlen werde ich es zeigen und mir beim Portier eigens eine Kutsche bestellen. Sie ging und hinterließ einen Luftwirbel. Er sah hinaus, beobachtete die Kutscher, die von ihren Böcken angriffslustig gestische Botschaften aussandten, doch dann stieg, mithilfe des Concierge, Peppina in die Kutsche des einen. Und die Sonderpost?, fragte er gegen die Fensterscheibe.
In den dritten Satz, dem Scherzo, für dessen Trio er das Motiv schon vorausgesungen hatte, redeten ihm die Proben zu »Aida« hinein. Vieles stimmte nicht, nachdem sich die Stimme der Stolz belegt hatte. Die Kulissenbauer schlampten, sodass die Leute auf der Bühne fürchten mussten, unter Teilen des Bühnenbildes begraben zu werden. Manchmal, wenn ihn die Wut packte, vergaß er sich. Und danach fürchtete er sich vor dem Spott Peppinas.
Er rief, nein, er schrie nach dem Bühnenmeister: Signor Calotto! Der kam, hager, ungemein fluchtgeübt und mit Augen, in denen sich die Frechheit konzentriert: Maestro, wo fehlt’s?
In drei Tagen haben wir Premiere, und das komplizierte Bühnenbild kommt mir vor wie improvisiert.
Der dürre Kerl nickte und ließ die Augen funkeln: Das stimmt, Maestro, nur wenn ich mich nicht irre, haben Sie ebenfalls in den letzten Tagen improvisiert.
Er hätte ihn am liebsten gepackt und in seine wackligen Kulissen geschmissen. Doch nun hörte er sich brüllen, und der Kerl wich zurück, machte geschwind kehrt und verschwand im Bühnengang.
Er merkte die erstaunten und erschrockenen Blicke der Bühnenarbeiter, der Musiker.
Sie hatten Teresina in ihrer Garderobe alarmiert. Sie war plötzlich da, neben ihm. Eine banale und bizarre Szene, die sich nur ein schlechter Librettist hätte ausdenken können.
Sehr leise fragte sie, um nicht weiter seinen Zorn zu schüren: Was ist, Verdi?
Sie legen sich alle quer, haben kein Interesse. Er musste aufpassen, sie nicht in seine Arme zu reißen und wie ein Hilfe suchendes Kind auf sie einzureden. Sie umfasste mit beiden Händen seine Hand: Das stimmt nicht, Verdi. Nach unendlich vielen Premieren, die du erlebt hast, müsstest du wissen, dass niemand vorher bei Trost ist. Du auch nicht. Sie lachte anders als Peppina. Ungleich bewusster.
Also komm! Sie hatten den gleichen Weg zum Hotel.
Er folgte ihrer Einladung nicht. Es geht nicht. Ich habe keine Zeit.
Er ließ sie stehen, lief zum Orchester, spürte, wie die Aufregung ihn angestrengt hatte, ihm war ein wenig übel, es drängte ihn jedoch zu planen, sich selber festzulegen, sich ein Ziel zu setzen.
Den Primgeiger mochte er. Es war ein Musiker mit Seele und Verstand. Ihm konnte er sich anvertrauen. Sie könnten mir am 1. April helfen, Camillo, und drei andere deswegen ansprechen.
Er ärgerte sich, wie umständlich er aus Verlegenheit redete.
Sie könnten, wären Sie dann willens, die erste Geige eines Streichquartetts einstudieren.
Der Musiker erwiderte fest und fragend seinen Blick. Mozart?, fragte er. Haydn?
Verdi senkte den Kopf und gab durchaus erleichtert Auskunft: Verdi.
Er hatte mit der Verblüffung des Geigers gerechnet. Der schnappte förmlich nach Luft.
Sobald ich fertig bin, bekommen Sie die Noten, und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie noch Kollegen, die Sie schätzen, für ein Quartett überreden.
Der Geiger verbeugte sich, lächelte: Ja, Maestro, zu einem Quartett von Giuseppe Verdi.
Er hastete, ohne Teresina zu treffen, ins Hotel, und das Scherzo begann mit dem kurzen Atem dieses Nachmittags, ehe es singen konnte, wie er es sich vorgenommen hatte.
Viel Zeit blieb ihm nicht. Gestört wurde er immer. Peppina kam atemlos herein, erzählte von einer neuen Bekanntschaft, einem spanischen Diplomaten, der, auf der Durchreise, im Hotel wohne.
Er ist ein Verehrer, Verdi, er kennt jede deiner Opern und spielt Viola, denk dir.
Er war aufgesprungen, hatte sich vor den Sekretär gestellt, um das beschriebene Notenblatt vor Peppinas Neugier zu schützen: Der Mann muss, scheint mir, ein wahres Wunder sein.
Sie nahm, wie so oft, seine Ironie nicht zur Kenntnis und fügte, zum Vergnügen Verdis, noch mädchenhaft auftrumpfend hinzu: Zu allem sieht er auch gut aus.
Verdi klatschte in die Hände, ein Beifall, der sie bestärkte. Der Mann muss ja vollkommen sein, Peppina.
Sie sank kurz zusammen, schien sich in dem üppigen Kleid zu verlieren, lächelte fragend, und die Liebe zu ihr überschwemmte ihn: Bitte, lass mich noch arbeiten, Peppina, und grüße mir den unbekannten Verehrer.
Mit ein paar Schritten war sie bei ihm, küsste ihn, wirbelte um die eigene Achse und verschwand. Aufseufzend sah er auf die Zimmertür, die hinter ihr ins Schloss gefallen war.
Eine Woche vor der Premiere brachte er die abgeschlossene Partitur des Streichquartetts »seinem« Geiger, ein Papierbündel mit Arbeitsspuren: Gestochen wäre es Ihnen lieber, denke ich mir. Er erfuhr, dass die anderen drei gefunden seien, Cassini, der Cellist, war ihm während der Orchesterproben ohnehin aufgefallen. Viel Zeit zum Proben haben Sie nicht, warnte er, sich und mögliche Patzer bei der Aufführung entschuldigend.
Der Erfolg der »Aida«-Aufführung überrumpelte ihn. Das Publikum raste, zweiunddreißigmal musste er vor den Vorhang, im Bühnengang fielen sie ihm nacheinander um den Hals, Teresina, die Waldmann, Tito und Giulio Ricordi.
Maestro!, der alte Ricordi schwelgte beim Premierenmahl im Hotel, »Aida« sei der Gipfel seines Schaffens, und Giulio versicherte, es seien ihm beim Abschied Aidas die Tränen gekommen. Verdi hob sein Glas: Nein, nein, erwartet keine Rede. Ich trinke auf die Musik, nicht auf die Tränen.
Mit dem Concierge bereitete er die Aufführung im Foyer des Hotels vor. Es müssten sich genügend Plätze finden. Er habe nur eine Handvoll Musikverständiger eingeladen und vielleicht fänden sich mehr ein, falls sich die Sache herumspreche. Und vier Notenständer müsse er besorgen. Aber der Signora Verdi dürfte er von alledem nichts verraten.
Nach dem Triumph beim Publikum verdrossen ihn die Kritiken. Dumpfes Unverständnis, klagte er Giulio Ricordi, und dass immer wieder Wagner zum Vergleich aufgeführt werde, sei ärgerlich. Was wisse dieser Germane vom Segen der Melodie. Nichts, sage ich dir. Peppina und Teresina stimmten zweistimmig bei: Er hat ja recht, unser Verdi. Ihre Zustimmung rührte und reizte ihn. Ich habe nicht recht, nein, die Musik hat recht. Nur die Musik.
Er hat nur zwei Tage, nach dem Lärm um »Aida«. Das Quartett trifft sich zu den Proben in einem Haus an der Bucht. Er kann am Meer spazieren gehen, es lärmt anders als das Theater, doch nicht weniger theatralisch mit den Rufen der Fischer, der Händler am Quai, dem Gekreisch der Möwen und dem Schmatzen der kleinen Brandung am Ufer.
Er solle zur Korrektur kommen, hatte ihn der Primgeiger gebeten. Er schlich sich mehr oder weniger an, die musizierenden Männer bemerkten ihn erst nicht, sie spielten in einem geradezu wütenden Tempo den letzten Satz, die Fuge, die auszudenken ihn glücklich gestimmt hatte. Zum ersten Mal ein solches Stück, er war sicher, es würde sich wiederholen.
Schon sehr gut, befand er. Die Bratsche schleppe etwas. Aber doch schon sehr gut. Sie baten ihn, auch den langsamen Satz abzunehmen. Keine Menschenstimmen mehr, nicht mehr überlegen, welcher Charakter sich ausdrücken könne, in welcher Stimmlage – nur Musik, nur Instrumente und die Erinnerung an Gesang.
Er hatte auf Billetts Einladungen geschrieben und einen Boten ausgeschickt. Zu einer »musikalischen Aufführung« hatte er geladen, kein Wort davon, dass es um eine Komposition von ihm gehe und kein Bariton oder kein Sopran zu hören sein werde. Auch die Stolz, die ihn auszuhorchen versuchte in allerlei skurrilen Anläufen, ließ er nichts wissen. Peppina ahnte allerdings, dass es um die Verwirklichung seiner Heimlichtuerei gehe. Worum es sich dabei handelte, wusste sie aber nicht.
Der Concierge bat ihn, für die Ordnung der Stühle Anweisungen zu geben, einen Plan zu zeichnen. Er stellte sich ins Foyer, schob in Gedanken die Stuhlreihen rund um die vier Stühle der Musiker, erklärte dem Concierge und den beiden Kellnern die Ordnung, dass man vielleicht auch die beiden Diwans in die Reihe rücke, für die Damen. Eben die, Peppina und Teresina, boten ihm Hilfe an, was ihn aufbrachte: Es ist meine Angelegenheit, ich bitte euch, habt Verständnis.
Die Abendstimmen auf der Straße vor dem Hotel wurden laut, die wartenden Kutscher luden wortreich mögliche Passagiere ein, Peppina hatte Lichter angezündet, sich vor den Spiegel postiert, eine noch immer schöne Frau, fand er, natürlich ein wenig schwerfällig geworden, wie ich auch, sagte er sich. Der Frack, fand er – er hatte sich neben sie in den Spiegel geschoben –, stand ihm gut und hielt ihn in Form.
Sie gab ihm mit dem Ellenbogen einen Stoß: Was hast du vor, Verdi?
Du wirst hören und sehen.
Und das wird mir nicht vergehen?
Untersteh dich. Er küsste sie auf die Wange und nahm ihren Duft mit: Komm, unsere Gäste werden schon eintreffen.
Wen hast du geladen?
Lauter Bekannte.
Auf der Treppe hinunter in die Lobby hörten sie Stimmen und Instrumente, die gestimmt wurden. Peppina hatte sich bei ihm eingehängt und drückte seinen Arm: Nun bin ich erst recht gespannt. Der Concierge empfing sie und bat Peppina, ihm zu ihrem Platz zu folgen. Sie warf Verdi einen fragenden Blick zu. Und du, Maestro?
Er hatte sie neben Teresina gesetzt, auf einen Diwan. Wenn es um diese Musik geht, müssten sie sich vertragen, fand er.
Neue Gäste lenkten ihn ab, der alte und der junge Ricordi, die ihm versicherten, sich auf seine Überraschung zu freuen. Und Maria Waldmann, seine Amneris, mit ihrem Liebsten, dem Herzog Massari. Nach und nach kamen auch Orchestermusiker, die gespannt auf den Auftritt ihrer Kollegen waren, und einige neugierige Hotelgäste sorgten dafür, dass noch Stühle aufgestellt wurden.
Als die vier Musiker in den Kreis traten, ihre Plätze vor dem Publikum einnahmen, war ein erstauntes Gemurmel zu hören. Der Geiger warf Verdi einen auffordernden Blick zu. Er wusste, dass der Maestro vor der Aufführung noch einige Sätze sagen wollte.
Er lief, wie von einer Schnur gezogen, durch die Reihe zwischen den Plätzen, in seinem Kopf sammelten sich Sätze, die er vorher aufgeschrieben hatte. Ich alter Esel – er stellte sich neben dem Quartett auf, verbeugte sich leicht, erwartete, dass ihm schwindlig werde, und schaute Hilfe suchend zu Peppina auf dem Sofa, vielleicht auch zu Teresina, und beide lächelten ihm aufmunternd zu.
Liebe Freunde, begann er und hörte sich verwundert selber reden, liebe Freunde, während der Schwierigkeiten mit »Aida« und durch eben dieselben aufgetretenen Pausen komponierte ich, was ich mir bisher nicht zugetraut habe, ein Streichquartett, ein Gedankensprung nach »Aida«. Der Geiger in seinem Rücken unterstrich diese Bemerkung mit einem leisen Lachen.
Es steht in e-Moll und hat vier Sätze. Er machte eine Pause, wie um drei Sätzen Platz zu machen; den vierten hingegen kündigte er mit Nachdruck an: Zum Schluss hören Sie eine Fuge.
Während er sich zuhörte, trat er aus sich heraus und sah sich, über den Sekretär gebeugt, schreiben, sah sich am Klavier im Lesezimmer, spürte die Aufregung, die durch seine Heimlichkeit hervorgerufen wurde, das Vergnügen, bald so weit zu sein und die musikalische Welt mit einer Komposition zu überraschen, nicht mit der Ankündigung einer Oper, nicht mit einer neuen Fassung des »Don Carlos«. Und nun war es auf der Welt, was ihn, wie einen Buben, beschäftigt hatte. Jetzt hörte er.
Sie spielten die Fuge zu hastig, sodass die Stimmführung nicht mehr deutlich zu hören war. Er war im Gang stehen geblieben, setzte sich nun und unterdrückte den Drang dazwischenzurufen.
Wie oft habe ich mir das Quartett angehört, bis zur Fuge. Und wie oft habe ich Verdi vorausgedacht, der ich sein Werk bis zum Schluss, bis zum »Falstaff« kenne, diese Oper, in der die glanzvollste Fuge für Menschenstimmen zu hören ist.
Warum wurden sie immer zum Ende hin süchtig nach dieser wunderbaren Mathematik? Schubert, der kurz vor seinem Tod zu Melchior Sechter in die Fugenstunde ging, Schumann, der noch in der Psychiatrie sich zur Ordnung rief und fugierte. Kann es sein, dass es die Erinnerung an die Kinderstimme ist, die beim Kanonsingen sich nicht aus der Spur bringen lässt, von den andern? Kann es auch sein, den Kern der Musik so durchsichtig zu machen wie einen geschliffenen Diamanten?
II. Andante con spirito
II.
Andante con spirito
Es war eine Art Rauschen, auf dem sein Gedächtnis sich bettete, wie Trauer, die noch keinen Grund hat. Kaum waren sie in Sant’Agata angekommen, zog er sich in sein Zimmer zurück, ohne wie sonst die Leute in und rund um die Villa zu begrüßen, nach den Pferden und den Hunden zu schauen. Peppina hielt sich zurück, schwieg, ging gleichsam auf Zehenspitzen: Verdi, erklärte sie dem Bürgermeister von Busseto, der dem berühmten Sohn seiner Stadt zu dem Erfolg in Neapel gratulieren wollte, Verdi braucht nach allem Ruhe.
Das Quartett hallte nach, und das Echo, das es hervorrief, wurde ihm lästig. Tito Ricordi fragte nach, wann er die Noten stechen lassen könne, und der Präsident der Gesellschaft für Kammermusik in Mailand, Prinetti, wünschte eine öffentliche Aufführung. Er winkte ab, er habe das Quartett in müßigen Stunden geschrieben und »es eines Abends bei mir zu Hause aufgeführt«. Was nicht ganz zutraf. Aber das Hotel delle Crocelle in Neapel zählte zu den Wohnungen unterwegs, die längst ein Zuhause waren, wie das Grand Hotel in Mailand und die Wohnung in Genua.
Er schickte einen der herumstreunenden Bauernjungen nach dem Verwalter aus, er wolle ihn noch vor dem Abendessen sprechen. Peppina war verschwunden. Er hörte sie lachen, ihr Gelächter wanderte durchs Haus.
Dichter, in einzelnen Schwaden sich ballender Nebel kam vom Po her. Er lehnte sich gegen die Haustür, merkte, dass atmen ihm schwerfiel. Mit diesem Nebel war er aufgewachsen und seine Mama hatte ihn oft gewarnt, sich nicht im Nebel zu verirren. Aus dem Dunst schälte sich, schwarz und schwer, Antonio, der Verwalter: Sie wünschen mich zu sprechen?
Ob die Entwässerung der Äcker inzwischen vorangeschritten sei?
Der Mann holte tief Atem, als habe er einen schweren Gang vor sich: Die Drainage, Signor Verdi, ist nicht einfach, sie muss überlegt sein, und bei dieser Witterung fällt sie uns auch nicht leicht. Er atmete noch einmal hörbar ein, dann brach es aus ihm heraus: Das ist ja wahrlich eine gottverlassene Gegend, wir wissen uns kaum zu helfen, wenn es Sie nicht gäbe, gestern wäre eines meiner Kinder beinahe gestorben, weil es eine Ewigkeit dauerte, bis angespannt war, und eine weitere Ewigkeit, bis wir das Krankenhaus erreichten. Jetzt liegt es dort, wird ordentlich gepflegt und seine Mutter braucht einen halben Vormittag, um zur Klinik zu wandern.
Peppina, die jede Bewegung im Haus und um das Haus wahrnahm, auch jede Stimmung, die ihn umtrieb, fragte, als er ins Zimmer gehen wollte, mit wem er sich unterhalten habe und was ihn so bedrücke.
Ich muss ein Krankenhaus bauen lassen für unsere Gegend. Wir sind hier schlecht versorgt.
Sie lehnte sich gegen den Türrahmen: Willst du Bürgermeister werden, ohne Auftrag? Oder Gouverneur? Was kümmerst du dich, was sorgst du dich?
Ich habe Geld dafür, Peppina, und diese armen Schlucker haben es nicht, sie können sich nicht helfen, sich nicht wehren. Er erzählte ihr, was er von Antonio erfahren hatte. Sie erwiderte seinen Blick, ihr Lächeln warf feine Falten um die Augen: Mein Verdi will also die Welt besser machen.
Er schüttelte heftig den Kopf: Nicht die Welt, meine Welt, Peppina.
Es ist auch meine, Verdi.
Das wusste er. Wie oft hatte sie ihre Kindervergangenheit an dem üppigen Leben gemessen, das sie führten, vom Elend erzählt, den Pflichten, denen sie schon als Fünfjährige nachkommen musste, von den Strafen, unter denen sie sich geübt weggeduckt hatte.
Sie fasste nach seiner Hand und zog ihn hinter sich her in den Salon. Sie rückte ihm einen Sessel zurecht, blieb hinter ihm stehen, nachdem er Platz genommen hatte, legte das Kinn auf seinen Kopf und sagte, dass er Wort für Wort spürte: Ich gehe jetzt Brot holen und Öl und du sorgst für den Wein.
Er grübelte, welcher Ort in der Nähe sich für ein Krankenhaus eignen könnte. Er wollte noch einmal mit dem Verwalter sprechen, doch ein Telegrammbote kam ihm dazwischen. Peppina warnte: Er solle den Umschlag erst im Laufe des Tages öffnen, wahrscheinlich bringe das Telegramm nur Ärger. Es ist entweder von den Ricordis oder von einem Theater.
Er lachte, gab ihr nach, aber als er den Umschlag dann doch aufriss, rief er mit einem Kinderschrei: Komm! Peppina, komm! Sie war sofort zur Stelle: Was um Himmels willen ist dir passiert?
Er drückte das Papier gegen die Brust: Es ist von Clara Maffei. Sie schreibt: »Manzoni ist gestorben.« Er ist tot, Peppina.
Verdi war ihm nur wenige Male begegnet, bei der Gräfin Maffei, ihm, dem Freiheitsdichter der Lombardei. Nun war sie frei von Österreich. Und Italien eine Nation. Manzoni und er hatten dazu beigetragen, hatten der Sehnsucht eines Volkes in ihrer Kunst Ausdruck gegeben. Die Trauer wurde laut. Der Bürgermeister von Busseto erschien mit einigen Granden der Stadt und fragte nach, ob er, Verdi, sie alle bei dem Begräbnis in Mailand vertreten könne. Er war nahe daran, sie wütend aus dem Haus zu treiben, beließ es dabei, sie und auch Peppina, die sich empört dazugesellt hatte, zu überraschen: Ich werde nicht an dem Begräbnis teilnehmen. Und war sicher, damit Klatsch und Gerüchte auszulösen.
Bei Giulio Ricordi, der ihn erwartete, entschuldigte er sich: »Ich komme morgen nicht nach Mailand. Ich brächte es nicht übers Herz, das Leichenbegängnis mitzumachen. Doch ich komme, bald, um das Grab aufzusuchen, allein, ungesehen. Und vielleicht, um einen Vorschlag zu machen.«
Die Leute aus Busseto verließen das Haus und den trauernden und unruhigen Verdi, dem Peppina aus dem Weg ging, der sich ans Klavier setzte und ein Quod libet spielte, bis er aufsprang und aus dem Stapel unerledigter Papiere das »Libera me« für das Rossini-Requiem italienischer Komponisten fischte. Peppina erfuhr als erste, was er vorhatte: eine Messe, ein Requiem zum Andenken an Manzoni.
»Requiem aeternam dona eis, Domine et lux perpetua luceat eis«, antwortete sie ihm.