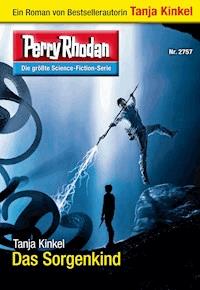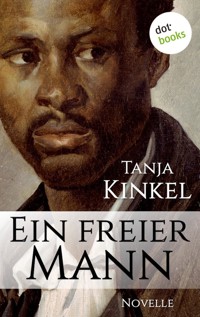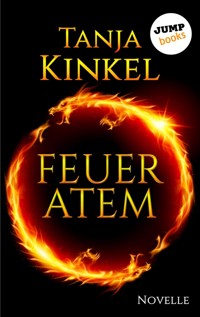Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Angiola Calori war die erste von nur einer Handvoll Frauen, der Casanova einen Heiratsantrag machte, doch sie wollte noch lieber die Bühnen Europas beherrschen. Zwei begnadete Verführer prallen aufeinander, und was lange wie ein Krieg wirkt, wird die Liebe ihres Lebens, die beiden ermöglicht, ihre so unterschiedlichen Ziele zu erreichen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tanja Kinkel
Verführung
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Angiola Calori war die erste von nur einer Handvoll Frauen, der Casanova einen Heiratsantrag machte, doch sie wollte noch lieber die Bühnen Europas beherrschen. Zwei begnadete Verführer prallen aufeinander, und was lange wie ein Krieg wirkt, wird die Liebe ihres Lebens, die beiden ermöglicht, ihre so unterschiedlichen Ziele zu erreichen.
Inhaltsübersicht
Prolog
Großes Jubiläumsgewinnspiel
I
II
III
IV
Epilog
Nachwort
Bibliographie
Prolog
Wie eine Symphonie in Marmor, so hatte der Erbonkel einmal geschwärmt, und so sieht Antonio Calori nun selbst die Palazzi am Canal Grande von seiner Gondel aus. Als Mailänder ist er an schöne, reiche Häuser gewöhnt, aber er muss zugeben, dass es den Palästen der Venezianer gelingt, gleichzeitig schön und graziös zu sein und miteinander zu harmonieren, obwohl sie doch gewiss genau wie in Mailand nicht gleichzeitig, sondern im Abstand von Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten entstanden sind. In Mailand hat man den Eindruck, die Reichsten der Stadt wollten einander ständig in den Schatten stellen und scherten sich den Teufel, ob das Ergebnis zueinanderpasste; hier scheinen es die Patrizier und ihre Architekten irgendwie fertiggebracht zu haben, dass sich die weißen, roten, blassgrünen und gelben Fronten auf bezaubernde Weise ergänzen und wie einzelne Noten ein klingendes, singendes Ganzes formen. Je mehr er von dieser Stadt sieht, desto mehr versteht er, dass es so viele Fremde aus dem restlichen Europa hierherzieht, auch wenn man in Mailand klatscht, dass sich dies in erster Linie den schönen Venezianerinnen und ihrer losen Moral verdanke und nicht so sehr den herrlichen Bauten.
Bald verlassen sie den großen Kanal und gleiten durch einen der vielen Seitenkanäle. Er hat den Gondoliere vorab bezahlt, wie der Onkel es ihm geraten hat, und hofft, damit zu vermeiden, dass der Mann sie auf Umwege führt, um mehr Geld für mehr Zeit herauszuschlagen. Seiner Frau und seiner Tochter gehen immer noch die Augen über, obwohl die Palazzi nun, im schattigen Grün eines kleinen Kanals, mehr von Verfall gekennzeichnet zu sein scheinen. Weniger eine Symphonie als ein Trauermarsch, doch immer noch schön. Das Teatro di San Samuele, das ihr Ziel ist, prangt dagegen schon von weitem wie ein herausgeputztes Schmuckkästchen her. Aber es stinkt, das fällt ihm als Nächstes auf, als er mit seiner kleinen Familie das Theater betritt: verbranntes Öl und Kerzen, und vor allem der Schweiß zahlreicher Besucher, von denen ein Teil offenbar auch nicht gesonnen gewesen war, nach draußen zu gehen, um sich zu erleichtern.
Außerdem krähen Verkäufer ständig herum, die Orangen und Wein anbieten. Durch die Jubelrufe und Flüche von den Spieltischen im Foyer und den Applaus, das Gelächter und Pfeifen aus dem Zuschauerraum herrscht ein ohrenbetäubender Krach. Signore Calori ist nicht mehr der Jüngste, und wäre es an ihm, so würde er den Abend geruhsam mit einem Buch verbringen. Schließlich wird er bald seine Verwaltungsstelle an der Universität von Bologna antreten, und da gilt es, auf alles vorbereitet zu sein, sonst werden sich seine zukünftigen Kollegen, Professoren an der ältesten Universität Europas, gewiss lustig über ihn machen, den zugereisten Mailänder. Aber er hatte seiner jungen Frau versprochen, einmal mit ihr ins Theater zu gehen, ehe sie Venedig wieder verlassen. Sie hat es sich so sehr gewünscht. Außerdem ist er in der Stimmung, großzügig zu sein: Gerade erst hat sie ihm mitgeteilt, dass sie erneut ein Kind erwartet. Einen Sohn nach der Tochter, dessen ist sich Signore Calori gewiss, einen Sohn, um den Namen Calori in der Welt fortzuführen. Doch wenn sie erst in Bologna eingetroffen sind, wird seine Gattin sich bald nicht mehr auf Gesellschaften blicken lassen können, wo Musik vorgeführt, getanzt und gespielt wird. Ein Abend in einem venezianischen Theater ist ihr deswegen mehr als nur zu gönnen.
Dennoch hat er ein Auge auf sie, während er sich mit ihr durch die Menge drängt. Viele der Venezianer scheinen ihm doch zu fingerfertig zu sein, und sie tragen fast alle Masken, obwohl es doch Oktober ist. »Bei uns in Venedig, Dottore«, hat der Herbergswirt ihm mitgeteilt, »herrscht das halbe Jahr über Karneval.« Unter einer solchen Maske lässt sich nicht erkennen, ob jemand ehrsam oder lüstern dreinschaut, ja, ob er Mann oder Frau ist. Es ist alles ein wenig beunruhigend für einen ehrsamen Mailänder, doch Calori hofft, dass die Venezianer sich trotzdem nicht zu viel bei seiner Lucia herausnehmen werden. Nicht nur, weil sie unübersehbar in seiner Begleitung ist, sondern auch, weil sie ihre kleine Tochter an der Hand führt. Deutlicher kann man gar nicht machen, dass es sich bei Lucia Calori um eine ehrbare Ehefrau handelt. Er hat schon gewusst, warum er darauf bestanden hat, das Kind mitzunehmen, statt es mit einer Kinderfrau in der Herberge zu lassen.
Seine kleine Tochter Angiola schaut sich mit Augen um, die so groß und geweitet sind wie die ihrer Mutter. Sie ist bereits sechs Jahre alt, was bedeutet, dass sie, anders als die Hälfte aller Geborenen, ihre Kindheit wohl überleben wird. Dottore Calori kann es sich deshalb gestatten, Zuneigung für sie zu entwickeln und Hoffnungen zu hegen. Sie hat eine rasche Auffassungsgabe, seine Angiola, plappert gerne darauflos und zeigt hierhin und dorthin. Einmal hat sie ihn schrecklich zum Lachen gebracht, als sie in Mailand einen österreichischen Soldaten imitierte, wie er mit wichtigem Gehabe durch die Gassen schritt, Tabak schnupfte und, nachdem er niesen musste, das deutsche Wort Gesundheit sagte, was Angiola garantiert nicht verstand und trotzdem richtig aussprach. Wenn sie klug ist, wird sie vielleicht Nonne werden. Ein Kind in der Kirche, das verschafft Ansehen, aber ihr zukünftiger Bruder wird natürlich im weltlichen Stand bleiben.
Angiola ist nicht das einzige Kind im Theater. Einige der kleinen Verkäufer, die Mandeln, Fächer und Orangen feilbieten, sind nicht älter als sie, und auch andere Familienväter scheinen ihren Nachwuchs mitgebracht zu haben. Zumindest nimmt Calori das an, bis ihm auffällt, dass ein hübsches Ding, das bestimmt nicht älter als elf Jahre alt sein kann und doch bereits Rot auf den Lippen und das Haar mit Schleifen hochgebunden und gepudert trägt, von dem Mann an seiner Seite höchst unväterlich am Hintern begrabscht wird. Er presst die Lippen zusammen und wendet sich hastig ab.
Mittlerweile haben er und seine Familie sich erfolgreich an den Spieltischen mit ihren klappernden Würfeln und den rauschenden Karten vorbeigedrängt, die Treppen zu den Rängen erklommen und die Loge gefunden, die ihnen der Herbergswirt bezeichnet hatte und für die sie bezahlt hatten. Eigentlich war er der Ansicht gewesen, dass weiterhin kein Geld aufzuwenden gewesen wäre, zumal der Herbergswirt ihnen unverschämterweise für seine zwei kleinen Räume eine halbe Zechine pro Woche berechnet hatte. Doch der Wegweiser, der Türaufschließer der Loge, ein weiterer, der weiche Polster bringt, der Nächste für sein Programm, jeder verlangt ein Trinkgeld, und wehe, es erscheint ihm nicht hoch genug. Ihre schimpfenden Stimmen vermischen sich, obwohl die Vorführung schon läuft, mit denen all der Bediensteten, welche Erfrischungen und Speisen in jeder nur denkbaren Form anbieten. Wie sich herausstellt, teilen sie die Loge mit einem Mann und zwei Damen, der sich als Bäcker bezeichnet und mit seiner Frau und deren Schwester da ist, auch wenn man nicht leicht unterscheiden kann, wen der Mann als Schwägerin und wen als Gattin behandelt. Andererseits dankt Calori dem Himmel, dass er die Loge nicht mit einer der vielen Kurtisanen teilen muss, die, wie man sich in Mailand erzählt, fast ein Fünftel der Stadtbevölkerung stellen.
»Zanetta spielt heute«, sagt die mutmaßliche Schwägerin mit atemlosem Kichern, »sie sieht phantastisch aus und singt großartig, man muss sie einfach gernhaben. Ist sie nicht wunderbar?«
Caloris eigene Gemahlin kämpft sichtlich damit, nicht zugeben zu wollen, dass sie keine Ahnung hat, wer »Zanetta« ist, jedoch für Auskünfte dankbar wäre, und weil er selbst in der Unwissenheit über irgendwelche venezianischen Komödiantinnen keine Schande sieht, erspart er ihr weiteren inneren Zwiespalt und fragt.
Zanetta, so stellt sich heraus, ist als singende Komödiantin schon so berühmt, dass sie gerade erst aus London zurückgekehrt ist, wo sie und die Truppe, die gerade eben die Bühne betritt, vor den Engländern gespielt haben, welche doch kein Wort der venezianischen Mundart verstehen. Ein Komödiendichter namens Goldoni habe eigens für sie ein Stück geschrieben, um sie wieder in Venedig willkommen zu heißen.
»Der edle Grimani wird’s schon bezahlen«, kommentiert der Bäcker mit einem Grinsen, und seine Begleiterinnen schnalzen mit den Zungen und kichern erneut. Auf diese Weise erfährt Calori, dass dieses Theater sich im Besitz eines venezianischen Senators namens Grimani befindet. Venedig wird immer verwirrender. In Mailand weiß man, dass kaum jemand hochmütiger ist und sich für etwas bedeutend Besseres hält als ein venezianischer Patrizier. »Die glauben sogar, sie scheißen golden«, hatte Caloris bester Freund einmal drastisch, aber bestimmt nicht übertrieben festgestellt. Wie vereinbart sich so ein Selbstbild bloß damit, so etwas Gewöhnliches wie ein Theater zu unterhalten?
»Wie darf ich das verstehen?«
Der Bäcker wirft ihm einen Blick zu, als habe Calori gerade eine ungeheuer dumme Frage gestellt, halb Spott, halb Mitleid in seinen Augen. Caloris Gattin räuspert sich. Die beiden Begleiterinnen des Bäckers kichern nicht mehr, sie lachen. Calori wird heiß unter dem Kragen. Er ist ein zukünftiger Beamter der Universität von Bologna, zum Teufel, kein Bauerntölpel!
»Ein Theater bedeutet auch Einnahmen und kommt daher viel billiger, als Mätressen von Rang für seinen guten Ruf auszuführen. Außerdem sagt man den Grimanis nach, wenigstens einer von ihnen hätte der Zanetta ein Kind gemacht«, stellt der Bäcker ganz sachlich fest. Calori beginnt zu bereuen, dass er seine Frau und seine unschuldige Tochter hierhergebracht hat. Wenigstens macht Angiola den Eindruck, nicht im Geringsten zu verstehen, von was die Erwachsenen da gerade reden. Stattdessen starrt sie wie gebannt auf die Bühne, wo unter großem Applaus eine Frau mit silber glänzendem kurzem Kleid, das ihre Knöchel noch sehen lässt, sich unter die übrigen Darsteller mischt. Die Schauspielerin wirbelt umher, scherzt mit dem Mann im Harlekinkostüm, dann, als sie ein paar Zurufe aus dem Publikum bekommt, mit zweien der Männer, die aufgestanden waren, obwohl das doch gewiss nicht zum Stück gehört, und beginnt, ein Lied zu trällern, was die beifälligen Zurufe des Publikums immerhin so weit zum Schweigen bringt, dass man die Sängerin nun selbst auf den Rängen verstehen kann.
Calori lebt wahrlich nicht nur für die Verwaltung und die Bücher, er schätzt auch die Musik, und in Momenten außergewöhnlich guter Laune summt er selbst mal ein Liedchen. Deswegen ist er bereit zuzugeben, dass die Komödiantin da unten nicht nur schön aussieht, sondern auch eine recht gute Stimme hat. Aber er findet es doch übertrieben, dass seine kleine Tochter sie anstarrt, als wäre sie ein fleischgewordenes Wunder, zumal wenn sich jenes Weib das glitzerende Halsband garantiert nicht durch seine, wie er weiß, schlecht bezahlte Darstellerkunst, sondern bestimmt über die Gunst eines reichen Mannes verdient hat. Angiola ist noch zu jung, um ihr das jetzt zu erklären und ihr die Augen über die Schlechtigkeit in der Welt zu öffnen.
»Ist sie ein Engel?«, fragt Caloris kleine Tochter ehrfurchtsvoll, und ehe er seine Beherrschung verlieren kann, erwidert seine Gemahlin rasch: »Aber nein, mein Schatz, wie kommst du denn darauf?«
Angiola deutet in die Höhe, und erst jetzt fällt Calori auf, dass die Decke des Theaters bemalt ist, mit goldenen Sternen auf einem dunkelblauen Grund.
»Das ist doch der Himmel«, sagt Angiola ernsthaft, »und sie klingt so herrlich.«
»In den Himmel kommst du erst, wenn du tot bist, Kleine«, sagt die Bäckersfrau freundlich. »Hier wird nur so getan, als ob.« Sie deutet auf die Komödiantin, die sich mit dem Ende ihres Lieds dem Harlekin entzieht, ehe er ihr einen Kuss rauben kann, nicht jedoch, ohne ihn mit ihrem Fächer neckend auf die Schulter zu klopfen. »Und unsere Zanetta dort unten ist eine Frau gerade so wie wir und deine Mama. Sie hat auch Kinder, ganz wie du eins bist, vier oder fünf sogar.«
»Wie schafft sie das bei einer so schmalen Taille?«, fragt Caloris Gattin beeindruckt und hoffnungsvoll, die Hand auf ihren eigenen Leib legend, wo, wie ihr Mann hofft, nunmehr sein Sohn heranwächst. Plötzlich stellt er sich seine Lucia vor, wie sie im kurzen Kleid und einem ähnlich offenherzigen Ausschnitt unter den Blicken fremder Männer auf der Bühne herumwirbelt, und ist zutiefst entsetzt und, wie er sich gestehen muss, ein ganz klein wenig erregt, weil er so ein Bild schon einmal in einem seiner Träume erlebt hatte. Zumindest weist der Umstand, dass ihm die Hose gerade etwas eng wird, darauf hin. Er versucht, nicht an die gelegentlich geschlossenen Vorhänge der Logen und die Liegen darin zu denken, die er im Vorbeigehen gesehen hatte, verbunden mit eindeutigen Geräuschen.
Er hat nur deswegen den Weg über Venedig genommen, um einem Onkel, der bald dahinscheiden und ihn hoffentlich in seinem Testament bedenken wird, seine Aufwartung zu machen. Das ist geschehen, und nun wird die Familie Calori nach Bologna weiterziehen und dort das gleiche ehrsame Beamtenleben führen, wie sie es in Mailand getan hat. Seine Gattin wird dann eine der angesehenen Damen der Stadt werden, wie es sich gehört.
»Eine Frau und Mutter«, sagt Calori missbilligend, »sollte sich nicht so zeigen.«
Der Bäcker zuckt die Achseln. »Das findet ihr Gatte nicht. Und wen wundert’s? Der Casanova ist als Schauspieler längst nicht so beliebt wie sie. Er ist nur bei der Truppe, weil sie so großen Erfolg hat. Sie ist’s, die fast allein das Geld verdient.« Er kneift seine Schwägerin in die Wange und streckt gleichzeitig die andere Hand aus, um seiner Gemahlin den Hintern zu tätscheln. »Mir wär das auch recht. Vorige Woche hat sie durch ihre Geistesgegenwart sogar eine neue Komödie gerettet. Sie spielte eine Witwe. Die ganze Handlung war langweilig. Irgenwann rief jemand ihr zu: ›Für die Rolle hast du doch gar keine Erfahrung, Zanetta. Wie viele Ehemänner hast du denn schon gehabt?‹ Sie schrie zurück: ›Der Raum hier würde vielleicht gerade dafür reichen, um sie unterzubringen.‹ Dann lachte sie über die vielen Ohs, die aus dem Publikum kamen, und fügte unter dem gewaltig aufbrausenden Gelächter hinzu: ›Ach, du meintest meine eigenen Ehemänner; davon habe ich bisher nur einen.‹ Die Vorstellung war gerettet, aber so ist sie, unsere Zanetta.«
Genug ist genug, denkt Calori und teilt seiner Gattin mit, man habe morgen eine lange Reise vor sich und müsse sich daher für die Nacht zurückziehen. Auf der Bühne hat inzwischen ein Duell angefangen, das von den Zuschauern mit Warnrufen und Beifall begleitet wird.
»Aber …«
»Basta«, donnert er, obwohl er nicht umhinkann, ein gewisses Schuldbewusstsein zu empfinden, als Lucia nun große Tränen die Wangen herunterrollen. Sie ist eben noch sehr jung, seine Frau. Man muss Nachsicht mit ihr haben. Aber man darf sie auch nicht zu vielen schlechten Einflüssen aussetzen.
Wie gefährlich die schlechten Einflüsse sind, zeigt sich, als sein Blick seine Tochter sucht und sie nicht findet. Calori springt auf und besteht darauf, umgehend unter alle Stühle zu blicken, doch Angiola ist nicht mehr in der Loge.
Angiola ist fasziniert von dem Besuch in Venedig. Sie hat noch nie eine Stadt gesehen, wo die Straßen aus Wasser sind und nicht Kutschen, sondern Gondeln von Haus zu Haus benutzt werden. Die Gondelfahrt, den großen Kanal hinunter, war wie ein Vorbeigleiten an lauter Königsschlössern. Wenn einmal ein Fensterladen kurz zum Lüften geöffnet wurde, blitzte es wie Gold und Silber aus den Zimmern heraus. Schade, dass die Gondelfahrt dann so schnell zu Ende war. Sie hofft auf weitere und auf einen erneuten Besuch des Platzes, wo ihre Eltern mit ihr aus dem Schiff, das sie nach Venedig gebracht hatte, ausgestiegen waren; der Platz vor der großen Kathedrale, auf dem sich Menschen in prächtigen Kleidern tummelten, die häufig Masken trugen, genau wie die Theaterbesucher jetzt. Zu gerne hätte sie auch eine gehabt, denn so viele der Besucher hier bedecken damit ihr Gesicht oder doch zumindest die Augen. Was sie dann auf der Bühne sieht, sind Bilder wie aus einem der Märchen, die ihre Mama gelegentlich erzählt. Nur wäre es zu schön, auch alles zu verstehen, was bei dem vorhandenen Lärm aber unmöglich ist. Die Diskussion ihres Vaters mit dem Bäcker verschafft ihr überraschend die Gelegenheit, aus der Tür zu schlüpfen und sich einen Weg zur Bühne zu suchen. Bei den Sitzen ganz unten, bei den Musikern, hat sie einen Jungen erspäht und diesen um seinen Platz beneidet. Dort strebt sie hin.
All die ausladenden Röcke und Überröcke, an denen sie sich vorbeidrängen muss, ersticken sie beinahe, doch sie erreicht ihr Ziel. Außer Atem lehnt sie sich an die vor der Bühne befindlichen Balustraden, als ihr einige Nussschalen auf den Kopf fallen. Mitleidig zieht der Junge sie zu sich, wo er, offenbar in einem toten Winkel für solche Attacken, den Platz eingenommen hat. Von dort bemerkt sie, dass es für die Leute hier unten nicht ungewöhnlich ist, von oben etwas abzubekommen. Ein nicht weit von ihr entfernt sitzender Mann hat wohl gerade etwas Feuchtes im Nacken gespürt und schimpft laut wie ein Marktschreier auf den Schuft, der seinen Kautabak einfach hinuntergespuckt hat. Wäre es für sie wichtig, Schimpfworte zu lernen, dann wäre hier der ideale Platz dafür.
»Ich heiße Angiola, und du?«, spricht sie den Jungen stattdessen an und wundert sich, als sie keine Antwort bekommt. Ihr Helfer schaut auf die Bühne, wo die Frau, welche als Zanetta bezeichnet wird, gerade mit einigen anderen Frauen tanzt. Erstaunlicherweise hat der Tanz zu mehr Stille im Haus geführt als die Lieder vorhin, um die zu hören sie eigentlich herabgekommen ist. Die Leute starren die Frauen an, vergessen teilweise sogar das Kauen und klatschen zum Ende des Tanzes so, wie Angiola es vorher bei den Sängern und Sängerinnen nie gehört hat.
Dem Jungen neben ihr muss ihr etwas fassungsloser Blick aufgefallen sein. »Die Leute kommen zum Schauen her, nicht zum Hören«, meint er, was ihr aber keine wirkliche Erklärung ist. Er kann also doch sprechen! Ein hagerer Junge, der nicht so viel älter als sie sein kann, mit komischen Augenbrauen und einer laufenden Nase; seine Stimme klingt etwas heiser. Vielleicht ist er erkältet. Auf jeden Fall sagt er nicht mehr, und auf der Bühne wird geredet, nicht mehr getanzt oder gesungen. Da Angiola nicht weiß, wann es wieder Gesangsdarbietungen gibt, schaut sie ins Publikum, und es wird ihr mit einem Schlag bewusst, dass ihre Eltern sich bestimmt Sorgen um sie machen. Sie dreht sich um, sucht mit ihren Augen die Loge zu finden, wo ihre Eltern sitzen, entdeckt aber weder den Platz noch ein ihr bekanntes Gesicht. Sie spürt ein Stechen in den Augen und zieht die Nase hoch, um nicht vor all den fremden Leuten in Tränen auszubrechen. Das erregt die Aufmerksamkeit des Jungen. Er macht ein weiteres Mal den Mund auf und sagt: »Komm, ich helfe dir, deine Eltern zu finden.«
Erleichtert erzählt sie ihm, dass sie bestimmt zwei Treppen hinuntergestiegen ist und oben die Loge schon finden würde. Sicherheitshalber packt sie ihn aber am Arm und lässt sich von ihm zu einer Tür ziehen, wo die Treppen beginnen.
Die Türen der Logen gleichen einander von außen wie ein Ei dem anderen. Nun ist sie sich nicht mehr sicher, wo sie hergekommen ist. »Dann probieren wir es einfach aus«, ist die Empfehlung des Jungen, und er drückt die nächstbeste Klinke herunter.
Angiola will schon hineingehen, als sie fast zu Eis erstarrt. Auf einer Bank kniet eine Nonne, zeigt einem hinter ihr stehenden Mann in einem Harlekin-Kostüm ihren nackten Hintern und lässt sich ihre Pobacken von ihm betasten. Dass beide Masken vor ihrem Gesicht haben, macht das Bild noch bizarrer.
»Aber wieso spielen die beiden hier Doktor?«, will sie wissen und zeigt damit, dass ihr so etwas unter Kindern nicht ganz fremd ist.
Der Junge schließt die Tür, obwohl sich die beiden Erwachsenen weder von ihren Blicken noch von ihrer Frage hatten stören lassen, und erwidert, ihr zugewandt: »Dummkopf, die spielen Liebeln, nicht Doktor.«
»Aber das war eine Nonne, und die beiden hatten Masken auf«, argumentiert sie, weil sie keinesfalls zugeben will, dass sie nicht weiß, wie das Spiel Liebeln geht.
»Das war bloß eine Frau im Nonnenkostüm, obwohl es hier in den Logen oft die Hälfte der Nonnen vom Kloster der Heiligen Jungfrau geben soll, sagt mein Vater. Aber die ziehen sich anders an. Und was die Masken betrifft, meine Mutter sagt, durch die Maske zeigt man ein Geheimnis und wird so immer umworben, weil jeden Mann das Geheimnisvolle reizt«, erklärt er ihr, als wäre es das Normalste von der Welt. Mit jedem Wort klingt seine Stimme weniger heiser und mehr, als wüsste er tatsächlich, wovon er redet, obwohl er doch nur wiederholt, was die Erwachsenen ihm erzählt haben. Der belehrende Tonfall macht das, entscheidet Angiola und merkt es sich, denn erwachsen klingen will sie auch, und der Junge kann höchstens acht Jahre alt sein, mehr nicht.
Seine Erklärungen ergeben für sie nicht viel Sinn, aber das gibt sie nicht zu. Andererseits ist sie von Natur aus neugierig, also fragt sie zurück, was er mit »reizen« meint. Ein einziges Wort kann man hinterfragen, ohne als dumm dazustehen, findet sie.
»Meine Mutter sagt«, fängt er wieder mit den gleichen Worten an, »wenn Menschen Masken tragen, seien sie sich sicher, über nichts erröten zu müssen, wären freier, und das würde Mann und Frau schneller zusammenführen als alle Begegnungen in der Kirche oder woanders. Außerdem wäre liebeln mit fremden Kavalieren, die schnell wieder gehen, einfacher als mit bekannten Leuten.« Je länger der Satz wird, umso unsicherer wird nun aber seine Stimme, und er macht irgendwie doch den Eindruck, als verstünde er nicht mehr ganz genau, was er ihr da sagt.
Ehe Angiola hier einhaken kann, hören sie die schreiende Stimme ihres Vaters und darin ihren Namen.
»Meine Tochter!«, lamentiert Lucia auf dem Gang zwischen den Spieltischen, wo sie bisher vergeblich nach Angiola gesucht haben. Calori fragt sich, ob Gott ihm etwas über das Theater als solches und den Besuch desselben sagen will. Er könnte jetzt bereits im Bett liegen, ohne weitere Sorgen als die, ob die Flohstiche, die er sich hier in Venedig eingefangen hat, schlimmer sind als die aus Mailand. Dann stellt er sich vor, Angiola bliebe verschwunden, gerade jetzt, wo er sich daran gewöhnt hat, eine überlebende Tochter zu haben, und obwohl der Tod der meisten Kinder, die auf dieser Welt geboren werden, Gottes Wille ist, trifft ihn die Vorstellung unerwartet heftig. Als ein maskierter Galan es wagt, der weinenden Lucia ein Taschentuch anzubieten, nutzt Calori das, um seiner schlechten Stimmung Ausdruck zu verleihen, und zwar durch einen heftigen Stoß gegen die Brust des Frechlings.
»Halte dich von anständigen Frauen fern, Bube!«
Leider handelt es sich bei der Maske um einen kräftigen Mann und bei Calori um einen gesetzten Beamten von zweiundvierzig Jahren mit einem kleinen Bäuchlein, der gewohnt ist, Papiere zu bewegen, keine schweren Sachen, so dass die Angelegenheit nicht gut für ihn ausgehen kann. Der Mann stößt ihn ebenfalls, Calori wankt, stürzt zu Boden, und der Frechling sowie alle Umstehenden brechen in Gelächter aus.
»Heilige Mutter Anna, heiliger Josef«, schluchzt Lucia, während alles in Calori rast und brennt.
»Papa?«, piepst eine Stimme, und da steht sie, seine Tochter, mit einem Bengel an ihrer Seite. Calori ist zu erbittert, um erleichtert zu sein, und rappelt sich auf, wütend die helfenden Hände seiner Frau abwehrend.
»Der Junge hat Nasenbluten«, sagt Angiola, und in der Tat, Blut tropft aus der Nase des neben ihr stehenden Bengels. »Das war ich nicht«, fügt sie hastig hinzu, wohl wegen Caloris düsterer Miene. »Die hat ganz von allein das Bluten angefangen.«
Der Junge bleibt stumm. Er hält nun eine Hand auf, wohl, um eine Belohnung zu empfangen. Als Calori grimmig nach seiner Börse tastet, stellt sich heraus, dass sie verschwunden ist. Genau wie der maskierte Mann, der erst Lucia ein Taschentuch angeboten und ihn dann zu Boden gestoßen hat.
Gott will Calori heute wirklich etwas über Theaterbesuche sagen, da ist er sich nun sicher.
»Dass ich dich wiederhabe, mein Schatz«, ruft Lucia aus, während Calori noch vergeblich auf dem Boden sucht, ob vielleicht irgendwo der Geldbeutel liegen könnte. Sie umarmt Angiola, die sich das Taschentuch schnappt, das ihre Mutter noch immer wie vergessen in der linken Hand hält, und es dem Jungen gegen die Nase drückt.
»Leg den Kopf zurück, dann wird es besser«, sagt sie dabei, und unter anderen Umständen wäre Calori ein wenig stolz, denn gerade dies hat er selbst erst vor zwei Tagen seinem Erbonkel beim nämlichen Leiden geraten. Offenbar hatte ihn seine kleine Tochter genau beobachtet und zugehört. Aber an diesem Unglücksabend ist er nicht in der Stimmung für väterlichen Stolz. Er will nur noch fort von hier, ehe sich weitere Katastrophen ereignen, und presst diese Worte heraus, während er Lucia und Angiola am Arm ergreift.
Der Junge macht eine enttäuschte Miene, und Calori richtet sich auf lautstarken Protest ein, wie der von allen anderen, die meinten, das Trinkgeld, das er hier im Theater gegeben hatte, habe nicht ausgereicht, aber der Kleine sagt nichts. Am Ende ist das Kind stumm. Nun, ihm kann es gleich sein. Calori drängt seine kleine Familie in Richtung Ausgang.
»Wie heißt du?«, ruft Angiola und zieht in die andere Richtung, als habe sie heute noch nicht genug mit ihrem Eigenwillen angerichtet. Der Junge erwidert nichts, sondern grinst und macht mit immer noch tropfender Nase und blutbeflecktem Taschentuch eine Verbeugung.
»Das ist Zanettas Ältester«, sagt ein Limonadenverkäufer, der zwischen den Spieltischen im Foyer hin und her eilt. »Ein Schwachkopf, der den Mund nicht aufkriegt.« Und an den Jungen gerichtet, fügt er hinzu: »Du solltest doch Wachs für die Ohren deines Vaters holen, Giacomo, was tust du noch hier?«
Der Junge zuckt die Achseln, dreht sich um und verschwindet in Richtung Treppenaufgang. Angiola ruft ihm »Addio, Giacomo« hinterher und lässt sich endlich mit ihrer Mutter aus dem Theater drängen.
Das, schwört sich Calori, war das letzte Mal, dass er und seine Familie ihre Zeit auch nur in der Nähe einer Bühne verbracht haben.
Großes Jubiläumsgewinnspiel
Jetzt nach den Sternen greifen und gewinnen!
Wir verlosen 1 Volkswagen up!, 5 Sony-Ebook-Reader
und Buch-Sofortgewinne im Wert von 500,- €.
http://www.knaur.de/e50
I
Angiola
Der jüdische Bezirk lag nicht weit vom Universitätsviertel entfernt, aber die Gassen waren viel, viel enger, fand Angiola, während sie sich ihren Weg durch die Via dell’ Inferno bahnte. Die Juden durften keine neuen Häuser bauen oder sich außerhalb des Ghettos Ebraico ansiedeln. Daher drängten sich mehr Menschen auf kleinem Raum als in jedem anderen Teil Bolognas. Nirgendwo gab es Arkaden, die vor Sonne und Regen schützten, wie sonst überall in der Stadt. Angiola war nicht groß für ihre fast dreizehn Jahre, und es fiel ihr nicht leicht, sich mit ihrer Bürde einen Weg durch die Menge zu bahnen. Ihre Mutter, die lieber gestorben wäre, als die Nachbarn wissen zu lassen, dass sie die Dienste eines jüdischen Pfandleihers in Anspruch nahm, der zu nur fünf Prozent lieh, hatte ihr einen viel größeren Korb gegeben, als nötig gewesen wäre, um den Atlasrock und die Samthose von Angiolas verstorbenem Vater darin zu verbergen. »Ich habe das gute Kind losgeschickt, um den Schwestern in San Giobbe Brot und Wein zu bringen«, hatte sie gezwitschert, als die neugierige Ceccha von nebenan sich zum Fenster hinauslehnte und ostentativ grüßte, während Angiola das Haus verließ. Ob die Nachbarin ihr das abgenommen hatte, blieb dahingestellt.
Als Frau eines Universitätsbeamten war Lucia Calori angesehen gewesen, und das wollte sie nicht aufgeben. Sie wollte auch Bologna nicht verlassen oder in einem anderen Stadtteil eine billigere Wohnung nehmen. Also blieb nur, Stück für Stück zu versetzen, möglichst ohne dass es jemand merkte, nachdem das erwartete Erbe des Onkels aus Venedig ausgeblieben war, und darauf zu hoffen, dass die Universität von Bologna nicht zu schnell versuchte, einen anderen Beamten in ihrem gemieteten Haus unterzubringen. Bis dahin musste sie nach ehrlichen Untermietern Ausschau halten. Der erste Mann, dem Angiolas Mutter zwei Zimmer vermietete, hatte sich zwar als reicher Weinhändler ausgegeben, war aber nach einem Monat verschwunden, ohne einen einzigen Soldi Miete bezahlt zu haben. Und das auch nicht, ohne die kostbare Taschenuhr von Angiolas Vater mitgehen zu lassen. Es war ein bitteres Lehrgeld dafür gewesen, unbekannten Mietern zu vertrauen.
Jetzt behauptete Angiolas Mutter natürlich, sie habe den angeblichen Weinhändler nie gemocht, doch Angiola wusste, dass dies nicht stimmte. Lucia hatte sich von dem Mann mehrfach trösten lassen, wenn der Gedanke an ihren Witwenstand sie in Tränen versetzte, und ihn wiederholt zum Essen eingeladen, nachdem sie ihre Tochter sehr früh ins Bett geschickt hatte. Deswegen hatte er die Uhr überhaupt stehlen können, da sie im Schlafzimmer in einer Schublade lag. Es war wohl so, dachte Angiola, dass man nicht unbedingt in einem Theater sein musste, um vorzugeben, jemand anderer zu sein, als man war. Wenn das der Vater gewusst hätte, dann hätte er ihr und der Mutter nicht ständig untersagt, den Straßenkomödianten zuzuschauen. Angiola vermisste ihren Papa, und wenn man die Mutter jetzt hörte, dann war der verstorbene Dottore Calori der beste aller Männer gewesen, ohne Fehl und Tadel, der Weib und Kind auf Händen getragen hatte. Aber das stimmte so nicht. Für jeden guten Tag, an dem der Vater sie in die Nase gezwickt und ihr von den Straßenverkäufern verzuckertes Mandelwerk mitgebracht hatte, hatte es auch einen schlechten gegeben. Dann warf er der Mutter vor, eine schlechte Hauswirtschafterin zu sein und durch ihre Tanzlust ihre ständigen Fehlgeburten verursacht zu haben, und versetzte seiner Tochter Ohrfeigen, nur weil er sie dabei ertappte, wie sie Lieder schmetterte, die sie irgendwo auf den Straßen gehört hatte, was oft genug vorkam.
Angiola blinzelte ein paar Tränen weg und hob eine Schulter, um sich die Nase abzuwischen. Wenn sie ihren Korb jetzt absetzte, um die Hände zu gebrauchen, würde er in der wogenden Menge gewiss gestohlen werden. Und sie brauchten das Geld, unbedingt.
Die Häuser im Ghetto waren genauso rot und gelb bemalt wie anderswo in Bologna, aber an vielen Türen erkannte sie Spählöcher, und das war ungewöhnlich. Die Leute hier mussten sehr misstrauisch sein. Auch die Tür des Hauses mit der Nummer, die ihre Mutter ihr eingeprägt hatte, besaß so ein Spähloch. Als sie den bronzenen Türöffner betätigte, um gegen das Holz der Pforte zu schlagen, glaubte Angiola bald zu spüren, wie sie jemand beobachtete.
»Worum geht es, meine Kleine?«, fragte eine männliche Stimme von drinnen. Angiola räusperte sich und gab zurück, sie komme auf den Rat von Moise, dem Apotheker. Sie hatte ihrer Mutter versprechen müssen, auf offener Straße auf keinen Fall den Namen Calori laut zu nennen, und der Apotheker, der oft genug mit ihrem Vater gesprochen hatte, war in der Tat derjenige gewesen, der Lucia die Pfandleihe empfohlen hatte.
Als sich die Tür öffnete, war der Mann dahinter keineswegs schwarzbärtig und unheimlich, wie sich Angiola einen jüdischen Pfandleiher vorgestellt hatte. Nein, der Mann vor ihr war rotblond und trug die Haare sogar gepudert, wie es der falsche Weinhändler auch getan hatte.
»Dann kommen Sie herein, Signorina«, sagte er freundlich.
In dem Zimmer, in das er sie führte, saß eine strickende Frau, und Angiola war der Ansicht, dass sie nun genug Vorsicht hatte walten lassen. Sie packte den schönen gelben Atlasrock aus, den sich der Vater an Festtagen übergeworfen hatte, und seine braunen Samthosen, die zwar etwas abgewetzt waren, aber dafür keine Flecken hatten.
»Ja«, sagte der Pfandleiher Giuseppe, »das kann ich für Ihre Mutter notfalls verkaufen, aber des altmodischen Schnittes wegen werden sich kaum mehr als dreißig Lira dafür erhandeln lassen.«
»Meine Mutter will dreieinhalb Zechinen dafür haben«, sagte Angiola empört, wobei sie die Zahl etwas höher ansetzte, weil sie wusste, dass in Bologna die Zechine nur siebzehn Lire hatte. Drei Zechinen, hatte Lucia gesagt. Aber Angiola hatte oft genug Leute auf dem Marktplatz beobachtet, um zu wissen, dass man niemals auf das erste Angebot eingehen durfte und immer einen höheren Preis nennen musste, als man letztlich erwartete.
»Das ist zu viel«, entgegnete Giuseppe kopfschüttelnd. »Niemand trägt mehr so weite Hosen.«
»Aber Dottore Moise hat gesagt, Sie wären gut in Ihrem Geschäft. Dreißig Lire könnten wir selbst bekommen«, behauptete Angiola und ahmte den falschen Weinhändler nach, wie er, das erste Mal um Miete gebeten, erklärte, die Nachbarin Ceccha habe ihm ein wesentlich günstigeres Angebot und drei Zimmer offeriert.
Die Mundwinkel des Pfandleihers zuckten. »Nun, vielleicht kann ich den Preis auf zweieinhalb Zechinen hochtreiben. Mit sehr viel Glück.«
»Mit Glück könnten Sie dreieinhalb bekommen«, beharrte Angiola. »Ohne Glück drei. Aber das ist ein venezianischer Atlasrock, und jeder weiß, dass die schönsten Moden immer aus Venedig kommen. Mein Papa hat ihn für viel, viel mehr Geld gekauft, das weiß ich bestimmt. Und er hat überhaupt nur zweihundertfünfzig Zechinen im Jahr verdient! Sich so einen feinen Atlasrock zu kaufen war ein großer Luxus für ihn!«
Am Ende versprach ihr der Pfandleiher drei Zechinen, und Angiola verließ glücklich das Haus. Inzwischen hatten sich die grauen Wolken am Himmel verdichtet, und als es zu regnen begann, konnte sie kaum noch den größeren der beiden gewaltig aussehenden Türme ausmachen, die man tagsüber im Ghetto selbst noch in der engsten Gasse erspähen konnte. Vielleicht sollte sie den Pfandleiher fragen, ob sie bei ihm warten könne, bis der Regen vorbei war. Aber sie wusste, dass ihre Mutter sich große Sorgen machte, sowohl des Geldes als auch Angiolas wegen. Erst heute früh hatte die Nachbarin gemeint, Angiola sei nun zu alt, um ohne Begleitung durch die Stadt zu laufen. Es verletze die Schicklichkeit. Lucias Einwand, ihre Tochter blute noch nicht und sei daher noch ein Kind, hatte nur ein Naserümpfen bei der Ceccha ausgelöst.
Also lief sie, so schnell es eben ging, und rutschte nur einmal aus. Ihr Kleid war aus Leinen, und der Schmutzfleck über dem Knie würde sich waschen lassen. So wie es regnete, war der Dreck bei ihrer Ankunft daheim bereits halb fortgespült, hoffte Angiola.
Als sie die zu den Hauptgebäuden der Universität führende Straße erreicht hatte, gab es auch wieder Arkaden an den Fassaden, aber es hatten sich so viele Leute dort untergestellt, dass es sich schneller auf den Straßen lief. Angiola wich einer vorbeifahrenden Kutsche aus und wäre beinahe an der Seitenstraße vorbeigelaufen, die zu ihrem Haus führte. Mittlerweile hingen ihr die Zöpfe wie nasse Taue über die Schultern, und sie fühlte sich wie eine dem Kanal entschlüpfte Ratte.
Sie bereitete sich darauf vor, sehr laut an die Tür pochen zu müssen, damit ihre Mutter sie bei dem prasselnden Regen überhaupt hörte, doch zu ihrer Überraschung stand eine der kleinen Sänften vor der Tür, wie sie in Bologna eigentlich nur die Patrizier benutzten. Die beiden Sänftenträger trugen nicht die Livree einer der großen Familien, was bedeutete, dass jemand sie gemietet haben musste. Außerdem war die Tür nur angelehnt.
Sie trat ein und stellte ihren leeren Korb ab. Dann zog sie ihre nassen Schuhe aus und war noch dabei, sie auf das Eisengestell zum Trocknen zu stellen, als ihre Mutter mit einem Fremden die Treppe herunterkam. Angiola blieb der Mund offen. Der Mann war sehr hoch gewachsen, größer als jeder andere, den sie bisher gesehen hatte, und wenn sonst große Männer lange Beine und einen kurzen Oberkörper hatten, so war bei diesem Mann auch ein langer Torso zu erkennen. Er wirkte sehr breit um die Schultern, wobei er sonst schlank gewachsen schien. Er trug einen eleganten roten Seidenrock, der denjenigen, den sie gerade beim Pfandleiher gelassen hatte, wirklich altmodisch aussehen ließ, und eine Perücke, was ebenfalls für Wohlstand sprach. Als er den Mund öffnete, erwartete sie seines großen Brustkorbs wegen unwillkürlich eine tiefe Stimme. So trafen seine ersten Worte sie völlig unvorbereitet, in einer Tonlage, die höher war als die ihrer Mutter.
»Aber wen haben wir denn da?«, fragte der Fremde und musterte sie.
»Das ist meine Tochter Angiola, Signore«, erklärte ihre Mutter hastig. »Es stört Sie doch gewiss nicht, in einem Haus mit einem Kind zu leben?«
Allmählich ahnte Angiola, um wen es sich handeln musste. Es hatte Gerüchte gegeben, dass einer der großen Kastratensänger nach Bologna kommen würde, Caffarelli, Appianino oder Salimbeni, und die Oper lag nicht allzu weit von ihrem Haus entfernt. Aber wäre es nicht wahrscheinlicher, dass ein solcher Sänger bei einer der großen Familien der Stadt wohnen würde? Gewiss würden sie es sich als Ehre anrechnen, Zimmer in einem ihrer Palazzi zur Verfügung zu stellen. Sie wünschte, sie könnte sich in den Arm kneifen, um sicher zu sein, dass sie nicht träumte, aber das wagte sie nicht, jetzt, wo er sie betrachtete, der Fremde. Sein Kinn war bartlos und glatt, aber durchaus kräftig geformt, und seine Nase lang und gerade. In dem Halbdunkel des Treppenaufgangs kamen ihr seine Augen bald blau, bald schwarz vor. Mehr denn je fühlte sie sich wie eine halb ertrunkene Ratte aus einem Kanal, während er wie ein Prinz aus einer anderen Welt wirkte.
»Aber Signora Calori«, sagte er, »es handelt sich hier doch nicht um ein Kind, sondern um ein bezauberndes junges Fräulein.« Damit ergriff er Angiolas Hand und führte sie flüchtig an seine Lippen, ohne sie jedoch zu berühren.
»Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Signorina.«
Mit einem Mal fühlte sie sich nicht mehr ärmlich und beschämt, obwohl sie barfuß war und ihr immer noch das Wasser aus den feuchten Kleidern tropfte. Sie sank in einen Knicks, wie sie es vor Jahren bei jener schönen Dame in Venedig gesehen hatte, unter einem gemalten Sternenhimmel und auf Brettern, wo jede Schäferin in Wirklichkeit eine verwunschene Prinzessin war.
»Auch ich bin hocherfreut«, erwiderte sie, weil es so in den Büchern mit Menschen aus besseren Kreisen stand, die sie und ihre Mutter hinter dem Rücken des Vaters gelesen hatten, der jedes Buch abgelehnt hatte, wenn es nur der Unterhaltung diente. Ganz konnte sie ihre Aufregung nicht verbergen, und ihre Stimme ging am Ende des Satzes in die Höhe, was ihre höfliche Erwiderung daher wie eine Frage nach seinem Namen klingen ließ.
Er lächelte. »Appianino, stehe Ihnen zu Diensten.«
Bei aller Aufregung darüber, eine Berühmtheit im Haus zu haben, hatte Angiolas Mutter ihre bitter erlernte Lektion nicht vergessen. Sie ließ sich vorab die Miete für zwei Monate bezahlen. Bei der Gelegenheit stellte sich heraus, dass der Sänger für das unglaubliche Honorar von 34000 Bolognesischer Lire für ein halbes Jahr in die Stadt geholt worden war. So viel verdiente ein Professor in zehn Jahren. »Ich habe in Wien für den Kaiser gesungen«, sagte Appianino sachlich. »Um eine solche Ehre aufzugeben, muss ein entsprechendes Gehalt geboten werden.«
»Ich … wusste nicht, dass man als Sänger so gut bezahlt wird«, sagte Lucia Calori schwach.
»Wenn man sich einen Namen gemacht hat«, entgegnete Appianino, und ein Schatten legte sich über sein Gesicht. »Nur dann.«
Er kam genau wie Lucia und ihr verstorbener Gatte aus Mailand, aber das war auch alles, was ihre Herkunft gemeinsam hatte, wie Angiola bald herausfand. Seine Familie hieß natürlich nicht Appianino; er war als Giuseppe Appiani geboren worden, und als Lucia Calori höflich fragte, ob es sich vielleicht um die Appiani aus dem Bankwesen handele, lächelte er bitter und erwiderte: »Nein, Signora, das erste nennenswerte Geld, das meine Familie je verdient hat, verdankte sie meiner … Stimme.«
Lucia errötete und wechselte sofort das Thema. Als Angiola ihre Mutter später fragte, was denn schändlich daran sei, dass Appianino derjenige war, der seiner Familie zu Vermögen, Ruhm und Ehre verholfen habe, erklärte ihr die Mutter unter einigem Gestammel, dass viele arme Familien ihre Söhne regelrecht verkauften, angeblich an die viertausend Knaben im Jahr, in der Hoffnung, dass nach einer Kastration große Sänger aus ihnen würden, und wenn nicht das, wenn Stimme und Talent nicht dazu reichten, dann wenigstens Musiklehrer, was ebenfalls ein gesichertes Einkommen bedeutete. Wenn also Appianinos Familie kein Vermögen besessen habe, dann sei es gewiss, dass es sich bei ihm um einen solchen Fall handele.
»Wäre er nicht bei uns eingezogen, dann wären wir jetzt auch arm«, sagte Angiola. »Wenn ich ein Junge wäre, würden Sie mich dann kastrieren lassen, Mama?«
»Rede keinen Unsinn«, sagte Lucia indigniert und rauschte davon, um mit ihren nunmehr für kurze Zeit gesicherten Einkünften neue Handschuhe zu kaufen, feine, gegerbte Handschuhe aus dem zarten Leder der Haut eines ungeborenen, im Mutterleib gestorbenen Kalbs, auf die sie schon zu Lebzeiten ihres Gemahls ein Auge geworfen hatte, und echte Pomade. Die Zeit, in der sie Ziegenfett mit Wachs hatte mischen müssen, um zu sparen, war vorerst vorbei.
Angiola hörte Appianino gerne beim Üben zu. Zunächst tat sie das in der Erwartung, Lieder aus dem Theater zu hören, aber bald merkte sie, dass ein Sänger seine Stimme anders geschmeidig hielt. Er sang und hielt vielmehr einzelne Noten, als dass er zusammenhängende Lieder von sich gab. Es klang eher, dachte Angiola, wie das, was ein Vogel auf den Ästen tat, und hatte etwas Magisches an sich. In ihrem Zimmer versuchte sie, ebenfalls eine einzelne Note sehr lange zu halten, doch es stellte sich als unendlich schwieriger heraus, als sie es sich vorgestellt hatte. Es musste irgendein Geheimnis darin liegen. Schließlich fasste sie sich ein Herz und suchte Appianino in dem Zimmer auf, das er für seine Übungen in Beschlag genommen hatte. Diesmal küsste er ihr nicht die Hand, vielmehr war er ungehalten darüber, unterbrochen worden zu sein. Bis sie ihren Grund offenbarte. Er hob eine Augenbraue.
»Aber warum wollen Sie das wissen, Signorina? Was nützt es Ihnen?«
»Ich möchte es eben können.«
»Bei der Gesangskunst handelt es sich um keinen Zeitvertreib für Kinder«, sagte er abweisend. »Es handelt sich um mein Leben.«
Damit wandte er ihr den Rücken zu, setzte sich wieder an das Reisespinett, das er mitgebracht und in ihrem Haus aufgebaut hatte, schlug eine Taste und versuchte, den gleichen Ton zu treffen, sie ignorierend, als befände sie sich nicht mehr im Raum. Angiolas schüchterne Neugier verwandelte sich in etwas anderes, Heftiges, in Enttäuschung und Ärger. Dabei schmerzte ihr Bauch, etwas zog in ihrem Inneren, sie schwitzte, obwohl es eigentlich noch kühl war; sogar ihr Kopf tat weh, und sie wusste nicht genau, was sie wollte, nur, was sie nicht wollte, und das war, einfach so von ihm als Kind entlassen zu werden. Sie öffnete den Mund, um laut zu sagen: »Sie haben selbst bestätigt, dass ich kein Kind mehr bin«, holte dann tief Luft und stieß mit aller Kraft, zu der sie fähig war, den gleichen Ton wie er hervor.
Lächerlicherweise ging ihr bald die Luft aus. Sie spürte Schweißperlen am Rücken und auf der Stirn und kam sich nun doch kindisch vor. Appianino sang immer noch, aber er drehte ihr nicht länger den Rücken zu, sondern schaute sie an. Nicht höhnisch, aber auch nicht freundlich, sondern neugierig. Endlich ließ er seinen Ton verklingen und sagte: »Ein Sänger, mein Kind, singt aus dem Zwerchfell.«
»Was ist das Zwerchfell?«, fragte sie, kam sich dumm und unwissend vor und wusste nur, dass dieses Gefühl noch ärger werden würde, wenn sie nicht fragte.
Er machte ein paar Schritte auf sie zu und an ihr vorbei. Sie befürchtete schon, dass er die Tür öffnen würde, um sie hinauszuwerfen. Doch nein, er trat nur hinter sie.
»Heb die Arme«, sagte er. »Seitwärts.«
Angiola gehorchte, und er legte eine Hand auf ihren Bauch, die andere von hinten auf ihre Taille. Mit der vorderen übte er einen leichten Druck aus, und etwas in ihr, das verspannt war, löste sich.
»Hier«, sagte er. »Aber um richtig atmen und singen zu lernen, braucht man Jahre.«
Es war ein seltsames Gefühl, einen fremden Menschen so nahe bei sich zu spüren. Seit sie gelernt hatte, sich selbst anzukleiden, hatte das selbst ihre Mutter nicht mehr bei ihr getan.
»Wie viele Jahre?«
»Warum willst du das wissen?«, fragte er erneut und ließ sie abrupt wieder los, ohne jedoch von ihr wegzutreten. Seine Stimme, diese hohe, volltönende Stimme, die mühelos das gesamte Haus füllen konnte, wenn er wirklich sang, drang weiterhin von ganz nahe an ihr Ohr, und sie spürte seine Körperwärme. Es war beunruhigend und aufregend zugleich.
»Ich habe noch Jahre meiner Karriere vor mir, ehe ich zum Lehrer werden muss, wenn ich mir das überhaupt antue, und deine Mutter hat das Geld nicht, sich auch nur eine Stunde von mir leisten zu können, geschweige denn sieben Jahre gründlichen Unterricht, wie ich ihn hatte.«
Warum er sie jetzt auf einmal duzte, glaubte sie zu erraten: Es war ein weiterer Versuch, sie auf die Position eines Kindes zu verweisen.
»Ich werde keine sieben Jahre brauchen«, sagte sie störrisch. »Ich werde es schneller lernen.«
Er lachte, und es waren die ersten Laute, die sie von ihm hörte, die nicht melodiös klangen, sondern abgehackt und harsch.
»Du kannst doch noch nicht einmal Noten lesen.«
»Geschriebene Musik ist wie ein erzähltes Mittagessen«, entgegnete sie hastig, denn er hatte recht, aber sie dachte an die Komödiantin auf der Bühne in Venedig, die gewiss auch keine Noten hatte lesen können und doch stürmischen Beifall für ihre Darbietung geerntet hatte. »Ich will singen!«
Verächtlich verzog er den Mund. »Dann sing Jahrmarktslieder, das stört keinen. Schon morgen wirst du lieber lernen wollen, wie man sich gelbe Schleifen ins Haar bindet. Es ist die Laune eines Kindes, dem langweilig ist, nicht mehr.«
»War es das für Sie auch?«, fragte sie wütend zurück, ohne nachzudenken, und seine Hände mit den sehr großen, etwas zu langen Fingern legten sich blitzartig um ihre Kehle.
»Mich haben meine Brüder und mein Vater in einen Badetrog gezerrt und festgehalten, während ein Schlächter, der normalerweise Schweine kastrierte, sein Werk tat«, stieß er hervor, »weil ich der beste Sänger im Kirchenchor war. Ich hatte Glück, überhaupt zu überleben, denn mit elf Jahren war ich schon fast zu alt für den Eingriff. Und danach habe ich jeden Tag meines Lebens gesungen, damit es nicht umsonst war!«
Sie wollte sagen, dass es ihr leidtat, aber mit seinen Händen an ihrer Kehle konnte sie das nicht. Er schien sich auf einmal bewusst zu werden, was er gerade tat, denn er löste seinen Griff.Aber er war immer noch zornig und packte sie stattdessen an den Schultern, während es weiter aus ihm herausbrach.
»Lernen, du hast überhaupt keine Ahnung, was das heißt, zu lernen! Wenn man am Conservatorio di Sant’Onofrio in Neapel studiert, dann gibt es nichts anderes. Morgens eine Stunde schwierige Passagen, eine Stunde Musikliteratur, eine Stunde singen vor Spiegeln; am Nachmittag eine Stunde Musiktheorie, eine Stunde Improvisation und eine weitere Stunde Literatur, dazwischen an- und absteigende Halbtonleitern, irrwitzige Triller, unendlich lang zu haltende Noten, um das notwendige Atmen zu entwickeln. Und die Strafen, wenn du nicht gut genug bist …«
Plötzlich erfasste sie ein stechender Schmerz, der nichts mit ihrem Hals zu tun hatte, und sie krümmte sich. Er ließ sie los, und diesmal trat er zurück. Angiola drehte sich zu ihm um. Dabei spürte sie etwas Warmes zwischen ihren Beinen auf den Boden tropfen. Sie hatte nicht mehr in die Hose gemacht, seit sie ein Kleinkind gewesen war, und die Vorstellung, sich jetzt vor diesem Mann auf diese Weise zu demütigen, war unerträglich. Sie wollte auf ihr Zimmer rennen, und mit etwas Glück würde er nichts bemerken, wenn ihr ein würdevoller Abgang gelang.
»Ich will singen lernen, weil es nichts in diesem Leben gibt, was schöner für mich ist als der Klang Ihrer Stimme«, sagte sie leise und zwang sich, langsam und mit hocherhobenem Kopf aus dem Raum zu schreiten. Erst als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, gestattete sie sich, zu rennen, nach oben unter das Dach, wo sie ihre Schlafstätte hatte, aus ihrem Kleid zu schlüpfen und nach dem Schaden zu sehen.
Es war keine Pisse, die warm ihre Beine herunterrann. Es war Blut.
»Oh, mein Gott«, hörte sie Appianino entsetzt ausrufen, und sie sah, dass er ihr gefolgt sein musste. »Das wollte ich nicht.«
»Das waren Sie auch nicht«, antwortete Angiola ungnädig. Gerade jetzt und hier wollte sie ihn nicht sehen. »Das hat doch mit meinem Hals nichts zu tun. Ich habe meine Blutungen bekommen.« Sie wollte, dass er ging, und sehnte ihre Mutter herbei.
Appianino machte immer noch eine verschreckte Miene und starrte auf das Blut auf ihren Oberschenkeln. Es kam ihr in den Sinn, dass er vielleicht an das Blut auf seinen eigenen Beinen dachte, als man an ihm herumgeschnitten hatte, und ihr Ärger schwand. Ihre Mutter hatte gesagt, dass man die Kinder manchmal bereits mit sechs oder sieben Jahren kastrierte, spätestens jedoch, ehe den Knaben die Stimme brechen konnte.
Er musste entsetzliche Angst gehabt haben.
»Es ist schon gut«, setzte sie sanfter hinzu.
Sein Blick wanderte zu ihrem Gesicht. »Du – du hast völlig klar gesungen«, sagte er. »Kurz, aber klar. Da ist etwas in deiner Kehle. Wir werden sehen, ob sich daraus mehr machen lässt. Wenn du nicht fleißig bist und mir nicht in allen Dingen gehorchst, dann ist jedoch Schluss damit. Und wenn mein Engagement hier zu Ende ist, reise ich ab.«
Wieder sank sie vor ihm in einen Knicks, doch diesmal meinte sie es nur halb ernst, halb war es etwas, das ihr half, nicht länger mit ihrem kurzen Unterrock vor ihm herumstehen zu müssen.
»Danke, mein höchst edler Herr.«
»Von nun an wirst du mich mit Maestro anreden«, versetzte er grimmig, doch mit irgendwie schuldbewusster Miene.
Giacomos Aufenthalt in Padua hatte endlich eine günstige Wendung genommen. Anstatt mit zehn älteren Jungen, die wie er die Rechtswissenschaft studieren sollten, in einem Raum schlafen zu müssen, hatte er bei einem seiner Lehrer, Dottore Gozzi, ein eigenes Zimmer. Die schönste Seite daran war, dass das Fenster auf den Hof und zu anderen Fenstern hinausging. Er hätte ohne große Anstrengung sogar in den ersten Raum hinübersteigen können. Hinzu kam, dass das Haus des Dottore ein Eckhaus mit zwei Flügeln war, und so konnte er in wenigen Spannen Abstand entfernt in einen weiteren Raum der Familie Gozzi blicken, was alles andere als uninteressant war.
Bettina, die jüngere Schwester seines Lehrers, lebte darin. Sie war höchstens fünfzehn, somit nur gut zwei Jahre älter als er, und der Schwarm aller Studenten, deren Nähe er gerade entkommen war. Im Gegensatz zu den anderen lebte er jedoch nun kaum zwei Armlängen weit von diesem Engel entfernt, der ihn anfänglich sogar noch badete und dabei manchmal, wie zufällig, sein Glied berührte. Seit diesen Berührungen hatte sich in seinem Körper etwas verändert, und er hatte Bettina nun manch schlaflose Nacht und Träume zu verdanken, die ihn mit klebrigen Spritzern in seinem Nachthemd aufwachen ließen.
Das Mädchen wusste nur zu genau, dass es schön war. Es hatte ganz dunkle Augen, die durch sein tiefschwarzes Haar noch unterstrichen wurden, einen cremigen Teint und kräftig geschwungene Lippen. Seine Figur konnte man nur als kurvig bezeichnen. Die Komplimente, welche es von allen Jungen dazu hörte, erzählte es aus purer Eitelkeit beim Essen seinem Bruder, obwohl es diesen damit von einer Verlegenheit in die andere stürzte, und das nicht nur, weil er sich der Nähe des jungen Giacomo dabei bewusst war.
»Ich muss dich verheiraten«, war die übliche Aussage Dottore Gozzis dazu. Dann ging man die in Frage kommenden Männer durch, die meist mindestens doppelt so alt wie Bettina waren. Das Mädchen quittierte diese Aussagen stets mit einem Augenrollen. Dabei waren Bettinas Aussichten auf eine gute Ehe durchaus begrenzt, seit sie um ein Haar mit einem der Studenten erwischt worden wäre und nur straflos davonkam, weil sie mit etwas Seifenschaum im Mund Besessenheit vortäuschte. Giacomo hatte sie die Seife hinterher ausspucken sehen, aber der Exorzist, den Dottore Gozzi bemüht hatte, war von Bettinas Teufelsbesessenheit überzeugt gewesen und hatte mit großem Zinnober eine Austreibung zelebriert. Danach konnte sich Dottore Gozzi sagen, dass der Teufel für die Anwesenheit seiner Schwester in den Armen eines Studenten verantwortlich gewesen war, aber es half ihm nicht dabei, Bettina zu verheiraten, und sie selbst zeigte auch keine Begeisterung für eine Eheschließung.
Der junge Giacomo konnte Bettina gut verstehen und hätte ohnehin lieber mehr von den Komplimenten gehört, um sie für sich variieren und einzigartig machen zu können. Denn das hatte er beim Abendessen mit den Geschwistern begriffen: Einzigartig mussten sie sein. Bettina fand alle langweilig, die sie schon kannte und anderweitig gehört hatte, und erachtete den aus ihrer Sicht einfallslosen Verehrer allein deswegen als nicht weniger langweilig.
»Eine schöne Frau braucht keine Komplimente, wenn sie Komplimente braucht, ist sie keine schöne Frau«, belehrte Gozzi seine Schwester gelegentlich.
Bettina ließ das nicht gelten. »Komplimente kann eine Frau nie genug hören, vor allem, wenn ein neues dabei ist, merk dir das.«
Wer die Ohren spitzte, war jedoch nicht ihr Bruder, sondern Giacomo, dem kein Wort entging. »Carlo hat gesagt, mein Gang, mein Haar, mein Gesicht sei einzigartig auf der Welt und mit dem keiner anderen Frau zu vergleichen«, berichtete sie einmal voll Vergnügen.
Giacomo fand das keineswegs einzigartig, weil es in dieser Form doch jedem Mädchen gesagt werden konnte. Er nahm sich vor, in seinem Leben auf die kleine Besonderheit zu achten, die jedes Mädchen hatte und von der es auch wusste. Diese kleine Einzigartigkeit würde er zum Gegenstand seiner Bewunderung und Komplimente machen. Schließlich war Beredsamkeit das einzige Gebiet, in dem er, dessen war er sich sicher, den Jurastudenten Carlo übertreffen konnte. Carlo Calucci, der mit seinen sechzehn Jahren fast schon ein Mann von Welt war und Bettina bestimmt mehr mit seiner bereits männlich tiefen Stimme, seinen strammen Schenkeln und seinem muskulösen Oberkörper als mit seinem Vokabular beeindruckte.
Und sich mit Carlo auf einen Streit einzulassen würde höchstens damit enden, dass ihn der ältere Junge grün und blau schlug. Nein, wenn Giacomo Bettina beweisen wollte, dass er größerer Aufmerksamkeit wert war als sämtliche älteren, größeren und stärkeren Studenten zusammen, dann musste er dafür seinen Verstand und seine Phantasie benutzen. Das übliche Süßholz über Bettinas Gang und Haar zu raspeln kam also nicht in Frage. Er zerbrach sich den Kopf bei der Suche nach einem Kompliment, das sie noch nicht erwähnt hatte und das dennoch auf sie zutraf. Die Erleuchtung kam ihm mitten in einer langweiligen Auslegung der noch langweiligeren Gesetze des Justinian. Er feilte noch ein wenig am Wortlaut und brachte es dann an, als er ihr später allein auf der Treppe begegnete: »Warum lächelst du heute so bezaubernd? Willst du mir deine schönen Zähne zeigen? Ich muss gestehen, ich habe bis heute keine schöneren gesehen.«
Zu seiner Befriedigung lösten diese Sätze wahrlich großes Staunen bei Bettina aus, die in ihm immer noch einen unschuldigen Jungen sah.
Wenige Tage später, an einem Abend, auf dem Weg zum Abendessen, als sich ihre Schultern leicht berührt hatten, wurde er deutlicher und unterstrich seine Worte mit Blicken, die feurig sein sollten, so wie er es auf den Theaterbühnen in Venedig beobachtet hatte.
»Du fühlst dich an, als wäre für dich die Liebe geboren worden oder als hättest du sie erfunden!«
Damit hatte er sie endgültig neugierig gemacht. Sie schaute ihn viel aufmerksamer an, als sie es sonst tat, und nahm offensichtlich zur Kenntnis, dass er dabei war, dem Kindsein zu entfliehen.
Als sie an diesem Abend beide auf ihr Zimmer gingen, wo er schnell seine Kerze auslöschte, um so besser in das Zimmer von Bettina blicken zu können, hatte sie vergessen, den Vorhang zu schließen, durch dessen Spalt er bisher immer nur sehr wenig von ihrem Anblick hatte erhaschen können. Zudem stand nun ihre Lampe auf einem Tisch in der Mitte des Zimmers und nicht, wie sonst, auf der Kommode an der Wand. Nach einer Weile begann sie sich zu entkleiden und rollte, langsam, sehr langsam, ihre Strümpfe hinunter. Was sie Schritt für Schritt enthüllte, war jung und fest, ja drall, und so anders, als er es bei kurzen Blicken in Theaterlogen oder zu Hause bei seiner Mutter gesehen hatte. Er hätte Stein und Bein geschworen, dass die Halbkugeln ihrer Brüste die Form der schönsten Glocken von San Marco hatten, wenn auch sicher deutlich kleiner, aber wie diese wippten sie bei jeder Bewegung auf und ab. Für einen Moment war sie völlig nackt, bis sie sich ein kurzes Unterhemd überzog. Giacomo geriet jedoch völlig außer sich, als sie sich plötzlich aus für ihn unerfindlichen Gründen bückte, vermutlich um etwas am Boden zu suchen. Dabei rutschte das Unterhemd weit über ihren Hintern hinauf, und zugleich fingen die gerade bewunderten Glocken das Läuten an, wobei sie gelegentlich aus dem Ausschnitt hervorlugten. Da kannte seine Hand kein Halten mehr, und er erleichterte sich bei diesem Anblick so schnell, dass er kaum sein Taschentuch fand, um aufzufangen, was da aus ihm herausspritzte. Aber nach dem Knopf, den Bettina suchte, oder was immer es war, wenn es überhaupt etwas gab, wurde noch eine ganze Weile geforscht, bis sie das Licht löschte und zu Bett ging. Es überraschte ihn, dass er es bis dahin erneut, dieses Mal viel langsamer und genussvoller, schaffte, sein wieder aufgerichtetes Glied zu befriedigen.
Dieses Spiel wiederholte sich von nun an immer wieder, und seine Komplimente wurden ebenfalls eindeutiger. Die letzte Nacht war für Giacomo besonders erfreulich verlaufen, und da Dottore Gozzi außer Haus war, traf er eine Entscheidung. Dem Tapferen gehörte die Welt. Wenn ein Mädchen so offensichtlich einen Jungen genauso sehr wollte wie dieser das Mädchen, dann sollte man nicht länger schauspielern, sondern tun, was getan werden musste.
Mutig trat Giacomo bei Bettina ein und sagte mit allem Mut, den er aufbringen konnte: »Die Zeit für Neckereien ist vorbei. Wir sollten nun wahrlich an ernsthaftere Genüsse denken.«
Er ging auf sie zu und wusste, wenn sie ihn jetzt auslachte, würde er sterben wollen. Bettina hatte eine Unterlippe, als wolle sie damit etwas auffangen, oder etwas beginnen. Ehe es ein Gelächter werden konnte, küsste er sie mit allem, was nach seiner Vorstellung dazugehörte.
»Nicht schlecht für einen Knaben«, meinte sie, als er nach Luft schnappen musste, »kannst du noch mehr?« Das verstand er als Einladung und machte Anstalten, mit seinen Händen den Weg die Beine hinauf nach dem zu suchen, das für seine Blicke längst kein Geheimnis mehr war. Bettina hob die Hände an ihre Schultern, löste etwas, was er nicht sehen konnte, und das Kleid rutschte ihr bis zum Becken. Sie bewegte die Hüften hurtig, und es fiel zu Boden. Nun konnte er ihre Brüste ganz aus der Nähe sehen, die schön rund wie Paradiesäpfel oder kleine Melonen waren. Bettina war noch so jung, dass diese trotz der Größe nur leicht hingen und prall wie ein gutgefülltes Kissen waren. Er wollte sofort danach greifen.
»Eins nach dem andern, sonst ist es bei euch Männern immer gleich vorbei«, meinte sie lachend. Giacomo fühlte sich nicht gekränkt, denn er war sich nun sicher, dass es ein Lachen mit ihm, nicht über ihn war. Sie half ihm, sich aus seinen eigenen Kleidern zu befreien. Völlig nackt lagen sie kurz danach auf ihrem Bett, und er durfte ihren Körper erforschen. Gewiss würden jetzt selbst erfahrene Kavaliere alle Zurückhaltung fallenlassen? Er war gleichzeitig glücklich und immer noch sehr, sehr aufgeregt. Wenn er sich jetzt ungeschickt anstellte, dann konnte er gleich im Erdboden versinken oder Eremit werden. Ihm war aus den Blicken durch Türspalten im Theater und Erzählungen der anderen Jungen durchaus bekannt, wohin er sein unerprobtes Liebeswerkzeug nun stecken sollte und dass es dann darum ging, hin und her zu fahren. Doch obwohl alles an ihm hart war, und ihre Hände, das, was sie da von ihm gepackt hielt, auch nicht mehr abgeben wollten: Diesen Weg machte sie ihm noch nicht frei.
»Ich zeige dir, was du tun sollst, und du sagst mir dabei, was du tust und was du entdeckst, denn Bettgeflüster ist der beste Weg, die Sprache der Liebe zu lernen«, murmelte sie. Sie begann, sich selbst zu streicheln, und da, wo sie gerade gewesen war, durfte er mit seinen Fingern und seinen Lippen, vom Kopf angefangen, über den Hals, ihre Brüste, wo zwischenzeitlich die Brustwarzen sich zu kleinen Türmen aufgerichtet hatten, ihren Bauch und ihr Geschlecht begrüßen. Obwohl sie sehr bald gurrte wie eine junge Katze, sich wohlig wand und zu keuchen begann, machte sie immer noch Gesten der Abwehr, weil es ihr sinnvoll erschien, sein Feuer noch mehr zu entfachen. Auch er keuchte und wollte endlich den Weg nehmen, von dem er so viel Geheimnisvolles gehört hatte.
Bettina musste aber schon erlebt haben, dass Jungen ohne Erfahrung dazu neigten, sehr schnell ihr Pulver zu verschießen, denn sie hielt seine Hände fest und sagte: »Nicht so schnell, Floh. Eine Frau ist wie ein Instrument, das ganz unterschiedlich gespielt werden kann, und das gilt auch für euch Männer.«
Sie rollte sich auf ihn, so dass er nun auf dem Rücken lag.
»Pass auf«, flüsterte sie, »ich zeig dir, wie. Machen wir Musik.«
Sie begann ihn mit Haaren, Wimpern, Händen und ihren Brüsten am ganzen Körper zu streicheln, überall.