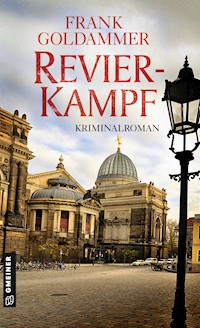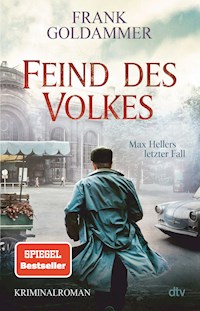9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Max Heller
- Sprache: Deutsch
Ein toter Junge. Eine Mauer des Schweigens. Ein Albtraum für Max Heller. Dresden 1948: Ein heißer Sommer, drei Jahre nach Kriegsende. Die große Währungsreform stürzt das besetzte und aufgeteilte Nachkriegsdeutschland in eine Krise. Inmitten der mühsamen Wiederaufbauarbeiten bekommt es Oberkommissar Max Heller mit dem Fall eines 14-jährigen Jungen zu tun, dessen Todesursache völlig unklar ist. War es ein Unfall, Mord oder sogar Selbstmord? Heller stößt bei seinen Ermittlungen auf eine Wand des Schweigens und wird dabei mit seinem ganz persönlichen Albtraum konfrontiert − den er längst vergessen geglaubt hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Frank Goldammer
Vergessene Seelen
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
17. Juni 1948, Nachmittag
Heller blieb stehen und stellte seine Tasche ab, indem er sie zwischen seine Beine klemmte. Bis auf ein paar spielende Kinder war er zwar allein auf der Plattleite, doch man wusste nie, ob nicht einer der Burschen ihm die Tasche stehlen und damit über den steilen, sandsteingepflasterten Weg abhauen würde. Heller hätte keine Chance, ihn zu schnappen.
Vorsichtig legte Heller den kleinen Blumenstrauß auf die steinerne Mauer, die den Weg begrenzte. Die Blumen, bei einer vormittäglichen Dienstfahrt am Wegesrand gepflückt, ließen bedenklich ihre Köpfe hängen. Selbst in einer schönen Vase würden sie ein trauriges Bild abgeben. Trotzdem warf er sie nicht weg, weil er hoffte, dass allein die Geste seiner Frau Freude bereiten würde.
Er zog ein Taschentuch aus seiner Jackentasche, hob die Schiebermütze an und wischte sich über die Stirn. Missbilligend betrachtete er die dunkelroten Staubränder auf dem karierten Stoff. Es war nicht zu ändern. Der Staub war allgegenwärtig. Er faltete das Tuch zusammen und steckte es wieder ein.
Er hatte sich heute extra Zeit genommen und das Dienstende eine Stunde vorgezogen, um dann einen weiten Umweg zu gehen, am Königsufer entlang. Er wollte Karin überraschen, doch er hatte seine Frau nicht gefunden. Nun war aus der Vorfreude eine leise Qual geworden, ein überlanger Spaziergang durch die beinahe hochsommerliche Hitze.
Unterhalb von ihm, auf der Schillerstraße, klapperten Pferdehufe, ratterten hölzerne Räder auf dem Kopfsteinpflaster und quietschten ungeschmierte Radlager.
Heller öffnete die Tasche, nahm seine blecherne Trinkflasche heraus, schüttelte sie skeptisch, schraubte den Deckel auf und trank den dürftigen Rest in einem Zug. Auch dies nicht mehr als eine Geste an seinen Körper. Aber der Weg nach Hause war nicht mehr weit, wenn auch sehr steil. Er musste trotzdem schmunzeln angesichts der Tatsache, dass er eine Sentimentalität nun mit brennenden Oberschenkelmuskeln und dem vertrauten giftigen Stechen im Fuß bezahlen musste.
Ehe er weiterging, warf er einen Blick auf die Stadt, doch die Blätter der Platanen, Linden und vor allem die Kastanien mit ihren weißen Blütenkerzen versperrten ihm die Sicht. Das Laub raschelte sommerlich leise im Wind, was aber nicht darüber hinwegtäuschen konnte, dass tausendfach das Klingen von Hämmern auf Ziegelstein wie ein hartnäckiger Tinnitus über der Stadt lag. Auf den Elbwiesen türmten sich Berge von Ziegeln, die dort von Putz und Mörtel gesäubert, dann gestapelt und zum Bau wieder abtransportiert wurden. Es waren Gleise verlegt worden, auf denen von Dampfloks gezogene Lorenbahnen täglich Zehntausende Ziegelbrocken aus den Ruinen transportierten. Die mühselige, eintönige Arbeit wurde von Frauen verrichtet, die sich selbst Trümmerfrauen nannten. Obwohl es eine schier endlose Aufgabe war, waren die Frauen meist fröhlich, denn was sie taten, erfüllte einen Zweck. Und das war es doch, worauf es ankam in diesen Zeiten. Sie sangen, erzählten sich derbe Witze und machten sich lustig über die ihnen zugeteilten Männer, meistens Nazimitläufer, die ihre Strafe mit »Schippen« abdienen mussten. Viele der Frauen hatten noch immer kein richtiges Dach über dem Kopf, viele warteten auf ihre Ehemänner und Söhne und viele hatten alles verloren. Doch wenigstens konnten sie etwas tun, sie hatten eine Aufgabe und sahen den Erfolg, auch wenn es nur ein paar Dutzend Ziegel waren, die jede von ihnen am Tag putzte. So wuchsen doch die Stapel zu stattlicher Höhe.
Ein wenig beneidete Heller die Trümmerfrauen. Sie sahen wenigstens den Erfolg ihrer Mühen. Er dagegen musste sich Tag für Tag mit dem trüben Satz der Menschheit herumschlagen, mit Diebstahl, Plünderung, versuchtem Raub, schwerem Raub, Raub mit Totschlag und Mord aus Habgier. Selten genug war seine Arbeit erfolgreich, was vor allem an den wenigen jungen, unerfahrenen, eilig ausgebildeten Kriminalisten lag, die zur Verfügung standen, und an der Vielzahl der Delikte.
Doch heute war der Tag zu schön für solcherart Gedanken. Heller sammelte die Blumen von der Mauer wieder auf und ging weiter. Eigentlich hatte er die Standseilbahn benutzen wollen, doch der Andrang war so groß gewesen, dass er bestimmt eine Stunde oder länger auf eine Fahrt hätte warten müssen.
Wenig später bog er in den Rißweg ein und ging die letzten hundert Meter bis zum Haus von Frau Marquart, in deren Haus sie seit Februar fünfundvierzig untergekommen waren, nachdem sie in der Bombennacht ihre Wohnung mit allem Hab und Gut verloren hatten. Für einige Sekunden hielt er sich am Gartentor fest, um wieder zu Atem zu kommen. Die alte Dame war immer sehr besorgt um ihn und vermutete hinter jeder kleinen Schwäche gleich einen Herzinfarkt.
»Vati!«, rief da eine helle Stimme, und ein kleines blondes Mädchen von ungefähr vier Jahren kam um das Haus gesaust. Heller öffnete das Tor, stellte schnell seine Tasche ab, fand aber keine Gelegenheit, die Blumen in Sicherheit zu bringen. Er fing das Kind auf, hob es hoch und ließ es auf seinem Unterarm sitzen. Das Mädchen schlang ihm die Arme um den Hals.
Im selben Augenblick erschien Frau Marquart und versuchte mit gespieltem Ärger, Heller die vermeintliche Last abzunehmen. Doch diese erwies sich als widerspenstig und umklammerte Heller.
»Lassen Sie nur«, lachte Heller und übergab ihr stattdessen die Blumen, die Frau Marquart mit skeptischem Blick entgegennahm.
»Da hätten Sie aus unserem Garten schönere haben können.«
»Die wären aber eben aus dem Garten gewesen«, erwiderte Heller und stupste dem Mädchen die Nase. »Anni, sag guten Tag.«
»Guten Tag«, sagte das Mädchen ernst.
»Ist Karin zu Hause?«
Anni schüttelte den Kopf.
»Warst du brav heute?«
Sie nickte stumm.
»Warst du Frau Marquarts Heinzelmännchen?«
»Ja, das war sie«, kam Frau Marquart dem Mädchen zuvor. »Schuhe hat sie geputzt.«
Heller warf Frau Marquart einen bittenden Blick zu. Er wollte das Mädchen, das sich viel zu selten äußerte und beängstigend oft in seiner eigenen Welt versunken schien, selbst zum Sprechen bringen.
»Schuhe hast du geputzt? Aber meine sind noch ganz staubig.« Heller sah demonstrativ nach unten, und Anni folgte seinem Blick. Sie dachte kurz nach und lächelte dann, weil sie ihn durchschaut hatte. Aber sie sagte kein Wort.
»Es liegt ein Paket auf der Post«, unterbrach Frau Marquart die Stille. »Man wollte es mir aber nicht aushändigen«, fügte sie vorwurfsvoll hinzu.
»Das ist so bei Auslandspaketen«, beschwichtigte Heller die alte Dame, ärgerte sich aber insgeheim auch über sie. So oft hatte er ihr die Zusammenhänge schon erklärt. Bestimmt hatte Erwin wieder ein Paket aus Köln über Schweden geschickt, weil die Sowjets solche Pakete nicht öffneten. Es kam genau zur rechten Zeit. Eine Woche schon war seine Pajok überfällig.
Heller setzte das Kind ab. »Anni, magst du mit mir zur Post gehen, das Paket holen?«, fragte er und Anni nickte.
»Sag doch mal ›Paket‹. Tu’s für mich«, bat er das kleine Mädchen.
Anni sah ihn mit großen Augen an und flüsterte etwas. Heller musste sich weit zu ihr hinunterbeugen, um etwas zu verstehen. Dann lächelte er.
»Wenn Sie zurück sind, müssen die Beete noch gegossen werden«, trompetete Frau Marquart. Heller hatte den Eindruck, sie torpedierte unbewusst immer wieder seine Bemühungen, Anni zum Reden zu bringen. Er seufzte. Seine Vermieterin war subtilen Botschaften gegenüber noch nie empfänglich gewesen. Jetzt hielt er Anni die Hand hin. Das Mädchen ergriff seinen Zeigefinger, und einträchtig liefen sie in Richtung der Bautzner Straße, in der sich die Poststelle befand.
Es war noch hell, als Karin am Abend nach Hause kam.
»Mutti!«, rief Anni, die schon gewaschen und im Nachthemd war, und rannte die Treppe hinunter. Karin kam gar nicht dazu, ihr Kopftuch abzubinden. Sie nahm die Kleine in die Arme und küsste sie.
Heller war hinter Anni die Treppe hinuntergekommen, hielt eine Hand auf dem Rücken und begrüßte seine Frau mit einem Kuss. »Es ist wieder ein Paket von Erwin gekommen.«
»Dieser gute Junge«, freute sich Karin.
»Ach, übrigens: Alles Gute zum Hochzeitstag«, murmelte Heller. Er zog die Hand hinter dem Rücken hervor und reichte Karin die beinahe schon verwelkten Blumen.
Karin konnte sich ein Lachen nicht verkneifen, ließ das Mädchen hinunter und nahm den kümmerlichen kleinen Strauß entgegen. »Wie lieb von dir, Max. Ich stell sie aber lieber schnell zurück in die Vase.«
»Ich wollte dich besuchen heute, aber ich habe dich nicht gefunden.«
Karin sah Anni nach, die in die Küche lief, und wandte sich dann an ihren Mann. »Dann hast du mich übersehen. Du hättest einfach rufen sollen.«
Heller schwieg peinlich berührt. Er hatte ja gerufen, aber hatte von den anwesenden Frauen nur Spott geerntet. Kariiinchen, Kariiinchen, hatten sie ihn nachgeäfft.
Karin zog sich das Kopftuch vom Haar und schüttelte es durch die offene Haustür aus. »Sie suchen schon nach Freiwilligen für die Ährenlese. Und Vroni meinte, es würde wieder ein so trockener Sommer werden wie letztes Jahr. Ihr Mann kam gerade von seiner Delegiertenreise zurück. Er sagt, im Westen hätten alle satt zu essen, es gäbe keinen Hunger mehr.«
Heller mochte so etwas nicht hören. Selbst wenn es so war, was nützte das Gerede? »Bestimmt hat man ihnen absichtlich immer nur das Beste vorgesetzt.«
»Da magst du recht haben.« Karin zog sich die schweren Schuhe aus und dehnte ihren Rücken. Heller strich ihr fürsorglich über den Arm, nahm dann ihre Hand in seine und fuhr sanft über ihre Handinnenfläche. Sie war ganz rau. Eine richtige Arbeiterhand, dachte er. Dabei müsste Karin das nicht tun. Jeden Tag so früh aus dem Haus, die harte körperliche Arbeit, die schweren Steine und die staubige Luft. Doch er hatte längst den Widerstand aufgegeben und sah ja auch, wie gut Karin diese Arbeit tat, wie die Farbe in ihr Gesicht zurückkam.
»Du bist spät heute«, sagte er.
»Die Bahn ist ausgefallen. Ich musste ein ganzes Stück laufen und dann hat mich ein Russenlaster mitgenommen.«
Heller runzelte die Stirn, schwieg aber. Er mochte es nicht, wenn sie so etwas machte. Dabei war er es, der ständig allen erklärte, dass man sich mit den Russen arrangieren musste, dass sie längst nicht die Barbaren waren, für die man sie noch immer hielt.
»In Räcknitz musste heute ein Blindgänger entschärft werden, da war für Stunden alles gesperrt«, erzählte Karin.
Heller hatte davon gehört. Er wunderte sich immer wieder, wie viele Bomben nicht detoniert waren. Es würde wahrscheinlich Jahrzehnte brauchen, sie alle zu finden.
»Hast du schon in das Paket geschaut?«, fragte Karin.
Er schüttelte den Kopf. »Habe erst die Beete gegossen. Ich fürchte übrigens, jemand hat uns Möhren gestohlen.«
»Ach!« Karin sah ihn entrüstet an. »Dabei hast du doch den Zaun gebaut.«
»Als ob das jemanden davon abhält, in den Garten zu steigen! Die Arbeit hätte ich mir sparen können«, bemerkte Heller resigniert. Eigentlich müsste man eine Wache aufstellen, so wie all die zu Beeten umfunktionierten Grünflächen in der Stadt bewacht wurden. Aber er konnte von Frau Marquart kaum verlangen, auf Anni aufzupassen, Besorgungen zu erledigen und noch auf die Beete zu achten. Vielleicht kamen die Diebe aus der direkten Nachbarschaft und konnten genau beobachten, wann jemand zu Hause war und wann nicht. Nach dem letzten dürren Sommer und dem darauffolgenden bitteren Winter war der Hunger noch immer das größte Übel. Und wer hungerte, ließ sich auch von Wachen und Schildern nicht abschrecken.
Karin zog Heller in die Küche. »Komm, lass uns anschauen, was Erwin geschickt hat.«
Frau Marquart wartete schon auf sie, und Anni hatte sich neugierig auf einen Stuhl gekniet. Erwins Pakete zu öffnen war für sie längst ein Ritual geworden, beinahe so feierlich wie das Weihnachtsfest. Heller nahm eine Schere, durchschnitt den Paketstrick, öffnete das verklebte Papier an der Seite und zog vorsichtig den Karton heraus. Auch das Packpapier und der Strick waren wertvoll und wurden sorgfältig aufgehoben. Der Karton war noch einmal mit Strick zugebunden, und Heller versuchte, den festen Knoten zu lösen. Karin kam ihm zu Hilfe.
»Schau mal«, sagte Karin staunend und holte zwei Tafeln amerikanische Schokolade heraus. Nach und nach packte sie in braunes Ölpapier eingewickelte Seife aus, eine Tüte Kaffeebohnen, eine Konservendose mit Corned Beef, eine große Packung Camel Zigaretten, allein die war ein wahres Vermögen wert, Kakaopulver und zwei Büchsen Ölsardinen. Zuletzt kamen noch eine Pappschachtel mit Taschenlampenbatterien zum Vorschein und eine große Blechdose.
Heller betrachtete die Dose von allen Seiten. Es war nicht zu erkennen, was sie enthielt. Er versuchte den Deckel aufzustemmen, nahm einen Schraubenzieher zu Hilfe. Ratlos blickte er auf das weiße Pulver in der Dose und hielt es dann Karin hin, die daran roch.
»Waschpulver«, erklärte sie.
Wortlos schüttete Heller das Pulver in die Schüssel, die Karin zum Waschen benutzte.
»Was tust du denn?«, fragte sie erstaunt. Heller fischte etwas aus dem Pulver und klopfte es ab. »Das sah mir doch gleich nach einem Kassiber aus«, sagte er und gab ihr ein kleines, fest mit Papier umwickeltes Päckchen.
Karin runzelte die Augenbrauen und öffnete es. »Geld! Warum schickt der Junge Geld?«
»Und so viel!«, staunte Frau Marquart.
Heller nahm seiner Frau das Bündel ab und begann zu zählen.
»Scholade«, flüsterte Anni.
»Ja, das ist Schokolade«, erklärte Karin. »Magst du ein Stück?«
Anni nickte artig.
»Sagst du es mir auch?«, fragte Karin und lächelte.
»Anni. Schokolade. Bitte«, sagte das Mädchen mit leiser Stimme.
Karin riss die Verpackung auf, brach ein kleines Stück ab, kaum größer als ein Daumennagel, und gab es Anni. Dann brach sie auch für die Erwachsenen jeweils ein Stück ab und steckte ihrem Mann eines in den Mund.
Heller war auf das Zählen konzentriert gewesen und sah jetzt auf. »Dem Jungen scheint es nicht schlecht zu gehen«, sagte er und ließ die Schokolade langsam im Mund zergehen. »Das sind über neunhundert Mark. Hast du ihn darum gebeten?«
»Natürlich nicht!«, empörte sich Karin.
»Wenn er nur keine Dummheiten anstellt«, murmelte Heller.
»Nicht doch. Unser Erwin ist ein schlauer Junge«, beruhigte sie ihn.
Das war eine gute Eigenschaft, dachte sich Heller, doch nicht jeder wusste damit umzugehen. Heller hatte genug mit jungen Burschen zu tun, die sich für besonders schlau hielten.
»Was sollen wir damit machen?«, fragte er. »Ob er will, dass wir es aufbewahren?«
Karin zuckte die Schultern. »Es war kein Brief dabei, oder?«
Heller durchsuchte den Karton und das Packpapier, fand aber nichts.
»Also, was machen wir?«, fragte er noch einmal.
»Wir bringen es zur Bank«, bestimmte Karin und schlug Anni spielerisch auf die Hand, weil diese noch einmal nach der Schokolade langen wollte. »Gleich morgen werde ich das erledigen.«
18. Juni 1948, morgens
»’n Morgen, Chef.« Oldenbusch sah zur Tür hinein.
»Werner! Schon zurück?« Heller sah auf und schob einen schweren Ordner beiseite. Oldenbuschs Erscheinen war eine willkommene Abwechslung zu seiner derzeitigen Arbeit. Er versuchte gerade eine Einbruchsserie mittels Indizienbeweisen einer organisierten Bande zuzuordnen. Die Arbeit war müßig. Es gab täglich Dutzende gemeldete Einbrüche und Diebstähle, und die Polizei kam nicht mehr hinterher. In zwei anderen Aktenmappen warteten mehrere Fälle von Totschlag auf ihre endgültige Aufklärung. Dabei wusste Heller, dass man etwas gegen den Hunger, gegen die allgemeine Not unternehmen müsste. Denn wer nicht hungerte, stahl auch kein Essen und schlug niemanden tot, nur um an dessen Kartoffeln oder Bettwäsche zu kommen.
»Wie war es in Berlin, Werner?«
Oldenbusch nahm den Stuhl, der gegenüber Hellers Schreibtisch stand.
»Max, ich sage Ihnen, es gibt nichts Langweiligeres auf dieser Welt als so eine Konferenz«, stöhnte er und schwitzte bereits sichtbar, obwohl der Tag erst anfing. Trotz des Hungers und der Entbehrungen der letzten Jahre hatte er erstaunlicherweise nichts von seinem Leibesumfang eingebüßt. »Nie wieder mache ich so etwas mit.«
Heller konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Dabei war sein Assistent vor der Reise begeistert gewesen, zu der Delegation gehören zu dürfen.
Aber Oldenbusch war es ernst. Er beugte sich zwar vertraulich vor, sprach aber keinen Deut leiser.
»Die kriechen den Russen doch nur in den Arsch. Es gibt zu allem nur ein Ja und Amen. Diskussionen kommen gar nicht erst auf. Die lesen alle ihre Reden ab, beschwören den Sozialismus, die deutsch-sowjetische Freundschaft und danken den Befreiern. Druschba, Druschba überall. Immer die gleichen Phrasen! Da weiß keiner, wie der Mann auf der Straße redet.«
Heller wollte etwas erwidern, aber Oldenbusch war nicht zu bremsen.
»Nicht mal gutes Essen gab es. Nur dünne Brühe und trockenes Brot. Wie zu Hause. Und ich sage Ihnen, auch in Berlin ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Unser Hotel war eine halbe Ruine. Bettzeug musste man beim Abgeben mit Stempel quittieren lassen. Ein Unding!«
»Werner …«, versuchte es Heller noch einmal vergeblich.
»Selbst Niesbach ist eingeschlafen! Das hält kein Mensch drei Tage aus«, polterte Oldenbusch weiter.
»Nun, Werner, als Parteigenosse müssen Sie Pflichten wie diese …«
»Überall wird man kontrolliert. Und Scheine braucht man. Wehe du verlierst einen. Pass, Reiseschein, Passierscheine für Berlin, für jede Zone. Sonderlebensmittelmarken, Fahrkarten für den Zug, und dann muss man sich auch noch streiten, obwohl man Sitzkarten hat, weil jemand die Plätze blockiert. Und raten Sie, wer? Bonzen, wie früher!«
Heller hob resignierend die Hände, aber Oldenbusch beachtete ihn nicht. Er wurde sogar noch lauter.
»Überall wird man beklaut. Und die Bauern haben satt zu essen, und in der Stadt kommt nichts an. Was nützt da die Enteignung der Junker?«
»Fragen Sie mich das jetzt, Herr Kommissar?«, sagte Heller deutlich.
Das brachte Oldenbusch zur Räson. Etwas verlegen wischte er sich Staub von seiner Jacke. »So viele sind schon in den Westen gegangen«, murmelte er trotzig. »Wenn man hier wenigstens selbst entscheiden könnte, nach deutschen Belangen. Doch es wird nur gemacht, was die Russen wollen.«
»Die Sowjets, Werner, es sind die Sowjets.«
Oldenbusch nickte ergeben und versank in die Betrachtung des dunkelroten Linoleumbodens. Heller musterte ihn amüsiert. Er kannte Werner Oldenbusch schon sehr lang und wusste, dass der Mann nie lange niedergeschlagen sein konnte. Doch heute wollte sein Assistent nicht so schnell von seiner bedrückten Stimmung lassen. Deshalb zog Heller seine Schreibtischschublade auf, brach ein Stück von der Schokolade ab, die Karin ihm mitgegeben hatte, und hielt es Oldenbusch hin. Der blickte durch Hellers Hand hindurch und zeigte keine Regung. Heller legte das Schokoladenstückchen an der Schreibtischkante ab.
»Was das noch werden soll, Max«, raunte Oldenbusch. »Die Deutschen im Westen sind alle satt und bekommen von allem das Beste. Wir werden nur hingehalten. Hat mich doch wirklich einer gefragt, wie es sich lebt in Sowjetdeutschland. Ich sage Ihnen, Max, die haben unser Land längst unter sich aufgeteilt. Insgeheim ist der Anschluss an die Sowjetunion längst gebilligt.«
Heller atmete tief durch. Wenn Oldenbusch, selbst SED-Mitglied, schon die Absichten der Partei hinterfragte, was redeten dann erst die Leute auf der Straße. Beinahe alles, was die Politiker taten, war ungeschickt. Noch immer demontierten die Befreier ganze Fabriken, noch immer fingen sie Leute von der Straße weg und steckten sie in Lager. Die Westmächte ließen die Kriegsgefangenen alle frei, während die Sowjets Millionen Männer nicht nach Hause ließen. Sie hielten tönende Reden und priesen die Errungenschaften des Sozialismus an, während die Menschen hungerten.
»Kommen Sie, Werner, Sie wissen selbst, es wird immer weitergehen«, argumentierte Heller etwas lahm.
Oldenbusch schnaufte und nickte. Dann angelte er sich die Schokolade vom Tisch und warf sie sich in den Mund.
»Von Ihrem Erwin?«, fragte er schmatzend.
Heller nickte. »Wir fragen uns nur, ob er es übrig hat oder sich vom Mund abspart. Er schreibt ja immer, dass es ihm gut geht. Er hat eine kleine Wohnung und studiert Jura.« Dass Erwin auch jedes Mal schrieb, dass sie zu ihm kommen sollten in den Westen, erzählte er Oldenbusch nicht. Ein heikles Thema. Heller war noch nie auf den Gedanken gekommen, seine Heimat zu verlassen. Und was Karin dachte, traute er sich nicht zu fragen. Sie sprachen nicht darüber. Wenn sie zu Erwin gingen, was wäre mit Klaus? Der würde niemals gehen.
Das Telefon klingelte. Heller nahm ab, meldete sich knapp, lauschte kurz und machte sich Notizen, die Oldenbusch interessiert versuchte mitzulesen.
»Ein Unfall?«, fragte er, als Heller aufgelegt hatte.
»Wir werden sehen. Ist der Wagen fahrbereit?«
»Ich will’s hoffen, sie wollten ihn flottkriegen, bis ich wiederkomme.«
18. Juni 1948, früher Vormittag
Heller beugte sich über das Loch in der Erde, ohne zu dicht heranzutreten. Er sah kaum mehr als die nackten Fußsohlen eines Menschen.
»Chef, Obacht!«, rief Oldenbusch. Heller tat wieder einen Schritt zurück und überließ Oldenbusch das Feld. Aufmerksam betrachtete er die Umgebung an der Rennersdorfer Straße. Die Gegend nahe der Weißeritz hatte vor allem unter dem letzten Bombardement der Amerikaner gelitten, die es auf das Reichsbahnausbesserungswerk am anderen Ufer des kleinen Flusses abgesehen hatten. Auch hier waren die Straßen geräumt und einige Ruinen schon abgetragen. Andere lagen noch genauso da, wie sie vor drei Jahren zusammengestürzt waren. Es gab viele Freiflächen und doch einige Häuserzeilen, die allen Bomben getrotzt hatten. Auf den Straßen fanden Schachtarbeiten statt. Weiter oben auf der Lübecker Straße standen Arbeiter und schauten der Polizei zu. Als Heller sich ihnen näherte, formierten sich die Männer zu einer Reihe, so dass Heller sich einer Front abweisender Gesichter und vor der Brust verschränkter Arme gegenübersah.
»Guten Morgen«, grüßte Heller.
»Morsche!«, erwiderte der Älteste von ihnen, offensichtlich der Vorarbeiter, ein großer, kräftiger Mann von etwa sechzig Jahren in schwarzer Arbeitskluft.
»Was ist das für ein Schacht?« Heller deutete hinter sich auf die Stelle, wo der Tote kopfüber in dem Loch steckte.
»Ein Sichtschacht. Zur Überprüfung. Dort wird ein Bach unterirdisch in einen Kanal geführt. Da muss irgendwo ein Rohrbruch vorliegen. Der Schacht war jedenfalls vorschriftsmäßig abgesichert.«
»Daran zweifle ich nicht.« Heller hatte die hölzernen rot-weiß bemalten Absperrzäune wahrgenommen, die man natürlich auch nachträglich noch hätte hingestellt haben können.
»Hat einer von Ihnen die Leiche gefunden?«
»Der Horstel.« Der Ältere zeigte auf einen jungen Mann, der gerade sechzehn, höchstens siebzehn Jahre alt war. Seine Mundwinkel zuckten, als wollte er etwas sagen, traute es sich aber nicht. »Der hat aber nichts angefasst, nur sein Schuhabdruck ist da. Das haben wir den Genossen von der Vopo schon mitgeteilt.«
»Woher wussten Sie, dass die Person tot war?«, fragte Heller den Jungen.
Horstel öffnete den Mund, da kam ihm der Polier zuvor.
»Wir sind schon drei Stunden auf der Baustelle gewesen. In dieser Zeit ist da keiner reingestürzt, das hätten wir sehen müssen.«
»Ich hatte nicht Sie gefragt«, sagte Heller, ohne den Mann anzusehen.
»Der Horstel hat mich aber gleich gerufen, er kann also auch nicht mehr wissen als ich.«
Jetzt wandte sich Heller doch dem Vorarbeiter zu und nahm sein Notizbuch heraus. »Ihr Name!«, forderte er ihn auf.
»Bodefeld, Manfred.«
»Wann haben Sie zuletzt in den Schacht hineingesehen? Gestern?«
»Gestern nicht. Dienstag, oder?« Die anderen Männer nickten.
»Halten Sie sich zur Verfügung«, befahl Heller und ging zu seinem Assistenten zurück.
»Dienstag? Also konnte der Tote schon drei Tage in dem Loch stecken«, bemerkte Oldenbusch. »Nicht viel zu holen hier«, sprach er weiter, »auf dem Gras gar nichts, hier auf den Granitplatten auch nicht. Nur ein Schuhabdruck auf dem zertretenen Erdklumpen, aber der ist von einem der Arbeiter. Lassen wir den Toten hinaufziehen?«
Heller stimmte nickend zu und winkte die zwei Bestatter heran, die schon seit einiger Zeit bereitstanden. Die Männer trugen trotz der Wärme schwarze Mäntel und Handschuhe. Anscheinend hatten sie alles schon besprochen und gingen pragmatisch an die Sache heran. Einer hatte eine Schlinge in ein starkes Seil geknüpft, die legten sie nun um die Füße der Leiche, zurrten sie fest und versuchten, den Körper nach oben zu ziehen. Das erwies sich als schwierig, denn der Leichnam steckte fest in dem engen Loch. Erst nach mehrmaligem Ziehen gab es einen Ruck und der Tote rutschte ein Stück hoch. Der Hose nach war es ein Mann. Einer der Bestatter ließ das Seil los, stellte sich breitbeinig über das Loch, um den Toten an den Beinen zu packen, und zog mit Leibeskräften. Der korpulente Körper rutschte noch etwas weiter hinauf, wobei die Jacke umklappte, den Kopf verdeckte und die Arme schlaff nach unten fielen. Mit vereinten Kräften zogen sie den Toten ein Stück weg von dem Schacht und legten ihn bäuchlings auf der Straße ab. Dann zogen sie die mit Erde verdreckte Jacke wieder nach unten und drehten den Toten um. Entsetzt fuhren sie zurück. Trotz aller Abgebrühtheit war der Anblick des Toten, der eine ganze Zeit lang im Wasser gehangen haben musste, selbst für sie abstoßend. Bis zum Hals war er völlig verquollen, die Haut war weiß und schwammig. Die offenen Augen starrten sie milchig trüb an und die Pupillen waren kaum zu erkennen. Die Zunge hing wie ein toter schwarzer Molch aus dem Mund, die Lippen waren lila-blau und erinnerten an madige Pflaumen.
Heller bückte sich und suchte in der Jacke des Toten nach einer Brieftasche. Er fand einige Geldscheine, die er Oldenbusch gab, und einen schmalen Packen Papiere, die er auseinanderfaltete und las.
»Wilfred Stiegler, geboren 1912, wohnhaft in …« Heller sah sich um. »Hier. Wo ist die Pennricher?«
»Diese Richtung, da die Straße hoch«, erklärte einer der Bestatter. »Vielleicht kam er aus der Kneipe in Altcotta.«
Heller nestelte den einen Gummihandschuh, der ihm noch geblieben war, aus seiner Jackentasche. Der andere war vorletzte Woche zerrissen und es hatte sich noch kein Ersatz gefunden. Eigentlich war der verbliebene für die linke Hand, doch Heller zog ihn sich kurzentschlossen über die rechte. Er nahm den Kopf des Toten und drehte ihn erst nach links, dann nach rechts. Das Wasser lief dem Toten aus Nase und Mund und eine Wolke süßlichen Gestanks stieg auf. Heller drehte kurz sein Gesicht weg, dann tastete er den Schädel der Leiche nach Verletzungen ab, anschließend auch den Hals und den Oberkörper, aber er fand keinen noch so kleinen Hinweis auf einen Kampf oder Überfall.
»Vielleicht war er nur neugierig und wollte einen Blick reinwerfen und ist hineingestürzt. Vielleicht war er betrunken«, spekulierte Oldenbusch.
Heller zog sich den Handschuh ab. »Immerhin fehlen ihm Schuhe und Strümpfe. Seiner Kleidung nach konnten es recht gute Schuhe gewesen sein.«
»Genauso gut könnte ihm jemand die Schuhe abgenommen haben, als er schon da drinnensteckte.«
Denselben Gedanken hatte Heller auch schon gehabt. »Wir müssen ihn zu Doktor Kassner ins Pathologische Institut bringen lassen. Ich gehe von einem Unfall aus. Befragen wir noch mal die Arbeiter, wie das Loch genau abgesichert war. Und es muss jemand in die Kneipe geschickt werden, Zeugen suchen. Salbach soll das machen. Kümmern Sie sich, Werner.«
Als sie am späten Vormittag ins Büro zurückkamen, klingelte bereits Hellers Telefon.
»Heller … Ja … Ich verstehe … Und Kassner ist nicht da?«, kommentierte Heller die Nachricht des Anrufers. »Dann muss das eben so lange warten. Sie darf weder den Angehörigen noch dem Krematorium übergeben werden … Ja, ich notiere mir das. Bleiben Sie an der Sache dran.« Heller legte auf.
»Salbach hat keine Angehörigen gefunden. Ein paar Zeugen haben außerdem ausgesagt, Stiegler hätte seine Stammkneipe vorletzte Nacht mit einer Frau verlassen, andere sagen, er sei allein gegangen«, erklärte er dem erwartungsvoll blickenden Oldenbusch. »Salbach will …« Das Telefon klingelte erneut.
»Heller … Aha …« Heller schrieb mit, während Oldenbusch sich den Hals verrenkte, um das Geschriebene mitlesen zu können. »Wir kommen.«
Mit Wucht knallte Heller den Hörer auf die Gabel. »Können Sie nicht die zwei Sekunden abwarten, bis ich Ihnen sage, was geschehen ist?«
»Entschuldigung«, murmelte Werner.
Heller stand auf und nahm seine dünne Blousonjacke wieder vom Haken. Sie war aus Fallschirmstoff. Erwin hatte sie geschickt. »Heute ist kein guter Tag. Offenbar ein totes Kind.«
18. Juni 1948, Mittag
Oldenbusch bremste den schwarzen Ford Eifel ab und bog in die Mommsenstraße ein, um zu halten. Heller kurbelte das Seitenfenster hoch und stieg aus. Obwohl der Wagen gerade erst aus der Werkstatt zurück war, gab der Motor schon wieder seltsame Geräusche von sich.
»Ich lasse ihn lieber laufen«, meinte Oldenbusch mit besorgtem Blick. Heller nickte nur, warf die Tür zu und sah dem uniformierten Polizisten, der sie schon erwartet hatte, auffordernd entgegen.
Der Polizist, der eine blau gefärbte Wehrmachtsuniform trug, grüßte mit der Hand am Tschako. Heller gab den Gruß zurück und sah sich dann kurz um. Auf dem Gelände der Technischen Hochschule wurde gebaut. Die Erde war aufgerissen und Rohrleitungen wurden verlegt. Ziegelberge türmten sich und eine mächtige Planierraupe schob sich abseits durch den Schutt, in Staubwolken eingehüllt, die sich mit den schwarzen Dieselabgasen vermengten. Weiter hinten auf der Baustelle wurden dicke Ziegelwände gemauert. Zementmischer rumpelten vor sich hin. An dem Ausleger eines auf Gleisen stehenden Krans flatterte eine rote Fahne träge im Wind. Auf der linken Seite erhob sich die leere Fassade eines hohen Gebäudes, hinter dessen Mauern Presslufthämmer knatterten. Durch die Fenster der obersten Etage konnte Heller den Himmel sehen. Doch die Ruine war stabilisiert und zum Wiederaufbau freigegeben. Direkt vor ihnen jedoch standen alle Maschinen still. Ein Vorkriegsbagger der Firma Menck & Hambrock hatte seine Schaufel abgestellt. Drei Arbeiter hatten sich in den Schatten der Maschinen zurückgezogen und sprachen kein Wort. Zwei Polizisten standen in ihrer Nähe. Heller ließ sich von dem Uniformierten auf das Gelände führen.
»Wir vermuten einen Unfall. Der Bauingenieur, Genosse Friedrichs, bestand jedoch auf eine genaue Untersuchung«, erklärte der Polizist.
»Liegt er noch da?« Heller musste genau achtgeben, wohin er seinen Fuß setzte. Die Spuren, die von Lastkraftwagen und Baggern nach dem letzten Regen vor einigen Wochen in den Schlamm gedrückt worden waren, waren durch die anhaltende Dürre festgebrannt und steinhart. Kleinere Lehmklumpen zerbrachen unter Hellers Schuhsohlen.
»An der Stelle, wo er gefunden wurde. Seine Lage wurde jedoch verändert, weil man zuerst glaubte, ihm helfen zu können. Achtung, da vorn ist ein Graben!« Der Polizist nahm zwei Schritte Anlauf und sprang darüber. Heller tat es ihm gleich, landete mit dem linken Fuß, wie er es sich angewöhnt hatte. Für Oldenbusch mit seinem kriminaltechnischen Handwerkszeug mussten sie einen anderen Weg finden, stellte Heller fest.
»Dort ist es.« Der Polizist blieb stehen, deutete auf einen weiteren Graben, im Schatten der Ruine.
Heller kam näher und sah hinunter. Obwohl er sich kaum angestrengt hatte, schwitzte er schon wieder in der heißen Mittagssonne. Er nahm sein Taschentuch heraus, setzte seine Mütze ab und wischte sich über Stirn und Genick. »Gehört er nicht zu den Arbeitern?«, fragte er.
»Laut Aussage des Poliers nicht. Angeblich hat ihn noch nie jemand gesehen.«
Heller ging in die Hocke, stützte sich mit einer Hand ab und sprang in den Graben.
Der Junge hatte dunkles Haar und lag auf den Rücken, doch die linke Gesichtshälfte sah seltsam platt gedrückt aus, die Nase war ganz schief. Er hatte auf dem Bauch gelegen, jemand hatte ihn umgedreht. Heller betrachtete die schreckliche Totenmaske, bückte sich dann, um den Jungen am Jackenärmel anzuheben. Er war vollkommen steif. Er musste mindestens seit zwölf Stunden hier liegen. Die Hitze beschleunigte die Totenstarre.
»Und man hat ihn erst vor etwa einer Stunde entdeckt?« Vielleicht konnte ein Bestatter den Jungen ein wenig herrichten, wenn die Starre nachließ. In diesem Zustand würde man ihn seinen Eltern nicht zeigen können. Sofern er welche hatte. Heller knöpfte dem Jungen die Jacke und das darunterliegende Hemd auf. Er suchte im Kragen nach einem eingenähten Namen oder einem anderen Hinweis.
Der Uniformierte sah auf seine Uhr. »Vor zirka vierzig Minuten, ja.«
»Und er gehört wirklich nicht hierher? Ein Lehrling vielleicht. Wie alt mag er sein? Vierzehn?«
»Da müssen Sie die Arbeiter noch einmal dazu befragen«, sagte der Polizist.
Heller erhob sich und betrachtete den Toten nachdenklich. Seine Hosen waren viel zu weit, obwohl sie schon eingenäht waren, die Hosenbeine waren dagegen viel zu kurz. Die Jacke wirkte abgewetzt und hatte Aufnäher an den Ellbogen. Die Schuhe des Jungen waren riesig und mehrfach geflickt, und die Sohle schien aus alten Autoreifen geschnitten zu sein.
Jetzt blickte Heller zu dem Polizisten hoch, dem das Unwohlsein in das junge blasse Gesicht geschrieben war. Vielleicht hatte er noch nie einen Toten gesehen, dachte Heller, obwohl das eigentlich kaum möglich sein konnte. »Ist das Gelände in der Nacht abgesperrt?«, fragte er ihn.
»Es ist von einem Bretterzaun umgeben. Der wird nach Feierabend geschlossen. Er stellt jedoch kein großes Hindernis dar.«
Heller legte seinen Kopf in den Nacken, sah an der Hauswand hinauf. »Ist die Ruine gegen Zutritt gesichert?«
Der Schupo nickte und schüttelte dann trotzdem den Kopf. »Es ist ebenfalls abgesperrt, aber wer hier hineinwill, der kommt auch hinein.«
Heller hockte sich noch einmal neben die Leiche und untersuchte den Boden genauer. »Wissen Sie, wer den Jungen umgedreht hat?«
Der Uniformierte wollte etwas sagen, schloss dann aber schnell wieder den Mund und schüttelte nur den Kopf.
»Falls Sie sich erbrechen müssen, entfernen Sie sich bitte vom Fundort«, befahl ihm Heller.
»Es geht schon wieder.« Der junge Mann schnappte nach Luft.
Heller gab die Suche auf. Auf dem steinharten Boden war es unmöglich, irgendwelche Spuren zu finden. Der Junge war äußerlich nicht verletzt, er hatte nicht einmal geblutet. Um aus einem der Fenster gestürzt zu sein, lag er ein wenig zu weit weg von der hohen Fassade. Es sei denn, er wäre abgesprungen, überlegte Heller. Doch warum sollte er das tun?
»Helfen Sie mir hinauf«, bat Heller und hielt dem Schutzmann eine Hand hin. Der griff zwar zu, doch schaffte es nur mit Müh und Not, Heller herauszuziehen. Beinah verlor Heller den Halt und musste sich mit dem Knie im Dreck abstützen.
»Hören Sie, solche Dinge kommen vor.« Heller klopfte sich den Schmutz von der Hose. »Sie müssen lernen, damit umzugehen.«
Der Schupo nickte zwar, wirkte aber immer noch niedergeschlagen. Heller klopfte ihm auf die Schulter. »Sie schaffen das schon.« Etwas Besseres war ihm angesichts der Situation nicht eingefallen. Wenn man Polizist werden wollte, musste man solche Dinge akzeptieren lernen. »Gehen Sie zum Kranführer. Er soll den Kranarm hier herüberschwenken.«
»Jawohl.« Der Schutzmann wollte abtreten.
»Warten Sie noch«, befahl Heller. »Ihren Namen?«
»Weesmann, Georg.«
Heller notierte es sich in seinem Notizbuch. »Nur für das Protokoll. Sagen Sie den Herren, dass ich sie gleich noch befragen werde. Sie sollen sich nicht entfernen.«
Der Schutzmann grüßte noch einmal militärisch, blieb aber stehen. »Glauben Sie, dass es ein Unfall war? Denken Sie, er ist auf den Kran geklettert?«
»Vermutlich.« Heller nickte und steckte das Notizbuch weg. Er hatte Oldenbusch kommen sehen, der einen Umweg um den Graben gefunden hatte und jetzt schwitzend und ächzend seinen Koffer neben sich abstellte.
»Jetzt ist der vermaledeite Motor von allein ausgegangen. Bestimmt ist das Benzin schlecht«, murrte Oldenbusch, nachdem der Schupo abgetreten war.
Heller nickte gedankenverloren und beobachtete den Kranführer, der gerade den Unterwagen bestieg, auf dem der Kranturm befestigt war. Wenige Sekunden später sprang der Motor an und der Ausleger schwenkte langsam zu ihnen hinüber. Heller winkte den Kran näher heran, der sich daraufhin langsam auf seinen Gleisen auf ihn zubewegte, und drehte sich zu Oldenbusch um.
»Was meinten Sie, Werner?«, fragte er.
Oldenbusch sah nach oben und verzog den Mund. »Warum sollte er auf den Kran geklettert sein?«
»Eine Mutprobe?«
Der Kranführer war jetzt aus dem Führerhaus geklettert und schlenderte auf Heller zu.
»Kriminaloberkommissar Heller«, stellte Heller sich vor. »Waren Sie es, der den Jungen entdeckt hat?«
»Nee, das war der Schreiber, Hans.« Der Kranführer, ein Mann von über fünfzig, mit Schnauzer und Halbglatze, hatte seine Hände in die Taschen der grauen Arbeitshose gesteckt.
»Wie heißen Sie?« Heller hielt Stift und Notizbuch parat.
»Schmidt, Christian.«
»Sind Sie der Einzige, der diesen Kran bedienen kann?«
»Nee, das können auch andere.« Schmidt blickte ernst, es war nicht auszumachen, ob er sich über Heller lustig machte. Heller beschloss, gelassen zu bleiben.
»Aber Sie sind der Einzige, der diesen Kran auf der Baustelle bedient?«
»Das bin ich.«
»Und können Sie sich erinnern, ob Sie ihn gestern zum Feierabend in dieser Position verlassen haben?«
»Das weiß ich nicht mehr genau.«
Heller sah den Mann forschend an. Er wusste, dass vor allem unter den Arbeitern Unzufriedenheit herrschte. Sie fühlten sich bevormundet und von den Sowjets unterdrückt. Sie arbeiteten hart, mussten ihre Vorgaben erfüllen und hatten trotzdem das Gefühl, dass alles, was sie taten und bauten, den Russen und den neuen Eliten zufiel. Niemand wagte den offenen Widerstand, doch gemurrt wurde viel. Für jemanden wie Schmidt war auch er nur ein Handlanger der Sowjets.
»Haben Sie den Kran heute Morgen in dieser Position vorgefunden?«
»Denken Sie denn, jemand hat das Ding in der Nacht bewegt?«, fragte Schmidt zurück.
Oldenbusch mischte sich in barschem Tonfall ein. »Die Baustelle wird doch bewacht, nicht wahr?«
Schmidt nickte eifrig. »Freilich, sonst würde sich hier jeder bedienen!«
»Also, haben Sie den Kran in dieser Position vorgefunden?«
»Weeß ich nicht mehr so genau, kann schon sein.« Der Kranführer zuckte mit den Achseln.
Heller reichte es jetzt. »Da liegt ein toter Junge, der vielleicht vom Kran gestürzt ist. Ich bin auf Ihre Unterstützung angewiesen, um diese Sache zu klären, verstehen Sie das?«
»Wenn der Bengel sich hier herumtreibt, ist das nicht meine Angelegenheit.«
»Wir können es aber zu Ihrer Angelegenheit machen«, knurrte Oldenbusch.
Der Kranführer zuckte sichtbar zurück und seine Hände fuhren aus den Hosentaschen.
Heller hob beruhigend die Hand. »Gehen Sie noch einmal in sich. Vielleicht können Sie sich mit Ihren Kollegen beraten. Niemand verlässt die Baustelle, bis ich nicht mit jedem gesprochen habe, der heute anwesend war.«
Der Mann wandte sich ohne Widerworte ab und ging zu seinem Kran zurück.
»Was soll das denn heißen, ›zu Ihrer Angelegenheit machen‹?«, fragte Heller Oldenbusch verärgert.
»Na ja, ich wollte nur ein wenig …«
»Genau das erwarten sie von uns. Die betrachten uns nicht als Freunde oder Helfer. Für die sind wir ein Teil der Obrigkeit.« Heller sah dem Mann nach. »Wieder einmal«, fügte er seufzend hinzu. Er sah zu dem toten Jungen.
»Kommen Sie, Werner, ich will Ihnen etwas zeigen.« Heller ging in die Hocke, stützte sich mit einer Hand auf und ließ sich in den Graben hinabgleiten.
Doch Oldenbusch zögerte, sah sich suchend um, entdeckte etwas und ging es holen. Mit einer hölzernen Leiter kehrte er zurück, stellte sie in den Graben und kletterte an ihr hinunter.
Heller hatte sich bereits zu dem Jungen hinuntergebeugt, ihm die Kleidung geöffnet und seinen mageren Oberkörper freigelegt. Unter der Haut des Toten zeichneten sich die Rippen deutlich ab.
Oldenbusch betrachtete den Körper nachdenklich.
»Wenn es eine Mutprobe gewesen sein soll, muss es Zeugen geben«, überlegte er laut. »Er muss es schließlich vor jemandem beweisen können.«
»Es sei denn, er hatte es auf die rote Fahne auf dem Kranausleger abgesehen«, widersprach Heller. »Als Beweis dafür, dass er auf dem Kran gewesen war. Aber vermutlich haben Sie recht, Werner, jemand wird es gesehen haben. Bestimmt sind die anderen einfach davongelaufen, nachdem er abgestürzt war. Aber Werner, sehen Sie mal.«
Heller war auf etwas aufmerksam geworden, das er jetzt aufhob. Es war eine Stofftasche, aus einer alten Gardine mit groben Stichen zusammengenäht, braun, kaum vom Lehmboden zu unterscheiden. Mit spitzen Fingern öffnete er die Tasche, betrachtete den Inhalt und nahm dann ein Stück nach dem anderen heraus. Er fand ein kleines Klappmesser, ein Taschentuch, etwas Speck, in Butterbrotpapier eingewickelt, eine aufgewickelte Schnur, zwei verdörrte Zwiebeln, ein kleines Fläschchen und einen Kanten hartes Brot, kaum groß genug, um eine Mahlzeit zu sein. Heller hob das braune Fläschchen mit zwei Fingern hoch und hielt es gegen das Licht. Es war leer und der Schraubverschluss fehlte. Heller roch daran, konnte aber keinen markanten Geruch ausmachen. Es war offensichtlich ein Medizinfläschchen, auf dem die Beschriftung fehlte, doch es war die Stelle zu erkennen, an der ein Etikett geklebt hatte. Vorsichtig tat er es in die Tasche zurück und überreichte sie Oldenbusch.
»Hier, Werner, vielleicht sagt Ihnen der Inhalt etwas.« Dann blickte er wieder auf den Jungen. »Schauen Sie sich das mal an.« Er deutete auf den Oberkörper, der mit blauen und schwarzen Flecken übersät war.
»Das kommt nicht vom Sturz«, schlussfolgerte Oldenbusch nach einigem Zögern. »Eher von einer Prügelei.«
Heller knöpfte das Hemd des Jungen wieder sorgfältig zu. »Ich will ihn auch zu Kassner bringen lassen. Diese Flecken sind nicht von einer Prügelei. Die Blutergüsse befinden sich in verschiedenen Stadien der Heilung. Manche sind schon Wochen alt, andere sind ganz frisch.«
Eine schlimme Ahnung schwang in seinen Worten mit. Heller betrachtete das Gesicht des Jungen, ohne es wirklich zu sehen. Ein anderes Gesicht hatte sich auf einmal davorgeschoben. Eine Erinnerung. Eine, von der er wünschte, es gäbe sie nicht.
Da näherten sich Schritte, ein Mann trat an den Graben.
»Entschuldigen Sie. Aber meine Leute würden jetzt gern zu Mittag essen. Wenn se nach zwölfe kommen, wird in der Kantine nichts mehr da sein.«
»Mit wem habe ich denn bitte die Ehre?«, fragte Heller, der es nicht leiden konnte, wenn er von jemandem angesprochen wurde, der sich nicht vorstellte.
»Mein Name ist Flossel, Herbert Flossel. Ich bin der Polier. Genosse.«
»Heller, Oberkommissar.« Grundsätzlich verstand Heller das Anliegen des Poliers, wusste er doch nur zu gut, wie viele Gedanken man an die nächste Mahlzeit verwenden konnte, vor allem wenn man befürchtete, sie zu verpassen. Er selbst dachte seit Dienstbeginn an sein Mittagessen.
»Schreiben Sie mir eine Namensliste aller Männer. Dann schicken Sie sie zum Essen. In einer Stunde sollen alle wieder zurück sein. Ausnahmslos. Und bringen Sie mir eine Plane, bitte, oder ein Tuch, mit dem wir den Jungen zudecken können. Sagen Sie, wissen Sie etwas von einer Bande, die sich hier vielleicht in der Gegend herumtreibt?«
»Hier gibt es einige Banden. Die stellen eine Menge Unfug an. Manchmal brechen sie in die Bauwagen ein oder stehlen Armierungseisen und Kabel von der Baustelle. Die verkaufen sie dann beim Altmetallhändler. Andere beschmieren den Bauzaun oder legen auch mal Feuer.«
»Geschieht es oft, dass sich jemand illegal auf der Baustelle aufhält?«
»Die machen sich einen Spaß daraus, den Posten zu foppen, der nachts die Baustelle bewacht. Die einen lenken ihn ab, die anderen stiften Unheil.«
»Sie haben aber diesen Jungen noch nicht gesehen?«
Flossel zog die Mundwinkel nach unten. »Die sehen doch alle gleich aus für mich, Lumpenpack, allesamt.«
»Meinen Sie denn, das sind Waisenkinder? Flüchtlinge vielleicht?«
»Ach was, der Spuk geht immer los, wenn die Schule vorbei ist. Die müssen hier in der Gegend wohnen, streunen immer nur nachmittags herum und nachts. Auf der Nöthnitzer und der Coschützer gibt es Schulen. Vielleicht fragen Sie da mal.«
18. Juni 1948, Nachmittag
Als Heller das Gebäude der 55. Grundschule in der Nöthnitzer Straße wieder verließ, steckte in seinem Notizbuch ein Zettel des Schulleiters mit etwa zwanzig Namen von Kindern, die nicht zum Unterricht erschienen waren. Es hatte mehr als eine Stunde gedauert, diese Namen zusammenzutragen. Da die Schüler der zerstörten 39. Volksschule auch dort unterrichtet wurden, waren die Klassen mit an die vierzig Kindern überfüllt. In dem teilweise zerstörten Gebäude besaßen einige Zimmer immer noch keine Fensterscheiben, an den Tischen mussten die Kinder zu viert sitzen. Die Lehrer konnten die Ordnung nur mit außerordentlicher Strenge aufrechterhalten. Einige Klassen mussten erst durchgezählt werden, was in beinahe militärischer Manier geschah. Manche der Kinder hatten sich noch nicht einmal das Hackenknallen abgewöhnen können. Die Neulehrer, selbst gerade erst dem Schüleralter entwachsen, störten sich nicht daran. Sie waren in der Nazizeit groß geworden und kannten es nicht anders. Obwohl ihnen eine eilige sozialistisch geprägte Ausbildung angediehen worden war, wollte Heller sich nicht ausmalen, wie viele nationalsozialistische Ideale und Vorurteile nach wie vor in ihnen steckten. Vom Sozialismus überzeugt waren die wenigsten. Pragmatismus war eine Überlebensstrategie. Stolz nur ein Hindernis. Die Parteizugehörigkeit ein Vorteil. Kompetenz zählte nur bedingt. Es schien sich nie etwas zu ändern.
Heller war nicht zufrieden. Er hatte sich mehr erhofft von dem Besuch in der Schule. Letztlich waren die Kinder auf der Liste allesamt zu jung, als dass eines von ihnen der Junge gewesen sein konnte. Und sein Magen knurrte lauter als zuvor. In der Grundschule hatte es nach Essen gerochen. Doch die Mittagszeit war vorbei gewesen und die Kinder hatten nichts übrig gelassen, oder aber es war in den Töpfen der Essensfrauen verschwunden. Nicht einmal einen Kanten Brot hatte man für ihn.
Heller lief jetzt in Richtung des Plauener Rathauses und bog dann links ab in die Coschützer Straße. Unwillig registrierte er den steilen Anstieg der Straße. Doch es half nichts, er musste zur Oberschule Dresden Süd hochlaufen.
Die steil stehende Sonne brannte ihm auf den Rücken und trieb ihm den Schweiß aus den Poren. Es war nicht weit, doch die Straße war steil und der Anstieg nicht minder beschwerlich wie am Vortag die Plattleite hinauf. Schülergruppen kamen ihm entgegen. Die Schule war aus, und wenn er sich nicht beeilte, war die Schule womöglich sogar geschlossen. Heller ärgerte sich. Hätten sie mehr Leute bei der Polizei zur Verfügung, wären diese Schulbesuche nicht seine Aufgabe gewesen.
Seine Befürchtung, den Weg heute umsonst gemacht zu haben, schien sich zu bewahrheiten, denn nun stand Heller am Haupteingang und rüttelte vergeblich an der verschlossenen Tür. Ein Plakat war an der Tür angeschlagen: Schüler, helft beim Aufbau des Sozialismus, sammelt Glas.
»Wo wolln Se hin? Die Lichtspiele beginnen erst um sechse abends«, sagte eine Stimme.
Heller sah sich um und entdeckte einen Mann mittleren Alters, der in den Gemüsebeeten vor der Schule gearbeitet hatte und nur noch seinen linken Arm besaß.
»Guten Tag. Oberkommissar Heller. Ich muss zum Schuldirektor.«
»Neubert, mein Name.« Er kam humpelnd näher. In seiner Hand hielt er eine kleine Egge, die er sich jetzt unter seinen Armstumpf klemmte. Dann nahm er seine schirmlose Kappe ab, die wie die Kopfbedeckung einen Sträflings aussah. Er knüllte sie in seine Hosentasche, holte einen Lappen aus der Jacke und wischte sich über die Glatze. »Da haben Sie aber Pech.«
»Bin ich zu spät?«
»Nein, das nicht, aber Sie müssen mit einer Direktorin vorliebnehmen.« Der Mann setzte seine Kappe wieder auf und grinste amüsiert.
Heller betrachtete den Mann. Sein Alter war schwer zu schätzen. Und es war absurd, dass man sich fragen musste, in welchem Krieg er seinen Arm verloren hatte. Einige gab es, die in beiden Kriegen gekämpft hatten. Als ob nicht schon der erste Grund genug gewesen wäre, nie wieder Krieg zu führen.
»Sie sind wohl der Hausmeister hier?«
Der Mann nickte. »Und im Winter Heizer, wenn es was zum Verheizen gibt. Neulich waren welche da, die haben sich die Orgel angesehen. Der Frost der letzten Winter hat ihr nämlich mächtig zu schaffen gemacht. All das Holz und die Röhrchen brauchen gleichmäßige Temperaturen, sonst springt das alles oder beginnt zu rosten.« Der Mann zögerte. »Na, ich seh schon, das interessiert Sie nicht.«
Heller machte eine entschuldigende Geste. »Ich bin in einer ernsten Angelegenheit hier.«
Der Hausmeister setzte eine sachliche Miene auf. »Dann will ich Sie mal zu Frau Doktor Schleier bringen.«
Frau Doktor Schleier war eine kleine, schmale Frau um die vierzig, mit kurzgeschnittenem Haar und einer Brille, die nicht für sie gemacht zu sein schien, sie wirkte viel zu groß. Tatsächlich schob die Direktorin ihre Brille mit einer fahrigen Handbewegung nach oben, kaum dass sie sich vorgestellt hatten.
Sie wirkte resolut, doch Heller spürte eine skeptische Zurückhaltung in ihrem Verhalten, als sie ihn in ihr Zimmer bat. Ihm war es, als würde sie ihn kennen. Nicht weil sie ihm bekannt vorkam, sondern weil sie sich gab, als hätte sie Grund, sich vor ihm zu fürchten.
Mit einer knappen Handbewegung deutete sie auf einen Stuhl. »Wenn Sie mir Ihr Anliegen schildern würden, ich bin in Eile.« Sie selbst nahm hinter ihrem Schreibtisch Platz. An der Wand hinter ihr blickte Stalin auf sie herab. Eine rote Sowjetfahne links und eine rote Fahne mit dem Emblem des FDGB rechts rundeten das Ensemble ab.
Hellers Blick blieb ein wenig zu lang daran hängen. Er fragte sich, ob den Parteigenossen nicht selbst die Ähnlichkeit zu Hitlers Machtinsignien auffiel. Dieser Art von Heiligsprechung, die Aufmärsche mit Fahnen, Fackeln und Fanfaren. Sie hatten nur die Abzeichen, nicht einmal die Farben gewechselt. Seine Skepsis war ihm wohl anzusehen.
»Einer muss führen!«, sagte die Schleier barsch. »Wenn nötig mit harter Hand. Man sollte nur genau überlegen, wem man folgt. Einem Wahnsinnigen oder einem Visionär.«
Sofern man das unterscheiden kann, dachte sich Heller, doch er sprach es nicht aus. Deswegen war er nicht hergekommen. Frau Doktor Schleier wirkte zornig, zerfahren, als hätte sie alle Mühe, sich zu beherrschen.
»Heute Morgen wurde ein Junge auf einer Baustelle ganz in der Nähe tot aufgefunden. Er ist etwa vierzehn Jahre alt. Seine Identität konnte noch nicht festgestellt werden. Nun versuche ich eine Liste aller männlichen Schüler in diesem Alter zu erstellen, die heute nicht zum Unterricht erschienen sind.«
»Die kann ich Ihnen morgen geben. Frau Kühne, meine Sekretärin, ist schon weg. Und ich kann nicht dafür garantieren, dass alle Namen gelistet sind, denn manche Schüler kommen zwar morgens, lassen sich mitzählen und verschwinden dann wieder. Nur zum Essen tauchen sie wieder auf.« Die Direktorin erhob sich.
»Bitte«, sagte Heller eindringlich, »ich brauche die Liste jetzt. Wenn Sie mich in die Schulbücher einsehen lassen, kann ich mich auch selbst bemühen.«
»Meinen Sie nicht, die Eltern des Jungen würden ihn vermisst melden?«, fragte Frau Doktor Schleier unfreundlich.
Heller kam es vor, als würde die Frau gleich aus der Haut fahren. Sie zuckte zusammen, sobald er nur ein wenig die Hand bewegte. Er konnte sich ihr Verhalten nicht erklären. Hatte sie wirklich Angst?
»Ich möchte die Eltern des Jungen nicht im Ungewissen lassen. Außerdem ist es nicht gesagt, dass sie ihr Kind als vermisst melden. Nicht wenige in seinem Alter versuchen in den Westen zu kommen«, sagte Heller betont sachlich und ruhig.
»Nun gut.« Schleier erhob sich und ging ins Nebenzimmer. »Welches Alter, sagten Sie? Vierzehn? Das schließt einige Klassenstufen aus.«
Heller stand auf und folgte der Direktorin langsam zur Tür. »Dreizehn möglicherweise«, sagte er und prallte im selben Augenblick fast mit der Frau zusammen, die ihm bereits wieder entgegenkam. Ihr entfuhr ein Schrei und die Klassenbücher fielen zu Boden.
Heller murmelte eine Entschuldigung und bückte sich, um die Bücher aufzuheben. Unwirsch riss die Direktorin ihm diese aus den Händen, klappte sie auf und begann im Stehen die Namenslisten mit den Zeigefingern abzufahren.
»Schreiben Sie!«, forderte sie Heller auf, der wortlos sein Notizbuch zückte.
»Schiller, Hans, dreizehn. Bruckner, Matthias, dreizehn. Hamann …«
Die Tür öffnete sich und der Hausmeister sah hinein. »Kann ich helfen?«, fragte er und sah Heller prüfend an.
»Nein, danke, Herr Neubert«, antwortete die Schleier rasch. Der Hausmeister nickte und schloss die Tür wieder.
»Also, Hamann, Joseph, zwölf. Kummrau, Adolf, vierzehn. Kummrau, Heinrich, zwölf. Utmann, Albert, vierzehn. Helfrich, Heinz, vierzehn …« Die Frau hielt inne und sah auf.
Heller schrieb unaufhörlich. »Sprechen Sie nur weiter, ich komme mit.«
»Wie sah der Junge aus?«, fragte Frau Doktor Schleier.
»Recht schmal, dunkles Haar, dunkle Augen. Durchschnittliche Größe.«
»Ist Ihnen sonst etwas aufgefallen?«
Heller sah der Frau einige Augenblicke direkt in die Augen, bis sie ihren Blick senkte. »Er hatte Hämatome am gesamten Oberkörper«, antwortete er dann.
Nun ließ die Frau sich auf ihren Stuhl sinken. »Doch nicht der Albert«, murmelte sie.
»Albert Utmann?«, fragte Heller. Die Direktorin nickte. Dann stand sie rasch wieder auf, ging erneut ins Nebenzimmer und kam mit einem weiteren Buch zurück. Sie begann zu suchen, zählte die Spalten ab, las stumm und ihre Lippen bewegten sich stumm.
»Utmann, Alfons, zwölf. Sein Bruder war heute beim Unterricht anwesend. Hat sogar einen Eintrag wegen ungehörigen Verhaltens bekommen.«
»Und Albert fehlte?«
Frau Doktor Schleier sah auf und nickte.
»Der Bruder, Alfons, ist der schon nach Hause gegangen?«
»Davon gehe ich aus. Zwar arbeitet unsere FDJ-Gruppe noch in unserem Schulgarten, doch die Eltern der Utmanns verweigerten den Jungen den Eintritt in die Freie Deutsche Jugend.«
»Ist es üblich hier an der Schule, der FDJ beizutreten?«
Die Direktorin zögerte einen Moment, betrachtete Heller mit demselben misstrauischen Blick, mit dem sie ihn schon empfangen hatte. Es ärgerte Heller, dass er keinen Zugang fand zu dieser Frau. Eigentlich sollte sie doch auch Interesse an der Klärung der Todesumstände des Jungen haben.
»Es ist natürlich die freie persönliche Entscheidung eines jeden, und es gibt in meinen Augen keinen Grund, nicht dem Ruf unseres Ersten Sekretärs des FDJ Zentralrats, Erich Honecker, zu folgen oder schlimmer noch, seinem Kind diesen Wunsch zu verweigern.«
»Vielleicht sind sie abgeschreckt, wegen der Fackelaufzüge und Fanfaren«, bemerkte Heller trocken.
»Ich weiß, worauf Sie anspielen. Aber uns Kommunisten gehörten die Fanfaren und Fackelzüge. Die Nazis haben uns das weggenommen. Wir haben sie uns nur wiedergeholt. Das kann nichts Schlechtes sein!«
Nun langte sie nach einem Stapel Flugblätter im DIN-A5-Format und reichte ihn Heller.
Heller las: Deutscher Junge, deutsches Mädel, steh nicht abseits. Hilf auch du beim Wiederaufbau unseres Landes, hilf bei der Erhaltung der deutschen Einheit, bei der Schaffung eines neuen Deutschlandes unter den Idealen der Freiheit, des Humanismus, der kämpferischen Demokratie, des Völkerfriedens und der Völkerfreundschaft und der Förderung des Gemeinschaftsgeistes.
Heller beugte sich vor und legte das Flugblatt wieder auf den Schreibtisch. Direktorin Schleier ließ es liegen, als hätte sie gar nicht erwartet, es zurückzuerhalten.
»Ich benötige die Wohnadresse der Utmanns«, sagte Heller, ohne ein Wort über das Flugblatt zu verlieren.
»Ich notiere Sie Ihnen, dann müssen Sie mich bitte entschuldigen.«
Heller nickte, doch er war keineswegs zufrieden. »Kann es sein, dass Sie mir etwas über Albert Utmann sagen wollten?«
Die Direktorin erhob sich und reichte Heller mit barscher Geste einen Zettel über den Tisch. »Nein, das kann nicht sein.«
Heller blieb nichts übrig, als sich ebenfalls zu erheben und den Zettel zu nehmen.
»Auf Wiedersehen«, wünschte die Schleier knapp und begann dann, die Bücher und Papiere auf dem Schreibtisch zu sortieren.
Als Heller wieder im Foyer der Schule stand, trat plötzlich der Hausmeister hinter einer Säule hervor. Offenbar hatte er auf Heller gewartet.
»Sie hat doch vorhin aufgeschrien, nicht wahr?«
Heller wich ein wenig zur Seite, da ihm der Mann unangenehm nahe gekommen war, und sah ihn fragend an.
»Na, als Sie bei ihr im Zimmer waren«, erklärte der Mann.
»Ein kleines Missverständnis. Sie war erschrocken.«
»Die war im KZ, in Buchenwald, als Politische. Hat wohl einiges durchmachen müssen. Und jetzt …« Neubert hob die ihm verbliebene Hand und beschrieb mit dem Zeigefinger zwei kleine Kreise an seiner Schläfe.
Heller ging nicht näher darauf ein. Er hörte von so vielen schrecklichen Dingen und Schicksalen, auch von seinem Sohn Klaus, der in Russland gewesen war. Er wollte nicht darauf eingehen. Es führte zu nichts.
»Sagen Sie, die Kaitzer Straße ist doch hier in der Nähe?« Er hielt dem Hausmeister den Zettel mit der Adresse hin.
Neubert nickte. »Das ist hier, die Straße weiter hinauf, an der Aussicht Hoher Stein.«
Heller sog unauffällig den Zigarettengeruch des Mannes ein, beschloss, sich selbst etwas zu gönnen, und griff in seine Jackentasche. »Bekomme ich hierfür etwas zu essen bei Ihnen?« Er holte drei Zigaretten aus einer Packung und bot sie Neubert an.
Der nahm sich eine, steckte sie sich gleich in den Mund und nickte dabei. »Wenn Sie nicht wählerisch sind«, sagte er und die Zigarette wippte zwischen seinen Lippen.
»Und telefonieren müsste ich auch. Es gab zwar im Zimmer der Direktorin ein Telefon, aber ich hatte keine Gelegenheit …«
Neubert unterbrach ihn mit eiligem Nicken. »Ich habe noch einen Anschluss im Keller.« Er hatte aus seiner Hose eine Streichholzschachtel geholt, öffnete sie und zog geschickt ein Streichholz heraus.
»Warten Sie.« Heller wollte helfen, doch Neubert klemmte sich die Schachtel schon unter seinen Armstumpf, riss ein Streichholz an und hatte die Zigarette schneller angezündet, als Heller es wahrscheinlich gekonnt hätte.
»Man gewöhnt sich eher daran, als man glaubt. Wenn man sich erst einmal selbst davon überzeugt hat, dass man gut davongekommen ist. Andere sind erfroren und verhungert. Und selbst die sind noch gut davongekommen, was?« Der Mann zwinkerte, als wäre es ein Spaß. »Kommen Sie.«
Heller folgte ihm.
Mit einer Scheibe krümeligem Brot und etwas dünner Kohlsuppe im Bauch ging Heller nun die Coschützer Straße weiter hinauf und bemühte sich, nicht länger darüber nachzudenken, ob die schwarzen Körnchen in der Suppe Kümmel gewesen waren oder Mäusedreck.
Zwei Jungen, die einen Handkarren über das Kopfsteinpflaster zogen, überholten ihn.