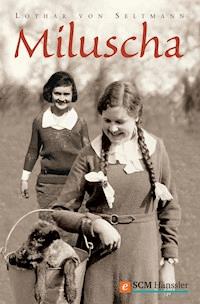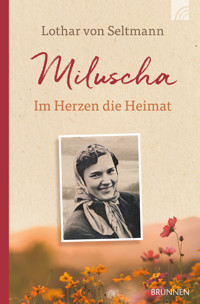Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM R. Brockhaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mitten im Krieg wird auf einem großen Bauernhof im Lahntal ein Kind geboren: Marie. Aber der Mann ihrer Mutter ist nicht der Vater. Wegen der Familienehre muss Marie vom Hof, bevor die Leute etwas merken. Sie wächst in einer Pflegefamilie auf. Nach dem sehr frühen Tod des gütigen, klugen Pflegevaters bleibt ihr nur die Pflegemutter, die "Katen-Assi". Diese lebt mit ständig wechselnden Liebhabern, liest die Karten und trinkt. In dieser bedrückenden Umgebung versucht das kleine, unglückliche Schulmädchen seinen Weg zu finden. Nach der Ausbildung wird Marie schwanger. Eine Katastrophe zur damaligen Zeit. Soll sie ihr Kind weggeben? Nein, sie will es nicht so machen wie ihre Mutter. An dem Tag, an dem sie im Westerwald ihre große Liebe heiratet, ist sie die glücklichste Frau der Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der SCM-Verlag ist eine Gesellschaft der Stiftung Christliche Medien, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
Dieses E-Book darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, E-Reader) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das E-Book selbst, im von uns autorisierten E-Book Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
ISBN 978-3-417-22724-6 (E-Book)ISBN 978-3-417-20673-9 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
1. Taschenbuchauflage 2006
© 2001 SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG Bodenborn 43 · 58452 Witten Internet: www.scmedien.de | E-Mail: [email protected]
Umschlaggestaltung: Ursula Stephan, Wetzlar
Umschlagfoto: SUPERBILD, Erich Bach (Key), Grünwald
Satz: Werbe- und Verlags-Gesellschaft mbH, Grevenbroich
INHALT
Marie
Im neuen Zuhause
Trauriger Geburtstag
»Marie, Marie, Marickelchen …«
Schuljahre
Die Tochter der Katen-Assi
Konfirmationsgeschenke
Lehrjahre auf dem Eicherhof
Das Hausmädchen
Die Katastrophe
Unglück verbindet
»Westerwäller sind immer freundlich!«
Hochzeit
Eine neue Familie
Endlich die Mutter
Sorge um Stephan
Tragischer Unfall
Verwaiste Familie – neue Freunde
Marie im Glück
Nachbemerkung
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Marie
Spät war er heute dran, der alte Becker, dachte Elsbeth, als sie den Briefträger des weitläufigen Dorfes Kramberg abseits des Lahntals auf den Bornemannschen Hof zukommen sah. Es war doch schon kurz vor Mittag. Sonst war er immer viel früher.
Ob er wohl gute Nachrichten brachte? Oder schlechte? Aber was waren in diesen Zeiten schon gute und was schlechte Nachrichten? Die Nachricht, auf die sie seit Tagen wartete, war wohl beides zugleich, und der jungen Frau, Schwiegertochter auf diesem Hof, war bange davor.
»Tag, Elsbeth«, rief ihr der Postbote von der Hofeinfahrt her zu. »Kein guter Tag, zu viel schlechte Post für die Leute. Ich hoffe, für dich habe ich Besseres.« Der Mann, an dem die Einberufung in den Krieg wegen seines Alters vorbeiging, stellte sein Fahrrad an der Hoflinde ab und warf einen raschen Blick auf Marie im Kinderwagen darunter. »Ich glaube, ich habe Post von deinem Vater, Kleines. Da wird die Mutter sich freuen.«
Elsbeth zuckte zusammen. Das würde wohl keine Nachricht sein, über die sie sich freuen konnte. Sie ging dem alten Becker ein paar Schritte entgegen, um ihm die Post abzunehmen. Wenn der wüsste …
»Soll ich Ihnen etwas zu trinken holen? Sie sind ja ganz verschwitzt.«
»Tu das, Mädchen, ich wäre dir dankbar. Eine Erfrischung täte gut. Es ist ja auch schrecklich heiß heute. Wenn wenigstens ein Lüftchen ginge.«
Ohne die Post genommen zu haben, wandte sich Elsbeth zum Haus, um bald mit einem Krug und einem Becher zurückzukommen. »Holunderwasser, ganz frisch gemacht.«
Der Briefträger hatte derweil seine Tasche abgehängt und sich auf die Bank in die Laube neben der Haustür gesetzt. Er wischte sich mit einem großen Tuch umständlich den Schweiß von der Stirn und aus dem Nacken. »Hier im Schatten ist es angenehm.« Dann griff er den Becher und nahm einen guten Schluck. »Danke, das tut gut. Ist der Bauer im Heu?«
»Alle sind im Heu. Ich bin nur wegen Marie hier. Und Heinzemann spielt auch irgendwo.«
Der Postbote wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Willst du deine Post eigentlich gar nicht haben? Du lässt sie hier auf der Bank liegen, als interessiere sie dich gar nicht. Das ist keine von der Sorte, wie ich sie heute schon zweimal abgeben musste. Wirst sehen, du kriegst gute Nachricht. Dein Hellmut kommt bald auf Heimaturlaub. Wirst sehen.«
Elsbeth zuckte wieder zusammen. Und hätte der alte Becker ihr ins Gesicht gesehen, hätte er bemerkt, dass der jungen Frau alle Farbe daraus gewichen war. »Ich mach den Brief gleich auf, trinken Sie erst noch einmal.«
»Versteh, Mädchen, du willst ihn lieber öffnen, wenn du allein bist. Ich bin ja auch gleich weg.« Damit stand der alte Mann auf, hängte sich seine Tasche wieder um und verabschiedete sich.
Er warf noch einmal einen Blick auf das schlafende Kind im Wagen, bestieg dann sein Fahrrad und fuhr vom Hof. »Sag dem Bauern einen Gruß«, rief er über die Schulter zurück. »Und danke noch mal für die Erfrischung.« Dann war er durch das Hoftor verschwunden.
Elsbeth setzte sich auf die Bank, sah die Post durch und behielt schließlich den einen Brief in der Hand, der als Absender den Namen ihres Mannes trug. Ein Zittern ergriff ihren Körper, und Tränen stiegen ihr in die Augen. Ihr verschleierter Blick wanderte zwischen Kinderwagen und Brief hin und her. Hier in diesem Umschlag war das Schicksal ihrer kleinen Tochter wohl endgültig besiegelt. Wenn Hellmut auf Urlaub kam, musste Marie vom Hof. Der Schwiegervater, größter und angesehenster Bauer der Umgebung, wollte es so. Ein »Bastard« auf dem Hof konnte und durfte auf Dauer nicht geduldet werden. Und Hellmut durfte nach dem Willen seines Vaters vom Seitensprung seiner Frau nichts erfahren.
Wie ein Schauer ging es durch Elsbeth, und jetzt ließ sie ihren Tränen freien Lauf. Es sah sie ja niemand, und so konnte sie sich ihren Gefühlen hingeben. Nachher, wenn der Schwiegervater zurück war, musste sie wieder die Harte spielen, die sich der Hofmoral zu beugen und die Konsequenzen ihres Tuns zu tragen hatte.
»Mami, warum weinst du?«, vernahm die junge Frau plötzlich ihren Vierjährigen. Sie hatte ihn gar nicht kommen hören.
»Mami ist sehr traurig, mein Großer. Aber das kannst du noch nicht verstehen. Es geht auch gleich vorbei.«
»Du musst doch nicht traurig sein, Mami. Ich bin doch da.«
»Ja, Heinzi, du bist da; und du wirst mir auch bleiben.« Elsbeth nahm den Jungen heftig in die Arme. Dann öffnete sie mit einer schnellen Bewegung den Feldpostbrief. Sie überflog die Zeilen so rasch, wie das mit ihren immer noch tränenverschleierten Augen ging. Dann hatte sie es vor sich, das schicksalsträchtige Datum: »Im Juli bekomme ich für drei Wochen Heimaturlaub.«
Was Hellmut davor und danach geschrieben hatte, registrierte sie kaum. »Im Juli … im Juli … im Juli …«, hämmerte es in ihrem Kopf. Bis dahin waren es noch knapp drei Wochen.
In heftiger Erregung sprang Elsbeth auf, lief zum Kinderwagen, riss die immer noch schlafende Marie heraus und drückte sie an sich. »Mein Kind, mein Kind. Du bist doch mein Kind. Warum muss der Bauer so hart sein? Hellmut würde mir sicher verzeihen und dich auch irgendwann lieb gewinnen. Aber der Bauer …«
Das Kind, aus dem Schlaf geschreckt, begann zu weinen. Das brachte die Mutter wieder zu sich. Sie legte das Mädchen in den Wagen zurück und forderte Heinzi auf, das Gefährt ein wenig zu schaukeln, damit das Kind sich beruhigte.
Sie selbst ging ins Haus, um den Tisch zu richten. Dabei bemühte sie sich, ihren Tränenfluss zu ersticken. Die Schwiegereltern und die Hilfskräfte würden bald zum Essen kommen. Die mussten ihren Seelenzustand nicht gleich bemerken. Dann hatte alles gerichtet zu sein. Beim Essen würde der Bauer nach der Post fragen. Und dann würde er … Elsbeth überkam wieder ein Frieren, trotz der Hitze …
Beim verspäteten Mittagessen hatte Richard Bornemann nicht nach besonderer Post gefragt. Aber er hatte an Elsbeths Verhalten wohl gemerkt, dass außer der Post auf dem Tisch auch noch eine Nachricht von Hellmut gekommen sein musste. Am Abend sprach er seine Schwiegertochter darauf an. Und er fragte sehr direkt: »Wann kommt dein Mann?« Die junge Frau war auf die Frage vorbereitet und antwortete ebenso knapp und in deutlich hartem Ton: »Im Juli.«
»Wann genau?«
»Hat er nicht geschrieben.«
»Dann weißt du ja, was bis dahin zu geschehen hat. Bis zum letzten Juni ist der Balg aus dem Haus. Der Lehrer hat seine Fühler schon ausgestreckt.«
Elsbeth hatte sich vorgenommen, einen letzten Versuch zu wagen, den Schwiegervater umzustimmen. »Vater …«
Kaum war die Anrede ausgesprochen, kam es sehr deutlich und scharf zurück: »Keine Diskussion. Jeder, der auf meinem Hof lebt und arbeitet, kennt meine Einstellung. Du kennst sie auch. Und ich habe entschieden. Der Balg kommt vom Hof. Hellmut braucht davon nichts zu wissen, und du wirst ihm davon nichts sagen.«
»Und wenn andere ihm …«
»Andere werden darüber nicht reden, dafür habe ich gesorgt.«
»Und wenn Heinzi seinem Vater …?«, versuchte Elsbeth noch einmal einzulenken.
»Dann wird dir wohl eine Erklärung einfallen, wem das Kind gehört, das der Junge hier hat schaukeln müssen. Und jetzt basta.«
Schwer sank Elsbeth auf einen Stuhl und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Dass ein Mensch so hart sein konnte, so stolz und so unbeugsam. Und dann kamen wieder die Selbstvorwürfe in ihr hoch. Warum hatte sie auch dem Drängen des Sohnes vom Nachbarhof nachgegeben! Dabei wusste niemand etwas von dessen Vaterschaft. Er selbst war längst wieder an der Front und wusste auch nichts von seinem Kind. Warum hatte sie auch …, warum …?
Plötzlich fühlte die junge Frau eine Hand auf ihrer Schulter. Die Schwiegermutter stand hinter ihr und wollte mit dieser Geste wohl ihr Mitempfinden ausdrücken. »Tust mir Leid, Kind. Aber ich kann gegen den Bauern nicht an. An den Bornemanns darf kein Makel kleben. Und du hast halt einen verursacht. Musst die Suppe auslöffeln, die du dir eingebrockt hast. Tust mir Leid.« Nach ein paar Sekunden Stille im Raum fügte die Bäuerin hinzu: »Ich habe mit dem Lehrer gesprochen. Er hat da jemanden gefunden, einen Freund wohl oder Bekannten mit seiner Frau, die das Kind nehmen wollen. Sollen gute Leute sein. Hab Vertrauen und schick dich.« Sie strich ihrer Schwiegertochter noch einmal über die Schulter und ließ sie dann wieder allein, allein mit ihrer Not, ihrem Zorn, ihrer Verzweiflung, ihren Fragen … Heinzi würde ihr bleiben – und hoffentlich Hellmut. Irgendwann würde sie ihm die Geschichte doch beichten, beichten müssen. Ewig würde sie dies Geheimnis nicht bewahren können.
Erich Jahnke war ein liebenswürdiger Mensch. Der alte Kramberger Dorflehrer galt als Frömmler und Spinner. Der Partei beizutreten hatte er sich immer geweigert; Politik interessierte ihn nicht.
Dass Krieg herrschte, ließ ihn leiden, und dass das halbe Dorf Hitlers Parolen nachlief und zujubelte, bekümmerte ihn. Dieses gottlose Wesen konnte zu keinem guten Ende führen. Davon war er fest überzeugt; wobei er sich schon vorsehen musste, wo und vor wem er seine Bedenken aussprach. Was ihn mit Richard Bornemann verband, verstand niemand so recht, war er doch in seiner Art und in seinem Denken ganz das Gegenteil des Bauern.
Wie oft hatte der Lehrer versucht, seinen Freund zu bewegen, den »Balg«, wie der das Mädelchen immer nannte, auf dem Hof zu behalten. Keine menschliche Verfehlung sei so groß, dass sie nicht vergeben werden könnte. Sein Sohn würde das Kind schon anzunehmen lernen, auch wenn es nicht von ihm war. Es sei ohnehin ein Fehler gewesen, Elsbeth zu hindern, ihren Hellmut von dem Fehltritt und seinen Folgen zu informieren. Außerdem dürfe man einer Mutter ihr Kind nicht ohne Not wegnehmen. Alles Reden des Lehrers war vergeblich gewesen. Richard Bornemann war ein unbeugsamer und unbelehrbarer Dickschädel.
Also hatte sich der »Frömmler« aus seiner Verantwortung vor seinem Gott, an den er glaubte und dem er auch in den schwierigen Nazi-Zeiten zu dienen versuchte, auf die Suche gemacht. Er wollte Menschen finden, die bereit waren, sich der kleinen Marie anzunehmen und ihr Eltern zu sein.
In einem Ehepaar im weit genug entfernten Wüstenfeld war er fündig geworden. Heinrich und Luise Grüber waren wohl die richtigen. Beide waren verwitwet und zum zweiten Mal verheiratet. Beide hatten in ihren ersten Ehen Kinder gehabt und auf tragische Weise verloren. Ein Sohn des Mannes hatte sich als junger Mann nach irgendeinem fragwürdigen Vorkommnis in die französische Fremdenlegion abgesetzt und galt als verschollen.
Diesen Grübers konnte die kleine Marie wohl überlassen werden. Wenn die Frau auch manchmal ein bisschen komisch schien und zuweilen merkwürdiges Zeug daherredete. Der Mann war jedenfalls eine Seele von einem Menschen, wie man zu sagen pflegt. Der würde mögliche Defizite bei der Frau schon ausgleichen. Heinrich Grüber hielt sich trotz schwieriger Zeiten zur Kirche. Das war dem alten Lehrer wichtig. In ein gottloses Haus hätte er Marie auf keinen Fall vermittelt.
In der letzten Juniwoche 1943 kam er dann vormittags auf den Bornemann-Hof, um seine traurige Aufgabe zu erledigen. Bauer und Bäuerin waren in die Rüben gefahren und hatten Heinzi ganz gegen ihre sonstige Art mitgenommen. Wohl um den Jungen aus dem Geschehen herauszunehmen und um selbst das Drama des erzwungenen Abschieds der jungen Mutter von ihrem Kind nicht erleben zu müssen. Vielleicht meldete sich da doch irgendwo das Gewissen.
Elsbeth war verzweifelt, und es gelang Erich Jahnke nicht, sie zu beruhigen. Die Antwort auf die Frage nach seinem Reiseziel verweigerte er beharrlich. »Glaub mir, Elsbeth, dein Kind kommt zu guten Leuten. Sie werden ihm gute Eltern sein. Aber es ist besser, du weißt nicht, wo sie wohnen. Es ist für alle besser. Die Leute wissen auch nicht, woher ich das Kind bringe. Außer mir weiß nur Gott davon. Und er hält seine Hände über alle.«
Nach einer Weile des stummen Mitleidens fügte der Lehrer noch hinzu: »In der heutigen Losung steht ein gutes Wort aus dem Psalm 91. Das darfst du dir merken, und das steht auch über dem Leben deines Kindes: ›Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.‹ Und jetzt lass mich gehen. Ich werde für dich beten und für das Kind.«
Erich Jahnke nahm die schluchzende Mutter noch einmal kurz in die Arme, griff dann mit der einen Hand das Köfferchen mit den wenigen Habseligkeiten der kleinen Marie und mit der anderen den Kinderwagen und verließ den Hof. Am Tor wandte er sich noch einmal um und warf Elsbeth einen letzten Blick zu. Aber sie konnte diese Geste nicht sehen. Sie saß bitterlich weinend, ihr Gesicht in der Schürze vergraben, in der Laube. Und dann liefen auch dem alten Lehrer die Tränen über die zerfurchten Wangen. O Gott, welches Elend und welche Not als Folgen menschlicher Schwäche und menschlichen Stolzes. Gott möge sich über diese Ereignisse erbarmen.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Im neuen Zuhause
Wüstenfeld war ein evangelisches Bauerndorf am Rande des katholischen Johannlandes, einer Region im südlichen Westfalen, die weniger naziverseucht war als andere Gegenden und die vom Krieg direkt nicht sehr viel mitbekam. In der Kate an der Einfahrt zum Henrichshof war mit dem Einzug von Marie Leben eingekehrt. Heinrich und Luise Grüber hatten doch lange Jahre nicht mehr mit kleinen Kindern zu tun gehabt. So war das schon eine erhebliche Umstellung für die beiden Mittvierziger, jetzt wieder einen kleinen Menschen im Haus zu haben, der sein Recht auf Brei, Flasche, frische Windeln und saubere Kleidung lauthals anmeldete und der auch zunehmend beschäftigt werden wollte.
Einerseits machte dies veränderte Familienleben den Eltern Freude, andererseits brachte es aber auch Belastungen mit sich.
Der Vater hatte als Schmied Wechselschicht in einer Hammerschmiede und war immer nur halbtags zu Hause. Die Produktion von Kurbelwellen in seinem Betrieb hatte ihn vor der Einberufung zur Wehrmacht bewahrt. In der freien Zeit galt es, sich um den Garten zu kümmern, um die beiden Schweine im Koben und die Hühner im Pferch. Manchmal bat auch der Henrichsbauer um Mithilfe bei bestimmten Arbeiten, besonders bei Reparaturen an Haus und Maschinen.
Die Mutter hatte bisher nahezu täglich einige Stunden auf dem Hof mitgearbeitet. Das ging jetzt nicht mehr so regelmäßig. Sie musste für das Kind da sein. Das machte ihr zuweilen mehr Mühe als Freude. Sie hätte es vorgezogen, Garten und Vieh zu versorgen und auf dem Hof und auf Feldern und Wiesen zu arbeiten, statt Windeln zu waschen, Breichen zu kochen und sich sonstwie um das Kind zu kümmern. Hatte ihr Heinrich da nicht doch ein wenig voreilig dem Drängen von Erich Jahnke nachgegeben, dieses ungewollte Kind aufzunehmen?
Dazu kam, dass Marie an Rachitis litt. Ihr kleiner Körper zeigte deutliche Spuren dieser Mangelerkrankung. Ihrem Alter nach sollte das Mädchen eigentlich wenigstens schon sitzen, sie konnte es aber noch nicht. Sie brauchte also mehr Zuwendung und Pflege als ein gesundes Kind im gleichen Alter.
»Wenn Sie dem Kind vitaminreiche Nahrung geben und es viel draußen an der Sonne sein lassen, dann ist das schon hinzukriegen«, hatte der Arzt gemeint. Es sei dennoch zu überlegen, ob eine stationäre Behandlung in der nahen Kreisstadt nicht angebracht wäre.
Damit war Luise Grüber aber gar nicht einverstanden. Das hätte in der Woche mehrfaches Hin- und Herfahren bedeutet und damit zusätzliche Belastungen. Nein, wenn das nicht zwingend sein müsste, dann doch lieber nicht. Außerdem sei das Kind doch in der Stadt viel mehr gefährdet als auf dem Land, wegen der Bombardierungen und so.
Auch Heinrich war es lieber, das Kind konnte im Haus bleiben. Er hätte doch kaum die Möglichkeit gehabt, es in der Stadt zu besuchen. Und er würde das kleine Wesen schon vermissen. Sein Herz hatte Marie längst gewonnen.
Also sollte Luise alle möglichen Anstrengungen unternehmen, das Kind auf die Beine zu kriegen und dem Vitaminmangel und seinen Folgen abzuhelfen.
Aber der Pflegemutter ging der Prozess der Genesung zu langsam. In ihr steckte der Hang nach schnelleren, dafür aber fragwürdigen Heilungsmethoden. Diesen Hang hatte sie aus ihrer ostpreußischen Heimat mitgebracht. Dort hatte es im Dorf ein Kräuterweiblein gegeben, das manchem Hilfesuchenden auch Hilfe gewährt hatte. Dass es da manchmal nicht mit rechten Dingen zugegangen war, hatte nie jemanden gestört.
Ob es solch einen Menschen nicht auch in der Umgebung von Wüstenfeld gab? Luise Grüber machte sich auf die Suche. Das war gar nicht so einfach, denn sie hatte im Dorf nur wenige Kontakte, so dass sie nicht viele Leute fragen konnte. Außerdem musste sie sich vorsichtig an die gewünschten Informationen herantasten, damit ihr Mann von ihrem Ansinnen nichts erfuhr. Der wäre damit nämlich überhaupt nicht einverstanden gewesen. Der würde zehnmal eher zum Pastor laufen und über dem Kind beten lassen. Sie hatte doch vor ihm auch schon ihre Karten verschwinden lassen müssen, aus denen sie so gerne sich selbst und anderen die Zukunft gelesen hatte, damals, vor ihrer Heirat.
Luise erschrak deshalb auch richtig, als ihr Heinrich ihr eines Tages eröffnete, dass er beim Pastor die Taufe von Marie angemeldet hätte.
»Bist du ganz gescheit? Willst du dich bei den Leuten unbeliebt machen? Wenn deine Chefs erfahren, dass du es so deutlich mit der Kirche meinst, schmeißen die dich noch raus und du kommst doch noch an die Front«, empörte sich die Frau.
»Mach dir da mal nur keine Sorgen, meine Liebe. Das brauche ich nicht zu befürchten. Die haben doch gar keinen anderen, der den Manipulator richtig bedienen kann. Und sie kriegen auch nirgendwo einen her. Also da bin ich ganz sicher. Und außerdem will ich, dass Marie getauft wird. Sie hat schon Schlimmes hinter sich, wenn sie das auch selbst nicht weiß. Ich will, dass ihr kleines Leben unter den Segen Gottes gebracht wird. Da lass ich mir von dir nicht reinreden.«
»Ist ja schon gut«, gab Luise etwas missgestimmt zurück und machte sich in der Küche zu schaffen. Gegen ihren Heinrich war da nicht zu argumentieren. Was der wollte, das wollte er.
»Wann soll die Tauffeier sein?«, fragte sie aus der Küche heraus in die Wohnstube, wo Heinrich sich zu dem Mädchen auf den Boden gelegt hatte und mit ihm spielte.
»Wenn hier Taufen sind, dann sind die immer am letzten Sonntag im Monat. Solltest du eigentlich auch wissen. Also Sonntag in einer Woche«, gab der Vater zurück. »Mach dir schon mal Gedanken, wie wir den Tag gestalten können. Ein bisschen festlich und mit ein paar Gästen und gutem Essen. Da kannst du wieder einmal zeigen, welche Meisterin der Küche du bist.«
Luise fühlte sich geschmeichelt. »Wen willst du denn dazu einladen?«
»Den Küster und seine Frau, habe ich gedacht. Und meinen Bruder mit der Schwägerin, wenn du nichts dagegen hast. Wir hatten lange keinen richtigen Kontakt mehr.«
»Ich werd schon nichts dagegen haben. Sag mir nur, was ich zu tun hab, und dann kann die Feier losgehen.«
Die Vorbereitungen für die Taufe und die übrige Arbeit im Haus und drum herum nahmen die Hausfrau stark in Anspruch. So hatte sie zunächst gar keine Zeit, weiter nach einem Kräuterweiblein zu suchen. Gut, dann würde sie das eben später tun, wenn der Taufsonntag vorbei war.
Der kam, und Pastor Eicher hielt einen guten Gottesdienst. Die Taufe des Grüberschen Pflegekindes hatte eine ganze Reihe Leute mehr in den Gottesdienst gelockt, als üblicherweise in den Bänken saßen. Unerschrocken machte der Pastor den Zuspruch und den Anspruch des Wortes Gottes aus Markus 16 deutlich: »Wer aber glaubt und getauft wird, der wird selig. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.« Mutig war das in diesen wirren Zeiten. Viele Gottesdienstbesucher hatten so eine Botschaft lange nicht gehört; die Predigt war das Gesprächsthema für die Sonntags-Tischrunden in den Häusern des Dorfes.
Als Taufpaten traten die Frau des Küsters und der Bruder des Taufvaters, Adelheid Menn und Norbert Grüber, mit ans Taufbecken. Klein-Marie, Hauptperson der Veranstaltung, ließ die Prozedur auf dem Arm ihres Pflegevaters offenbar gerne über sich ergehen. Sie war während des ganzen Gottesdienstes friedlich und ruhig und tat während der Taufhandlung sogar einen fröhlichen Jauchzer, so, als könne sie ermessen, welche Bedeutung in dem Psalmwort liegen mochte, das ihr der Pastor zusprach: »… Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Und so segne und behüte dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen!«
Dass dieses Psalmwort, nun schon zum zweiten Mal über dem Kind ausgesprochen, für Marie wirkliche Lebensbedeutung haben sollte, konnte in der Dorfkirche von Wüstenfeld an diesem Tag niemand ahnen. Aber die Pflegemutter bekam es schon bald zu spüren, wenn sie den Zusammenhang auch nicht erkennen konnte.
Der Taufsonntag verlief friedlich und schön. Das Zusammensein der Familie mit ihren Gästen war sehr harmonisch. Heinrich Grüber freute sich besonders über das gute Miteinander mit seinem Bruder und dessen Frau. Das war nicht immer so gewesen, vor allem nicht, seit Luise zur Familie gehörte.
Etwas Besonderes durften sie alle zusammen erleben: Marie blieb zum ersten Mal allein auf ihrer Decke sitzen, ohne gleich wieder umzufallen. Sie schien diese Veränderung selbst am deutlichsten zu empfinden und begleitete ihre neue Kunst mit lautem Freudengebrabbel.
Heinrich Grüber war rundum zufrieden mit diesem schönen Tag, dem freilich seine Frau das Besondere nicht abgewinnen konnte. Ihr war es viel wichtiger, dass sie endlich wieder einmal Gäste im Haus hatten, die ihre Koch- und Backkunst sehr zu rühmen wussten.
Dann zog der Alltag wieder ein. Heinrich hatte Mittagschicht. Er musste dann immer nach dem Essen aus dem Haus, um nach seiner täglichen 15-km-Radtour rechtzeitig am Arbeitsplatz zu sein. Für Luise bedeutete das mehr zeitlichen Spielraum, um zu einer alten Zigeunerin zu kommen, von der sie erfahren hatte. Die Frau lagerte mit ihrer Sippe im Steinbruch. Wo die Leute herkamen, wusste niemand. Dass es die überhaupt noch gab, verwunderte manchen. Denn es war irgendwie auch zur Landbevölkerung durchgesickert, dass der Hitler-Staat nicht gerade freundlich mit den Leuten des schwarzhaarigen Volkes umging, wo er ihrer habhaft wurde.
Diese Alte sollte nach dem, was die Leute redeten, über heilende Kräfte verfügen und sie gegen entsprechendes Entgelt auch zur Verfügung stellen.
Der Weg zum angegebenen Lagerplatz der Zigeuner war nicht weit, und heute musste es klappen. Wer weiß, ob die schwarzhaarige Sippe nicht bald weiterzog. Und wer weiß, ob Heinrich nicht plötzlich seine Schicht wechseln musste, wie das zuweilen vorkam.
Bald nachdem ihr Mann das Haus verlassen hatte, packte Luise ihr Pflegekind in den Wagen und schob los, querfeldein durch die Felder und durch einen größeren Wald Richtung Steinbruch, immer darauf bedacht, von den Leuten nicht gesehen zu werden. Dem Kind im Wagen machte es Spaß, so über Stock und Stein geschoben zu werden. Es brabbelte fröhlich vor sich hin.
Endlich hatte sie ihr Ziel erreicht. Im Steinbruch fand sie etliche schlichte Planwagen vor, um die herum ein paar Kinder spielten und einige struppige Pferde grasten. Sonst war niemand zu sehen. Als die Kinder die Frau mit dem Kinderwagen bemerkten, riefen sie ein paar unverständliche Worte und waren im Nu irgendwo verschwunden.
»Was suchst du hier?«, meldete sich eine krächzende Stimme aus einem der Planwagen.
Luise schaute von einem Wagen zum anderen, konnte aber niemanden sehen.
»Was suchst du hier?«, kam die Frage zum zweiten Mal herüber. Der Mutter wurde jetzt doch ein wenig unheimlich. Aber sie antwortete: »Hilfe für mein Kind.«
»Komm näher zum Wagen in der Mitte.«
Luise folgte der Aufforderung. Und dann stand sie einem alten, hutzligen, dunkelhäutigen Weiblein gegenüber, das auf dem Wagen unter der Plane kaum richtig zu sehen war.
»Was fehlt dem Kind?«, fragte die Zigeunerin.
»Sie hat die Englische Krankheit.«
»Komm näher, dass ich das Kind besser sehe. Nimm es auf den Arm.«
Luise folgte auch dieser Aufforderung, schob den Kinderwagen näher heran und nahm Marie heraus. Ganz geheuer war ihr nicht bei der Sache.
»Woher weißt du von mir?«, wollte die Zigeunerin jetzt wissen.
»Leute haben erzählt.«
»Was haben sie erzählt?«
»Meinem Kind könnte hier geholfen werden.«
»Das Kind ist nicht dein Kind«, gab die Alte zu Luises Erstaunen zurück. »Und ich kann ihm auch nicht helfen. Bei diesem Kind versagt meine Kraft. Ich spüre das. Ein anderer hat ihm schon geholfen. Und jetzt nimm dein Kind und geh.«
Luise war irritiert. Wie sollte sie das verstehen? Ein anderer hatte schon geholfen?
Jetzt wiederholte die Alte in schärferem Ton: »Ich sagte, nimm dein Kind und geh! Und noch eins: Hüte dich, irgendjemandem von unserer Begegnung zu sagen. Das hätte böse Folgen für dich und auch für mich und meine Leute. Hast du das verstanden?«
»Ja, ja, ich habe verstanden«, gab Luise unsicher zurück, setzte Marie in den Wagen, wendete ihn und verließ fast panikartig das Steinbruchgelände.
Erst nachdem sie den größten Teil der Strecke zurückgelegt hatte, hielt sie für einen Moment inne und atmete tief durch. Was sie da erlebt hatte, verstand sie nicht. Das sollte ihr mal jemand erklären. Da wusste diese Alte, dass Marie nicht ihr Kind ist, und sie behauptete, da habe ein anderer bereits geholfen. Luise schüttelte den Kopf, beugte sich über das Kind und strich ihm über die blonden Löckchen. »Was bist du für ein Kind, Mariechen? Kannst du mir das sagen?« Das Mädchen schaute die Mutter mit großen Augen an, von dem zurückliegenden Ereignis offenbar völlig unbeeindruckt, und tat nur einen Jauchzer, hell und fröhlich wie vergangenen Sonntag am Taufbecken.
Luise setzte ihren Weg fort, um diese Begegnung rasch hinter sich zu lassen und möglichst bald nach Hause zu kommen.
Selbstverständlich würde sie niemandem etwas von der Sache erzählen, niemandem, auch Heinrich nicht. Wenn die Worte der Alten eine Drohung waren und diese Drohung dann wahr würde … Wer weiß, was geschehen würde.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Trauriger Geburtstag
In der folgenden Zeit verbesserte sich Maries Gesundheitszustand merklich. Bald war von der Rachitis nichts mehr zu sehen und zu spüren. Das Mädchen lernte das Laufen ohne eine längere Kriech- und Krabbelperiode. Bald lernte Marie, »Papa« und »Mama« zu rufen, und begann, ihre allmählich größer werdende Welt zu erkunden.
Dabei waren ihre Tage meistens in zwei Abschnitte geteilt. War das Mädchen mit der Mutter allein zu Haus, dann waren ihre Aktivitäten auch auf das Haus beschränkt. Luise beschäftigte sich sehr wenig mit ihr – sie war ja schließlich nur ihre Pflegetochter. Sie überließ das Kind meist sich selbst. Allein durfte das Kind nicht nach draußen, und sie ließ auch keine anderen Kinder an es heran. Marie spielte dann mit ihren wenigen Sachen auf dem Stubenboden oder am Tisch und war es in der Regel auch zufrieden.
Wenn aber der Papa zu Hause war, dann wurde es immer interessant. Papa nahm sein Mariechen mit an seine Arbeitsplätze, wann immer es ging. Er spielte mit ihr in der Stube und im Garten. Er half ihr, Haus und Hof zu erkunden und ihren Horizont Schritt für Schritt zu erweitern. Er erzählte ihr Märchen und Geschichten, malte mit ihr Bilder und sang mit ihr alle Kinderlieder, die er aus seiner eigenen Kindheit noch kannte.
Später setzte der Vater seine Tochter oft auf den Gepäckträger seines Fahrrades und fuhr mit ihr durch Wald und Feld. Dann zeigte er ihr, was dort Großes und Kleines wuchs und blühte, erklärte ihr Nutzpflanzen und Wildkräuter, warnte sie vor giftigen Beeren und Kräutern, erklärte ihr die Stimmen von Amsel, Drossel, Fink und Star und was sonst außer Spatz und Taube noch herumflog. Der Vater wusste alles und er konnte alles. Marie liebte ihren Papa, und sie genoss die Zeiten, in denen er zu Hause war, auch dann, wenn er einmal keine Zeit für sie hatte.
Kontakte zu anderen Kindern des Dorfes konnte Marie erst knüpfen, als sie mit vier Jahren in den Kindergarten kam. Aber das war zunächst nicht einfach. Sie hatte ja vorher kaum andere Kinder erlebt. Auch als Kindergartenkind konnte das Mädchen keine Freundschaften aufbauen. Morgens lieferte Luise Grüber ihre Pflegetochter beim Kindergarten ab, mittags nahm sie sie wieder in Empfang, ohne auch nur anderen Kindern oder deren Müttern eine Geste der Freundlichkeit und des Interesses zu zeigen oder mit ihnen ein Wort zu wechseln.
Wie gut, dass Heinrich in seiner ganz anderen Art da vieles ausglich und ersetzte. Was seine Frau zuweilen natürlich ärgerte und dann auch gegen das Kind aufbrachte. Sie wurde hart und streng. Wehe der Kleinen, wenn sie ihr Kleidchen oder die Schürze einmal verdreckt oder gar zerrissen hatte! Wehe ihr, wenn beim Hinfallen Löcher in die selbst gestrickten Strümpfe gekommen waren! Wehe ihr, wenn irgendetwas in der Wohnung zu Bruch ging, weil Marie sich ungeschickt anstellte oder ihre kleinen Hände die Dinge noch nicht beherrschten! Dann wurde Mama laut und heftig. Hin und wieder gab es auch saftige Ohrfeigen oder Schläge auf den Popo.
Marie verzog sich in solchen Fällen dann in eine Stubenecke und wartete still leidend und schmollend darauf, dass Papa nach Hause kam und der Tag wieder besser wurde. Papa brachte auch manches in Ordnung, ehe Mama etwas davon erfuhr. Da waren die beiden oft wie ein verschworenes Paar, das seine Geheimnisse hütete.
Mit wachsendem Alter versuchte Marie immer wieder einmal, selbst Kontakt zu anderen Kindern oder zu Erwachsenen zu knüpfen. Dann büchste sie einfach zu Hause aus, lief mal zu Onkel und Tante oder zu den Küstersleuten, mal zum Pastor, mal hinüber zur Schule, wo sie sich einfach mit in den Unterricht setzte. Überall wurde sie gerne aufgenommen. Aber wenn Mama sie dann wieder irgendwo abholen musste, gab es anschließend strenges Ausgehverbot.
Alles in allem waren es für Marie keine leichten, aber doch durch die Liebe des Pflegevaters schöne Kinderjahre. Aber diese ersten Jahre ihrer Kindheit sollten leider bald ein jähes Ende finden.
Marie war inzwischen sechs Jahre alt und kräftig gewachsen. Ein Lockenwuschel, in der Regel in zwei kräftigen Zöpfen gebändigt, umgab ihr hübsches Gesicht. Dem Mund fehlten die ersten Milchzähne. Nach Ostern sollte sie eingeschult werden.
Einige Wochen vorher eröffnete Heinrich Grüber seiner Frau, dass er vorhabe, die Pflegetochter zu adoptieren. »Wenn Mariechen demnächst in die Schule kommt, ist es besser, sie trägt auch amtlich unseren Namen. Ich habe mit Pastor Eicher schon darüber gesprochen. Er wird sich um die Sache kümmern mit dem Jugend- und Sozialamt und so.«
»Wenn du meinst, du solltest das tun, dann tu’s.« Luise wäre es lieber gewesen, sie hätte das Kind unter dem Namen ihrer richtigen Eltern anmelden können: Marie Bornemann. Die Leute wussten doch ohnehin, dass das Kind ein Pflegekind war und nicht ein leibliches, eigenes. Warum also diese Prozedur?
»Mariechen weiß nichts davon, dass sie nicht unser eigenes Kind ist«, belehrte Heinrich seine Luise. »Sie denkt, wir seien ihre richtigen Eltern. Warum sollen wir sie nicht in diesem Glauben lassen? Wenn das Kind in der Schule plötzlich mit einem anderen Namen registriert und angesprochen wird, bricht doch eine Welt zusammen. Das muss nicht sein. Und ich will das verhindern.«
»Wenn du meinst, dass das wichtig ist, dann tu, was du für richtig hältst«, gestand die Frau ihrem Mann zu. »Marie Grüber, Marie Grüber, wie das klingt«, murmelte sie vor sich hin, als sie den Raum verließ.
Leider ließ sich das gut gemeinte Vorhaben des Pflegevaters nicht so schnell in die Tat umsetzen. Da fehlten gültige Papiere, die damals in den Kriegsjahren nicht ordnungsgemäß weitergegeben worden waren. Die Suche nach den leiblichen Eltern musste aufgenommen werden. Bei mehreren Besuchen hatte ein Mitarbeiter des Jugend- und Sozialamtes die häuslichen und familiären Verhältnisse zu prüfen. Zum Glück geschah das alles sehr dezent, so dass Marie nicht merkte, worum es eigentlich ging. Nur brauchte das alles sehr viel Zeit. Und auch die wiederholten Nachfragen von Pastor Eicher und Heinrich Grüber vermochten nicht, die Sache zu beschleunigen.
So ließ es sich nicht vermeiden, dass das neue Schulmädchen als Marie Bornemann eingeschult wurde. Hoffentlich hielten die beiden Lehrer und die Lehrerin der kleinen Dorfschule ihr Wort: Sie wollten vor den Kindern nur den Vornamen benutzen und wenn es notwendig war, einen Nachnamen zu nennen, dann im Vorgriff auf die erwartete behördliche Entscheidung den Namen Grüber. So wurde es auch ins Klassenbuch und in die Schülerkartei eingetragen. Heinrich Grüber hatte darauf bestanden, obgleich ihm nicht ganz wohl dabei war. Hoffentlich wurde Maries Adoption bald vollzogen!
Aber die Dinge sollten sich ganz anders entwickeln.
Der 1. April 1948 war ein richtig schöner Frühlingstag. Die Sonne schien warm vom wolkenlosen Himmel. Die ersten Obstbäume und viele Sträucher standen schon in Blüte, der Geruch frisch bestellter Felder stand über dem Land, und fröhliches Vogelgezwitscher erfüllte die Luft. Alles war in diesem Jahr sehr früh für diese Gegend.
Die Einschulung wurde auch diesmal wieder zu einem Fest für die ganze Dorfgemeinschaft. Die drei Lehrer der Schule hatten sich mit den älteren Schulkindern allerlei einfallen lassen, um den Neulingen den bedeutsamen Tag unvergesslich zu machen. Als Begrüßungsgeschenk gab es für jeden der zehn Erstklässler eine Tafel bester Schokolade, eine Packung Kekse und einen Zeichenblock mit Buntstiften.
Organisiert hatten diese Dinge Soldaten der belgischen Besatzungstruppen, die seit Kriegsende in einer Kaserne der Kreisstadt stationiert waren.
Zum Abschluss des gemeinsamen Vormittags gab es ein großes Eintopfessen für alle. In diesem Jahr stellten es Georg und Hanna Eicher bereit, denen der größte Hof des Dorfes gehörte. Auch ihre Tochter Erika war unter den Kindern, für die mit diesem Tag der »Ernst des Lebens« begann.
Die ersten Schulwochen vergingen. Marie kam gut zurecht mit allem, was von ihr gefordert wurde. Schule und Lernen machten ihr Spaß. Was sie immer wieder ärgerte war, dass sie nachmittags kaum jemals Kinder aus ihrer Klasse sehen durfte. Vor allem nicht, wenn Papa Mittagschicht hatte. Dann ließ die Mutter sie nicht aus dem Haus oder vom Grundstück. Und wenn Papa zu Hause war, hatte das Mädchen meist kein Verlangen nach anderen Kindern.
Es wurde Sommer. Die ersten großen Ferien kamen und gingen vorbei. Marie hieß offiziell immer noch Bornemann. Es wurde Herbst, und die Entscheidung des Jugend- und Sozialamtes lag immer noch nicht vor. In den Herbstferien sollte die Sache endlich abgeschlossen werden. So hatte es Pastor Eicher inoffiziell aus dem Amt erfahren.
»Na, mein Mädchen, noch ein paar Tage, dann sind Herbstferien, und ich mache eine Woche Urlaub«, verabschiedete sich Heinrich Grüber eines Mittags Anfang Oktober von seiner Pflegetochter, fertig für seine Fahrt zur Arbeit. »Und für morgen habe ich meine Schicht getauscht, damit wir deinen Geburtstag auch richtig feiern können.«
»Au fein, Papa! Darf ich dann ein paar Kinder einladen?«, rief Marie dem geliebten Vater noch hinterher.
»Das sehn wir dann. Ich glaub schon«, rief der über die Schulter zurück und war um die Straßenbiegung verschwunden.
Voller Vorfreude betrat Marie die Küche. »Ich darf für meinen Geburtstag morgen ein paar Kinder einladen, hat Papa gesagt.«
»Der hat leicht sagen. Und wer macht die Arbeit?«
»Du wolltest doch sowieso einen Kuchen backen, Mama. Dann machst du einfach ein bisschen mehr Teig, und dann kannst du auch gleich zwei backen.«
»Nichts da. Ein Kuchen reicht, und die Kinder können bleiben, wo sie hingehören«, grantelte die Mutter. »Außerdem machen viele Leute im Haus nur Dreck. Den darf ich dann wieder wegputzen.«
»Dabei kann ich dir doch helfen«, bettelte das Mädchen. »Ich helfe dir doch auch sonst beim Putzen, Mama.«
»Heute ist heute, morgen ist morgen. Und jetzt lass mich in Ruh.«
Marie schwieg. Weiteres Reden hatte jetzt keinen Sinn. Sie musste halt warten, bis Papa morgen von der Schicht nach Hause kam. Dann würde Mama nicht mehr widersprechen, und sie könnte die anderen Kinder immer noch abholen.
Am Spätnachmittag schickte Luise ihre Pflegetochter noch einmal in den Dorfladen. Die Eier und die Milch reichten nicht für den Geburtstagskuchen. »Aber beeil dich und komm sofort wieder«, bekam Marie noch mit auf den Weg. Das tat sie auch.
Sie kam bald zurück und wunderte sich über das große Auto, das vor ihrem Haus an der Straße stand. Das passierte nicht oft, dass im Dorf solche Fahrzeuge auftauchten. Traktoren ja und ein paar Mal am Tag der Bus, aber kaum solche Personenwagen. Und das noch vor ihrem Haus. Was das wohl zu bedeuten hatte?
Und warum standen Onkel Norbert und der Küsteronkel da mit einem fremden Mann am Törchen? Und die sahen alle so ernst aus. Marie lief ein bisschen schneller. Als Onkel Norbert das Mädchen erblickte, kam er ihm ein paar Schritte entgegen.
»Was macht ihr denn alle hier?«, rief die Kleine dem Onkel zu. »Ist Papa auch da?«
»Du kannst jetzt nicht ins Haus gehen, Kind«, stellte sich der Onkel ihr in den Weg. »Und du musst jetzt ein ganz tapferes Mädchen sein.«
»Was redest du da, Onkel Norbert? Was will der Mann mit dem Auto?«
»Komm her, Mariechen, ich muss dir was sagen.«
Marie wurde es ganz merkwürdig ums Herz. Der Onkel hatte doch was. Sie stellte die Milchkanne auf den Boden und legte die Eierpackung auf den Tisch vor der Bank. »Ist was mit Papa, Onkel Norbert?«
»Ja, Kind, es ist was mit deinem Papa.« Der Onkel setzte sich auf die Bank, atmete schwer ein. Er nahm die Kleine in den Arm und offenbarte ihr dann das Schreckliche. »Dein Papa kommt nicht mehr nach Hause. Er ist heute Nachmittag bei seiner Arbeit schwer verunglückt.«
»Was ist mit ihm? Ist er tot?«, schrie es nach einer Schrecksekunde aus Marie heraus. Der Onkel nahm das Kind fester und bestätigte: »Ja, dein Papa ist tot. Sein eigener Manipulator hat ihn an die Wand gedrückt. Keiner konnte ihm mehr helfen.«
Marie schaute ihren Onkel mit großen, leeren Augen an. »Sag, dass das nicht wahr ist, Onkel. Nein, das ist nicht wahr! Nein, das ist nicht wahr! Du lügst, Onkel Norbert, du lügst! Papa! Mein Papa!«, brach es mit sich steigernder Stimme aus dem Mädchen heraus. Dann schüttelte sie ein wildes Schluchzen. Norbert Grüber nahm sie noch fester in seine Arme, als könnte er so den zitternden und bebenden kleinen Körper beruhigen. Dabei liefen ihm jetzt selbst die Tränen über das Gesicht. Und auch die beiden anderen Männer, die schweigend dabeistanden, mussten zu ihren Taschentüchern greifen.
»Wo ist Mama?«, fragte Marie nach einer Weile zwischen zwei Schluchzern.
»Deine Mama ist in der Stube. Tante Irmgard und die Küstertante sind bei ihr. Und die Frau von Papas Chef ist auch noch drin.«
»Ich will zu Mama«, löste sich das Mädchen aus den Armen des Onkels und lief ins Haus. Hier fand sie die Pflegemutter leichenblass und völlig apathisch auf der Couch sitzend. Tante Irmgard saß neben ihr und hielt sie im Arm. Die Küstertante und die fremde Frau saßen