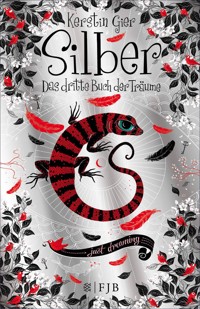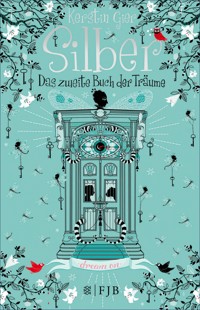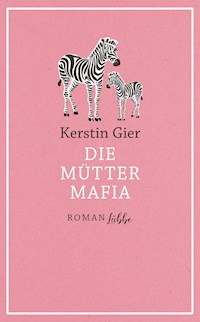16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Vergissmeinnicht
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Kerstin Gier öffnet uns nach der »Edelstein«- und der »Silber«-Trilogie die Tür zu einer neuen phantastischen Welt und erzählt eine mitreißende Liebesgeschichte aus zwei Perspektiven: Quinn ist cool, smart und beliebt. Matilda entstammt der verhassten Nachbarsfamilie, hat eine Vorliebe für Fantasyromane und ist definitiv nicht sein Typ. Doch als Quinn eines Nachts von gruseligen Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht von dieser Welt sein können. Nur – wem kann man sich anvertrauen, wenn Statuen plötzlich in schlechten Reimen sprechen und Skelettschädel einem vertraulich zugrinsen? Am besten dem Mädchen von gegenüber, das einem total egal ist. Dass er und Matilda in ein magisches Abenteuer voller Gefahren katapultiert werden, war von Quinn so allerdings nicht geplant. Und noch viel weniger, sich unsterblich zu verlieben … Noch mehr magische Lesestunden mit den Büchern von Kerstin Gier: Wolkenschloss Die Vergissmeinnicht-Reihe: - Band 1: Was man bei Licht nicht sehen kann - Band 2: Was bisher verloren war - Band 3: Was die Welt zusammenhältDie Silber-Reihe: - Das erste Buch der Träume - Das zweite Buch der Träume - Das dritte Buch der Träume
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kerstin Gier
Vergissmeinnicht
Was man bei Licht nicht sehen kann
Roman
Über dieses Buch
Quinn ist cool, smart und beliebt. Matilda entstammt der verhassten Nachbarsfamilie, hat eine Vorliebe für Fantasyromane und ist definitiv nicht sein Typ. Doch als Quinn eines Nachts von gruseligen Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht von dieser Welt sein können. Nur – wem kann man sich anvertrauen, wenn Statuen plötzlich in schlechten Reimen sprechen und Skelettschädel einem vertraulich zugrinsen? Am besten dem Mädchen von gegenüber, das einem total egal ist. Dass er und Matilda in ein magisches Abenteuer voller Gefahren katapultiert werden, war von Quinn so allerdings nicht geplant. Und noch viel weniger, sich unsterblich zu verlieben …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Kerstin Gier, Jahrgang 1966, hat 1995 ihr erstes Buch veröffentlicht und schreibt seither überaus erfolgreich für Jugendliche und Erwachsene. Ihre Edelstein-Trilogie und die »Silber«-Bücher wurden zu internationalen Bestsellern, mehrere Romane von ihr sind verfilmt worden. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Köln.
Inhalt
[Widmung]
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn
Matilda
Quinn: Was bedeutet Schlippe? [...]
Nachwort
Personenverzeichnis
Erdencast
Saumcast
Für alle, die gerade ein bisschen Magie gebrauchen können
Quinn
»Einen Gin Tonic – nein, zwei, bitte!« Und zwar alle beide für mich. Ich hatte nicht vorgehabt, mich heute Abend zu betrinken, zumal ich Lasse versprochen hatte, bis zum Schluss zu bleiben und darauf aufzupassen, dass niemand nach zu viel Beerpong das Mobiliar demolierte, auf den Teppich kotzte, oder – wie bei der letzten Party – im Bett von Lasses Eltern einschlief. Aber Pläne ändern sich. Ich zum Beispiel hatte heute Abend mit meiner Freundin Lilly Schluss machen wollen, stattdessen trug ich jetzt ein Armband, auf dem »Knuffelchen« stand, und brauchte dringend Alkohol.
»Entschuldige mal, bitte! Ich war vor dir an der Reihe.« Das Mädchen, das mich empört von der Seite anfunkelte, hatte ich glatt übersehen. Während ich sie musterte, bekam sie feuerrote Wangen. »Oh, du bist das, Quinn«, murmelte sie.
Ich kannte sie ebenfalls. Sie war eins der Mädchen unserer streng katholischen Nachbarn, den grässlichen Martins oder den »biblischen Plagen«, wie mein Vater sie zu nennen pflegte. Die weiblichen Nachkommen der Martins sahen mit ihren Stupsnasen und den blonden Kringellöckchen alle gleich aus. Ich jedenfalls konnte sie nie auseinanderhalten.
»Ach nee, Luise«, sagte ich auf gut Glück. »Also, dir hätte ich am allerwenigsten zugetraut, ein Partycrasher zu sein.« An den Barkeeper gewandt fügte ich hinzu: »Sie können ruhig schon mal anfangen mit meinen Gin Tonics. Dieser Posaunenengel hier hat nämlich gar keine Einladung.«
Der Barkeeper grinste, und Luises Wangen wurden noch ein bisschen röter. Offiziell hatte Lasse fünfzig Gäste zu seinem achtzehnten Geburtstag eingeladen, inoffiziell waren es mindestens doppelt so viele, die Getränke hätten höchstens bis zehn Uhr gereicht. Zu Lasses Glück hatten seine Großeltern diese mobile Cocktailbar zur Party beigesteuert, die am frühen Abend als Überraschungsgeschenk geliefert worden war. Samt Barkeeper.
»Erstens bin ich nicht Luise, sondern Matilda, und zweitens sind Julie und ich sehr wohl eingeladen. Von Lasse persönlich«, sagte Luise. Beziehungsweise Matilda, wie ich ja nun wusste. Ihre Stimme zitterte ein wenig, vermutlich vor Wut. »Und ich hätte gern einen Caipirinha. Bitte.« Sie versuchte, den Barkeeper anzulächeln, aber das Lächeln fiel ziemlich grimmig aus. Meine Laune hingegen hob sich etwas. In meiner Familie war »die grässlichen Martins ärgern« seit Jahren eine Art sportlicher Wettbewerb, bei dem sogar meine harmoniesüchtige Mutter manchmal mitmachte.
»Erst die Party crashen und jetzt auch noch Alkohol.« Ich schüttelte bekümmert den Kopf. »Da machst du den lieben Gott aber heute sehr traurig, Luise.«
»Ich bin Matilda, du blödes, arrogantes …« Sie presste ihre Lippen aufeinander. Der Barkeeper hatte mit dem Mixen der Drinks begonnen, ich hatte allerdings den Eindruck, er höre uns interessiert zu, während er Limettenstücke und Eiswürfel in Gläser füllte.
»Oh, oh, und … Beschimpfungen?« Jemand hatte die Musik lauter gedreht, doch ich konnte deutlich sehen, dass sie mich verstehen konnte, denn die Flügel der typischen Martin-Stupsnase blähten sich vor Wut. »Blödes, arrogantes – was denn? Hast du Angst, du wirst mit ewiger Verdammnis gestraft, wenn du weitersprichst?«
Sie starrte mich bitterböse an, ihr Blick wanderte von meinem Gesicht abwärts, bis er schließlich an meinem Handgelenk hängenblieb. »Blödes, arrogantes Knuffelchen«, sagte sie dann mit unverkennbarer Schadenfreude in der Stimme.
Punkt für sie. Schlagartig erinnerte ich mich wieder, warum ich hergekommen war.
»Genau genommen bin ich Schnuffelhase«, korrigierte ich. Das stand jedenfalls auf dem Armband, das nun um Lillys Handgelenk geknotet war. Und sie sagte es ständig zu mir, einer der Gründe, warum ich heute Abend Schluss machen wollte. Was ich aber jetzt nicht mehr konnte, jedenfalls nicht nüchtern und nicht, ohne mich wie ein supermieses Arschloch zu fühlen. Denn – Überraschung! – es hatte sich herausgestellt, dass Knuffelchen und Schnuffelhase heute seit fünfundsiebzig Tagen zusammen waren, offenbar ein Anlass, selbstgebastelte Armbänder zu überreichen und zu versichern, dass man noch nie, nie im Leben so glücklich gewesen sei.
Der Barkeeper schob uns unsere Drinks hin, und ich lächelte ihn entschuldigend an, bevor ich meinen ersten Gin Tonic hinunterkippte wie ein Glas Wasser. Ich meine, Knuffelchen? Ernsthaft? Sollte ich das jemals gesagt haben, hätte ich dieses Armband sowie weitere fünfundsiebzig Tage mit Lilly absolut verdient. Zur Strafe. Warum hatte ich auch auf meine Eltern gehört und nicht vor der Party kurz und schmerzlos per Handy Schluss gemacht? Dann wäre es gar nicht erst zur Übergabe des Armbands gekommen.
Dass ich überhaupt so dämlich gewesen war, meine Eltern über meine Pläne zu informieren, lag daran, dass Lilly ihnen während der vergangenen zweieinhalb Monate noch mehr ans Herz gewachsen war als meine Freundinnen davor. Meine Mutter fand es grundsätzlich wunderbar, wenn ein Mädchen im Haus war, für sie waren alle meine Freundinnen »zauberhaft« und »entzückend«, bei meinem Vater ging die Liebe mehr durch den Magen. Lillys Eltern besaßen nämlich zwei Feinkostfilialen in der Stadt, und Lilly brachte oft etwas mit, wenn sie mich besuchte.
»Heißt das, nie wieder gratis Carpaccio cipriani und Steinpilzrisotto frei Haus?«, hatte mein Vater entsetzt ausgerufen, als er begriff, was ich vorhatte. »Auf Nimmerwiedersehen, Zimtmacarons und Zitronensorbetpralinés? So ein wunderbares Mädchen wirst du nie wieder finden, Quinn.«
»Natürlich wird er das, Albert!« Meine Mutter schaute ihn streng an. »Und vielleicht haben deren Eltern ja ein Fitnessstudio, in dem du dann deinen Schmarotzerbauch wieder abtrainieren kannst.« Während mein Vater beschämt auf seinen Schmarotzerbauch blickte, wandte sie sich an mich und lächelte nachsichtig. »Du machst das schon richtig, Schatz. Folge deinem Herzen. Aber per Handy Schluss zu machen, das gehört sich einfach nicht, so etwas muss man persönlich tun.«
»Absolut!«, bestätigte mein Vater. »Sonst hassen sie einen für immer! Und man muss ihnen dabei mutig in die Augen schauen.«
Und jetzt musste ich genau das tun, allein schon, um meine Eltern nicht zu enttäuschen. Ich stellte das leere Glas ab. Vielleicht wäre es klug, wenn nicht nur ich, sondern auch Lilly bei meinem zweiten Versuch ein wenig Alkohol intus hatte. Also griff ich mit der einen Hand nach meinem zweiten Gin Tonic und schnappte mir mit der anderen den Caipirinha, den das Martin-Mädchen praktischerweise noch nicht angerührt hatte, weil sie zu sehr damit beschäftigt gewesen war, mich mit weit aufgerissenen Augen anzustarren.
»Den nehme ich lieber mal mit, Luise«, sagte ich, während sie empört nach Luft schnappte. »Du weißt ja, keine harten Drinks an Minderjährige.«
Ohne ihre Antwort abzuwarten, begann ich, mir einen Weg durch die Menge zurück ins Wohnzimmer zu bahnen, die Gläser möglichst vorsichtig erhoben.
»Ich heiße Matilda, du eingebildeter … Schnuffelhase«, rief sie mir nach. »Und du bist selber noch keine achtzehn!«
»Dann bete für mich, damit ich nicht in die Hölle komme!«, rief ich lachend über meine Schulter.
»Wenn es dafür mal nicht zu spät ist«, sagte jemand ironisch, und ich blieb überrascht stehen. Die meisten Partygäste kannte ich von der Schule oder vom Parkour, aber das Mädchen, das direkt vor mir stand, hatte ich noch nie gesehen. Wenn doch, wäre sie mir garantiert in Erinnerung geblieben. Sie hatte leuchtend blau gefärbte kurze Haare, einen kleinen silbernen Ring im Nasenflügel, einen weiteren in der Augenbraue, trug knallenge schwarze Jeans und ein tiefausgeschnittenes schwarzes Oberteil zu robusten halbhohen Schnürstiefeln. Ihre Augen waren mit jeder Menge schwarzer Schminke umrandet. Fehlte eigentlich nur noch ein auf dem Kopf stehendes Kreuz als Kettenanhänger um ihren Hals oder ein 666-Tattoo, dann wäre das Klischee perfekt erfüllt gewesen. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, war sie ziemlich attraktiv. Ich schätzte sie ein paar Jahre älter als mich, vielleicht schon Anfang zwanzig, was aber am vielen Make-up liegen konnte oder an ihrer selbstbewussten Haltung. Als sie ihren Mund zu einem kurzen Lächeln verzog, zeigte sich ein drittes Piercing am Lippenbändchen, mit einem blau glitzernden Stein. Dann wurde ihre Miene wieder ernst und ihr Tonfall fast feierlich. »Gut, dass ich dich gefunden habe, Quinn Jonathan Yuri Alexander von Arensburg.«
»Okay«, sagte ich gedehnt. Woher kannte sie meinen vollen Namen? Der war ja selbst mir nicht geläufig. Die Tatsache, dass meine Mutter es mit der Anzahl der Vornamen so übertrieben hatte, war mir immer ein bisschen peinlich gewesen, weshalb ich sie auch nie an die große Glocke gehängt hatte. »Quinn Jonathan Yuri Alexander von Arensburg« klang, so langsam und salbungsvoll ausgesprochen, fast schon bedrohlich, wie der Beginn einer Zauberformel.
»Wir müssen uns unterhalten.«
»Dummerweise habe ich gar keine Zeit«, erklärte ich. Ich muss nämlich diese Drinks hier zu meiner künftigen Exfreundin bringen, und du scheinst ein bisschen durchgeknallt zu sein. Leider. Andererseits – ich war neugierig. »Kennen wir uns denn?«
»Mein Name ist Kim.« Wieder ein Lächeln, bevor sie ernst wurde. »Was ich dir über dich erzählen werde, wird sich vermutlich erst mal verrückt anhören. Wir wissen auch erst seit kurzem, dass du existierst.«
»Aha.« Nicht nur ein bisschen durchgeknallt, sondern total, korrigierte ich mich stumm, aber ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, sie einfach stehenzulassen. Sie war wirklich sehr hübsch.
Ihre braunen Augen musterten mich eindringlich. »Es ist wichtig. Denn wenn wir dich gefunden haben, können sie das auch.«
Jetzt wurde es mir doch zu albern. »Und sie sind Killer eines internationalen Verbrechersyndikats, die die Geheimpläne haben wollen, die mir ein Agent letzte Woche auf der Straße unbemerkt in den Rucksack gesteckt hat? Oder alternativ Gesandte einer Delegation des Planeten Metis, von dem ich, ohne es zu wissen, abstamme und den nur ich retten kann, weil …«
»Wir treffen uns in zehn Minuten vor der Haustür«, fiel mir die Blauhaarige ungerührt ins Wort. »Und Metis ist kein Planet, sondern einer der Jupitermonde.« Damit drehte sie sich um und ging. Verdutzt sah ich ihr dabei zu, wie sie an der Bar vorbei im Flur verschwand.
»Die war ja heiß!« Das kam von meinem Freund Lasse, der neben mir aufgetaucht war und so schwungvoll einen Arm um meine Schultern legte, dass ich etwas von dem Caipirinha verschüttete. »Wer war das, Alter?«
»Das wollte ich dich fragen, Mann! Das ist schließlich deine Party. Ich habe gehofft, sie wäre eine deiner merkwürdigen Cousinen oder so. Sie heißt Kim.«
»Nein, meine merkwürdige Cousine ist die dahinten am Fenster, die sich schon seit einer halben Stunde Kaugummi aus den Haaren friemelt. Diese Kim habe ich noch nie gesehen, ich schwöre«, beteuerte Lasse. »Wahrscheinlich hat sie jemand von den Parkourleuten mitgebracht.«
»Sie will, dass ich sie in zehn Minuten vor der Haustür treffe, wo sie vermutlich ihr Raumschiff geparkt hat.«
»Krass!« Lasse schüttelte mich begeistert, so dass noch mehr Alkohol auf den Boden schwappte. »Alter, du hast so ein Glück bei den Weibern! Ich meine, ich versteh das voll. Ich würde auch auf dich abfahren, wenn ich ein Mädchen wäre, ganz ehrlich.« Er griff nach einem meiner Drinks und nahm einen großen Schluck. »Sieh dich nur an. Es sind die Gegensätze. Dieser athletische Body zu dem niedlichen asiatischen Babyface, das tiefschwarze Haar zu den wahnsinnig blauen Augen …« Er unterbrach sich. »Oh Mann, jetzt höre ich mich auch schon an wie ein verliebtes Mädchen. Aber echt, Bro, ich liebe dich!«
»Wie viel hast du schon getrunken, Lasse?« Ich sah ihn stirnrunzelnd an. Nüchtern war er nicht so der gefühlsbetonte Typ. Aber gut, man wird ja nur einmal achtzehn. Auch bei mir begann jetzt der auf ex getrunkene Gin Tonic zu wirken. »Ich liebe dich auch, Mann. Und die Blauhaarige hat mich nicht angemacht, die war einfach … total seltsam.«
»Das wäre mir bei der echt egal.« Er nahm noch einen Schluck Caipirinha.
»Lasse, kennst du eigentlich meinen vollen Namen?«, erkundigte ich mich. »Mit all meinen Vornamen?«
»Klar. Quinn Johann Mega Gengar Graf Koks von Arensburg.« Lasse lachte. »Oder so ähnlich.« Dann entdeckte er das Armbändchen. »Knuff… Oh, Scheiße, was ist das denn? Von Lilly? Das musst du aber abmachen, bevor du dich mit der Blauhaarigen triffst, das ist echt nicht sexy.«
»Das geht nicht ab«, sagte ich finster. Lilly hatte mir die Lederschnur mit einem enthusiastischen dreifachen Doppelknoten umgebunden, der würde nicht nur die nächsten fünfundsiebzig Tage halten, sondern mindestens fünfundsiebzig Jahre.
»Du brauchst eine Schere.«
Ja, oder das. »Aber wenn ich es durchschneide, wird Lilly total beleidigt sein.« Andererseits – sobald ich mit ihr Schluss machte, würde sie ohnehin total beleidigt sein, und ich hatte wenigstens meine Würde zurück. Und vielleicht war Lilly ja so gekränkt, wenn sie mich ohne Armband sah, dass sie den Spieß umdrehen und mit mir Schluss machen würde. Dann hätte ich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Beziehungsweise mit einer Schere durchgeschnitten.
»Oben im Badezimmer in der Schublade unter dem Waschbecken.« Lasse hatte meine Gedanken erraten. »Gib mir das Glas! Ich warte hier auf dich.« Er nahm mir den Gin Tonic auch noch aus der Hand und nippte sofort daran. »Oh Mann, ich glaube, das ist die beste Party, die ich je hatte. Wir müssen nur aufpassen, dass dieses Mal niemand was in Dads Aquarium kippt.«
Auf jeden Fall. Nach der Party zu Lasses sechzehntem Geburtstag hatten wir ein Vermögen dafür ausgegeben, die Fische zu ersetzen, bevor Lasses Eltern aus dem Urlaub zurückkamen. Auf der Suche nach türkisgoldenen Buntbarschen, Lanzenharnischwelsen und siamesischen Rüsselbarben hatten wir sämtliche Tierhandlungen der Stadt aufsuchen müssen, nichts, was ich noch einmal wiederholen wollte.
»Ich bin gleich wieder da«, versicherte ich, ohne ansatzweise zu ahnen, dass das die letzten Worte waren, die ich für lange Zeit zu Lasse sagen würde.
Im ersten Stock war es ruhig, sicherheitshalber hatte ich auch im Schlafzimmer von Lasses Eltern nachgeschaut, doch das Bett war unberührt, noch spielte sich die Party brav im Erdgeschoss ab. Lasses Eltern waren wie immer in den letzten Jahren in den Urlaub gefahren und hatten Lasse das Haus unter der Bedingung überlassen, es bei ihrer Rückkehr genauso vorzufinden, wie sie es verlassen hatten. Wobei sie ähnlich wie meine Eltern Kratzer im Parkett weniger tragisch fanden als den Geruch von Zigarettenqualm, der sich in Vorhängen und Teppichen festsetzte. Die Raucher versammelten sich deshalb frierend draußen auf der Terrasse, bisher hatte sich aber noch niemand beschwert.
Die Nagelschere, die ich im Badezimmer fand, war leider keine Linkshänderschere, und da Lilly mir das Armband um das rechte Handgelenk geknotet hatte, brauchte ich eine ganze Weile, um das Leder durchzusäbeln. Beinahe hätte ich es anschließend in den Papierkorb geworfen, steckte es jedoch lieber in die Hosentasche, für den Fall, dass Lilly es für ihren nächsten Schnuffelhasen zurückhaben wollte. Besonders eilig, das herauszufinden, hatte ich es allerdings nicht. Das Badezimmerfenster ging nach vorn zur Straße raus, und ich war neugierig, ob diese blauhaarige Kim wirklich vor der Haustür auf mich wartete. Noch war ich unsicher, ob ich ihrer Aufforderung folgen sollte, andererseits hätte ich schon gern gewusst, woher sie – im Gegensatz zu meinem besten Freund – meine vielen Namen kannte und was sie von mir wollte. Wir wissen auch erst seit kurzem, dass du existierst – was sollte das bitte schön heißen?
Vorsichtshalber schaltete ich das Licht aus, bevor ich das Fenster so leise wie möglich öffnete und mich vorbeugte, um unter das Vordach zu spähen.
Oh ja, das waren eindeutig ihre langen Beine in den schwarzen Boots. Offenbar lehnte sie mit dem Rücken an der Wand neben der Tür. Sie war allein, der stete Zustrom der Gäste war inzwischen verebbt. Ihre Miene konnte ich von hier aus nicht erkennen, aber sie trommelte mit ihren Fingern ungeduldig gegen die Wandverkleidung. Sie schien wirklich auf mich zu warten.
Also gut, dann würde ich eben mit ihr reden. Um Lilly konnte ich mich auch noch später kümmern.
Als ich gerade das Fenster schließen und hinuntergehen wollte, löste sich aus dem Schatten der Vorgartenbepflanzung eine Gestalt und schlenderte langsam über den gepflasterten Weg auf die Haustür zu. Neugierig beugte ich mich weiter vor. Es war ein eher kleiner Mann mit Mantel und Hut, das Alter konnte ich im spärlichen Licht nicht einschätzen. Da es aber die Art Hut war, die ich nur von Opas mit Rauhaardackeln kannte, ging ich davon aus, dass er älter war. Offenbar war er kein Partygast, sondern wegen dieser Kim hier, die sich jetzt abrupt von der Hauswand löste.
»Sie!«, stieß sie erschrocken aus.
Der Mann blieb stehen. »Hast du wirklich gedacht, wir hätten dich nicht bemerkt? Auf unserem Terrain?! Dass du es gewagt hast!« Er hatte eine seltsam schnarrende Stimme, und es hätte gar nicht die Reaktion der Blauhaarigen gebraucht, um zu wissen, dass er kein harmloser Dackelopa war.
Sie machte ein paar Schritte seitwärts, so dass ich jetzt ihren ganzen Körper sehen konnte, der extrem angespannt wirkte.
Dem Mann schien ihre Reaktion zu gefallen. »Ein bisschen spät, Kindchen«, sagte er mit einem leisen Lachen. »Uns entkommt so schnell kein Mensch.«
Kim blickte sich nach allen Seiten um, als suche sie nach einem Fluchtweg. Oder nach jemandem, der ihr beistehen konnte.
Drogen. Das war die erste Erklärung, die mir in den Kopf schoss. Die Blauhaarige war eine Dealerin und hatte ihr Zeug im Revier der Konkurrenz verkauft.
Der Mann kam wieder langsam näher. »Du wirst mir jetzt alles sagen, was ich wissen muss. Wer noch dazu gehört und wie du das angestellt hast und wer dahintersteckt …«
»Lieber sterbe ich«, erwiderte Kim leise.
Der Mann lachte mittlerweile richtig, genauso schnarrend und unheimlich, wie er sprach. »Diesen Wunsch erfüllen wir immer gern. Und für kleinere Vergehen als deines. Vorher müssen wir uns lediglich noch ein bisschen unterhalten. Wobei nichts dagegen spricht, währenddessen schon mit dem Sterben zu beginnen.«
Das Mädchen machte eine Art Ausfallschritt zur Seite, wie um die Reaktionsgeschwindigkeit des Mannes zu testen. Der schnippte mit den Fingern. Ein Knurren ertönte, ich konnte es nicht ganz zuordnen, aber es ließ mir die Haare zu Berge stehen. Hatte der Opa etwa da eben geknurrt? Der gruselige Laut schien Kim jedenfalls in ihrer Bewegung erstarren zu lassen, als wäre sie eingefroren.
»Sie können mir nichts tun«, stieß sie hervor. »Das würde zu viel Aufsehen erregen. Und … ich habe Aufzeichnungen, die im Falle meines Todes an die Öffentlichkeit kommen würden, Videos …«
Der Opa blieb ungerührt. »Ach wirklich?«, fragte er und fasste in seine Manteltasche.
Ohne nachzudenken, schwang ich mich auf die Fensterbank, sprang von dort hinüber aufs Vordach und kam eine Sekunde später mit einer perfekten Vierpunktlandung zwischen der Blauhaarigen und dem Mann auf dem Pflaster auf, so wie hundertmal vorher im Training bei Parkour geübt. Erst als ich mich aufrichtete, begriff ich, was ich getan hatte. Man könnte sagen, ich war beinahe genauso verblüfft wie die beiden, die mich ungläubig anstarrten. Aber zum Grübeln war jetzt keine Zeit.
»Lass uns abhauen!« Ich griff nach dem Arm der Blauhaarigen und zog sie mit mir. Da die Haustür geschlossen war und der Mann den Weg zur Straße versperrte, blieb uns als Fluchtweg nur ein Sprung durch die dichte Hecke, die den Vorgarten seitlich vom restlichen Garten abtrennte. Da Lasse und ich von klein auf befreundet waren, kannte ich mich hier genauso gut aus wie bei mir zu Hause und wusste, an welcher Stelle man sich mit Schwung zwischen zwei Büschen hindurchquetschen konnte. Ich schubste Kim zuerst durch die Lücke und folgte ihr, ohne einen Blick zurück auf den Mann zu werfen, der sich hoffentlich noch nicht von meinem Überraschungsauftritt erholt hatte. Wenn wir es ums Haus herum nach hinten zur Terrasse schafften, konnten wir uns im Inneren in Sicherheit bringen.
»Was ist das für ein Typ?«, keuchte ich, während wir durch die Dunkelheit auf den Lichtstreifen zurannten, der vom Wintergarten aus auf den Rasen fiel.
»Wie kann man nur so dämlich sein?«, fragte sie gleichzeitig.
Ja, dass es wohl keine besonders kluge Idee gewesen war, spontan und ohne jeglichen Plan aus dem Fenster zu springen, war mir schon klar. Vielleicht hätte ich aus dem Badezimmer einfach einen schweren Gegenstand nach dem Mann mit Hut werfen sollen, die Personenwaage beispielsweise. Oder mit möglichst tiefer Stimme »Polizei! Nehmen Sie langsam die Hände hoch und drehen Sie sich mit dem Gesicht zur Wand« rufen. Trotzdem. Es war nett von mir gewesen. Und ziemlich cool. Undankbare Ziege.
»Gern geschehen«, sagte ich.
»Du kapierst es nicht. Sie dürfen dich auf keinen Fall erwischen.«
»Mich?«, fragte ich nach. Die war ja lustig. Immerhin hatte bisher keiner gedroht, mich umzubringen. »Was passiert hier gerade? Sag bitte, das ist irgendein schräges Cosplay.«
Sie antwortete nicht, was vielleicht an den drei Gestalten lag, die zehn, fünfzehn Meter vor uns um die hintere Hausecke bogen. Leider waren es keine knutschenden Partygäste, die von der Terrasse kamen, sondern der Silhouette nach ein Mann und eine Frau und etwas, das wie ein riesiger Hund aussah.
»Scheiße!«, flüsterte Kim.
Ja, scheiße.
Die Frauensilhouette sah eher harmlos aus, der Mann hingegen wirkte schon als Schattenriss deutlich jünger und muskulöser als der Hutmann, aber das eigentliche Problem war der Hund – er reichte dem Mann bis fast zur Hüfte. Ein Hecheln ertönte, das Tier warf sich in unsere Richtung, offenbar nur von einer Leine gebremst.
Hinter uns kämpfte sich der Hutmann durch die Hecke, was wir mehr hörten als sahen. Jetzt saßen wir in der Falle.
Der Garten seitlich des Hauses war nur wenige Meter breit, von einer zwei Meter hohen Mauer zu den Nachbarn, Lasses spendablen Großeltern, abgetrennt. Außer ein paar Johannisbeersträuchern, Kompostern und einem Brennholzstapel stand hier noch der Geräteschuppen. Die Musik und das Stimmengewirr der Party waren lediglich gedämpft zu hören. Keine Chance, um Hilfe zu rufen.
Es gab nur noch einen Ausweg. »Hier entlang«, zischte ich, griff nach der Hand der Blauhaarigen, zwängte mich mit ihr durch die Sträucher und rannte auf den Geräteschuppen zu. »Kannst du über die Mauer springen?«
Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ebenfalls Parkour machte und zwei Meter locker überwinden konnte, war nicht wirklich groß, hätte es uns aber ein wenig einfacher gemacht.
»Nein, kann ich nicht! Du musst ohne mich abhauen, hörst du? Sie dürfen dich nicht kriegen.«
Was hatte sie immer mit mir? Egal, das konnte ich später herausbekommen. Bis jetzt schienen sich unsere Verfolger noch zu orientieren, jedenfalls waren keine Schritte zu hören, nur die Stimme des Hutmanns, die irgendwo jenseits der Büsche Befehle erteilte. »Es ist noch ein Bürschchen bei ihr. Holt sie euch beide«, schnarrte er. »Aber das Mädchen brauche ich lebend. Lass die Sirin los!«
Oh verdammt! Die Sirin war vermutlich der riesige Hund. Und wenn sie nur das Mädchen lebend brauchten, hieß das wohl, dass das Bürschchen, also ich, von dem Vieh zerfleischt werden durfte.
Jetzt mussten wir schnell sein. Als Lasse noch klein war, hatten seine Großeltern hier neben dem Schuppen eine Art Katzenklappe in die Mauer gebaut, damit er jederzeit zu ihnen hinüberkommen konnte. Früher war ich dort oft mit Lasse durchgekrabbelt, und ich hoffte sehr, dass diese Klappe noch existierte. Während Kim mich anfauchte, dass ich nicht auf sie achten, sondern allein abhauen solle, kniete ich nieder, fand die Griffmulde und zog die Klappe auf. »Du zuerst!«
Die Klappe war ziemlich klein, aber glücklicherweise war die Blauhaarige schlank und beweglich. Ich war dankbar, dass sie keine Zeit mit einer Diskussion verlor, wer nun zuerst an der Reihe war, sondern sich bäuchlings hindurchquetschte. Allerdings nicht, ohne dabei eindringlich zu flüstern: »Wir müssen uns trennen, Quinn! Lauf weg und bleib erst stehen, wenn du in Sicherheit bist. Ganz egal, was passiert, und ganz egal, was du hörst, komm nicht noch mal zurück, um mich zu retten. Versprich mir das!«
»Schon klar.« Es war nicht zu überhören, dass es ihr wirklich wichtig war, nicht von mir gerettet zu werden.
»Venatores, capite!«, rief die schnarrende Stimme, und ich ließ die Klappe zufallen und sprang auf die Füße. Waren da etwa noch mehr Verfolger dazugekommen, namens Venatores und Capite? Ein kurzes Aufjaulen ertönte, und aus Angst, der Riesenhund könne sich in meinen Füßen verbeißen, während ich mich gerade durch die Öffnung zwängte, schwang ich mich mit kurzem Anlauf auf die Mauer, um von dort in den Garten von Lasses Großeltern zu springen. Gerade noch rechtzeitig. Bei meiner Landung hörte ich den Hund laut knurrend durch die Johannisbeersträucher brechen und gegen die Mauer prallen. So riesig er auch ausgesehen hatte, über dieses Hindernis schaffte er es offenbar nicht. Bei mir dagegen hatten sich die monatelangen Trainingssessions mit Lasse bezahlt gemacht. Wenn sie die Kinderklappe nicht entdeckten, würde die Mauer sie eine Weile aufhalten.
Von der Blauhaarigen war nichts mehr zu sehen. War sie Richtung Straße losgerannt oder in Richtung der angrenzenden Gärten? Ich hatte keine Ahnung. Und so schlau es theoretisch auch sein mochte, wenn wir uns trennten und die Verfolger so in unterschiedliche Richtungen lockten, wollte ich doch wissen, was zur Hölle hier eigentlich abging.
Nach dem Zufallsprinzip wandte ich mich nach links und sprintete am Gartenteich vorbei zu dem niedrigen Zaun, der das Grundstück zum rückwärtigen Nachbarn abgrenzte. Das Haus von Lasses Großeltern war voll erleuchtet, die beiden waren allerdings in der Oper, das hatten sie bei der Lieferung der Überraschungscocktailbar erzählt. Das Licht brannte nur, um eventuelle Einbrecher abzuschrecken. Mir half es, mich im Dunkeln halbwegs zu orientieren. Von der Blauhaarigen immer noch keine Spur. Ich hoffte, dass sie sich irgendwie zurechtfand. Und dass sie ein Handy dabeihatte, mit dem sie Hilfe rufen konnte. Mein Handy befand sich wie üblich in der Tasche meiner Jacke, und die Jacke lag bei Lasse auf dem Bett. In meiner Hosentasche hatte ich nur den Lieferschein der mobilen Cocktailbar, die ich vorhin für Lasse entgegengenommen hatte. Echt hilfreich.
Als ich an einer Tanne vorbei über den Zaun in den nächsten Garten setzte, hörte ich ein Rauschen, es klang wie das Schwingen der Flügel eines Vogels, eines Riesenvogels, um genau zu sein. Ich duckte mich instinktiv, so stark war das Gefühl, jeden Moment von einem gigantischen Flügel getroffen zu werden. Doch als ich hochblickte, war da nichts.
Vermutlich nur eine aufgeschreckte Eule in einem der angrenzenden Bäume. Zeit zu entspannen hatte ich allerdings trotzdem nicht, denn im selben Moment hörte ich ein lautes Jaulen hinter mir, das definitiv nicht in die Einfamilienhausidylle passte, sondern eher in eine mittelschlechte Horrorserie. Dieses Hundebiest hatte tatsächlich irgendwie die Mauer überwunden und war mir auf den Fersen!
Und plötzlich fragte ich mich, ob ich das hier gerade wirklich erlebte. Ein blauhaariges Mädchen, ein Dackelhutopa, ein Riesenhund und ein unsichtbarer Vogel machten Jagd auf mich? Was war in diesem Gin Tonic gewesen? Wahrscheinlich würde das alles sofort aufhören, wenn ich meinen Kopf für eine Minute unter kaltes Wasser hielte.
Aber dann wurde das Jaulen zu einem Heulen, und das klang so dermaßen gruselig, dass mir gar nichts anderes übrigblieb als weiterzusprinten. Später konnte ich ja immer noch über mich lachen.
Ich hechtete über eine durch Bewegungsmelder hell erleuchtete Rasenfläche und sprang über einen Jägerzaun in den nächsten Garten. Dort schlug ich einen Haken, kletterte an einem Spalier hinauf auf ein Garagendach, um vorne über eine Einfahrt auf die Parallelstraße zu gelangen, die ich überquerte, um über die nächste Einfahrt, die nächste Hecke in den nächsten Garten zu springen. »Bleib erst stehen, wenn du in Sicherheit bist«, hatte diese Kim gesagt. Guter Tipp. Nur wo genau sollte das sein? Das hier war eine reine Wohngegend, und um diese Zeit war absolut nichts los, man konnte höchstens dem Pizzaboten begegnen oder einem einsamen Jogger. Irgendwo zu klingeln war um diese Uhrzeit vermutlich sinnlos, schlimmstenfalls öffnete niemand, oder man würde mir die Tür vor der Nase zuschlagen, während von hinten der Riesenhund seine Fänge in meinen Nacken grub. Lieber weiterlaufen und genügend Abstand zwischen mich und das Vieh bringen. Zumal ich spürte, wie schnell ich war, was mir, je weiter ich mich durch die Gärten vorarbeitete, immer mehr Selbstvertrauen verlieh. Parkour im Dunkeln über unbekanntes, nicht gesichertes Terrain war unvernünftig und gefährlich, aber meine Füße fanden wie von selbst genau die richtigen Absprungpositionen, und mein Körper war perfekt angespannt, während ich von einem Garagendach zum nächsten flog. Je weiter ich kam, desto lebendiger fühlte ich mich. Unmöglich, dass jemand mit meinem Tempo mithalten konnte, schon gar kein Opi mit Hut. Und kein Hund der Welt konnte über eine Garage springen.
Mit ein paar Sätzen kletterte ich auf eine Eiche oder was auch immer das für ein Baum war, dessen Krone über den nächsten hohen Gartenzaun ragte. Für einen Moment horchte ich in die Dunkelheit und spürte, wie wilder Triumph in mir aufkam. Keine Schritte, keine schnarrenden Befehle, kein abartiges Heulen. Ich hatte sie abgehängt!
Zeit, tief durchzuatmen. Was immer hier gerade passiert war, es war total verrückt und unwirklich, wie eine Szene in einem Traum oder einem Film. Nur im Film sagten Leute Sätze wie »Ich brauche sie lebend!« und »Sie dürfen dich nicht erwischen!« Und nur im Film gab es Geräusche wie dieses Flügelrauschen, das nun unvermittelt über mir auftauchte, begleitet von einem schrillen, hohen Schrei, der weder von einem Menschen noch von einem Tier zu stammen schien und wie eine Mischung aus Kreischen und Fauchen klang. So viel zum Thema abgehängt.
Ich stürzte mich seitlich aus der Krone des Baums und hangelte mich abwärts, bis ich mich auf den Rasen fallen lassen konnte. Wieder war ich in einem Garten gelandet, mittlerweile wusste ich nicht mehr, in welcher Straße ich mich befand, aber da der Verkehr zugenommen hatte, musste ich schon in der Nähe der Ringe sein. Dort gab es geöffnete Restaurants, Straßenbahnen und Theater. Und Menschen.
Hier hingegen schienen alle schon zu schlafen. Auch als mehrere Lampen angingen, von Bewegungsmeldern eingeschaltet, rührte sich im Haus niemand. Noch einmal ertönte das Kreischen und trieb mich weiter vorwärts in Richtung einer Garage, bei der ich auf eine offene Hintertür hoffte. Doch ich kam gar nicht erst dazu, das auszuprobieren. Denn bevor ich an der Tür war, entdeckte ich zwei leuchtend gelbe Augen, die mich aus den Büschen heraus anstarrten.
Nein! Das war unmöglich! Und doch – als er hinaus in den Lichtkegel trat, wusste ich, dass der Riesenhund in Wirklichkeit ein Wolf war, schwarz, zottelig und mit drohend erhobenen Lefzen. Er hatte schon auf mich gewartet.
Seine gebleckten Zähne waren monströs, und nach einer Sekunde der Erstarrung reagierte mein Körper von allein. Ich sprang auf einen wackeligen Holzstapel neben der Garage und von dort mit einem verzweifelten Satz auf das Dach. Ein paar Holzscheite polterten zu Boden, als ich mich abstieß. Im Haus rührte sich immer noch nichts. Wenn die Leute jetzt aus dem Fenster schauen würden, sähen sie einen riesigen Wolf, der über ihren Rasen galoppierte und knurrend an ihrer Garagenwand emporsprang. Aber dummerweise schauten sie nicht aus dem Fenster. Niemand kam mir zu Hilfe. Mit einem Hechtsprung flüchtete ich auf das Garagendach der Nachbarn, von dort auf ein langgezogenes Vordach, hinunter zu einer Mülltonnenabtrennung und wieder hinauf auf das nächste Garagendach. Weiter hinten konnte ich die pinke Neonschrift des Friseursalons erkennen, der an der Einmündung zur Ringstraße lag. Wie ein Besessener rannte ich auf »Die vier Haareszeiten« zu. Ich würde mich in Güngörs Dönerimbiss flüchten, der gleich neben dem Friseursalon lag, und von dort die Polizei anrufen. Oder den Zoo. Oder meine Eltern. »Papa, kannst du mich schnell abholen? Ein Wolf und ein Riesenvogel wollen mich fressen!«
Die Motorengeräusche vorbeifahrender Autos sorgten dafür, dass ich das Flügelschlagen erst hörte, als es direkt über mir war. In meiner Panik sprang ich nicht richtig ab, und anstatt auf dem nächsten Dach endete mein Sprung irgendwo in der Luft davor. Die Dachrinne, an der ich mich festklammerte, löste sich sofort aus ihrer Verankerung und landete mit mir zusammen scheppernd auf dem Pflaster. Ein jäher Schmerz zuckte durch meinen Fuß, aber ich achtete nicht darauf, sondern lief, so schnell ich konnte, auf die Kreuzung zu. Die Lichter eines entgegenkommenden Autos blendeten mich, den Wolf sah ich deshalb erst, als er mich von der Seite ansprang und auf die Fahrbahn warf. Das Letzte, was ich hörte, bevor ich auf dem Asphalt aufschlug, waren die Bremsen des Autos, die mit dem Flügelwesen um die Wette kreischten. Und das Letzte, was ich dachte, war, dass jetzt doch hoffentlich auch die letzten Menschen in der Straße begriffen hatten, dass der Krach nicht aus ihrem Fernseher kam. Aber für mich war es zu spät.
Matilda
Bisher war der fünfte Dezember in meiner Erinnerung immer als »der Tag, an dem ich die Nikolauslüge entlarvte«, verankert oder im Gedächtnis meiner Familie als »der Tag, an dem Matilda Onkel Ansgar den Bart aus dem Gesicht rupfte, auf der Bischofsmütze herumtrampelte und allen den Nikolausabend verdarb«. Aber jetzt würde er wohl für immer der Tag bleiben, an dem Quinn von Arensburg verunglückte.
Und das nur eine halbe Stunde nachdem ich ihn auf Lasse Novaks Geburtstagsparty zur Hölle gewünscht hatte. Auf den ersten Blick hätte man da vielleicht einen Zusammenhang vermuten können, aber ich hatte Quinn schon hundertmal zur Hölle gewünscht, ohne dass ihm danach etwas zugestoßen war, und obwohl ich normalerweise sehr empfänglich für Schuldgefühle aller Art war – Julie behauptete sogar immer, »Schuldgefühl« sei mein zweiter Vorname –, bildete ich mir keine Sekunde lang ein, etwas damit zu tun zu haben.
Die Nachricht, dass Quinn vor ein fahrendes Auto gelaufen war, hatte Lasses Party abrupt beendet. Die Polizei war ins Haus gekommen, und das Letzte, was Julie und ich gesehen hatten, bevor wir zusammen mit den anderen völlig schockierten Partygästen gingen, war Lasse. Er saß zusammengesunken und verwirrt auf dem Sofa und versuchte, Fragen zu beantworten, während Lilly Goldhammer tränenüberströmt in den Armen einer überfordert wirkenden Polizistin hing.
Aus irgendeinem Impuls heraus wünschte ich mir in diesem Moment, mit Lilly tauschen und ebenfalls hemmungslos weinen zu können.
Das war natürlich völlig abwegig. Offiziell hasste ich Quinn von Arensburg nämlich, seit ich ungefähr sechs war und er mich »dumme Hamsterbacke« genannt und in die Brennnesseln geschubst hatte.
Die von Arensburgs und die Martins waren, seit ich denken konnte, verfeindet, auch wenn man Begriffe wie »verfeindet« oder »hassen« in unserer Familie selbstverständlich weit von sich weisen würde. Die von Arensburgs stellten allerhöchstens unsere Nächstenliebe ein wenig auf die Probe. Was aber im Grunde dasselbe war.
Julie war die Einzige, die wusste, dass ich eine heimliche, über jede Nächstenliebe hinausgehende Zuneigung für Quinn hegte, obwohl das umgekehrt ganz sicher nicht galt und »nerviges Grübchenface« noch das Netteste war, das Quinn im Laufe der Jahre zu mir gesagt hatte. Das bisher Gemeinste auf der Liste war »sprechender Wirsing«, dicht gefolgt von »Zwiebacktütengesicht«.
Zugegeben: Quinn wusste vermutlich nie, mit wem genau er gerade sprach, sondern verwechselte mich beliebig mit meinen Cousinen Luise und Mariechen oder mit meiner großen Schwester Teresa. Aber das machte es ja nicht besser, sondern nur noch ungerechter. Mit Luise verwechselt zu werden kränkte mich am meisten. Ich meine, dass man Luise in die Brennnesseln schubsen wollte, konnte ich absolut verstehen, es verging bis heute fast kein Tag, an dem ich nicht selber Lust dazu gehabt hätte.
Ärgerlicherweise sahen Luise und ich uns aber zum Verwechseln ähnlich, und Quinn war nicht der Einzige, der uns nicht auseinanderhalten konnte. Genau genommen sahen wir alle recht gleich aus, Luise, Mariechen, Teresa und ich. Und Luises Zwillingsbruder Leopold. Das lag daran, dass meine Mutter und Luises Mutter – Tante Bernadette – Schwestern waren und mein Vater und Luises Vater Brüder. Wir Kinder hatten allesamt blonde Locken, nach oben geschwungene Nasen und auffallende Grübchen in den Wangen, was vielleicht ganz niedlich klingt, aber nur niedlich ist, wenn man unter acht Jahre alt ist.
Oder eben ein Posaunenengel.
Ich schnaubte, als ich an unser Gespräch an der Bar dachte. Er hatte mich wirklich aufgeregt, jetzt war ich allerdings froh, dass mir im Gegenzug kein originelles Schimpfwort eingefallen war. Möglicherweise wäre es ja das Letzte gewesen, was ich jemals zu ihm gesagt hätte …
»Das überlebt der schon, wenn er es denn überhaupt war.« Julie lächelte mich auf dem Weg nach Hause von der Seite aufmunternd an und drückte meine Hand. Sie hatte natürlich gemerkt, dass ich meine unangebrachten Tränen runterschluckte. »Abgesehen davon bist du nicht die Einzige, der das nahegeht. Ich bin auch ganz aufgewühlt. Lasses komische Cousine hat sogar geheult, und die kannte Quinn überhaupt nicht.«
»Ich glaube, die hat geheult, weil sie Kaugummi in den Haaren kleben hatte«, sagte ich. »Sie hat mich gefragt, ob ich ein Taschenmesser dabeihätte und ihr damit einen Pony schneiden könnte.«
Irgendwo ein paar Straßen weiter war ein Martinshorn zu hören, und ich blieb stehen.
»Bestimmt ist alles nur halb so schlimm.« Julie zog mich weiter. »Ich kann mir Quinn gar nicht verletzt vorstellen, du denn? Ich meine, der Typ hat neulich einen Salto vom Turnhallendach gemacht.«
Daran erinnerte ich mich noch gut, weil er nur zwei Meter von mir entfernt gelandet war, anmutig wie eine Katze. Er hatte sich lachend aufgerichtet, eine glänzende schwarze Haarsträhne aus dem Gesicht gepustet und mit seinen leuchtend blauen Augen an mir vorbei zu seinen Freunden geschaut, die natürlich grölten und applaudierten.
»Ja«, sagte ich. »Ich kann mir leider immer alles vorstellen.«
»Vor allem das Negative, ich weiß, du bist eine äußerst phantasievolle Pessimistin.« Julie schnaubte. »Aber jetzt müssen wir einfach positiv denken. Ich bin sicher, Quinn kommt am Montag wieder zur Schule, und dann kannst du ihn von weitem anhimmeln, und er kann dich ignorieren. Wie immer.«
»Wenn er mich nicht gerade mit Luise verwechselt.« Ich versuchte zu lächeln. »Ich hätte heute Abend dein T-Shirt tragen sollen.« Zu meinem fünfzehnten Geburtstag hatte Julie mir nämlich ein Shirt mit dem Aufdruck »Ich bin NICHT Luise« geschenkt. Genau wie das »Es gibt zwei Arten von Menschen. Ich hasse beide«-Shirt durfte ich es leider nur als Schlafanzugoberteil tragen, und meine Mutter versuchte überdies seit anderthalb Jahren, es durch zu heißes Bügeln zu töten, wie sie das mit all meinen Kleidungsstücken machte, die ihr ein Dorn im Auge waren. Während auf dem Menschenhasser-Shirt inzwischen nur noch »ei ei M asse« stand, blieb der Schriftzug auf dem Luise-Shirt aber wie durch ein Wunder unversehrt. Vielleicht war das ja ein Zeichen.
»Ich sag dir was. Wenn Quinn am Montag wieder zur Schule kommt, trage ich das T-Shirt nächsten Sonntag in der Kirche«, erklärte ich feierlich. »Ohne Strickjacke.«
Julie lachte. »Deine Eltern werden einen Exorzisten holen, wenn du das tust, aber ich werde dich nicht davon abhalten. Ich träume seit Jahren davon.«
In diesem Augenblick vibrierten unsere Handys, und wir griffen synchron in unsere Jackentaschen.
»Oh, Scheiße«, murmelte Julie.
Die ersten Gerüchte hatten zu kursieren begonnen. Und demnach war Quinn entweder tot oder schwer verletzt oder leicht verletzt oder überhaupt gar nicht erst in einen Unfall verwickelt.
Den Rest des Wegs starrten wir verwirrt auf unsere Displays und versuchten herauszufinden, welche Meldung der Wahrheit am nächsten kommen könnte. Und welche allein auf Phantasie oder Wunschdenken basierte. Für Quinns Tod sprach, dass jemand aus seiner Stufe irgendwo ein Posting des Imbissbesitzers entdeckt hatte, vor dessen Laden der Unfall stattgefunden hatte. Es zeigte ein verschwommenes Foto von der Unfallstelle, dazu der Text: »Ich hoffe, sie machen im Himmel genauso guten Döner für diesen Jungen, der ein großer Fan unseres Iskender-Tellers war.« Und jemand, der angeblich jemanden kannte, der einen der Rettungssanitäter kannte, schrieb, es seien jede Menge Gehirnmasse sowie ein Ohr auf dem Asphalt zurückgeblieben.
Aber wenn Quinn tot war, warum war dann der Rettungswagen noch mit Sirene und Blaulicht abgefahren, was Smilla Bertrams Bruder wohl mit eigenen Augen gesehen hatte? Und wie passte das zu der Behauptung, Quinn sei so betrunken gewesen, dass ihm im Krankenhaus der Magen ausgepumpt werden musste?
Und dann war da auch noch unsere Freundin Aurora, die beschwören konnte, Quinn gerade eben noch völlig unversehrt im Kino gesehen zu haben. »Zwar nur von hinten, aber das war er ganz sicher!«, schrieb sie.
Leider war es nicht mal Julie möglich, Auroras Version zu glauben, denn die hatte im Oktober erst Justin Bieber im Supermarkt gesehen, wie er Klopapier und eine Tüte Leinsamen kaufte. Also vermutete ich, die Wahrheit lag irgendwo zwischen verletzt und tot. Zumindest an dem Gerücht, Quinn sei betrunken gewesen, war ja ein wahrer Kern: Er hatte seinen Gin Tonic auf ex gekippt, und wenn er danach genauso schnell den anderen sowie meinen Caipirinha getrunken hatte, war er alles andere als nüchtern gewesen und seine Reaktionsgeschwindigkeit sicher eingeschränkt. Vielleicht wäre ihm ja nichts passiert, wenn ich mehr um meinen Drink gekämpft hätte …
»Und da sind sie wieder, die guten alten Schuldgefühle«, sagte Julie, als ich meine Überlegungen mit ihr teilte. »Ich dachte, es reicht dir, für den Klimawandel verantwortlich zu sein.«
»Man trägt eine Mitschuld, wenn man Produkte mit Palmöl konsumiert«, gab ich zurück, den Blick weiterhin fest auf mein Handy geheftet.
Es war erst halb elf, als wir bei Julie ankamen, aber im Haus schliefen bereits alle. Vor der Tür hatten Julies drei kleine Stiefbrüder ihre Gummistiefel für den Nikolaus aufgestellt, und wie es aussah, war der auch schon da gewesen, die Stiefel waren voller kleiner Päckchen und Mandarinen.
»Lass einen Schuh hier stehen«, flüsterte Julie, während sie eine ihrer schicken schwarzen Wildlederstiefeletten neben den Gummistiefeln abstellte. »Sonst ist sie enttäuscht.«
»Und ich erst.« Sie war Julies Stiefmutter, meine Tante Berenike aka der netteste Mensch auf der Welt. »Letztes Jahr hatte ich diese supertolle Wimperntusche im Schuh. Und Marzipankugeln.« Ich rückte meine eigene Stiefelette sorgfältig neben Julies in Position. Sie war auch schwarz, aber nicht schick, weil ich sie von Teresa geerbt hatte, und die ging immer mit meiner Mutter shoppen.
Auf Zehenspitzen schlichen wir uns hinauf in Julies Zimmer und schlossen leise die Tür hinter uns. Tante Berenike hatte Julies Schlafsofa bereits für mich überzogen und uns Kekse und Johannisbeerschorle hingestellt. Tante Berenikes Fürsorge war einer der Gründe, warum wir viel lieber hier übernachteten als bei mir zu Hause. Ein anderer war, dass mein Zimmer nur acht Quadratmeter groß war, wohingegen Julie sogar ein eigenes Bad besaß. Und das Wichtigste: Hier durften wir sonntags ausschlafen, so lange wir wollten, während meine Eltern darauf bestanden, dass wir auch an den kirchenchorfreien Tagen um neun Uhr mit ihnen in den Gottesdienst gingen.
Tante Berenike hatte genetisch zwar das volle Löckchen-Grübchen-Näschen-Schmollmündchen-Programm wie meine Mutter und Tante Bernadette abbekommen, in jeder anderen Hinsicht hätten sie jedoch unterschiedlicher nicht sein können. Ihre Schwestern erwähnten bei jeder Gelegenheit, wie »unstet« Tante Berenikes Lebenswandel vor ihrer Eheschließung gewesen war, und die Urgroßtanten benutzten gern Worte wie »liederlich« und »Skandalnudel«, wenn sie über sie sprachen. Tante Berenike warf dann ihre Lockenmähne in den Nacken und lachte laut. Sie lachte überhaupt sehr viel, und vielleicht wirkten deshalb die Grübchen bei ihr immer noch anziehend und waren nicht wie bei meiner Mutter und Tante Bernadette zu zwei missbilligenden Falten rechts und links der Mundwinkel mutiert.
Julies leibliche Mutter stammte aus Tansania und war an Brustkrebs gestorben, als Julie gerade laufen konnte. Nach dem Tod seiner Frau war Julies Vater nach Deutschland zurückgekommen, wo er dann Tante Berenike kennengelernt hatte. Auf diese Weise war Julie meine Cousine geworden, eine Tatsache, für die ich dem Schicksal jeden Tag dankbar war. Ohne Julie an meiner Seite wäre ich in dieser Familie längst wahnsinnig geworden.
»Luise und Leopold haben offenbar eine Gruppe mit dem Namen Trauer um Quinn gegründet.« Julie schnappte empört nach Luft. »Nur für Leute aus ihrer Stufe, natürlich. Wir sind nicht eingeladen.«
»Trauer um Quinn? Heißt das …?« Ich konnte den Satz nicht zu Ende sprechen.
»Nein, heißt es nicht«, sagte Julie energisch. »Es heißt nur, dass Luise und Leopold schlimm sind. Und solche Streber. Sie haben Lehrer zu der Gruppe eingeladen!«
»Vielleicht wissen sie ja mehr«, erwiderte ich unsicher. Oh Gott, vielleicht hatten sie mit Quinns Eltern gesprochen … »Ist Quinn tot?«, schrieb ich mit zitternden Fingern an Luise.
»Höchstwahrscheinlich«, schrieb sie sofort zurück. »Man hat sehr viel Gehirnmasse und ein Ohr am Unfallort gefunden.«
Ich atmete erleichtert auf. Luise war also genauso ahnungslos wie wir alle und orientierte sich auch nur an den Gerüchten. Und das mit dem Ohr glaubte ich nicht eine Sekunde lang.
»Das ist so luisig, eine Trauergruppe für jemanden zu gründen, der überhaupt nicht tot ist«, sagte ich, nachdem ich ihr ein Kotzsmiley geschickt hatte.
»Ja, genauso gut könnte man eine Hochzeitsfeier für jemanden organisieren, der Single ist«, erwiderte Julie.
Mir entschlüpfte ein kleines hysterisches Kichern, und ich schlug mir erschrocken auf den Mund. Was stimmte denn mit mir nicht? »Und wenn er wirklich tot ist?«
Julie schüttelte ihren Kopf. »Die drehen doch alle völlig frei. Niemand weiß irgendwas. Oder glaubst du etwa, dass Lilly Goldhammers Vater der Fahrer des Unfallwagens war und Quinn ermorden wollte? Iss einen Keks! Quinn lebt noch.« Sie schaute auf ihr Display. »Siehst du! Gerade bekommt er nämlich eine Niere gespendet, von der Frau, die ihn angefahren hat. Oh Mann!«
»Du hast recht! Niemand weiß irgendwas. Wir können nur abwarten.« Ich legte mein Handy entschlossen zur Seite. »Sollen wir uns eine von den langweiligen Tierdokus anschauen, die du so magst? Das beruhigt die Nerven.«
»Au ja«, sagte Julie begeistert. »Ich habe neulich eine Reihe über die Natur am Oberlauf der Donau angefangen, die wird dir gefallen, da passiert absolut gar nichts. Und wir ziehen meine Weihnachts-Flanell-Schlafanzüge an. Mama wird sich so freuen, wenn wir die morgen am Frühstückstisch tragen.«
Zusammengekuschelt machten wir es uns auf dem Sofa gemütlich. Die Kekse schmeckten zwar ein wenig seltsam – wahrscheinlich hatte Tante Berenike den Kleinen wieder erlaubt, alles Mögliche in den Teig zu werfen, Hauptsache, es machte ihnen Spaß –, aber wir aßen sie trotzdem alle auf. Irgendwann – im Video schüttelte gerade ein Haubentaucher in Zeitlupe Wasser von seinem Gefieder – schlief ich ein.
Als ich wieder aufwachte, lag Julies Kopf auf meiner Schulter, der Laptop war zugeklappt. Ich hatte geträumt, und eine Sekunde lang hatte ich das Gefühl, der Traum sei irgendwie von Bedeutung, und es wäre wichtig, ihn festzuhalten. Aber je mehr ich versuchte, mich zu erinnern, desto mehr entglitt er mir, bis ich nach einer halben Minute nur noch wusste, dass die Katze der von Arensburgs mir im Traum zugeblinzelt hatte. Dann war ich nicht mal mehr sicher, ob das stimmte. Das Einzige, das zurückblieb, war ein ungewöhnliches Gefühl von Zuversicht.
Vorsichtig schob ich Julies Kopf beiseite, schälte mich aus der Decke und griff nach meinem Handy. Es war halb drei, und ich musste dringend aufs Klo. Während ich mir die Zähne putzte, sah ich aus dem Fenster. Wäre ich jetzt zu Hause in meinem Zimmer, könnte ich direkt hinüber zu Quinns Haus schauen. Im Winter, wenn es früh dunkel wurde und ab nachmittags Licht brannte, konnte man die Inneneinrichtung gut erkennen. Alles dort war bunt: Möbel, Bilder, Wände, Kissen und die Blumen auf dem Esstisch. Auch die Kleider von Quinns Mutter und die Hemden seines Vaters waren farbenfroh gemustert, und selbst die Katze, die mir im Traum zugezwinkert hatte, besaß leuchtend orangerotes Fell. Von meinem Zimmer aus konnte ich am besten in die mintgrün gestrichene Wohnküche gucken, in der sie zusammen kochten, aßen oder mit Freunden zusammensaßen und spielten. Zumindest von weitem wirkten sie wie aus einem Bilderbuch, die harmonischste Familie der Welt.
Manchmal machten sie abends zu dritt einen kleinen Spaziergang durch das Viertel, und dann legte Herr von Arensburg einen Arm um Quinns Schultern, während Quinn wiederum einen Arm um die Schultern seiner Mutter legte. Wegen Quinns asiatischem Aussehen – die großen blauen Augen hatte er wohl von seiner Mutter geerbt – war jedem auf den ersten Blick klar, dass sein eher untersetzter rotbärtiger Vater nicht sein leiblicher Vater sein konnte, aber er wirkte immer so, als würde er jeden Moment vor Stolz auf seinen Adoptivsohn platzen.
Wie es den Eltern wohl gerade erging? Saßen sie in ihren bunten Klamotten auf einem tristen Krankenhausflur und warteten, starr vor Angst?
Wenigstens blieben sie von den Fake News verschont, die immer noch kursierten. Smilla Bertram hatte die Vermutung geäußert, Quinn habe sich mit Absicht vor das Auto gestürzt, und es war eine heftige Diskussion über die Motive dafür entbrannt. Und noch schlimmer war, dass Gereon Meyer mit seinem 3-D-Drucker ein Ohr für Quinn ausdruckte, aus neongrünem Kunststoff.
Als ich Zahnpasta ins Waschbecken spuckte, leuchtete ein Bild von Luise auf meinem Display auf. Sie lächelte traurig in die Kamera, und im Hintergrund konnte man brennende Kerzen und Blumen erkennen und … Moment mal! War das etwa der Gartenzaun der von Arensburgs? Ich zoomte die Eisengitter neben Luises rundem Kopf heran. Oh ja! Das war der Gartenzaun der von Arensburgs. Auf dem Mäuerchen darunter standen diverse Windlichter und Friedhofskerzen und eine Art Plakat mit einem Regenbogen, unter dem »Wir werden dich nie vergessen, Quinni«, stand.
»Ich hoffe, dass Quinn es gut über die Regenbogenbrücke geschafft hat, und bete für seine armen Eltern«, hatte Luise unter das Foto geschrieben. »Danke an alle, die hier mit uns ihr Mitgefühl und ihre Betroffenheit ausdrücken.« Von den Hashtags las ich nur noch #kannnichtschlafen, #friends und #gottesplan, da hatte ich auch schon die Badezimmertür aufgerissen.
Die hatten doch nicht alle Nadeln auf der Tanne!
Julie schrak vom Sofa hoch, offenbar hatte ich das laut gerufen. »Was ist los?«, fragte sie verschlafen. »Warum ziehst du dich an?«
»Ich muss nach Hause. Luise und Leopold haben eine Art Totenwache vor Quinns Haus inszeniert, und ich möchte nicht, dass seine Eltern … Guck mal auf Luises Insta-Account.« Ich zog den Reißverschluss meiner Jeans hoch. »Stell dir vor, die kommen aus dem Krankenhaus nach Hause, total übermüdet und voller Sorge, und dann sehen sie das! Organisiert von ihren Lieblingsnachbarn. Wo ist meine Jacke?«
»Das haben sie nicht wirklich getan!« Julie setzte sich auf und suchte nach ihrem Handy. »Wo ist denn …? Oh, ich sehe es!« Sie riss ihre großen braunen Augen weit auf. »Hashtag allesschläfteinsamwacht … Ich fasse es nicht.«
Ich rannte bereits die Treppe hinunter, schlüpfte vor der Haustür in meine Stiefeletten und war schon eine halbe Straße weiter, als Julie hinter mir herkam.
»Warte«, rief sie. »Ich kann Luise mit Krav Maga aus meinem Komm-sicher-nach-Hause-Kurs drohen.«
Ich konnte nicht anders, ich musste ihr einen Kuss auf die Wange geben, als sie mich eingeholt hatte. »Danke! Du bist die Beste!« Dann sprintete ich wieder los. »Los, wir nehmen die Abkürzung!« Ich zeigte auf das kleine Gittertor, das zum Friedhof führte.
»Auf keinen Fall«, keuchte Julie. »Nicht über den unheimlichen Friedhof. Nicht mitten in der Nacht. Ich trage immer noch meinen Pyjama!«
»Sei nicht so ein Baby!«, gab ich zurück. »Den Zombies ist es egal, was du anhast.« Der Weg über den Friedhof kürzte die Strecke zwischen Julies und meinem Zuhause um mehr als die Hälfte ab, und ich benutzte ihn zu jeder Tageszeit, weil ich mich im Gegensatz zu Julie dort nicht gruselte. Der Friedhof war einer der größten und ältesten der Stadt und mit seinen denkmalgeschützten Grabmälern, den breiten baumbestandenen Alleen, den vielen moosbewachsenen Statuen und den verwilderten Flächen auch der schönste. Offiziell schloss er im Winter um neunzehn Uhr, aber meistens blieben die Nebeneingänge unverschlossen, und für den Fall, dass sie mal von einem besonders eifrigen Friedhofswärter oder -gärtner abgeschlossen wurden, hatte ich immer einen Schlüssel dabei. Sich um die Pflege vernachlässigter Gräber zu kümmern war das Einzige meiner vielen mir von der Familie aufgezwungenen Ehrenämter, das ich uneingeschränkt mochte.
Auch im Dunkeln kannte ich mich auf dem Friedhof bestens aus, weshalb ich wieder in den Laufschritt fiel, nachdem ich die kleine eiserne Nebenpforte geschlossen hatte, durch die wir reingekommen waren.
Julie griff nach meiner Hand. »Nicht so schnell, bitte«, flüsterte sie.
Aber ich wollte keine Zeit verlieren, ich musste Quinns Eltern den Anblick von Luises verfrühter Totenwache ersparen. »Zombies sind langsam, sie kriegen dich nicht, wenn du läufst.«
»Haha.« Julie beschleunigte ihre Schritte, hielt dabei aber meine Hand fest umklammert. »Uh! Überall diese flackernden roten Lichter. Und ich glaube, dahinten hat sich was bewegt.«
Mir konnte sie damit keine Angst machen. Der Friedhof war auch um diese Uhrzeit voller Leben, der Wind raschelte in den Bäumen, Käuzchen, Fledermäuse, Marder und Katzen gingen hier nachts auf die Jagd, und ich hatte schon oft einen Fuchs gesehen, der irgendwo seinen Bau haben musste. Ich hatte ihn Gustav getauft. Aber weil wir mit unserem Gerenne und Gekeuche alle in die Flucht trieben, gelangten wir an das Tor, das auf die Alte Friedhofsstraße führte, ohne Gustav oder einem anderen Tier zu begegnen. Julie atmete erleichtert auf, als wir das Tor hinter uns schlossen. Wie immer quietschte es dabei leise.
»Gru. Se. Lig«, hauchte Julie und schüttelte sich.
»Oh, gut, dass ihr da seid«, sagte jemand erfreut, und Julie kreischte auf, als habe doch noch ein Zombie nach ihr gegriffen. Es war aber schlimmer, es war Luise. Ich hatte gehofft, sie sei in der Zwischenzeit ins Bett gegangen und ich müsse nur schnell die Sachen von der Mauer räumen. Luise sah allerdings hellwach aus. Sie kommentierte Julies Kreischen mit einem tadelnden Zungenschnalzen. »Habt ihr Grablichter mit Deckel dabei? Die Kerzen werden immer vom Wind ausgeblasen, und wir bräuchten noch viel mehr, es soll wie ein Lichtermeer aussehen, wenn Herr und Frau von Arensburg nach Hause kommen.«
»Wenn man nur wüsste, wann das wäre …«, ergänzte Leopold. Er stand in der Einfahrt der von Arensburgs und hatte die Hände vor seiner Brust verschränkt. Auf der Mauer neben ihm lag sein Oboenköfferchen. »Ich stelle es mir wunderbar stimmungsvoll vor, ›So nimm denn meine Hände‹ anzustimmen, während sie aus dem Auto steigen. Oder ›Time to Say Goodbye‹ Oder vielleicht einfach ganz schlicht …«
»Hier wird gar nichts angestimmt, ist das klar?«, sagte ich leise. Eigentlich wollte ich es wütend und energisch schreien, nur war ich doch mehr außer Atem, als ich gedacht hatte. »Ihr räumt diesen heuchlerischen Scheiß jetzt hier weg und verkriecht euch, bevor jemand verletzt wird.«
Leopold und Luise starrten mich überrascht an. »Bevor jemand verletzt wird?«, wiederholte Luise. »Drohst du uns etwa?«
»Ich dachte eigentlich an die von Arensburgs, die ihr mit eurer Performance hier verletzt, aber wenn du es so verstehen willst – ja! Ich drohe euch!« Meine Stimme wurde schon kräftiger. »Ihr könnt hier doch keine Totenwache für jemanden veranstalten, der überhaupt nicht tot ist. Habt ihr euch mal überlegt, wie Quinns Eltern sich fühlen, wenn vor ihrem Zuhause schon die Grablichter brennen, während Quinn vielleicht im Krankenhaus schwer verletzt um sein Leben kämpft?«
»Das weißt du doch gar nicht«, schnappte Luise.
»Ja, aber ihr doch auch nicht!«, rief ich.
Etwa fünf Sekunden lang schwiegen die Zwillinge. Im Licht der Straßenlaterne und der Kerzen konnte ich sehen, wie es in ihren Gesichtern arbeitete, und ganz kurz keimte in mir die Hoffnung auf, sie würden ihren Fehler einsehen.
»Selbst wenn er noch nicht tot ist, schadet ein wenig Anteilnahme nicht«, sagte Leopold dann, und meine Hoffnung schwand dahin. Nie im Leben würden Luise und Leopold einen Fehler eingestehen. Das war in ihrem Charakter einfach nicht vorgesehen. »Der Sterbeprozess wird aus unserer Gesellschaft viel zu sehr ausgegrenzt«, belehrte mich Leopold. »Und mit Gebeten, Kerzen und Liedern verletzt man doch niemanden.«
Ich ballte meine Hände zu Fäusten. Es war wie immer zwecklos, mit den beiden zu diskutieren.
»Ganz genau.« Luise nahm das Regenbogenplakat vom Zaun. »Das hier kann ich ja ersetzen. Vielleicht schreibe ich einfach: ›Wir alle beten für dich, Quinni.‹ Das passt auf jeden Fall.«
»Quinni? Ernsthaft?« Julie hatte sich endlich von ihrem Zombietrip erholt und kam mir zu Hilfe. »Du kannst den Typ nicht mal leiden! Und für ihn bist du die dämlichste Kuh, die je auf Erden gewandelt ist.«
Und nicht nur für ihn. Ich pustete entschlossen eine Kerze aus.
»Quinn würde nicht mal wollen, dass du für ihn betest, wenn Beten helfen würde«, fuhr Julie fort, und Luise und Leopold atmeten empört ein.
»Und was heißt überhaupt, wir alle? Ich sehe hier nur euch beide«, sagte ich. Bei Julies Worten war ich innerlich ein bisschen zusammengezuckt. Ich war zwar seit einigen Jahren angesichts des Elends der Welt unsicher, ob Gott überhaupt existierte, aber ich brachte es auch nicht über mich, es völlig auszuschließen.
»Mach doch was«, sagte Luise zu Leopold.
»Ja, mach doch was, Leopold.« Ich fegte mit Schwung ein Grablicht von der Mauer. Wachs spritzte auf das Pflaster. Leopold riss erschreckt sein Oboenköfferchen an sich. »Am besten einfach schlafen gehen, wir räumen euren verlogenen Mist hier schon weg. Aber wenn du willst, können wir uns auch gern prügeln.«
»Sehr gern, sogar«, bestätigte Julie. »Ich möchte endlich mal meine Kenntnisse vom Komm-sicher-nach-Hause-Kurs anwenden. Diesen Hammerfaustschlag gegen das Genick, zum Beispiel.«
Leopold machte einen Schritt zurück. »Ihr seid ja … nicht ganz bei Trost. Wir stehen hier schon seit Stunden und haben uns wirklich Gedanken gemacht!«
»Ja, zeigt bitte ein wenig Respekt. Und Einfühlungsvermögen«, sagte Luise.
»Klingt seltsam von jemandem, der selber so einfühlsam wie eine Schrottpresse ist.« Julie ging auf die gegenüberliegende Straßenseite und zog unsere Restmülltonne aus dem Holzverschlag.
Das war eine gute Idee. So würde es am schnellsten gehen.
»Von wem sind die hier?« Ich hielt den kleinen Blumenstrauß in die Höhe, der zwischen den Gitterstäben steckte. Dann schaute ich ihn mir genauer an. »Sagt mal, ist das nicht der Strauß, den wir Tante Bernadette neulich zum Geburtstag geschenkt haben?«
»Sie waren noch fast wie neu«, verteidigte sich Luise. »Es geht doch auch mehr um die symbolische Botschaft.«
Mir kam allmählich der Verdacht, dass sämtliche Lichter und Plakate und Blumen allein von Luise und Leopold stammten und ihr Dank auf Instagram »an alle, die hier mit uns ihre Trauer und ihr Mitgefühl ausdrücken«, als ein Aufruf zu verstehen gewesen war, dem glücklicherweise niemand gefolgt war. Ich pfefferte den Blumenstrauß in die Mülltonne.
»Da kommt ein Auto«, sagte Julie, und mein Herz machte vor Schreck einen kleinen Hüpfer. Hastig pustete ich weitere Kerzen aus.
»Das ist das gute Windlicht von unserer Terrasse, das kannst du nicht in die Mülltonne werfen!« Luise riss Julie ein Glas aus der Hand. »Hast du etwa einen Schlafanzug an?«
Glücklicherweise bog das Auto in eine Einfahrt ein paar Häuser weiter vorne. Trotzdem hatte ich es jetzt eilig. Wenn die von Arensburgs nach Hause kamen, sollten sie auf keinen Fall die Kinder ihrer blöden Nachbarn sehen müssen. Deshalb überließ ich es Julie, die restlichen Kerzen in die Mülltonne zu werfen, und begann stattdessen, meinen Cousin energisch über die Fahrbahn zu schieben. Wir wohnten in einer Doppelhausvilla von 1902, in der schon mein Urgroßvater aufgewachsen war, Leopold, Luise, Onkel Thomas, Tante Bernadette und Mariechen in Nummer 14, meine Eltern, Teresa, ich und ein Gaststudent aus Uruguay namens Matías in Nummer 16.
Leopold stemmte sich nur halbherzig gegen mich. »Ich werde mich von dir sicher nicht zu gewalttätigen Handlungen verleiten lassen«, sagte er. »Aber ich protestiere nachdrücklich.«
So nachdrücklich, dass ich ihn nur bis zum Gartentörchen stupsen musste, den restlichen Weg bis zur Haustür ging er von ganz allein.
»Und jetzt du.« Ich drehte mich zu Luise um. Sie würde es mir vermutlich nicht so leicht machen.
»Versuch’s doch!« Sie verschränkte die Arme, so gut es mit einem Windlicht in der Hand möglich war. Dann wurde ihr Tonfall wehleidig. »Weißt du, wie oft ich die Kerzen wieder anzünden musste, weil der Wind sie ausgepustet hat?«
»Vielleicht war das gar nicht der Wind, sondern der Atem Gottes«, sagte ich, und Luise zischte: »Dass du dich nicht schämst!«
»Lass sie, Schwesterherz«, rief Leopold von gegenüber. Er schloss bereits die Haustür auf. »Wir haben getan, was wir konnten.«
»Ja, genau, Luise, du hast doch schon dein Instagram-Foto, das beweist, was für ein wahnsinnig mitfühlender Mensch du bist.« Julie knallte den Deckel der Mülltonne zu und rollte sie zurück in ihren Verschlag. »Das gibt bestimmt ein Like vom Heiligen Vater persönlich. Oder wenigstens von seinem Sekretär.«
Luise bedachte uns mit einem vernichtenden Blick. »Ich bin gespannt, was unsere Eltern morgen früh dazu sagen werden.«
Ja, da war ich allerdings auch gespannt. Aber jetzt wollte ich lieber nicht darüber nachdenken.