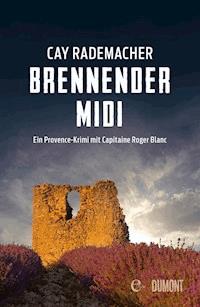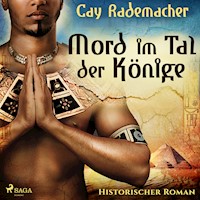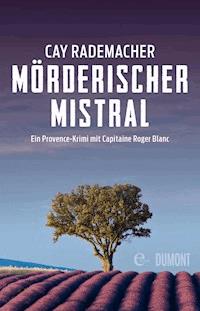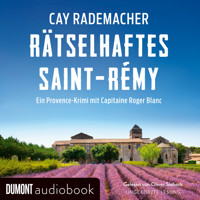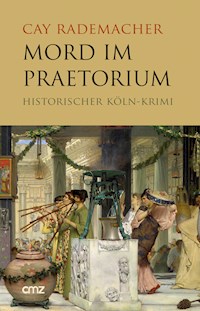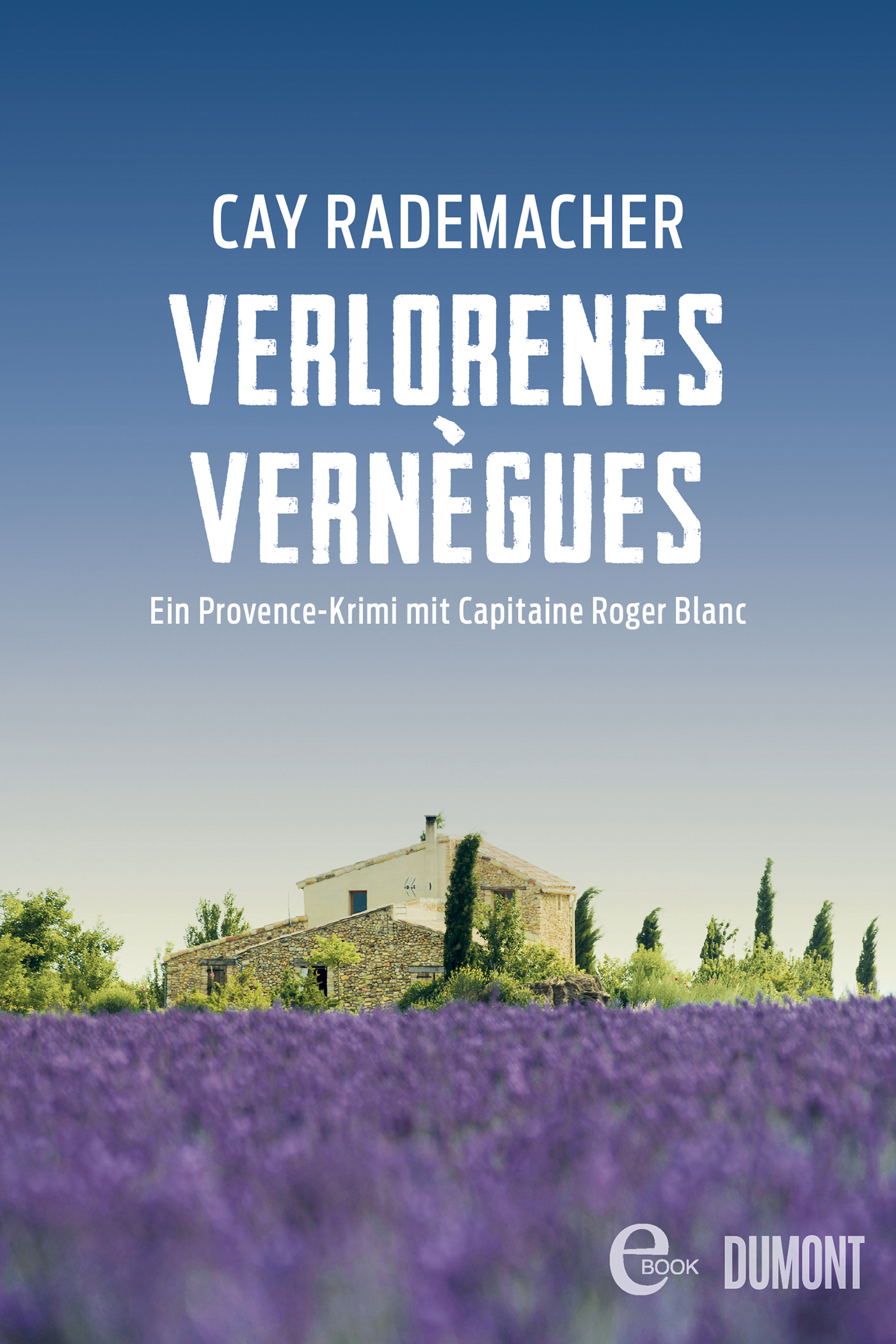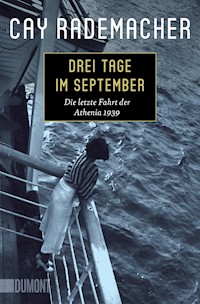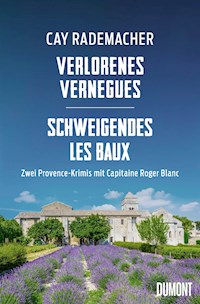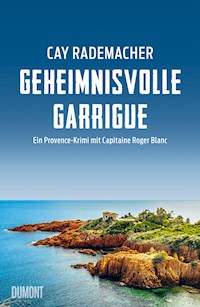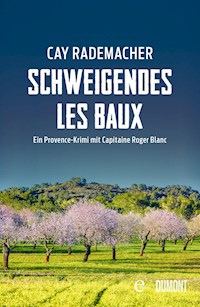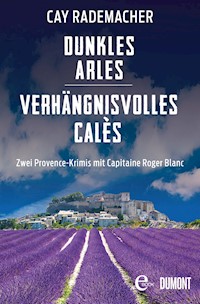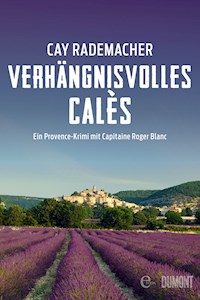
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Capitaine Roger Blanc ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der sechste Fall für Capitaine Roger Blanc Winter in der Provence, die Tage sind klar und eiskalt. Capitaine Roger Blanc wird in die Grotten von Calès gerufen: ein düsteres, verstecktes Tal in den Alpilles mit Dutzenden Höhlen, in denen vor Jahrhunderten Menschen lebten. Eine Archäologin ist dort auf ein Skelett gestoßen. Doch es ist keine uralte Leiche – denn im Stirnknochen gähnt das Einschussloch einer Pistolenkugel. Bevor Blanc mit den Ermittlungen richtig beginnen kann, wird er zu einem dramatischen Notfall gerufen. In der Burg La Barben ist während einer Hochzeitsfeier die neunjährige Noëlle verschwunden. Noch in der Nacht wird ein Verdächtiger verhaftet, gegen den scheinbar alle Indizien sprechen. Doch der Mann leugnet – und das Mädchen bleibt unauffindbar. Während sich seine Kollegen und Frankreichs Medien auf den Verhafteten konzentrieren, findet Blanc heraus, dass Noëlles Schicksal untrennbar mit dem namenlosen Skelett von Calès verbunden ist. So fahndet er nach einem Täter, der offenbar seit Jahrzehnten immer wieder Verbrechen begeht. Dafür gräbt Blanc sich tief in die finstere Vergangenheit einer Familie ein – und entdeckt, dass auf der Burg an jenem Abend viele Menschen ein Motiv gehabt haben könnten, die kleine Noëlle für immer verschwinden zu lassen ... Mord in der Provence – Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Band 9: Geheimnisvolle Garrigue Band 10: Stille Sainte-Victoire Band 11: Unheilvolles Lançon Band 12: Rätselhaftes Saint-Rémy Band 13: Bedrohliche Alpilles Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Winter in der Provence, die Tage sind klar und eiskalt. Capitaine Roger Blanc wird in die Grotten von Calès beordert: ein düsteres, verstecktes Tal in den Alpilles mit Dutzenden Höhlen, in denen vor Jahrhunderten Menschen lebten. Eine Archäologin ist dort auf ein Skelett gestoßen. Doch es ist keine uralte Leiche – im Stirnknochen gähnt das Einschussloch einer Pistolenkugel.
Bevor Blanc mit den Ermittlungen richtig beginnen kann, wird er jedoch zu einem dramatischen Notfall gerufen. In der Burg La Barben ist während einer Hochzeitsfeier die neunjährige Noëlle verschwunden. Noch in der Nacht wird ein Verdächtiger verhaftet, gegen den scheinbar alle Indizien sprechen. Doch der Mann leugnet – und das Mädchen bleibt unauffindbar. Während sich seine Kollegen und Frankreichs Medien auf den Verhafteten konzentrieren, findet Blanc heraus, dass Noëlles Schicksal untrennbar mit dem namenlosen Skelett von Calès verbunden ist. So fahndet er nach einem Täter, der offenbar seit Jahrzehnten immer wieder Verbrechen begeht. Dafür gräbt Blanc sich tief in die finstere Vergangenheit einer Familie ein – und entdeckt, dass auf der Burg an jenem Abend zahlreiche Menschen ein Motiv gehabt haben könnten, die kleine Noëlle für immer verschwinden zu lassen …
© in medias res
Cay Rademacher, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Bei DuMont erschienen seine Kriminalromane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit: ›Der Trümmermörder‹ (2011), ›Der Schieber‹ (2012) und ›Der Fälscher‹ (2013). Seine Provence-Krimiserie umfasst: ›Mörderischer Mistral‹ (2014), ›Tödliche Camargue‹ (2015), ›Brennender Midi‹ (2016), ›Gefährliche Côte Bleue‹ (2017), ›Dunkles Arles‹ (2018) und ›Verhängnisvolles Calès‹ (2019). Außerdem erschien 2019 der Kriminalroman ›Ein letzter Sommer in Méjean‹. Cay Rademacher lebt mit seiner Familie in der Nähe von Salon-de-Provence in Frankreich.
Mehr über das Leben im Midi erfahren Sie im Blog des Autors: Briefe aus der Provence
CAY RADEMACHER
VERHÄNGNISVOLLES CALÈS
Ein Provence-Krimi mit Capitaine Roger Blanc
Alle Personen in diesem Roman sind erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.
eBook 2019 © 2019 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN
Il faut mourir ou voir mourir.
Das Grab in der Höhle
Das Erste, was Capitaine Roger Blanc an dem Skelett auffiel, war das beinahe kreisrunde Loch im Stirnknochen. Ein Totenschädel mit drei Augenhöhlen, dachte er unwillkürlich.
»Wenn ich ein Bild davon ins Netz stellen würde, gäbe es eine Million Leute, die das für den Beweis halten würden, dass Aliens uns besucht haben«, flüsterte Sous-Lieutenant Fabienne Souillard.
Blanc blickte seine junge Kollegin bloß schweigend an. Sie stand neben ihm und hatte sich tief in ihre gelb-schwarze Trekkingjacke eingegraben. Die Fleece-Mütze hatte sie bis fast auf die Augenbrauen hinuntergezogen, und sie ballte ihre in Skihandschuhen steckenden Hände rhythmisch zu Fäusten und entspannte sie wieder, es sah einen absurden Moment so aus, als atmete sie mit den Fingern. Sie war gestern erst von ihrem Urlaub in Barcelona zurückgekehrt, und wahrscheinlich war es dort wärmer gewesen als in der Provence.
Winter in der Provence … Blanc sah sich um, es war sein erster Dezember im Midi. Über ihm wölbte sich ein Himmel wie aus blauem Glas. Doch die Nachmittagssonne war schon hinter einigen hoch über ihm aufragenden Klippen verschwunden und ließ am Boden bloß gräuliches Halbdunkel zurück. Er spürte, wie sich der Frost auf den Felsen durch seine Schuhsohlen fraß. Fabienne und er standen in einem düsteren, stillen Tal. Blanc kam sich vor wie auf dem Grund eines vor Urzeiten ausgetrockneten Sees. Das Tal war wie ein in die Berge hineingefräster Kreis, vielleicht dreihundert, vierhundert Meter im Durchmesser, sicherlich fünfzig Meter tief.
Ein älterer Beamter der Police municipale, der einzige uniformierte Polizist der winzigen Stadt Lamanon, hatte Fabienne und Blanc auf dem Parkplatz vor der kleinen Kirche erwartet und sie über einen steil ansteigenden Pfad in die Hügel der Alpilles geführt. Sie waren durch einen Pinien- und Eichenwald gegangen, die Erde dort, wo Schatten lagen, raureifüberkrustet, der Felsboden tückisch glatt durch einen kaum sichtbaren Eisfilm. Ihr Atem stand in weißen Wölkchen über den Lippen – kein Wind, der in den Zweigen flüsterte, kein Warnruf eines Vogels, nur ihr Luftholen, das immer schwerer wurde, je höher sie stiegen.
Und plötzlich traten sie in dieses dunkle Tal. Der Polizist hatte sie durch einen Riss in einem Felsen geführt. Nachdem sie diese Engstelle passiert hatten, blickten sie in ein weites Steinrund – und es war, als starrten die Steine zurück.
Höhlen, überall Höhlen.
Die Wände des Tals waren vom Boden bis hoch in die Klippen vernarbt: Im mürben Sandstein gähnten Löcher, manche Höhlen waren kaum hüfthoch und reichten nicht mehr als drei Meter in das Gestein, andere waren weit wie Scheunentore, fünf, zehn, zwanzig Meter hoch, und niemand konnte ahnen, wie tief sie in den Berg hineinführten. Die Höhlen, so kam es Blanc vor, waren schwarze Augen, die jeden seiner Schritte in diesem verbotenen Reich verfolgten. Sie schienen in den Felsen gefräst worden zu sein. Gefräst, ja, dachte er, das kann doch gar nicht natürlich sein. Die Ränder der Öffnungen waren glatt poliert. In wenigen besonders weiten Löchern war in der Mitte ein Stück Felsen als stützender Pfeiler stehen gelassen worden, damit das Gewölbe nicht kollabierte. Diese Grotten wirkten wie gigantische Totenschädel, Augenlöcher eines Riesen, dazwischen ein Nasenbein, das größer war als Blancs Körper. Zu manchen höher gelegenen Höhlen führten schmale Stufen, die in den Felsen geschlagen worden waren, keine breiter als ein Fuß. Er sah Mulden in den Böden der Grotten, schwarz von unzähligen längst erloschenen Lagerfeuern, und meterlange Rinnen, die vielleicht vor Urzeiten Regenwasser in tief ins Gestein gehauene Zisternen geleitet hatten. Auf einem Felsvorsprung, der von einer Talseite aus bis weit in den Kessel hineinragte, waren Mauern aus sorgsam geschichteten Steinen aufgerichtet worden. Auf dem Grund des Tals wuchsen Pinien und Eichen, so jung, dass ihre Stämme kaum dicker waren als der Oberschenkel eines Mannes. Oben, am Rand, standen die Bäume höher und dichter, schwarze Kronen im tiefen Licht der Sonne. Es duftete nach nassem Eichenlaub und feuchter Erde. Und es war unfassbar still. Die Grotten von Calès waren ein verborgener Kessel zwischen stummen Gipfeln.
Es war Montag, der 11. Dezember, und die meisten Gendarmen patrouillierten gerade die Weihnachtsmärkte der Dörfer ab, umweht von süßlichen Düften und schauderhafter Musik, fröstelnd und hoffend, dass nicht ausgerechnet hier ein Wahnsinniger mit einem Lastwagen durch die Menge pflügen würde. Fabienne und Blanc waren froh gewesen, dass sie dabei nicht länger mitmachen mussten, als Commandant Nkoulou sie zu sich rief, nachdem eine Archäologin sich telefonisch bei der Gendarmerie-Station von Gadet gemeldet hatte. Die Forscherin sei in Calès, wie sie sagte, über die Knochen eines Toten »gestolpert«. Das Skelett sei allerdings wahrscheinlich kein Fall für die Wissenschaft, sondern für die Gendarmerie, ob nicht mal einer der Beamten vorbeisehen mochte?
Und so starrte Blanc eine Dreiviertelstunde nach diesem Anruf auf den malträtierten Schädel. Hinter den leeren Augenhöhlen und dem Loch in der Stirn sah er feinen, gelben Sand, der sich über die Jahre in jenem Bereich des Kopfes abgelagert hatte, in dem einst das Gehirn gewesen sein musste. Sein Blick wanderte die Halswirbel abwärts, über die Schultern, Rippen, Ober- und Unterarme, das Becken, Ober- und Unterschenkel, alle Gebeine gelb-weiß, fleischlos. Doch selbst die winzigen Zehenknochen waren noch an ihrem Platz. Der namenlose Tote hat auf dem Rücken gelegen, vermutete er, beide Arme an den Seiten, die Beine ausgestreckt und parallel; er ist beerdigt worden, kein Tier hat diese Knochen je gestört. Auf der linken Talseite war er in den Boden einer kleinen Höhle eingelassen worden, der Sand, der die Gebeine umhüllte, war nichts anderes als Steinstaub, der hineingerieselt war. Aber wie lange? Jahrtausende? Oder bloß ein paar Jahre? Die Höhle lag ein Stück oberhalb der Sohle und war wahrscheinlich für lange Zeit so gut wie unsichtbar gewesen, sie war kaum zwei Meter hoch und zwei Meter breit und bis vor Kurzem vielleicht drei oder vier Meter tief gewesen. Doch ein Teil der Felswand war an diesem Tag abgerutscht. Blanc musterte die Steine, heller und gezackter als die anderen Felsen, das staubüberzogene Geröll. Einige Brocken, so groß wie Autos, waren bis in die Mitte des Tals gerollt. Wahrscheinlich hatte der Frost den mürben Sandstein gesprengt, sagte er sich. Der Felssturz hatte die Höhle aufgerissen – und dabei das Grab des Toten freigelegt.
»Kein Schmuck«, sagte Fabienne, »keine Uhr, keine Gürtelschnalle, nichts aus Metall, das noch erhalten wäre. Vielleicht liegt dieser Tote seit der Steinzeit hier.« Sie deutete auf die Höhlen. »Ich habe in der Schule mal ein Referat über Cro-Magnon-Menschen gehalten. Eine Weile wollte ich danach Paläontologin werden, aber dann hab ich mich doch für moderne Leichen entschieden.« Sie lachte und schüttelte den Kopf, als wäre sie verwundert über sich selbst. »Ich habe mir immer vorgestellt, dass die Steinzeitmenschen in genau solchen Höhlen gelebt haben. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es die mitten in der Provence gibt.«
»Diese Grotten sind wirklich gut verborgen«, murmelte Blanc, während er sich dicht über die Knochen beugte, ohne sie zu berühren. Er stutzte, dann fuhr er nachdenklich fort: »Calès ist das ideale Versteck. Ein unsichtbares Tal, Dutzende Öffnungen im Fels. Bäume. Diese Stille. Der perfekte Platz für einen Mörder, der sein Opfer verschwinden lassen will.«
Fabienne sah ihn erstaunt an. »Du meinst, diese Leiche hier ist erst in unserer Zeit vergraben worden?«
Blanc bedeutete ihr mit einer Handbewegung, sich über das Skelett zu beugen. »Sieh dir den Schädel an«, forderte er sie auf.
»Das Loch ist nicht zu übersehen. Aber das wirkt auf mich nicht unbedingt wie ein Einschuss. Das könnte irgendwann passiert sein, als der Tote schon lange hier gelegen hat. Vielleicht durch einen Stein, der irgendwann auf den Schädelknochen gestürzt ist.«
»Nicht die Stirn«, sagte er, »der Kiefer. Was siehst du?«
»Gute Zähne. Keine Lücke und … merde!« Fabienne richtete sich auf und starrte Blanc an.
Der lächelte. »Doch Metall an der Leiche«, sagte er. »Eine Plombe im Backenzahn oben links.«
»So viel zu meinem Cro-Magnon-Menschen«, sagte seine Kollegin und zog ihr iPhone aus einer der zahllosen Taschen ihrer Jacke. »Gut, dass ich mich am Ende gegen die Paläontologie entschieden habe. Ich rufe die Spurensicherung und die Gerichtsmedizinerin.«
Blanc schickte den Dorfpolizisten zurück nach Lamanon, um dort auf Doktor Thezan und die Kriminaltechniker zu warten und sie anschließend zu den Grotten zu führen. Dann wandte er sich der Frau zu, deren Anruf sie überhaupt erst hierhergeführt hatte. Die Archäologin hatte etwas abseits gestanden und gewartet, während sich die beiden Gendarmen das Skelett angesehen hatten.
»Doktor Havel?« Blanc schüttelte ihre Hand.
»Agnes Havel, den Doktortitel dürfen Sie sich schenken.«
Blanc schätzte sie auf fünfzig Jahre, aber sie wirkte, als wollte sie für immer Studentin bleiben: groß gewachsen, sportlich, lange, lockige braune Haare, bretonischer Wollpullover, Jeans, schwere Trekkingschuhe. Vor ihren braunen Augen leuchtete das feine Goldgestell einer Brille, aber ihre selbst im Winter gebräunte Haut und ihre raue Rechte, mit der sie seinen Handschlag erwiderte, verrieten ihm, dass sie ihre Zeit lieber außer- als innerhalb einer Studierstube verbrachte. Sie hatte die markante Stimme einer Raucherin, die einst viele Zigaretten inhaliert, das aber schon lange wieder aufgegeben haben musste, denn sie duftete nicht nach Tabak.
»Sie arbeiten hier in den Grotten von Calès?«, fragte Fabienne und schüttelte der Archäologin ebenfalls die Hand.
»Eine Kampagne lang.« Als Agnes Havel die fragenden Blicke der beiden Gendarmen wahrnahm, lachte sie. »So nennen wir Archäologen die Zeit, die wir mit Grabungen verbringen: eine Kampagne. Wir haben hier noch bis Weihnachten zu tun. Das heißt, wenn Sie uns jetzt noch graben lassen.« Sie deutete in Richtung der Gebeine.
Blanc lächelte. »Sie glauben nicht, dass es eine alte Leiche ist?«
»Deshalb habe ich Sie gerufen. Man muss keinen Doktor in Zahnmedizin gemacht haben, um die Plombe zu erkennen.«
Fabienne hüstelte. »Dann kommt es eher selten vor, dass Archäologen in den Grotten Tote finden? Ich meine: Die Höhlen sind doch uralt, oder? Legen Sie da nicht andauernd Gebeine frei?«
Die Wissenschaftlerin deutete mit einer umfassenden Bewegung auf den Talkessel. »Das war nie ein Friedhof hier. Mein Spezialgebiet ist mittelalterliche Archäologie, ich arbeite an der Sorbonne, über die Grotten von Calès habe ich seinerzeit schon promoviert.
Es stimmt zwar, dass wohl schon im Neolithikum Menschen hier gehaust haben. Man ist gut verborgen vor Feinden, geschützt gegen den Mistral, es ist schattig im Sommer, nur im Winter vielleicht ein wenig frisch.« Sie lachte wieder. »In der Region erzählen sich die Menschen viele Legenden über diese Grotten. Noch heute behaupten manche, dass sie hier hin und wieder einen ›Wolfsmann‹ sehen, l’homme sauvage de Calès, einen geheimnisvollen Mann, der sich jeden Wanderer holt, der so unvorsichtig ist, nach Einbruch der Dunkelheit in dieses Tal vorzudringen.« Agnes Havel wies auf das Skelett. »Es würde mich nicht wundern, wenn schon heute Nachmittag im Café du Midi in Lamanon die Legende vom Wolfsmann, der sich wieder ein neues Opfer geholt hat, die Runde machte. Eine andere Geschichte dreht sich um den Namen: Ein Sarazenenfürst namens Kalès soll sich im Mittelalter im Tal verschanzt haben, daher der Name, der so gar nicht provenzalisch klingt. Dahinter steckt immerhin ein Körnchen Wahrheit, auch wenn sich wahrscheinlich nie ein einziger Sarazene hierher verirrt hat.«
Die Archäologin deutete auf die nächstgelegene intakte Grotte. »Sie sehen ja selbst, dass die Höhlen Menschenwerk sind. Wahrscheinlich gab es zwar immer schon Öffnungen im Felsen, es ist Sandstein, der ist nicht sehr solide, aber erst im Mittelalter wurden sie systematisch größer gegraben, nicht in der Steinzeit. Ab dem 12. Jahrhundert haben die Menschen dieses Tal als Steinbruch genutzt. Die Kirchen, ein paar Burgen und Dutzende Bauernhäuser der Region sind aus Material erbaut worden, das hier herausgebrochen wurde.
Und erst nachdem man durch die Steinbrüche viele Höhlen vergrößert hatte, haben die Leute festgestellt, wie gut man sich in Calès verschanzen kann. In Kriegszeiten sind die Einwohner von Lamanon und anderen Dörfern fortan hierher geflohen.« Sie deutete auf eine Reihe schmaler, kreisrunder Löcher oberhalb einer Grotte. »Das sind Halterungen für Stangen der Vordächer, die einst die Eingänge überspannten. Mit Leitern wurden auch höhere Höhlen erreicht. Holz und Stoff sind selbstverständlich längst verrottet, aber es muss hier mit den Holzstangen und -leitern und Stoffplanen und Seilen einmal ausgesehen haben wie eine Art Campingplatz. Meistens haben fremde Truppen dieses Tal gar nicht erst entdeckt. Und wenn doch, nun, Sie haben ja selbst den Zugang passiert. Der ließ sich leicht verteidigen. Das Tal war jedenfalls im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit historisch viel bedeutender als in der Steinzeit.«
»Und wann wurden die Höhlen verlassen?«, fragte Blanc.
»Im 16. Jahrhundert erst; für Archäologen ist das so, als wäre es gestern gewesen. In den Religionskriegen haben katholische Truppen einige verschanzte Hugenotten gestellt. Die Katholiken hatten Kanonen. Da haben dann auch die Höhlen nicht mehr viel genutzt.«
»Aber danach müssten doch viele Tote hier herumgelegen haben?«, fragte Fabienne.
Agnes Havel schüttelte den Kopf. »Sie dürfen sich das nicht vorstellen wie ein überfülltes Flüchtlingslager heute, irgendwo im Nahen Osten. Wir haben in diesem Talkessel achtundfünfzig Höhlen gezählt, aber manche waren wohl nur so etwas wie Vorratskammern. Wenn man die Zahl der Feuerstellen lokalisiert und davon ausgeht, Beweise gibt es dafür ja nicht, dass um jede Feuerstelle eine Familie gehockt hat und dass vielleicht vier oder fünf Menschen zu einer Familie gehörten – eh bien, dann dürften hier zwischen einhundert und zweihundert Menschen gelebt haben. Weniger als in einem einzigen Metro-Waggon in Paris, zumindest zur Rushhour.« Sie dachte nach. »Kein Archäologe hat je einen Friedhof gefunden, soweit ich mich erinnern kann«, fuhr sie fort, »oder auch nur eine einzige Leiche. Bis heute. Ob die Leute hier auf natürliche Art gestorben sind oder in einem der Kämpfe getötet wurden – sie sind offenbar stets außerhalb des Tals bestattet worden, wahrscheinlich unten in Lamanon, bei der Kirche.«
»Das ist also Ihr erster Toter?«, vergewisserte sich Blanc.
»So kann man das sagen.«
»Sie haben das Skelett freigelegt?«
»Nein, das war der Fels selbst.« Agnes Havel deutete auf ein weißes Zelt am Fuß der gegenüberliegenden Talseite. »Meine Studenten und ich haben auf dem Talgrund gegraben. Plötzlich ist eine ganze Felswand abgerutscht, sicherlich zehn Kubikmeter. Wir waren fürchterlich erschrocken, es hat gekracht, als wäre eine Bombe explodiert. Und einen Moment lang fürchteten wir, die größten Brocken könnten bis zu uns rollen und uns zerschmettern. Als sich der Staub dann ein wenig gelegt hatte, habe ich meinen Studenten gesagt, dass sie bleiben sollen, wo sie sind. Ich wollte mich allein umsehen und dabei kein unnötiges Risiko eingehen, die Felsen sind nicht sicher. Das kann sich jederzeit wiederholen.« Sie wies auf das Gestein. »Sie sehen selbst die Risse und Sie spüren den Frost. Das ist eine gefährliche Kombination. Jedenfalls bin ich hier hinaufgeklettert und habe sofort das Skelett entdeckt. Ein unglaublicher Zufall, dass der Felssturz die Gebeine freigelegt, aber sie nicht zerstört hat. Oder vielleicht doch nicht: Der Leichnam ist ja bestattet worden. Jemand hat eine Mulde in den Sandstein gehauen, um den Körper hineinzulegen, und noch Felsbrocken über den Toten geschichtet, deshalb haben Aasfresser die Gebeine nie durcheinandergebracht. Ich habe die letzten Steine, die noch auf den Knochen lagen, beiseitegeräumt, weil ich zuerst dachte, das sind alte Gebeine. Der erste Tote, der jemals in Calès entdeckt wurde! Was war ich aufgeregt! Aber dann habe ich die Zahnplombe bemerkt und Sie angerufen. Man kann nicht immer Glück haben. Jetzt ist das Skelett Ihre Angelegenheit.«
Blanc sah auf die am Talboden zur Ruhe gekommenen Felsbrocken, auf die Furchen, die sie in den Boden gerissen hatten, auf die paar jungen Eichen, die sie auf ihrem Weg nach unten zerfetzt hatten. »Ist Ihr Job nicht gefährlich?«, fragte er. »Wie oft rutschen hier Steinwände ab?«
»Manche Archäologen graben in Kriegsgebieten. Die würden sagen, dass es hier ungefährlich ist«, erwiderte Agnes Havel fatalistisch. »Felsstürze sind selten und unberechenbar. Niemand kann sagen, wann und wo als Nächstes etwas runterkommt. Es gibt keine Warnzeichen. Wir haben das Donnern erst gehört, als es losging. Der letzte Felssturz ist zwei Jahre her. Seitdem ist das Tal aus Sicherheitsgründen für Wanderer gesperrt, und nicht mal Jäger und Förster wagen sich herein. Nur noch verrückte Archäologen aus Paris.« Wieder das ansteckende Lachen.
Blanc jedoch lächelte aus einem anderen Grund. Nicht nur verrückte Archäologen aus Paris würden sich fortan in diese Grotten wagen, sondern auch Flics aus der Provinz. Hier gab es einen Job zu erledigen für Mordermittler. Schauermärchen von einem Wolfsmenschen. Eiserne Barrieren am einzigen Zugang. Vor Agnes Havel und ihren Studenten war vielleicht monate- oder gar jahrelang niemand mehr im Tal von Calès gewesen – nur der Tote, der hatte hier gelegen …
»Kennen Sie einen Einheimischen, der uns mehr über die Grotten sagen könnte?«, fragte Blanc.
»Monsieur Roland Compagnat«, erwiderte die Archäologin. »Er ist drüben am Zelt und hilft uns bei der Kampagne, weil er in Calès jeden Stein kennt. Er ist nämlich ungefähr genauso alt wie die Höhlen.«
Agnes Havel führte sie quer durch das Tal. Unter der Zeltplane waren einige längliche Tische aufgebaut, auf denen Gegenstände lagen, an denen noch Erde klebte und von denen Blanc nicht zu sagen vermochte, was sie sein könnten. Daneben lagen eiserne Siebe, einige Kellen, Pinsel, Plastikflaschen, in denen eine helle Flüssigkeit im letzten Sonnenlicht funkelte. Vier Studentinnen und zwei Studenten standen am Tisch oder saßen auf Campingstühlen, drei der jungen Leute rauchten. Alle blickten die Gendarmen neugierig an, waren aber zu höflich, um sie mit Fragen zu behelligen. Auf einem Campingstuhl ein wenig abseits der Gruppe saß ein kleiner, gedrungener Mann: ein kahler Kopf, so rund wie eine Billardkugel, kugelrunde dunkle Augen hinter einer Brille mit runden Gläsern – der Alte wirkte wie aus Bällen zusammengesetzt. Blanc sah die Altersflecken auf dem haarlosen Haupt und die Falten um Augen und Mund, mon Dieu, die Archäologin hatte nicht übertrieben, wie alt war er? Achtzig? Neunzig? Doch als Blanc näher kam, erhob sich der Mann erstaunlich geschwind vom Stuhl und gab ihm kräftig die Hand mit seiner hornhautüberzogenen Rechten.
»Roland Compagnat«, sagte er, nachdem Blanc sich vorgestellt hatte, blickte dabei jedoch Fabienne an und lächelte. Der flirtet, dachte Blanc erstaunt.
Fabienne erwiderte das Lächeln und ließ es zu, dass der Alte ihre Hand etwas länger schüttelte, als es bei einer Begrüßung notwendig war. »Sie sind der Grotten-Experte?«, fragte sie.
»Ich bin so etwas wie der Hausmeister der Höhlen.« Compagnat lachte, als er ihren verblüfften Blick wahrnahm. »Nehmen Sie mich nicht ernst, Mademoiselle. In Wahrheit bin ich bloß ein alter Mann, der gerne hier herumwandert.«
»Monsieur Compagnat ist seit Jahren ehrenamtlicher Wanderführer in Lamanon. Er kennt nicht bloß jede Höhle«, ergänzte Agnes Havel, »er kann uns auch die versteckten Pfade oder gehauenen Treppenstufen zeigen, die den Zugang zu verborgenen Öffnungen in den Felswänden erleichtern. Und er zeigt uns Bäume, die seit unserer letzten Kampagne nach einem Gewitter umgestürzt sind und möglicherweise neue Funde freigegeben haben.«
»Aber der Felssturz heute Morgen hat selbst einen erfahrenen Mann wie Sie überrascht?«, hakte Blanc nach.
»Diese Sachen kann niemand voraussehen.« Compagnat wurde ernst, und plötzlich wirkte er auf Blanc so alt, wie er wohl war, sorgenvoll, sogar fragil. »Eines schönen Tages hätte mich beinahe so ein riesiger Brocken überrollt. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen: Es hat so laut geknallt, dass mir die Trommelfelle wehtaten. So etwas habe ich nur einmal zuvor gehört, im Krieg, als die Amerikaner hier in der Provence deutsche Stellungen bombardiert haben. Das war aber zwanzig Jahre nach Kriegsende, und im ersten Moment dachte ich: Genau nach zwanzig Jahren explodiert ein Blindgänger. Und wieso liegt in den Grotten von Calès überhaupt eine Bombe? Und jetzt erwischt es mich doch noch. Absurd, was einem in so einem Augenblick durch den Kopf rauscht.« Compagnat kratzte sich, wie um das zu bestätigen, die faltenzerfurchte Stirn. »Aber es war keine Bombe, sondern nur ein Felsen. Es war Ende August, die Tage waren trocken und sehr heiß, nicht ein einziges Hitzegewitter war runtergekommen, seit Monaten hatte es weder Frost noch Regen gegeben, es gab kein Vorzeichen – und doch rumpelte dieser Brocken plötzlich aus der Wand.« Der Alte deutete mit seiner Rechten, die ganz leicht zitterte, auf eine Stelle in halber Höhe des Talkessels, die auf Blanc, wenn er genau hinsah, etwas eingedellt wirkte. Dann zeigte er auf einen Felsen am Grund, groß wie ein Gartenschuppen, moosbewachsen, in einer Mulde auf der Oberseite lag Eis im Schatten. »Der ist mir damals praktisch über die Zehen gerollt. Ich war ganz allein und konnte eine Stunde lang nicht aus diesem Tal hinaus, weil ich so schockiert war, meine Beine waren weich wie Gummi, und ich musste mich erst mal hinlegen. Wäre damals noch ein zweiter Brocken abgegangen, ich wäre zerschmettert worden.
Beim letzten Felssturz war es dann anders.« Compagnat lächelte schwach. »10. März 2017 gegen 15.30Uhr, ich war in der Mairie, um ein paar Papiere abzuholen, und habe mich gerade mit der hübschen neuen Sekretärin unterhalten, ich erinnere mich noch genau, ich hätte nämlich beinahe die Abgabefrist für diesen Antrag verpasst. Na, jedenfalls zittert auf einmal die Erde, und es kracht, aber den Lärm kannte ich ja jetzt schon. Die Mademoiselle im Rathaus hat geglaubt, dass Terroristen eine Bombe ausgerechnet in Lamanon gezündet hätten. Sie ist die Treppe zum Bürgermeister hinaufgerannt.« Der Alte schüttelte verwundert den Kopf – oder vielleicht auch ein wenig verächtlich, dachte Blanc. »Als ob der Bürgermeister ihr in so einem Fall helfen könnte! Ich habe vom Fenster aus eine Staubwolke gesehen, die aus dem Wald bis runter nach Lamanon gequollen ist. Später hat sich dann herausgestellt, dass oben am Rand des Talkessels dreißig Tonnen Gestein abgegangen sind. Die meisten Brocken sind auf den Wanderweg gestürzt, sie haben ihn verschüttet. Aber einige sind da nicht liegen geblieben, sondern weiter auf dem Weg runtergerollt, wie auf einer gigantischen Murmelbahn. Einer hat es bis auf hundertfünfzig Meter an das erste Haus von Lamanon geschafft.«
»Seither ist das Tal endgültig für Wanderer gesperrt«, ergänzte Agnes Havel. »Wir dürfen noch hinein, aber nur, weil wir den Bürgermeister seit Jahren gut kennen. Und nur, weil Monsieur Compagnat so freundlich ist, uns für die Dauer der Kampagne zu begleiten.«
»Ich bin Rentner«, wehrte der Angesprochene bescheiden ab. »Während ich auf den Tod warte, kann ich ja noch etwas Sinnvolles tun. Außerdem sind die Studentinnen so hübsch wie ihre Professorin.«
»Monsieur Compagnat geht jeden Tag als Erster ins Tal«, sagte die Archäologin und bedachte sein Kompliment mit einem milden spöttischen Blick, »weil ihm jeder neue Riss und jeder lockere Felsen auffallen würde. Und während wir mit den Knien auf dem Boden unsere Schätze ausgraben, beobachtet er die Felswände.«
»Das verhindert aber keinen Felssturz«, sagte Blanc trocken.
Compagnat schüttelte nachdenklich den Kopf. »Leider. Es gibt hier ein, zwei Stellen mit besonders mürbem Gestein. Mit großen Rissen, mit Pinienwurzeln, die sich gefährlich tief unter Steine gegraben haben, Brocken, die auf den Kanten von Abhängen balancieren. Da dürfen Sie nicht einmal in die Nähe kommen, und das habe ich Doktor Havel auch von Anfang an gesagt.«
»Und wir haben uns daran gehalten«, warf die Archäologin rasch ein.
Compagnat nickte. »Sie waren brav. Aber dann, peng!, kommen plötzlich die Felsen an einer Stelle runter, von der ich geglaubt habe, dass sie die sicherste im ganzen Talkessel ist. Ein Blitz aus heiterem Himmel gewissermaßen.« Blanc sah dem Alten an, wie erschüttert er war. Da passt du als ehrenamtlicher Helfer auf eine Gruppe junger Leute auf, und plötzlich stürzt ein Felsen zu Boden. Hätte er einen der Studenten zermalmt, Compagnat hätte sich im hohen Alter noch mitschuldig an diesem Tod gefühlt. Kein Wunder, dass seine Hände zitterten.
»Vielleicht hat die Grabmulde das Gestein von innen geschwächt.« Blanc lächelte Compagnat aufmunternd an. »Niemand konnte ahnen, dass dort eine Mulde verborgen lag. Haben Sie das Skelett gesehen?«, fragte er nach einer kurzen Pause.
Der Alte warf der Archäologin einen raschen Blick zu. »Eh bien, ich durfte eigentlich nicht. Doktor Havel hat gesagt, dass es zu gefährlich ist, sie wollte allein rübergehen auf die andere Talseite. Aber ich konnte sie doch nicht …« Er machte eine entschuldigende Geste und lächelte die Forscherin an. »Ich bin Ihnen hinterhergegangen, Madame. Nur um sicherzugehen, dass Ihnen nichts passiert.«
»Sie sind mir gefolgt?«, fragte Agnes Havel und zog eine Augenbraue tadelnd hoch.
»Bien sur. Ich konnte Sie doch da nicht allein hingehen lassen.«
»Und dabei haben Sie das Skelett gesehen?«, hakte Fabienne nach, bevor die Archäologin dem Alten eine Strafpredigt halten konnte.
»Nicht so genau wie Doktor Havel. Ich wollte sie ja nicht stören und war nicht ganz so nah dran, aber für meinen Geschmack nah genug. Ich habe die Knochen gesehen. Gruselig.«
»Sie haben in all den Jahren, die Sie die Grotten von Calès kennen, noch nie zuvor eine Leiche entdeckt?«
»Nie.« Compagnat schüttelte entschieden den Kopf.
»Haben Sie je irgendein Gerücht gehört, dass man in diesem Tal einen Toten versteckt haben könnte?«, fragte Blanc. »Vielleicht irgendeine wilde Geschichte, die man sich beim Pastis im Café erzählt – von jemandem, der in die Grotten hineingegangen, aber nie wieder herausgekommen ist?«
Der Alte starrte ihn verblüfft an. »Also – ich habe ja zu den Grotten schon viele seltsame Legenden gehört, aber das …« Er schüttelte den Kopf und sah Blanc besorgt an. »Hören Sie, Sie könnten der nächste Tote sein«, fuhr er fort. »Sie sehen doch selbst, wie gefährlich das ist. Doktor Havel darf seit 2017 mit ihren Studenten nur noch auf dem Talboden graben. Unten hat man immer noch eine Chance, davonzukommen, wenn oben die Felsen abgehen. Sie hören den Lärm, schauen, wo die ersten Steine sich lösen, dann rennen Sie weg, so schnell Sie können. Wie heute: Ich habe es krachen gehört, sah die Brocken und habe Doktor Havel gewarnt. Wir sind hier hinter einigen großen Steinen in Deckung gegangen, bis alles vorbei war.
Aber wenn Sie in die Steilwände hineinsteigen, dann haben Sie diese paar Sekunden Vorwarnzeit nicht. Da kann es sein, dass der Boden unter Ihren Füßen wegrutscht. Dann ist es so, als stünden Sie auf einer Bombe, die unter Ihnen explodiert. Sie rutschen mit vielen Tonnen Felsen in die Tiefe, und wir werden Sie später nicht einmal mehr finden können unter all dem Gestein.«
»Wir werden das Skelett später auch nicht mehr finden, wenn das hier so weitergeht«, erwiderte Blanc. »Wir müssen die Gebeine bergen. Jetzt.«
Compagnat hob die Hände. »Es sind Ihre Gebeine.«
Blanc wollte lieber nicht so genau wissen, was der Alte damit meinte.
Eine Viertelstunde später führte Blanc die Gerichtsmedizinerin Doktor Fontaine Thezan und Damian Hurault, den Leiter der Kriminaltechnik von Salon, vom Taleingang aus hoch zur Leiche. Fontaine Thezan hatte ihren alten Jeep Cherokee nicht in Lamanon zurückgelassen, sondern war mit ihm ein gutes Stück weit den Waldweg hinaufgefahren. Das war selbstverständlich verboten, doch die Ärztin gehörte nicht zu den Menschen, die sich an jedes Verbot hielten. »Sie verschaffen mir mehr Studienobjekte als alle Ihre Kollegen zusammen, mon Capitaine«, begrüßte sie ihn.
»Ich fürchte, es ist diesmal ein sehr altes Objekt«, erwiderte Blanc.
»Wenn alles verwest ist, kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren.« Die Gerichtsmedizinerin trug beinahe bis zu den Knien reichende, elegante schwarze Stiefel, eine schwarze Hose, sie war in eine lange Lederjacke gehüllt, ihre Haare waren hochgesteckt und unter einer roten Skimütze mit dem Aufdruck Sankt Moritz verborgen. Während sie noch miteinander sprachen, kam Hurault den Weg hoch. Sie erkannten ihn schon von Weitem an seiner leuchtendgelben Warnweste mit dem Schriftzug TIC, die ihn als Mitglied der Techniciens en identification criminelle auswies. Beim Näherkommen erkannte Blanc unter der Warnweste Skihose und -jacke in olivgrüner Pseudo-Tarnfarbe, wie sie bei Snowboardfahrern angesagt waren und die dem jungen, aber schon kahlen und leicht übergewichtigen Experten nicht gerade gut standen. Blanc selbst trug Basketballschuhe, Jeans, Lederjacke und Baseballcap, wie immer. Aber er kam ja auch aus dem Norden. Richtige Provenzalen, die den ersten leichten Frost spürten, zogen sich an, als läge der Midi auf demselben Breitengrad wie Murmansk.
Während sie auf uralten, in die Felswand geschlagenen Stufen höher stiegen, gab Blanc Compagnats Warnung vor Felsstürzen weiter. »Wir müssen vorsichtig sein«, sagte er und bemerkte, dass er unwillkürlich leiser gesprochen hatte.
Fontaine Thezan blickte in den Himmel. »Wir müssen uns trotzdem beeilen. Wir haben höchstens noch eine Stunde Tageslicht«, sagte sie. »Im Tal wahrscheinlich sogar weniger.«
»Wir könnten generatorbetriebene Scheinwerfer installieren«, schlug Hurault vor. Er atmete bereits schwer, und auf seiner kahlen Stirn hatte sich ein feiner Schweißfilm gebildet. Er sah aus, als bereute er schon, in seinem schweren Skianzug nach oben zu klettern. Oder vielleicht machen ihm auch die Felsen Angst, dachte Blanc.
»Aber die Dieselgeneratoren sind schwer und vibrieren, wenn sie laufen«, gab Fabienne zu bedenken. »Ihr Schütteln könnte den Stein …« Sie vollendete den Satz nicht. »Vielleicht können Sie ein paar Petroleum-Campinglampen besorgen?«
»Ich habe mich bei den Kriminaltechnikern beworben, weil ich Hightech mag«, brummte Hurault. »Aber ich sehe, was ich tun kann.«
Blanc deutete auf die Archäologen, die beim Zelt auf dem Talboden zurückgeblieben waren. »Fragen Sie nachher die Wissenschaftler. Ich habe ein paar Öllampen auf ihren Tischen gesehen.«
Sie blieben vor dem Skelett stehen. Der Tote lag in der Mulde, die Höhle war so eng, dass sich nicht mehr als zwei Menschen gleichzeitig dort aufhalten konnten. Blanc und Fabienne bezogen an der Öffnung Posten. Fontaine Thezan betrachtete die Gebeine lange schweigend, ging langsam um die Leiche herum, stellte schließlich ihren Arztkoffer ab und wechselte ihre Fleece- gegen ein Paar Gummihandschuhe. Währenddessen hatte Hurault eine Spiegelreflexkamera gezückt und schoss Fotos. Bei jedem Blitz zuckte Blanc zusammen in der irrationalen Furcht, das Licht könnte den Stein sprengen.
»Der Tote hat eine Zahnplombe«, sagte er.
Die Gerichtsmedizinerin nickte. Sie hatte sich neben die Gebeine gehockt und betrachtete sie aus der Nähe, rührte sie aber noch nicht an. Dann zog sie eine Lupe und eine Taschenlampe aus ihrem Koffer und betrachtete eingehend das Loch in der Stirn.
»Ich dachte, das war vielleicht ein Stein«, sagte Fabienne. Sie klang nicht mehr so sicher.
»Sie kennen sich mit Computern besser aus als mit Knochen«, erwiderte Fontaine Thezan trocken. »Genaueres werde ich Ihnen selbstverständlich erst sagen können, nachdem ich die Leiche im Institut auf dem Tisch gehabt habe. Aber auf mich wirkt das wie ein Einschussloch.« Blanc zwängte sich in die Höhle, als Hurault mit den Fotos fertig war. Die Gerichtsmedizinerin wies auf eine feine dunkle Linie an der Oberseite des Schädels. »Ein Bruch des Knochens, der sich von dem Loch bis zum linken Scheitelbein zieht. Typisch für eine Verletzung durch eine Kugel.«
»Großes oder kleines Kaliber?«, fragte Blanc.
»Eher klein, sonst wären die Risse im Schädelknochen bedeutender. Wahrscheinlich eine Pistole, kein Gewehr.« Fontaine Thezan wandte sich an Hurault, der draußen wartete. »Wir müssen auch den Sand in und unter den Knochen bergen. Und Sie sollten die Höhle absuchen, zumindest das, was nach dem Felssturz noch davon übrig geblieben ist. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Kugel.«
»D’accord.« Der Kriminaltechniker ließ von außen einen skeptischen Blick durch die kleine Höhle schweifen. »In dieser Grube hat sich Sand gesammelt und in zwei weiteren Mulden. Ansonsten ist das hier nackter Felsboden. Da werden wir nicht viel finden. Ich hole die Kollegen hoch und frage die Archäologen nach den Lampen. Je eher wir hier fertig sind, desto besser.« Damit stapfte er davon, sichtlich erleichtert, zumindest für diesen Augenblick wieder aus dem Hang hinuntersteigen zu können.
Kopfschuss, dachte Blanc, mit einer Pistole – kein Selbstmord, denn der Tote lag mit den Armen am Körper in der Grube, so hätte er sich niemals selbst eine Kugel in die Stirn schießen können. Also Mord. Mit einer Pistole hätte der Täter nicht aus großer Entfernung feuern können. Er muss seinem Opfer nahe gewesen sein, so nahe, dass er ihm bei der Tat ins Gesicht gesehen hatte. Blanc fröstelte.
»Wie lange liegen diese Knochen wohl schon hier?«, fragte er die Gerichtsmedizinerin. Seit wann gibt es eigentlich Zahnplomben? Er fürchtete, dass er alle Vermisstenfälle in der Provence während der letzten hundert Jahre durchgehen müsste, um der Identität des Toten auf die Spur zu kommen. Und er dachte an das, was der alte Compagnat vorhin eher nebenbei gesagt hatte: Bomben, Explosionen, Zweiter Weltkrieg. Was, wenn das hier ein erschossener Wehrmachtssoldat war? Oder ein Résistance-Kämpfer? Dann könnte er in den Akten der Gendarmerie ewig nach dem Namen des Toten suchen. Vom Täter ganz zu schweigen.
Fontaine Thezan erhob sich und streifte die Gummihandschuhe ab. Sie verließ die Grotte und fischte aus einer Manteltasche eine Packung Mentholzigaretten und ein Feuerzeug. Sie nahm einen tiefen Zug. Immerhin kein Joint hier vor allen Leuten, sagte sich Blanc, auch wenn er den Tabak-Pfefferminz-Geruch der Zigaretten nicht unbedingt aromatischer fand als den Hauch von Marihuana, der die Ärztin sonst umspielte.
»Wahrscheinlich liegt das Skelett hier schon seit einigen Jahren«, erklärte sie. »Sie sehen ja selbst, dass das Gewebe vollständig verwest ist. Aber wie viele Jahre genau? Wer weiß, wie diese Höhle ausgesehen hat, bevor die Felswand eingestürzt ist. Vielleicht war die Grotte so etwas wie eine natürliche Grabkammer, der Körper könnte dann trocken und bei relativ stabilen Temperaturen gelegen haben. Dann hat sich die Verwesung möglicherweise über Jahrzehnte hingezogen. Die Zahnplombe ist wahrscheinlich eine Amalgamfüllung, so etwas wird in Frankreich seit etwa 1820 verwendet. Die Leiche kann hier also seit maximal zwei Jahrhunderten liegen. Vielleicht war es in der Höhle aber auch immer vergleichsweise feucht, dann wären die Verwesungsprozesse sehr schnell abgelaufen – und diese Leiche könnte erst vor vierundzwanzig Monaten beerdigt worden sein. Wahrscheinlich weiß ich erst mehr, nachdem ich die Gebeine im Labor untersucht habe.«
»Also suche ich einen Mann, der vor zwei Jahren verschwunden sein könnte. Oder vor zwanzig. Oder vor zweihundert«, schloss Blanc seufzend.
Fontaine Thezan lächelte und deutete gelassen auf das Skelett. »Sehen Sie sich den Beckenknochen an, mon Capitaine. Sie müssen keinen verschwundenen Mann suchen. Sie suchen eine Frau.«
Das Tal war dunkel, als Huraults Kriminaltechniker endlich die Gebeine und den Sand geborgen hatten. Fontaine Thezan war schon lange fort. Fabienne und Blanc standen frierend im Zelt der Archäologen. Die Studenten hatten ihre Gerätschaften und Funde von den Tischen geräumt und waren verschwunden, doch Agnes Havel hatte sich zu den Gendarmen gesellt. Und auch Compagnat saß noch auf einem Campingstuhl und trank Tee aus einer Thermoskanne. Ihm schien die Kälte nichts auszumachen.
»Ich fühle mich älter als dieser Typ«, flüsterte Fabienne Blanc zu. »Zäher Kerl.«
»Natürliche Auslese. Er ist siebenundachtzig Jahre alt«, antwortete Blanc, »ich habe ihn vorhin gefragt. Bis in solch ein Alter schaffen es nur zähe Kerle. Der wird noch hundert.« Er deutete auf die gegenüberliegende Felswand. Die Lichtblasen der Campingleuchten schwankten, drei Taschenlampenstrahlen zitterten durch die Nacht, einmal glühte gelbrot eine Zigarette auf. »Die Spurensicherer kommen nach unten. Wir können gehen.«
Hurault stapfte kurz darauf ins Zelt. »Nichts«, verkündete er. »Wir haben die ganze Höhle abgesucht, so viel ist von ihr ja auch nicht mehr übrig geblieben. Aber da lag nichts auf dem Boden, kein Metallrest, kein Stofffetzen, gar nichts. Nur Pinienzapfen und Mäusedreck. Die Knochen und das bisschen Erde, das sich um das Skelett gesammelt hat, haben wir intakt bergen können. Das bringen wir jetzt zur Gerichtsmedizin nach Salon.«
»Und was wird aus unserer Grabung?«, fragte Agnes Havel.
Blanc dachte kurz nach. »Haben Sie den Fundort der Leiche markiert?«, wollte er von Hurault wissen.
»Wir haben das Plastikband vor dem Höhleneingang zwischen eine Pinie und einen Felsbrocken gespannt. Besser ging es nicht.«
»Das reicht.« Blanc wandte sich der Archäologin zu. »Solange Sie und Ihre Studenten nicht in die Höhle gehen, dürfen Sie hier unten weiter arbeiten.« Kann ja nicht schaden, dachte er, wenn einige Experten den Talboden untersuchen. »Wenn Sie etwas Auffälliges finden, dann rufen Sie mich an.« Er reichte ihr eine Visitenkarte.
»Sie ernennen mich zum Hilfssheriff?«
»Ohne Stern und ohne Honorar.« Blanc lächelte und wandte sich dann zum Gehen.
Compagnat führte die Gruppe durch den schmalen Felsspalt hinaus. Er trug eine Campingleuchte, doch Blanc hatte den Eindruck, dass er das eher ihnen zuliebe tat. Die anderen sollten ihn nicht aus den Augen verlieren. Agnes Havel und Fabienne hielten ihre Handys als Taschenlampen in die Höhe. Blanc hätte es ihnen nachgemacht, wenn der Akku seines altersschwachen Nokias nicht schon seit Stunden leer gewesen wäre. Sie hatten alle Taschenlampen und die übrigen Campingleuchten den Kriminaltechnikern gegeben, die ihre gruselige Last in länglichen Holzkisten trugen und dankbar waren für jeden zusätzlichen Lichtschimmer, der ihre Schritte beleuchtete. Compagnat selbst hätte wohl auch ohne künstliches Licht seinen Weg gefunden, jedenfalls ging er so schnell über den eisbedeckten Pfad, dass es anstrengend war, ihm zu folgen.
Nach der engen Passage gelangten sie auf einen Wanderweg im Wald. Blanc atmete den schweren Duft von Piniennadeln und feuchtem Laub ein; er hatte gelernt, dass die Eichen am Mittelmeer ihre Blätter selbst im Winter nicht verloren. Einmal stieß eine Eule einen hohen Jagdruf aus. Ein anderes Mal knackte ein Ast, dann war es wieder still.
»Vorsichtig jetzt«, sagte Compagnat. Im zitternden Lichtkegel seiner Lampe tauchten mannsgroße Brocken auf, dazwischen ein Teppich aus Geröll, aus dem zwei oder drei verdorrte Äste ragten. »Die Felsen vom Sturz im vorletzten Frühjahr blockieren noch immer den Weg.«
Als der Polizist sie hochgeführt hatte, waren sie auf einem Trampelpfad durch den Wald um das Hindernis herumgegangen. Tageslicht hatte zwischen den Kronen geschimmert, und es war so leicht gewesen, Blanc hatte kaum darüber nachgedacht. Nun jedoch musste er vorsichtig tastend mit den Füßen auftreten, um nicht über eine Wurzel zu stolpern. Schützend hielt er eine Hand vor das Gesicht, damit ihn kein niedriger Ast traf, den man nicht sehen konnte. Einmal spürte er, wie Brombeeren oder irgendwelche anderen Dornen an seinem rechten Unterschenkel zerrten.
Er war erleichtert, als sie endlich in das trübe Licht der Straßenlaternen von Lamanon traten. Sie hatten die letzten Meter wieder auf dem Wanderweg zurückgelegt, der sie bis auf einen Parkplatz neben der massigen Kirche des Ortes führte. Huraults Männer luden die Kisten in die weißen Lieferwagen der Kriminaltechnik ab. Dann verabschiedeten sie sich mit einem müden Winken. Die Archäologin stieg in einen schwarzen Mini und brauste in die Nacht davon.
Neben dem Mégane der Gendarmerie, mit dem Fabienne und Blanc gekommen waren, stand ein alter, nicht gerade auf Hochglanz polierter dunkelgrüner Citroën DS. Compagnat steckte einen Schlüssel in die Beifahrertür.
»Coole Karre«, meinte Fabienne anerkennend.
Compagnat zuckte bloß mit den Achseln. »Wenn der Wagen kaputtgeht, kaufe ich mir einen neuen. Aber er geht einfach nicht kaputt. Deshalb fahre ich den schon seit fünfzig Jahren.« Er wuchtete seinen runden Leib auf den Beifahrersitz.
»Warum steigen Sie auf der falschen Seite ein?«, fragte Blanc.
»Weil das Türschloss der Fahrertür das einzige Teil ist, das kaputtgegangen ist.« Compagnat lachte. »Ein kleiner Unfall vor ein paar Jahren. Aber wenn ich das Schloss ersetzen lasse, kostet mich das mehr als eine Monatsrente. Also mache ich lieber ein bisschen Gymnastik. Das hält jung.«
»Wenn Sie den DS mal verkaufen, dann denken Sie an mich«, bat Fabienne. »Meine Frau würde …«
In diesem Augenblick knatterte mit Höllenlärm ein Motor los. Aus dem Schatten neben der Kirche schoss ein Vespafahrer, das Licht seines Rollers nicht eingeschaltet. Er brauste über den Platz, bog in eine Straße ein und war nach wenigen Sekunden außer Sicht. Nur das Röhren des Zweitakters war noch lange zu hören.
»Wer war das denn?«, rief Blanc verblüfft.
Compagnat seufzte. »Jérémy, der Dorftrottel. Er hat den IQ eines Aschenbechers.«
»Wie hat er dann den Führerschein für seinen Scooter gemacht?«
»Er weiß nicht, dass er einen Führerschein machen muss. Und es hat ihn nie jemand darüber aufgeklärt. Jérémy hat nach vielen Ehrenrunden wenigstens die Grundschule abgeschlossen. Seither lungert er herum, vor dem Café, vor der Grundschule, hier neben der Kirche.«
Blanc sah den Alten an, plötzlich war er hellwach. Er spürte die Kälte nicht länger. »Bleibt dieser Jérémy immer in Lamanon? Oder macht er auch den Wald unsicher?«
Compagnat verzog das Gesicht. »Sie meinen: Geht der Junge auch bis zu den Grotten von Calès? Leider ja. Wenn ich ehrlich sein soll: Jérémy ist vielleicht der einzige Mensch in der Stadt, der sich da noch besser auskennt als ich. Der ist immer dort, zu den unmöglichsten Zeiten, an den unmöglichsten Orten. Der hockt auf Felsen, die so wackelig sind, dass man sie mit einer einzigen falschen Bewegung in den Abgrund stürzen könnte. Setzt sich unter halb entwurzelte Pinien, die bei der nächsten Sturmböe umstürzen. Manchmal glaube ich, der Junge sucht sich absichtlich die gefährlichsten Plätze aus; wenn er denn klug genug wäre, um eine Absicht zu haben.«
Blanc erinnerte sich an das Geräusch des zerbrochenen Astes vorhin, neben dem Eulenruf der einzige Laut im stillen Wald. »Ist es möglich, dass er gerade im Wald war, als wir zurückgegangen sind? Oder … hat er sich womöglich die ganze Zeit im Tal versteckt?«
Compagnat zuckte mit den Schultern. »Wer weiß schon, was Jérémy macht? Er kennt sich gut genug aus, um nachts da draußen herumzuschleichen, das ist sicher.«
»Wie heißt er mit Nachnamen? Wie alt ist er?«, wollte Blanc wissen. Er hatte seinen Notizblock gezückt.
»Jérémy Dominici. Er ist siebzehn, glaube ich.«
»Wer kümmert sich um ihn?«, fragte Fabienne.
»Sein Vater hat sich zu Tode gesoffen, als er noch klein war. Die Mutter ist abgehauen. Jérémy lebt bei seinem Onkel und seiner Tante. Der Onkel ist der Bruder des Vaters und auch ständig betrunken. Und die Tante … na ja. Eigentlich kümmert sich niemand um ihn.«
Fabienne betrachtete Blanc, der bereits eine Seite seines Blocks vollgekritzelt hatte. Sie schüttelte den Kopf, holte ihr iPhone raus und sprach deutlich ins Mikro: »Jérémy Dominici.« Dann sah sie ihren Kollegen triumphierend an und hielt ihr Handy hoch. »Du kannst mit diesem Ding reden, weißt du? Siri ist klüger als dein Notizblock.« Sie deutete auf das Display. »Ich habe schon seine Adresse.«
Blanc seufzte. »Ich bin zu alt für ein iPhone.«
»Ich habe ein iPhone«, warf Compagnat ein.
»Jetzt haben Sie es ihm gegeben!«, rief Fabienne lachend und ließ sich auf den Beifahrersitz des Streifenwagens sinken. »Bonne nuit, Monsieur Compagnat. Sie haben meinen Tag gerettet.«
»Meinst du wirklich, es lohnt sich, wenn wir uns diesen Dominici mal näher ansehen?«, fragte Fabienne, als sie die Route départementale Richtung Gadet entlangrollten. Blanc fuhr vorsichtig. Die Streifenwagen der Gendarmerie in der Provence hatten keine Winterreifen, und er fürchtete sich vor Eis auf der Straße. »Wahrscheinlich war er doch nur zufällig nachts auf dem Parkplatz«, fuhr seine Kollegin fort. »Und der Junge ist debil und vielleicht auch verwahrlost. Wer weiß, was der uns erzählen würde.«
Blanc nickte. »Wir warten den Bericht von Doktor Thezan ab. Dominici ist siebzehn, falls Compagnat sich nicht geirrt hat. Wenn die Leiche zehn Jahre alt oder älter ist, dann lohnt es sich kaum, ihn zu befragen. Aber wenn die Tote da erst seit kurzer Zeit liegt …« Blanc lächelte. »Compagnat hat selbst zugegeben, dass sich niemand sonst so gut in den Grotten von Calès auskennt wie dieser Junge. Der mag ja nicht viel im Hirn haben, aber es würde mich nicht überraschen, wenn seine Augen und Ohren besser wären als meine.«
Den Rest der Fahrt legten sie schweigend zurück. Blanc dachte nach. Die Gebeine einer Frau. Ein Einschussloch mitten in der Stirn. Ein Grab in einer versteckten Höhle. Was hatte Compagnat behauptet? Dass er diese Stelle für besonders sicher gehalten habe, für viel weniger einsturzgefährdet als andere Bereiche des Tals. Die Tote hätte dort noch ewig unentdeckt bleiben können, wenn nicht auf einmal doch einige Felsen abgerutscht wären. Und wenn nicht zufällig ein Team von Archäologen in Calès gearbeitet hätte. Wäre niemand dort gewesen, gut möglich, dass Tiere die Knochen nach dem Felssturz rasch zerstreut hätten oder dass sie im nächsten Regenschauer fortgespült worden wären. Wer immer die Tote dort abgelegt hatte, war jemand, der sich in den Grotten gut auskannte. Jemand, der geglaubt hatte, dass genau diese Höhle den Körper für alle Zeiten verbergen würde.
Für alle Zeiten … Er warf einen nachdenklichen Blick auf seine junge Kollegin, die neben ihm auf dem Beifahrersitz eingenickt war. Er wusste, warum Fabienne mit ihrer Frau nach Barcelona gereist war: Spanische Ärzte nahmen künstliche Befruchtungen billiger und mit weit weniger kompliziertem Papierkram vor als französische Ärzte. Ob sie schon schwanger war? Und was dann? Ob Fabienne dann, wenn sie erst einmal ein Kind zu Hause hatte, noch die Nächte in düsteren Grotten und mit ermordeten Frauen verbringen wollen würde? Oder würde sie vielleicht etwas anderes machen? Sich einen Kindheitstraum erfüllen, Paläontologin werden – warum nicht? Blanc wurde schmerzlich bewusst, dass dies hier möglicherweise der letzte Fall war, den er zusammen mit Fabienne lösen würde.
Falls er diesen Fall denn überhaupt lösen könnte.
Später am Abend kam Blanc endlich vor seiner alten Ölmühle an. Es lag inzwischen ein Dunst in der Luft, der aus sich selbst heraus zu leuchten schien, wie in einem schlechten Horrorfilm. Die Wipfel der Platanen vor dem Haus erinnerten in diesem Zwielicht an skelettierte Riesenhände. Sie hatten ihre großen Blätter schon lange verloren. Und obwohl Blanc schon mehrmals ganze Blättergebirge zusammengekehrt und angezündet hatte – was verboten war, was aber jedermann machte –, lagen rätselhafterweise immer noch Tausende Blätter auf dem Zufahrtsweg, braun, raureifüberzogen, die nun auf dem Boden festgefroren waren, sodass er sie nicht einmal würde zusammenkehren können. Ihm war kalt. In seinem alten Espace, mit dem er die drei Kilometer von der Gendarmerie-Station in Gadet bis zur ehemaligen Ölmühle in Sainte-Françoise-la-Vallée zurückgelegt hatte, funktionierte die Heizung nicht mehr. Zum Glück hatte er rechtzeitig Holz gehackt und in einem trockenen Schuppen gestapelt. Er würde den schwarzen, gusseisernen Ofen anfeuern und sich anschließend irgendetwas Warmes in der Küche machen.
Beim Aussteigen aus dem Auto hielt er plötzlich inne. Da war jemand. Blanc musterte die Umgebung. Nur ein paar Schritte neben ihm war die Dunkelheit noch ein wenig dunkler. Er sah genauer hin. Vorsichtig zog er sein Nokia aus dem Ladekabel am Zigarettenanzünder und hoffte, dass der Akku auf den wenigen Kilometern Fahrt für ein paar Minuten Licht geladen worden war. Dann schaltete er blitzschnell die Taschenlampe ein und richtete sie auf die dunkle Gestalt.
Ein Hund.
Ein sehr, sehr großer Hund.
Der fahle Lichtstrahl traf zuerst den Körper des Tieres: struppiges, wildes graues Fell mit weißen Flecken, ein gewaltiger Brustkorb, massive Beine, die überhaupt nicht aufhören wollten. Blanc schwenkte das Handy ein wenig. Nun kam der Kopf ins Licht, ein riesiger mit einer zerklüfteten Schnauze, gewaltigem Kiefer und zwei dunklen Augen, die ihn mindestens genauso erschrocken anstarrten wie er das Tier. Mon Dieu, dachte Blanc, der Hund reichte ihm bis zur Hüfte, und er war ein Mann, der fast zwei Meter maß. Wo kommt der her? Er hatte das Tier noch nie in Sainte-Françoise-la-Vallée gesehen. Was sollte er jetzt tun? Er konnte doch nicht seine Pistole ziehen und schießen. Aber dem Hund den Rücken zudrehen wollte er auch lieber nicht. Doch das Tier schienen ganz ähnliche Überlegungen zu quälen. Der Hund gab ein leises Grollen von sich, kein Bellen, nicht einmal ein Knurren; für Blanc, der nach den vielen Jahren in Paris von Hunden nichts anderes kannte als deren allgegenwärtigen Dreck auf den Trottoirs, hörte sich das zumindest nicht bedrohlich an, eher wie eine Art Begrüßung.
»Schon gut«, murmelte er, »schon gut … Ich beiße dich nicht, wenn du mich auch nicht beißt.«
Das Tier blickte ihn noch einen Moment lang mit aufmerksamen Augen an, dann drehte es sich um und verschwand. Obwohl der Hund so riesig war, war er in einer einzigen Sekunde fort, lautlos wie ein Spuk.
Blanc atmete tief durch. Vielleicht sollte er doch einmal das rostige Tor vor seiner Ölmühle mit ein wenig Schmieröl behandeln, um es wieder zuziehen zu können. Er fischte den großen, eisernen Schlüssel für die alte Eichentür aus einem Versteck in einem Mauerloch. Er war so kalt, dass er in der Hand schmerzte. Die Wände waren aus groben Steinen gemauert und einen Meter dick. Im Innern der Ölmühle war es klamm und kühl wie in einer Burg. Blanc schleppte einen Weidenkorb voller Holz zum Ofen und erfreute sich eine Minute später an der orangefarbenen Flamme, die aus den Scheiten leckte. Er würde den Ofen stundenlang mit Holz füttern müssen, bis sich die Hitze im Raum ausgebreitet und auch in die Wände gefressen hatte. Aber wenn diese Mauern erst einmal warm waren, dann würden sie die wohlige Hitze speichern, vielleicht sogar den ganzen nächsten Tag über.
Blanc ging in die Küche, sah aus dem Fenster, der Hund blieb verschwunden. Er steckte sein Nokia ans Ladegerät und legte es auf die Fensterbank, die einzige Stelle im Haus, wo das Handy Empfang hatte. Vielleicht würde Aveline ihm noch eine SMS schicken. Zur Sicherheit hörte er auch seine Mailbox ab. Nichts. Denk nicht an sie, ermahnte er sich, sonst schläfst du heute Nacht wieder nicht. Denk lieber an deine Tochter. Astrid wollte über Weihnachten kommen, ihr erster Besuch in der Provence. Er hatte schon im Obergeschoss den kleinen Raum neben seinem Schlafzimmer für sie hergerichtet. Zwar wusste er noch nicht, wann sie anreisen wollte, doch er musste unbedingt bereit sein. Er hatte sie in den letzten Jahren kaum gesehen, geschweige denn ein vernünftiges Gespräch mit ihr geführt. Weihnachten. Vater und Tochter. Merde, er durfte das auf keinen Fall vermasseln. Er hantierte mit Töpfen und Pfannen, da hallte plötzlich ein gewaltiges Donnern durch die Ölmühle, selbst die Wände zitterten.
Blanc warf sich instinktiv zu Boden. Der riesige Hund, dachte er einen Moment absurderweise, aber der konnte nicht solchen Krach gemacht haben. Ein Felssturz, fuhr es ihm danach durch den Kopf, aber das war genauso unsinnig. Er rappelte sich wieder hoch und eilte, Böses fürchtend, von der Küche in den Salon, weil der Lärm von dort gekommen zu sein schien.
Asche, überall Asche.
Blanc hustete. Mit tränenden Augen tastete er durch den Raum. Die Ofentür war aufgesprungen, noch immer quollen schwarzgraue Wolken aus dem Inneren heraus. Kurz glaubte er, dass er vielleicht einen schrecklichen Fehler gemacht habe. Vielleicht hatte er nicht nur Holzscheite in den Ofen gepackt, sondern, verwirrt vom Schock der Begegnung mit dem Hund, irgendetwas Gefährliches, etwas, das in den Flammen explodiert war. Dann schmeckte er neben der Asche noch andere Materialien auf den Lippen: Mörtel, Stein. »Merde«, murmelte er.
Nach einem hastigen Gang durchs Haus und anschließend nach draußen, um das Dach zu inspizieren, wusste Blanc, was geschehen war: Der gemauerte Kamin war zusammengebrochen. Einige Brocken des Schornsteins lagen noch auf dem Dach, andere waren von oben bis hinunter in seinen Garten gestürzt. Die meisten jedoch waren durch den Schacht nach innen bis in seinen Ofen geknallt, ihre Druckwelle hatte die Klappe aufgesprengt.
Blanc ging zu seinem Handy und rief Matthieu Fuligni an. Die Nummer des jungen Bauunternehmers hatte er längst eingespeichert – es war nicht das erste Mal, dass er ihn um Hilfe rief. »Mein Kamin steckt in meinem Ofen«, berichtete er.
»Pas de souci«, erwiderte Fuligni so gelassen, als würde er jeden Abend mit solchen Nachrichten aufgeschreckt, was vielleicht auch stimmte. »Keine Sorge. Den kriegen wir schnell wieder aufgemauert. Ich schaue ihn mir morgen an.«
»Draußen friert es. Drinnen ist mein Ofen verstopft.«
»Haben Sie keinen Elektroheizkörper für diese Nacht?«
»Mit so einem Ding würden meine alten Sicherungen durchbrennen.«
»Den Verteilerkasten könnte ich auch gelegentlich ersetzen.«
»Sie müssen das vor Weihnachten repariert haben, das ist wichtig. Ich erwarte einen Gast.«
»Klingt nach Damenbesuch.« Fuligni lachte. Er war enervierend blendender Laune. »Pas de souci. Sie müssen nur diese eine Nacht ohne Kamin überstehen. Soll ich Ihnen schnell noch eine zweite Bettdecke vorbeibringen?«
»Nicht nötig, danke. Hier muss irgendwo noch mein alter Armeeschlafsack rumliegen«, sagte Blanc müde. In dieser Nacht würde er sich genauso fühlen wie die Gebeine der Toten in der Grotte von Calès.
Ein Mädchen verschwindet
Wenn Tote so tief schlafen, wie Blanc geschlafen hatte, dann war es vielleicht gar nicht so schlimm zu sterben. Seine Ölmühle fühlte sich an wie eine Tiefkühltruhe, aber in seinem Schlafsack war ihm warm gewesen. Der Wecker des Handys summte wie immer um sechs Uhr.
Eine Stunde später rumpelte Matthieu Fuligni mit einem verbeulten weißen Lastwagen vor das Haus. Auf der Bank neben ihm saßen zwei rumänische Bauarbeiter, die er schon von früheren Renovierungen her kannte, und für einen Moment hoffte Blanc, dass er tatsächlich das Glück hatte, seinen Kamin sofort repariert zu bekommen. Doch die beiden Rumänen blieben im Führerhäuschen hocken und guckten ihn bloß mit mildem Desinteresse an. Nur Fuligni – ein junger Mann, der bereits kahl wurde und seine schwarzen Haare raspelkurz geschnitten hatte und trotz der Kälte nur Arbeitsschuhe, Arbeitshose und ein mit eingetrockneten Mörtelstreifen beschwertes Sweatshirt trug – sprang heraus und schüttelte Blancs Hand.
»Wir haben eine Baustelle in Caillouteaux«, erklärte er. »Und da habe ich mir gedacht, auf dem Weg dahin sehe ich mir kurz Ihren Schaden an.«
»Das können Sie mit Ihren Männern doch in einer halben Stunde erledigen«, erwiderte Blanc in der schwachen Hoffnung, Fuligni noch überreden zu können, sofort mit der Arbeit zu beginnen.
Der Bauunternehmer antwortete darauf jedoch nicht einmal, sondern besah sich, soweit das von hier unten aus möglich war, den Stumpf des Kamins. Dann ging er hinein, fischte in der Asche des Ofens herum und hielt ihm schließlich einen gezackten, grau beschmutzten Brocken unter die Nase. »Der Kamin ist irgendwann mal aus Ziegeln gemauert, aber nie verputzt worden. Da wollte wohl jemand Geld sparen. Eh bien, nach und nach dringt Wasser in den Stein und bei dem Frost …«
»Ich kann mir lebhaft vorstellen, was passiert ist«, brummte Blanc.
»Wenn wir heute in Caillouteaux fertig werden, fahre ich bei Philibert vorbei und lade Steine, Mörtel und was wir sonst noch so brauchen auf den Lastwagen. Morgen sind wir dann bei Ihnen. Oder übermorgen. Spätestens Ende der Woche.«
Für Blanc hörte sich das so an wie »spätestens Ende nächsten Jahres«, aber was sollte er machen? Womöglich würde er den Ofen erst heizen können, wenn draußen schon längst wieder Sommer war.
Später fuhr er mit seinem Wagen durch Gadet. Zwischen die Stadthäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert hatte der Bürgermeister so viele Lichterketten spannen lassen, dass sie ausreichen würden, um alle Landebahnen von Orly zu erleuchten: Blanc fuhr unter weiß und rot blinkenden Kaskaden hindurch, unter großen Weihnachtssternen, Weihnachtsmännern und Kometen, unter Engelsflügeln und Trompeten aus Tausenden LED-Leuchten. An Laternenmasten und Dachrinnen waren Lautsprecher befestigt worden, deren Kabel an Platanenästen und Wänden festgebunden worden waren und ein wildes Gespinst bildeten. Amerikanische Weihnachtsmusik aus den Fünfzigerjahren schepperte durch die Gassen, für Blanc hörte sich das an wie aus einem alten Film mit Dean Martin. An die eisernen Poller, die Straße und Bürgersteig voneinander trennten, waren kaum hüfthohe Weihnachtsbäumchen gebunden, es mussten Dutzende sein. Sie sahen an diesem 12. Dezember bereits so kläglich aus wie ausrangierte Tannen, die nach den Feiertagen von der Müllabfuhr abgeholt werden sollten. Wer findet so etwas schön?, fragte sich Blanc fassungslos. Und: Wo kommt bloß das ganze Geld für diese Scheußlichkeiten her?
An den Tischchen vor den drei Bars von Gadet trotzten einige dick Vermummte der Kälte. Die meisten tranken Espressi und blätterten in der La Provence, vor einigen Gästen funkelte allerdings bereits Rosé im Glas. Niemand beachtete ihn, die Einheimischen hatten sich längst an Blancs asthmatisch röchelnden Espace gewöhnt.
Die Gendarmerie-Station von Gadet war ein niedriger Betonbau aus den Siebzigerjahren. Wahrscheinlich hatte sie ursprünglich, um wenigstens ein bisschen in die Provence zu passen, in einem Ockerton gestrichen werden sollen, doch war bei der Anmischung der Wandfarbe offenbar etwas schiefgegangen. Das Bauwerk rottete jedenfalls in einem ungesunden Orange vor sich hin, einer schäbigen Warnfarbe, die schon von Weitem signalisierte: Geh hier nicht rein!
Blanc betrat die Station durch den Haupteingang, grüßte den wachhabenden Brigadier Barressi mit einem Kopfnicken und tastete vergebens nach Post in seinem Fach. Plötzlich legte jemand eine Hand auf seinen Unterarm. Die etwas zu stark geschminkte Kollegin, deren Namen sich Blanc ums Verrecken nicht merken konnte.
»Ist das nicht eine Riesenschweinerei?«, sagte sie.
Blanc blickte sich Hilfe suchend nach Barressi um, doch der hatte sich hinter die Sportseiten von La Provence verkrochen. »Was ist eine Riesenschweinerei?«, fragte Blanc gehorsam zurück, da ihm nichts anderes übrig blieb.
»Die Sache mit der Butter.« Die Kollegin zündete sich eine Zigarette an. Sie wirkte, als könnte sie jetzt stundenlang neben den leeren Postfächern stehen bleiben.
»Butter?«, sagte Blanc. Er kam sich unfassbar dämlich vor. Wenn du mich jetzt hier aus dieser Situation rettest, dann schlage ich dich zur Beförderung vor, dachte Blanc in Richtung Barressi. Er dachte es so intensiv, dass nur ein Holzklotz diese telepathischen Schwingungen nicht spüren konnte. Brigadier Barressi jedoch rührte sich nicht hinter seiner Zeitung und verpasste die eine Chance seines Lebens auf eine Beförderung.
»Es gibt keine Butter mehr«, erklärte die Kollegin. Und als sie Blancs weiterhin irritierten Blick bemerkte, setzte sie hinzu: »In den Supermärkten. Ausverkauft. Überall. Eine Riesenschweinerei. Keine Butter vor Weihnachten. Ich meine, wie soll man denn jetzt backen? Sie gehen nicht einkaufen, eh? Wenn ich nicht wüsste, dass Sie geschieden sind, würde ich ja jetzt sagen: ›Alter Macho, Sie lassen wohl immer Ihre Frau einkaufen.‹ Oder gibt’s da schon wieder eine Frau?« Sie zwinkerte ihm zu.
»Ich esse Margarine«, log Blanc. Dann ließ er noch ein Rezept für einen Kuchen oder für Plätzchen, auf jeden Fall etwas mit viel Butter, viel Zucker und vielen Kalorien, über sich ergehen, bis er schließlich in sein Büro fliehen konnte. Als er die Tür aufstieß, sah er, dass er dort nicht allein war. Auf dem Stuhl am zweiten Schreibtisch saß ein Mann in einem lavendelfarbenen, gemusterten Hemd, das vielleicht einmal in den Achtzigerjahren modern gewesen war. Er trug dazu eine an seinem umfangreichen Bauch spannende, schilffarbene Flanellhose, deren Aufschläge in den gepolsterten Schäften schwarz-grüner Schneeschuhe verschwanden.
»Endlich ein normaler Mensch!«, rief Blanc.
»Der normalste und nüchternste Mensch, den du dir wünschen kannst.« Lieutenant Marius Tonon erhob sich und schüttelte ihm die Hand.
Blanc lächelte erleichtert und zog seinen Freund und Kollegen in eine Umarmung. »Die Entziehungskur ist vorüber? Bist du wieder an Bord? Wie fühlst du dich?«
»Ich bin so trocken wie die Provence im Juli. Ich trinke nur noch Château la pompe.« Marius rieb sich über den Bauch. »Und außerdem habe ich abgenommen! Auch wenn ich mir wünschte, dass man es sehen könnte. Zehn Kilo weniger, aber die Wampe ist immer noch da. Vielleicht habe ich ja Schaumstoff unter der Haut.«
»Wo ist deine Heilige geblieben?«, wunderte sich Blanc. Er kannte Marius bislang nur mit einem Goldkettchen um den Hals, an dem ein kleines Medaillon hing: Sainte Geneviève, die Schutzpatronin der Gendarmen. Blancs Exfrau hieß so, und es hatte ihm immer einen kleinen Stich versetzt, diesen funkelnden Anhänger zu sehen.