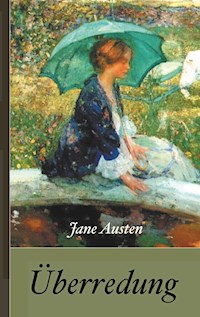7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manesse Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Der Klassiker in wunderschöner neuer Ausstattung
Die eine ist voller Lebenslust und Temperament, die andere beherrscht und vernünftig … Marianne Dashwood ist das genaue Gegenteil ihrer älteren Schwester Elinor, und so stürzt sie sich nach dem Tod ihres Vaters kopflos in eine Romanze mit dem begehrten Frauenschwarm John Willoughby – und wird bitter enttäuscht. Doch als auch Elinor entdeckt, dass sie von dem Mann ihres Herzens hintergangen wurde, müssen die ungleichen Schwestern lernen, dass sie den Weg der Liebe nur mit Unterstützung der jeweils anderen finden können ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
«Wenn es ein Heilmittel gegen Liebeskummer gibt, dann ist es dieser Roman.»
Denis Scheck
Temperamentvoll und leidenschaftlich, ist Marianne Dashwood das genaue Gegenteil ihrer älteren Schwester, der beherrschten und vernünftigen Elinor. Dass sich Marianne Hals über Kopf und natürlich unglücklich in den Frauenschwarm John Willoughby verliebt, erstaunt daher niemanden. Aber auch Elinor erlebt mit dem Mann ihres Herzens eine böse Überraschung, denn «ihr» Edward Ferrars hat einer anderen die Ehe versprochen. Gemeinsam lernen die ungleichen Schwestern mit ihren Enttäuschungen zu leben und am Ende – mit Hilfe von Vernunft und Gefühl – eine passende Wahl zu treffen.
Jane Austen verfasste den Roman im Alter von nur zwanzig Jahren, ließ ihn 1811 auf eigene Kosten anonym drucken und legte so den Grundstein für ihren bis heute andauernden Erfolg. Schließlich schreibt kaum jemand klüger über die komplizierten Herzensangelegenheiten zwischen Männern und Frauen als diese britische Kultautorin. In der Neuübersetzung von Andrea Ott erstrahlen geschliffener Witz und lebendige Dialoge von Austens Debütroman in neuer Frische.
Jane Austen (1775–1817) wurde in Steventon, Hampshire, geboren und wuchs als siebtes von acht Kindern im elterlichen Pfarrhaus auf. Die Welt, die sie beschrieb, war die des englischen Landadels, deren sorgsam kaschierte Abgründe sie mit psychologischem Feingefühl und ironischem Blick entlarvte. Bereits als Kind schrieb Austen Theaterstücke und Kurzprosa. Ab ihrem neunzehnten Lebensjahr bis zu ihrem frühen Tod mit nur 41 Jahren entstanden sieben Romane, zwei weitere blieben Fragment.
Andrea Ott (*1949) hat sich als Übersetzerin englischer und amerikanischer Literatur einen Namen gemacht. Für den Manesse Verlag übertrug sie u. a. Werke von Anthony Trollope, Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell, Upton Sinclair und Edith Wharton. 2016 erhielt sie «für ihren Beitrag zur Verbreitung der klassischen englischsprachigen Moderne in Deutschland» den Wilhelm-Merton-Preis für Europäische Übersetzung.
JANE AUSTEN
Vernunft und Gefühl
Roman
Aus dem Englischen übersetzt von Andrea Ott
Nachwort von Denis Scheck
MANESSE VERLAG ZÜRICH
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Titel der englischen Ausgabe:
«Sense and Sensibility» (1811)
Copyright © 2017 by Manesse Verlag, Zürich
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Favoritbüro
Covermotiv: shutterstock/LuFei; Favoritbüro
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-20746-5V003
www.manesse.ch
KAPITEL 1
Die Familie Dashwood war schon lange in Sussex ansässig. Von Nachbarn und Bekannten allgemein geachtet, lebte sie seit Generationen ehrbar und anständig auf Norland Park, dem herrschaftlichen Wohnhaus inmitten ihres großen Anwesens. Der letzte Gutsbesitzer, ein Junggeselle, der es auf ein stattliches Alter brachte, hatte in seiner Schwester viele Jahre eine treue Gefährtin und Haushälterin. Erst als sie starb, zehn Jahre vor ihm, führte das zu gewaltigen Änderungen in seinem Hauswesen. Um nämlich diesen Verlust zu ersetzen, bat er seinen Neffen und rechtmäßigen Erben Mr. Henry Dashwood, dem er Norland Park zu vermachen gedachte, mit seiner Familie bei ihm einzuziehen. Der alte Herr fühlte sich sehr wohl in der Gesellschaft des Neffen, der Nichte und ihrer Kinder. Seine Zuneigung zu ihnen wuchs. Er genoss, soweit sein Alter dies zuließ, jede erdenkliche Annehmlichkeit, denn Mr. und Mrs. Henry Dashwood kamen – nicht nur aus Eigennutz, sondern auch aus Herzensgüte – seinen Wünschen stets bereitwillig entgegen; die Fröhlichkeit der Kinder verlieh seinem Dasein zusätzliche Würze.
Aus einer früheren Ehe hatte Mr. Henry Dashwood einen Sohn, von seiner jetzigen Frau drei Töchter. Der Sohn, ein verlässlicher, ehrbarer junger Mann, war durch den stattlichen Besitz seiner Mutter, der ihm bei Erreichen der Volljährigkeit bereits zur Hälfte zugefallen war, üppig versorgt. Kurz darauf heiratete er, was seinen Wohlstand noch mehrte. Für ihn hatte daher die Erbfolge auf Norland Estate keine so große Bedeutung wie für seine Schwestern. Deren Vermögen wäre, abgesehen von dem, was für sie abfallen mochte, wenn ihr Vater den Landsitz erbte, auf jeden Fall bescheiden. Ihre Mutter besaß nichts, und der Vater hatte nur siebentausend Pfund zur freien Verfügung, denn auch die zweite Hälfte des Vermögens seiner ersten Frau war ihrem Kind vorbehalten, er selbst hatte nicht mehr als den Nießbrauch zu Lebzeiten.
Der alte Herr starb. Sein Testament wurde verlesen und sorgte wie fast jedes Testament nicht nur für Freude, sondern auch für Enttäuschung. Er war weder so ungerecht noch so undankbar gewesen, den Besitz einem anderen als seinem Neffen zu vermachen; doch vermachte er ihn zu Bedingungen, unter denen die Erbschaft lediglich halb so viel wert war. Mr. Dashwood hatte sie mehr um seiner Frau und seiner Töchter willen ersehnt, nicht so sehr für sich und seinen Sohn. Aber nun wurde das Erbe für ebendiesen Sohn und dessen vierjährigen Sprössling gesichert, und zwar in einer Weise, die ihm selbst keine Möglichkeit ließ, für jene zu sorgen, die ihm am nächsten standen und eine Versorgung durch eine Hypothek oder den Verkauf wertvoller Wälder am meisten benötigten. Das Ganze war einer Verfügungsbeschränkung zugunsten dieses Kindes unterworfen. Es hatte bei gelegentlichen Besuchen mit den Eltern auf Norland das Herz seines Großonkels durch den Einsatz von Reizen erobert, die für zwei-, dreijährige Kinder nichts Außergewöhnliches sind: durch eine fehlerhafte Aussprache, den unbedingten Wunsch, den eigenen Willen durchzusetzen, durch zahllose listige Streiche sowie gewaltigen Lärm – und das alles wog schwerer als jede Freundlichkeit, die ihm von seiner Nichte und deren Töchtern zuteilgeworden war. Er wollte jedoch nicht herzlos sein und hinterließ den drei Mädchen als Zeichen seiner Zuneigung jeweils eintausend Pfund.
Anfangs war Mr. Dashwood tief enttäuscht. Aber er war eine heitere und zuversichtliche Natur; nach menschlichem Ermessen würde er noch viele Jahre leben und konnte, wenn er sparsam wirtschaftete, aus den Erlösen eines bereits großen und in unmittelbarer Zukunft möglicherweise noch wachsenden Besitzes eine beträchtliche Summe beiseitelegen. Doch das Vermögen, das so spät auf ihn gekommen war, sollte ihm nur ein Jahr gehören. Länger überlebte er seinen Onkel nicht, und der Witwe und den Töchtern blieben ganze zehntausend Pfund inklusive der letztwilligen Zuwendungen.
Sobald offenbar wurde, wie ernst es um ihn stand, rief man nach seinem Sohn, und Mr. Dashwood legte ihm mit aller durch die Krankheit gebotenen Inständigkeit und Dringlichkeit das Wohl seiner Stiefmutter und seiner Schwestern ans Herz.
Mr. John Dashwood war nicht so gefühlvoll wie die anderen Familienmitglieder, aber eine derartige Empfehlung zu einem solchen Zeitpunkt rührte ihn doch, und er versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um ihnen ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Diese Zusage beruhigte den Vater, und Mr. John Dashwood konnte in Ruhe darüber nachdenken, wie viel wohl diesbezüglich vernünftigerweise in seiner Macht stand.
Er war kein charakterloser junger Mann – es sei denn, man nennt jemanden charakterlos, weil er ein wenig engherzig und selbstsüchtig ist. Im Gegenteil, er war allgemein sehr angesehen, da er sich der üblichen Pflichten mit Anstand entledigte. Hätte er eine liebenswürdigere Frau geheiratet, wäre er vielleicht noch mehr geachtet worden, wäre vielleicht sogar selbst ein liebenswürdiger Mensch geworden, schließlich hatte er sehr jung geheiratet und liebte seine Frau innig. Doch Mrs. John Dashwood war ein Zerrbild von ihm, war noch engherziger und selbstsüchtiger.
Als er seinem Vater jenes Versprechen gab, erwog er, das damalige Vermögen seiner Schwestern um jeweils eintausend Pfund aufzustocken. Zu diesem Zeitpunkt glaubte er tatsächlich, einem solchen Vorhaben gewachsen zu sein. Die Aussicht auf jährlich viertausend Pfund zusätzlich zu seinem bisherigen Einkommen, obendrein die noch ausstehende Hälfte des mütterlichen Vermögens, wärmten ihm das Herz und gaben ihm das Gefühl, er könne sich eine solche Großzügigkeit leisten. Ja, er würde ihnen dreitausend Pfund schenken, das war freigebig und freundlich! Das würde reichen, um ihnen ein gänzlich sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Dreitausend Pfund! Eine ansehnliche Summe, die er ohne größere Mühe abzweigen konnte. Er dachte den ganzen Tag und noch viele weitere Tage darüber nach und bereute seine Zusage nicht.
Kaum war der Vater begraben, traf Mrs. John Dashwood mit ihrem Kind und der Dienerschaft auf Norland ein, ohne ihre Schwiegermutter zuvor davon in Kenntnis gesetzt zu haben. Niemand konnte bestreiten, dass sie das Recht hatte zu kommen; von dem Moment an, da der Vater gestorben war, gehörte das Haus ihrem Mann. Die Taktlosigkeit ihres Verhaltens war dennoch unbestreitbar und hätte schon jeder normal empfindenden Frau in dieser Lage höchst unangenehm sein müssen. Mrs. Dashwood verfügte jedoch über einen derart ausgeprägten Ehrbegriff, eine so schwärmerische Großherzigkeit, dass ihr jede Unhöflichkeit, von oder gegenüber wem auch immer, eine Quelle unbezwingbaren Abscheus war. Mrs. John Dashwood war in der Familie ihres Mannes noch nie besonders beliebt gewesen, hatte aber bis jetzt noch keine Gelegenheit gehabt zu zeigen, wie rücksichtslos sie handeln konnte, wenn die Situation es erforderte.
Mrs. Dashwood schmerzte diese Lieblosigkeit aufs Äußerste, sie verachtete ihre Schwiegertochter dafür zutiefst und hätte bei deren Ankunft das Haus für immer verlassen, wenn nicht ihre älteste Tochter sie angefleht hätte, erst einmal nachzudenken, ob dies der richtige Schritt war, und schließlich bewog sie die zärtliche Liebe zu ihren drei Kindern, zu bleiben und um ihretwillen einen Bruch mit dem Bruder zu vermeiden.
Diese älteste Tochter Elinor, deren Einwand so wirkungsvoll gewesen war, besaß einen scharfen Verstand und ein unbestechliches Urteil, was sie dazu befähigte, trotz ihrer erst neunzehn Jahre die Ratgeberin ihrer Mutter zu sein und Mrs. Dashwoods Überschwänglichkeit, die in den meisten Fällen zu leichtsinnigem Handeln führte, zum Besten aller zu dämpfen. Sie hatte ein gutes Herz, war zärtlich und gefühlvoll, aber sie wusste ihre Gefühle zu zügeln, eine Kunst, die ihre Mutter noch lernen musste und eine ihrer beiden Schwestern nicht lernen wollte.
Mariannes Fähigkeiten glichen in vieler Hinsicht denen von Elinor. Auch sie war klug und begabt, aber in allem übereifrig; sie kannte in Freud und Leid kein Maß. Sie war großzügig, liebenswürdig und anziehend, sie war alles, nur nicht besonnen. Die Ähnlichkeit mit ihrer Mutter war auffallend.
Elinor beobachtete die übertriebene Empfindsamkeit ihrer Schwester mit Sorge, von Mrs. Dashwood dagegen wurde sie gehegt und gepflegt. Nun feuerten sich die beiden in ihrem Schmerz gegenseitig an. Der Gram, der sie anfangs überwältigt hatte, wurde aus freien Stücken aufgefrischt, gesucht, immer wieder wachgerufen. Sie überließen sich gänzlich ihrem Kummer, zogen aus jedem Gedanken, der sich dafür anbot, eine Steigerung ihres Leids und waren entschlossen, sich nie und nimmer trösten zu lassen. Auch Elinor war tief betrübt, aber sie vermochte noch zu kämpfen, sich anzustrengen. Es gelang ihr, sich mit ihrem Bruder zu beraten und ihre Schwägerin bei der Ankunft zu begrüßen und mit der gehörigen Aufmerksamkeit zu behandeln; darüber hinaus bemühte sie sich, ihre Mutter zu der gleichen Anstrengung und der gleichen Geduld zu ermuntern.
Margaret, die andere Schwester, war ein fröhliches, gutmütiges Mädchen, aber da sie mit ihren dreizehn Jahren bereits viel von Mariannes Schwärmerei übernommen hatte, ohne dabei Mariannes Verstand zu besitzen, sah es nicht danach aus, als würde sie im späteren Leben ihren Schwestern das Wasser reichen können.
KAPITEL 2
Mrs. John Dashwood richtete sich nun als Herrin auf Norland ein, und ihre Schwiegermutter und ihre Schwägerinnen wurden zu Logiergästen herabgestuft. Immerhin behandelte sie sie höflich, wenngleich reserviert, und ihr Mann ließ ihnen das größtmögliche Maß an Freundlichkeit angedeihen, das er für andere Menschen als sich selbst, seine Frau und sein Kind aufzubringen vermochte. Ja, er bat sie dringend und auch einigermaßen glaubhaft, Norland als ihr Zuhause zu betrachten, und da für Mrs. Dashwood nichts anderes in Frage kam als hierzubleiben, bis sie in der näheren Umgebung ein Haus gefunden hatte, wurde seine Einladung angenommen.
An einem Ort zu verweilen, wo alles sie an früheres Glück erinnerte, war genau, was sie sich wünschte. In fröhlichen Zeiten war niemand fröhlicher als sie oder empfand hoffnungsvoller jene Vorfreude, die schon die Freude selbst ist. Doch auch im Leid ließ sie sich von ihrer Fantasie mitreißen, und so ungetrübt ihre Freude war, so untröstlich war sie in ihrem Kummer.
Mrs. John Dashwood hieß keineswegs gut, was ihr Gatte für seine Schwestern zu tun beabsichtigte. Wenn er das Vermögen ihres lieben kleinen Jungen um dreitausend Pfund schmälere, sagte sie, werde er ihn bald an den Bettelstab bringen. Er möge bitte noch einmal darüber nachdenken. Wie er das vor sich selbst verantworten wolle, sein Kind, sein einziges Kind, einer so großen Summe zu berauben? Und welchen Anspruch die Misses Dashwood, die nur halbbürtig mit ihm verwandt seien – was in ihren Augen ja gar keine Verwandtschaft sei –, auf eine so ausnehmende Großzügigkeit seinerseits hätten? Bekanntlich erwarte niemand, dass eines Mannes Kinder aus verschiedenen Ehen Zuneigung füreinander verspürten, und warum er sich und ihren armen kleinen Harry ruinieren wolle, indem er all sein Geld an seine Halbschwestern verschenke?
«Es war die letzte Bitte meines Vaters», erwiderte ihr Mann, «dass ich seiner Witwe und seinen Töchtern helfe.»
«Er wusste bestimmt nicht mehr, was er sagte; zehn zu eins, dass er zu diesem Zeitpunkt schon wirr im Kopf war. Wäre er bei Verstand gewesen, wäre er nicht auf den Gedanken gekommen, Sie zu bitten, Ihrem eigenen Kind das halbe Vermögen wegzunehmen.»
«Er hat keine bestimmte Summe gefordert, liebe Fanny, er ersuchte mich nur ganz allgemein, ihnen zu helfen und ihnen bessere Verhältnisse zu ermöglichen, als er es vermocht hatte. Vermutlich hätte er diese Sache genauso gut mir allein anheimstellen können. Es war ja wohl kaum zu erwarten, dass ich sie im Stich lassen würde. Aber da er mich um mein Wort bat, musste ich es ihm geben. Zumindest dachte ich das damals. Ich habe es ihm also versprochen und muss dieses Versprechen nun auch halten. Es muss etwas für sie getan werden, wenn sie Norland verlassen und in ein anderes Haus ziehen.»
«Gut, dann soll auch etwas getan werden, aber dieses Etwas müssen keine dreitausend Pfund sein. Bedenken Sie», fuhr sie fort, «wenn das Geld erst einmal weg ist, kommt es niemals zurück. Ihre Schwestern werden heiraten, und dann ist es für immer verschwunden. Wenn es natürlich unserem armen kleinen Jungen zurückerstattet werden könnte …»
«Nun ja, das stimmt», sagte ihr Mann sehr ernst, «das wäre etwas anderes. Womöglich beklagt Harry eines Tages, dass wir eine so große Summe hergeschenkt haben. Falls er zum Beispiel irgendwann eine vielköpfige Familie haben sollte, wäre das ein willkommener Zuschlag.»
«Allerdings.»
«Dann wäre es vielleicht für alle Beteiligten besser, wenn wir den Betrag halbierten. Fünfhundert Pfund wären bei ihrem Vermögen ein gewaltiger Zuwachs.»
«Oh, das wäre über die Maßen großartig! Welcher Bruder auf Erden würde auch nur halb so viel für seine Schwestern tun, selbst wenn es echte Schwestern wären! Dabei sind es nur Halbschwestern. Aber Sie sind ja so großzügig!»
«Ich möchte nicht schäbig handeln», antwortete er. «Bei solchen Gelegenheiten tut man besser zu viel als zu wenig. Zumindest kann niemand sagen, ich hätte nicht genug für sie getan, nicht einmal sie selbst – sie können unmöglich mehr erwarten.»
«Was die erwarten, weiß man nie», meinte die Dame, «aber ihre Erwartungen brauchen uns nicht zu kümmern. Die Frage ist vielmehr, was Sie sich leisten können.»
«Sicher – und ich glaube, ich kann es mir leisten, jeder fünfhundert Pfund zu geben. So wie es jetzt steht, ohne eine Aufstockung von meiner Seite, erhält jede beim Tod der Mutter etwa dreitausend Pfund – reichlich viel Geld für eine junge Frau.»
«Allerdings. Mir kommt es so vor, als brauchten sie gar keine Aufstockung. Sie dürfen sich zehntausend Pfund teilen. Wenn sie heiraten, werden sie es bestimmt gut treffen, und wenn nicht, können sie zu dritt von den Zinsen der zehntausend Pfund ganz komfortabel leben.»
«Das ist richtig. Deshalb ist es am Ende vielleicht auch klüger, zu Lebzeiten etwas für ihre Mutter zu tun, im Sinne einer jährlichen Zuwendung, meine ich. Meine Schwestern bekämen die erfreulichen Auswirkungen genauso zu spüren wie sie selbst. Hundert im Jahr würden ihnen schon sehr guttun.»
Seine Frau zögerte ein wenig mit ihrer Einwilligung. «Sicher», sagte sie, «das ist besser, als sich auf einen Schlag von fünfzehnhundert Pfund zu trennen. Aber wenn Mrs. Dashwood dann noch fünfzehn Jahre lebt, sind wir die Dummen.»
«Fünfzehn Jahre! Liebe Fanny! Ich gebe ihr nicht mehr halb so viel Zeit.»
«Wahrscheinlich nicht. Aber wenn Sie mal darauf achten, die Leute, die eine Leibrente bekommen, leben immer ewig, und Mrs. Dashwood ist gesund und kräftig und kaum vierzig. Eine Leibrente ist eine sehr ernste Angelegenheit, sie wird jedes Jahr fällig, und man wird sie nicht mehr los. Sie sind sich nicht bewusst, was Sie da tun. Ich kenne mich mit diesen leidigen Renten aus, meiner Mutter hing nämlich die Bezahlung von drei uralten Dienstboten nach dem letzten Willen meines Vaters wie ein Klotz am Bein, und sie fand das wirklich unglaublich lästig. Die Renten mussten halbjährlich ausgezahlt werden, dann die Scherereien, bis das Geld bei den Leuten war, schließlich hieß es, einer sei gestorben, danach stellte sich heraus, das stimmte gar nicht. Meine Mutter hatte es bis obenhin satt. Sie sagte, bei solch unkündbaren Ansprüchen ist man nicht mehr Herr über das eigene Einkommen, und von meinem Vater war das besonders lieblos, weil das Geld sonst gänzlich meiner Mutter zur Verfügung gestanden hätte, ohne jede Einschränkung. Ich habe seitdem einen solchen Abscheu vor Leibrenten, dass ich mich um nichts in der Welt auf etwas Derartiges festnageln ließe.»
«Sicher, so eine alljährliche Belastung des Einkommens ist unerfreulich», erwiderte Mr. Dashwood. «Wie Ihre Mutter ganz richtig sagt, ist man nicht mehr Herr über das eigene Vermögen. Es ist keineswegs wünschenswert, regelmäßig an einem bestimmten Tag eine solche Summe zahlen zu müssen: Man verliert ja jede Unabhängigkeit.»
«Zweifellos. Und letzten Endes dankt es einem niemand. Die Empfänger wiegen sich in Sicherheit, und weil Sie nur tun, was man von Ihnen erwartet, fühlt sich keiner zu Dank verpflichtet. Ich an Ihrer Stelle würde ausschließlich nach freiem Ermessen handeln. Ich würde mich nicht zu einer jährlichen Leistung verpflichten. In manchen Jahren könnte es sehr lästig sein, wenn wir unsere eigenen Ausgaben um hundert oder auch nur um fünfzig Pfund einschränken müssten.»
«Ich glaube, Sie haben recht, meine Liebe; in diesem Fall wird es besser sein, keine jährliche Rente zu zahlen. Was immer ich ihnen gelegentlich zukommen lasse, wird ihnen mehr nützen als ein festes Jahresgeld, denn die Gewissheit größerer Einkünfte ließe sie nur auf größerem Fuße leben, und am Ende des Jahres wären sie um keinen Shilling wohlhabender. Das ist eindeutig die beste Lösung. Ab und zu ein Geschenk von fünfzig Pfund wird verhindern, dass sie in Geldnot geraten, und mein Versprechen mehr als angemessen einlösen.»
«Natürlich. Offen gestanden bin ich sogar überzeugt, dass Ihr Vater gar nicht an Geldgaben dachte. Vermutlich dachte er an die Art von Unterstützung, die man billigerweise von Ihnen erwarten kann; zum Beispiel ein gemütliches Häuschen für sie suchen, ihnen beim Umziehen helfen und ihnen während der Saison Fisch, Wild und so weiter zukommen lassen. Ich gehe jede Wette ein, er hat gar nichts anderes gemeint – das wäre ja auch sehr seltsam und unvernünftig gewesen. Überlegen Sie doch, mein lieber Mr. Dashwood, wie außerordentlich komfortabel Ihre Stiefmutter und deren Töchter von den Zinsen der siebentausend Pfund leben können, nicht gerechnet die tausend Pfund, die jedes Mädchen besitzt und die ihnen jeweils fünfzig Pfund im Jahr einbringen. Davon werden sie natürlich ihrer Mutter Kost und Logis zahlen. Alles in allem dürften sie zusammen fünfhundert im Jahr haben, und wozu um alles in der Welt brauchen vier Frauen mehr als das? Sie leben doch so billig! Die Haushaltsführung kostet sie gar nichts. Sie halten sich keine Kutsche, keine Pferde und kaum Dienstboten; sie empfangen keine Gäste und haben überhaupt keine Aufwendungen! Stellen Sie sich nur vor, wie gut es ihnen geht! Fünfhundert im Jahr! Ich begreife gar nicht, wofür sie auch nur halb so viel ausgeben könnten, und die Vorstellung, dass Sie ihnen mehr zahlen wollen, ist völlig aberwitzig. Eher sind sie in der Lage, Ihnen etwas zu zahlen.»
«Offen gestanden glaube ich, Sie haben vollkommen recht», sagte Mr. Dashwood. «Bestimmt hat mein Vater mit seiner Bitte nichts anderes gemeint, als was Sie sagen. Jetzt verstehe ich es erst, und ich werde meiner Verpflichtung durch die von Ihnen genannten Hilfeleistungen und Liebenswürdigkeiten gewissenhaft nachkommen. Wenn meine Stiefmutter in ein anderes Haus zieht, werde ich ihr meine Dienste anbieten und ihr zur Seite stehen, soweit ich dazu in der Lage bin. Dann dürfte auch gegen ein Möbelstück als kleines Geschenk nichts einzuwenden sein.»
«Selbstverständlich», erwiderte Mrs. John Dashwood. «Aber eins ist zu bedenken: Als Ihre Eltern nach Norland zogen, wurden zwar die Möbel von Stanhill verkauft, aber alles Porzellan, Besteck und Bettzeug wurde aufgehoben und gehört nun zur Erbschaft Ihrer Mutter. Ihr Haushalt ist also fast komplett, wenn sie einzieht.»
«Das ist zweifellos ein wichtiger Gedanke. Ein wertvolles Vermächtnis, in der Tat. Dabei hätten wir einiges von dem Silber auch bei uns recht gut gebrauchen können.»
«Ja, und das Frühstücksgeschirr ist viel schöner als das, was zu diesem Haus gehört. Meiner Meinung nach viel zu hübsch für jedes Haus, dass die sich leisten können. Aber so ist es nun einmal. Ihr Vater hat nur an sie gedacht. Und ich muss sagen: Sie, mein lieber Mr. Dashwood, schulden ihm keinen besonderen Dank und müssen seine Wünsche auch nicht respektieren, denn wir wissen sehr wohl, dass er fast alles denen hinterlassen hätte, wenn es ihm möglich gewesen wäre.»
Dieses Argument war nicht zu widerlegen. Es verlieh seinen Absichten die bisher fehlende Entschiedenheit, und er befand endgültig, dass es völlig unnötig, wenn nicht sogar ungehörig war, für die Witwe und die Kinder seines Vaters mehr zu tun, als jene nachbarschaftliche Hilfe zu leisten, die ihm seine Frau nahegelegt hatte.
KAPITEL 3
Mrs. Dashwood blieb noch einige Monate auf Norland, was aber nicht etwa daran lag, dass sie einem Umzug abgeneigt gewesen wäre, denn der Anblick der vertrauten Örtlichkeiten löste nun nicht mehr so heftige Gefühle aus wie am Anfang. Vielmehr konnte sie, als ihre Lebensgeister allmählich wieder erwachten und ihre Gedanken nicht mehr unablässig in melancholischem Erinnern und Trübsalblasen gefangen waren, sondern sich auch wieder zu anderem imstande fühlte, es kaum noch erwarten, wegzuziehen, und suchte unermüdlich in der Umgebung von Norland nach einer geeigneten Bleibe. Sich weit von diesem geliebten Ort zu entfernen schien ihr unmöglich. Aber sie erfuhr von keinem Wohnhaus, das ihren Vorstellungen von Komfort und Behaglichkeit entsprochen und gleichzeitig die Zustimmung ihrer besonnenen ältesten Tochter gefunden hätte; diese nämlich lehnte mit sicherem Urteil einige Häuser, die die Mutter gebilligt hätte, ab, weil sie für ihr Budget zu groß waren.
Mrs. Dashwood wusste von ihrem Mann, welch feierliches Versprechen ihm sein Sohn zu ihren Gunsten gegeben hatte; das war ihm in seinen letzten Stunden eine Beruhigung gewesen. Sie zweifelte ebenso wenig an der Aufrichtigkeit dieser Beteuerung, wie er daran gezweifelt hatte, und um ihrer Töchter willen war sie sehr froh darüber. Sie selbst hätte sich freilich auch mit einer viel kleineren Summe als siebentausend Pfund wohlversorgt gefühlt. Für den Bruder freute sie sich, freute sich über sein gutes Herz und warf sich vor, ihn bisher nicht richtig gewürdigt zu haben, da sie ihm keine Freigebigkeit zugetraut hatte. Sein aufmerksames Verhalten ihr und seinen Schwestern gegenüber schien zu beweisen, dass ihm ihr Wohlergehen am Herzen lag, und lange vertraute sie fest auf die Großzügigkeit seiner Absichten.
Die Verachtung, die Mrs. Dashwood schon bald nach der ersten Begegnung für ihre Schwiegertochter empfunden hatte, wuchs gewaltig, als sie sie näher kennenlernte; dazu genügte ein halbes Jahr Zusammenleben. Und obwohl Erstere es keineswegs an Höflichkeit oder mütterlicher Zuwendung fehlen ließ, hätten es die beiden Damen nie so lange gemeinsam unter einem Dach ausgehalten, wenn nicht ein besonderer Umstand eingetreten wäre, der nach Meinung von Mrs. Dashwood ihren Töchtern mehr denn je das Recht gab, auf Norland zu bleiben.
Dieser Umstand war die wachsende Zuneigung zwischen ihrem ältesten Mädchen und dem Bruder von Mrs. John Dashwood, einem angenehmen jungen Gentleman, der ihnen kurz nach dem Einzug seiner Schwester auf Norland vorgestellt worden war und seither den größten Teil seiner Zeit hier verbracht hatte.
Manche Mütter hätten diesen vertrauten Umgang aus Berechnung gefördert, denn Edward Ferrars war der älteste Sohn eines Mannes, der bei seinem Tod ein Vermögen hinterlassen hatte; andere hätten die Angelegenheit aus Vorsicht einschlafen lassen, denn bis auf einen geringen Betrag hing sein ganzes Vermögen vom Testament seiner Mutter ab. Mrs. Dashwood jedoch waren beide Denkweisen gleichermaßen fremd. Ihr genügte es, dass er ein gewinnendes Wesen zu haben schien, dass er ihre Tochter liebte und Elinor ihn ebenfalls gernhatte. Es widersprach ihrer Lebensauffassung, dass ein Paar, das sich durch ähnliche Wesensart zueinander hingezogen fühlte, wegen finanzieller Unterschiede getrennt werden sollte, und es war für sie unvorstellbar, dass ein Mensch, der Elinors gute Eigenschaften kannte, diese nicht schätzte.
Edward Ferrars empfahl sich weder durch besondere körperliche Vorzüge noch durch Gewandtheit. Er sah nicht gut aus, und man musste ihn schon näher kennen, um an seinem Auftreten Gefallen zu finden. Er war zu schüchtern, um ganz er selbst zu sein, sobald er aber seine natürliche Scheu überwunden hatte, ließ sein Benehmen ein aufrichtiges, liebevolles Herz erkennen. Er war intelligent und hatte eine solide Bildung erhalten. Dennoch befähigten ihn weder seine Anlagen noch seine Neigungen dazu, die Wünsche von Mutter und Schwester zu erfüllen, die ihn zu gern in einer wichtigen Position gesehen hätten, zum Beispiel … sie wussten selbst nicht recht, in welcher. Sie wollten, dass er draußen in der Welt auf die eine oder andere Weise eine gute Figur machte. Seine Mutter versuchte ihn für die Politik zu interessieren, wollte ihn ins Parlament bringen, wollte, dass er mit bedeutenden Männern verkehrte. Das wollte Mrs. John Dashwood ebenfalls, aber bis dahin, bis er eins dieser hochgesteckten Ziele erreichte, hätte es ihren Ehrgeiz schon befriedigt, wenn er wenigstens in einer Barouche1 gefahren wäre. Doch Edward machte sich nichts aus bedeutenden Männern oder Barouches. Seine Wünsche konzentrierten sich einzig auf häusliches Behagen und ein ruhiges Privatleben. Zum Glück hatte er einen jüngeren Bruder, der mehr Anlass zu Hoffnungen gab.
Edward war schon einige Wochen im Haus zu Gast, als er Mrs. Dashwoods Aufmerksamkeit erregte, denn in ihrem Gram war sie bisher für Menschen in ihrer Umgebung unempfänglich gewesen. Sie stellte fest, dass er ruhig und zurückhaltend war, und das gefiel ihr. Er störte ihren Kummer nicht durch unpassende Konversation. Erst eine Bemerkung Elinors über den Unterschied zwischen ihm und seiner Schwester veranlasste sie eines Tages, ihn genauer zu beobachten und für gut zu befinden. Es war ein Gegensatz, der in den Augen der Mutter sehr für ihn sprach.
«Das reicht», meinte sie. «Schon die Feststellung, dass er anders ist als Fanny, reicht mir. Daraus folgt unweigerlich, dass er liebenswert sein muss. Ich habe ihn bereits ins Herz geschlossen.»
«Ich glaube, er wird dir gefallen, wenn du ihn näher kennenlernst», sagte Elinor.
«Gefallen!», erwiderte die Mutter mit einem Lächeln. «Ich kann keine schwächere Form der Zuneigung empfinden als Liebe.»
«Du wirst ihn schätzen.»
«Ich habe Schätzen und Lieben noch nie auseinanderhalten können.»
Mrs. Dashwood setzte nun alles daran, ihn näher kennenzulernen. Ihre gewinnende Art ließ ihn bald alle Zurückhaltung aufgeben. Sie verstand rasch, wo seine Vorzüge lagen. Vielleicht half ihr dabei auch der Glaube, dass er Elinor liebte. Andererseits war sie wirklich von seinen inneren Werten überzeugt, und selbst das ruhige Auftreten, das all ihren bestehenden Vorstellungen davon, wie sich ein junger Mann zu benehmen hatte, zuwiderlief, war nicht mehr uninteressant, als sie erkannt hatte, wie warmherzig und liebevoll er war.
Kaum bemerkte sie erste Anzeichen der Liebe in seinem Verhalten zu Elinor, als sie schon eine ernsthafte Verbindung für sicher hielt und sich auf eine baldige Hochzeit freute.
«In ein paar Monaten, liebe Marianne», sagte sie, «wird für Elinor aller Wahrscheinlichkeit nach ein neues Leben beginnen. Wir werden sie vermissen, aber sie wird glücklich sein.»
«Ach, Mama, wir sollen wir denn ohne sie auskommen?»
«Wir werden gar nicht richtig getrennt sein, Liebchen. Wir werden nur wenige Meilen voneinander entfernt wohnen und uns für den Rest unseres Lebens jeden Tag sehen. Und du gewinnst einen Bruder, einen echten, liebevollen Bruder. Ich habe die denkbar höchste Meinung von Edwards Gesinnung. Aber du machst ein ernstes Gesicht, Marianne. Bist du mit der Wahl deiner Schwester nicht einverstanden?»
«Nun ja», sagte Marianne, «sie überrascht mich ein wenig. Edward ist sehr liebenswürdig, und ich mag ihn wirklich gern. Dennoch … er ist nicht die Art von jungem Mann … Es fehlt etwas … er sieht nicht gerade beeindruckend aus; er hat nichts von dem Charme, den ich bei einem Mann erwarte, der meine Schwester ernsthaft fesseln könnte. Seinem Blick fehlt das Geistvolle, das Feurige, das gleichzeitig von Tugend und Intelligenz zeugt. Außerdem hat er leider keinen guten Geschmack, Mama. Musik scheint ihn kaum zu reizen, und obwohl er Elinors Zeichnungen sehr bewundert, ist es nicht die Bewunderung eines Menschen, der ihren Wert begreift. Obwohl er häufig aufmerksam zusieht, wenn sie zeichnet, wird deutlich, dass er in Wirklichkeit nichts von der Sache versteht. Es ist die Bewunderung des Verliebten, nicht des Kenners. Ich bin erst zufrieden, wenn sich beide Rollen in einer Person vereinen. Ich könnte mit einem Mann, dessen Geschmack nicht in allen Punkten mit dem meinen übereinstimmt, nicht glücklich werden. Er muss auf all meine Gefühle eingehen, uns müssen dieselben Bücher, dieselben Musikstücke gefallen. Ach, Mama, wie geistlos, wie fade hat Edward uns gestern Abend vorgelesen! Ich hatte tiefes Mitleid mit meiner Schwester. Aber sie nahm es sehr gefasst, sie schien es kaum zu merken. Mich hingegen hielt es fast nicht mehr auf meinem Stuhl. Diese schönen Zeilen, an denen ich mich oft geradezu berauscht habe, so unerschütterlich ruhig, so fürchterlich gleichgültig vorgetragen zu hören!»
«Ja, schlichte, elegante Prosa hätte er bestimmt besser gemeistert. Das fiel mir gestern auch auf, aber du musstest ihm ja Cowper2 geben!»
«Ach, Mama, wenn er sich von Cowper nicht hinreißen lässt …! Aber die Geschmäcker sind eben verschieden. Elinor hat nicht meine Empfindsamkeit, und deshalb sieht sie vielleicht darüber hinweg und wird glücklich mit ihm. Mir bräche das Herz, wenn ich ihn liebte und er dann so leidenschaftslos vorläse. Mama, je mehr ich von der Welt weiß, desto fester bin ich überzeugt, dass ich niemals einem Mann begegnen werde, den ich wirklich lieben kann. Ich verlange zu viel. Er müsste Edwards Tugenden besitzen und diese Vorzüge noch mit einer anziehenden Erscheinung und charmanten Umgangsformen krönen.»
«Denk daran, Liebchen, du bist noch keine siebzehn. Das ist zu früh, um an solcher Seligkeit zu zweifeln. Warum solltest du weniger Glück haben als deine Mutter? Nur in einem Punkt, meine Marianne, möge dein Schicksal anders verlaufen als das ihre!»
KAPITEL 4
«Wie schade, Elinor», sagte Marianne, «dass Edward keinen Sinn fürs Zeichnen hat.»
«Keinen Sinn fürs Zeichnen?», erwiderte Elinor. «Wie kommst du darauf? Er selbst zeichnet nicht, das stimmt, aber er sieht sich mit großem Vergnügen die Arbeiten anderer an, und es fehlt ihm keineswegs an natürlichem Geschmack, auch wenn er keine Gelegenheit gehabt hat, ihn zu schulen. Ich glaube, er würde recht gut zeichnen, wenn er es jemals gelernt hätte. Er misstraut seinem eigenen Urteil, deshalb scheut er sich immer, seine Meinung zu einem Bild zu äußern, dabei hat er einen angeborenen Sinn für das Angemessene und Schlichte, der ihn im Allgemeinen durchaus in die richtige Richtung führt.»
Marianne fürchtete Elinor zu kränken, deshalb sagte sie nichts mehr zu diesem Thema, auch wenn Edwards Art von Beifall, den er nach Elinors Worten den Zeichnungen anderer Leute zollte, weit entfernt war von jenem hingerissenen Entzücken, das ihrer eigenen Meinung nach einzig als künstlerischer Geschmack gelten durfte. Die blinde Voreingenommenheit gegenüber Edward ehrte ihre Schwester, selbst wenn sie diese Schwäche insgeheim belächelte.
«Ich hoffe, Marianne», fuhr Elinor fort, «du findest nicht, dass es ihm grundsätzlich an gutem Geschmack fehlt. Nein, das kann nicht sein, denn du bist sehr herzlich zu ihm, und wenn du so dächtest, könntest du sicher niemals derart höflich sein.»
Marianne wusste nicht recht, was sie sagen sollte. Sie wollte die Gefühle ihrer Schwester auf keinen Fall verletzen, konnte jedoch unmöglich etwas behaupten, wovon sie nicht überzeugt war. Schließlich antwortete sie: «Nimm es mir nicht übel, Elinor, wenn mein Lob für ihn nicht in allen Belangen deiner Wahrnehmung seiner Vorzüge entspricht. Ich hatte nicht so häufig Gelegenheit wie du, mir ein Bild von seinen verborgenen Interessen, Vorlieben und Neigungen zu machen, aber ich habe eine hohe Meinung von seiner Güte und seinem Verstand. Ich halte ihn für äußerst achtbar und liebenswert.»
«Mit einem solchen Lob wären bestimmt auch seine besten Freunde einverstanden», erwiderte Elinor lächelnd. «Ich wüsste nicht, wie du es herzlicher hättest ausdrücken können.»
Marianne war froh, dass ihre Schwester so leicht zufriedenzustellen war.
«An seinem Verstand und seiner Güte kann wohl niemand zweifeln, der öfter mit ihm zusammen ist und ihn in freimütigen Gesprächen erlebt», fuhr Elinor fort. «Nur verstecken sich seine Intelligenz und seine edlen Grundsätze manchmal hinter der Schüchternheit, die ihn meist schweigen lässt. Du kennst ihn gut genug, um seinen wahren Wert zu würdigen. Aber von seinen verborgenen Interessen, wie du sie nennst, weißt du aus bestimmten Gründen weniger als ich. Er und ich sind bisweilen für längere Zeit miteinander allein gewesen, wenn du – fürsorglich, wie du bist – ganz von unserer Mutter in Anspruch genommen wurdest. Ich habe ihn aus der Nähe erlebt, habe seine Empfindungen erforscht und gehört, wie er über Literatur und guten Geschmack denkt, und im großen Ganzen wage ich zu behaupten, dass er vielseitig gebildet ist, außerordentlich große Freude an Büchern hat und eine lebhafte Fantasie, eine scharfe, genaue Beobachtungsgabe, einen feinen, gediegenen Geschmack. Er gewinnt bei näherer Bekanntschaft, sowohl hinsichtlich seiner Fähigkeiten als auch seiner äußeren Erscheinung und seines Auftretens. Auf den ersten Blick wirkt er nicht besonders gewandt, und man wird ihn kaum als gut aussehend bezeichnen, erst wenn man seine außergewöhnlich ausdrucksvollen Augen und die allumfassende Liebenswürdigkeit in seiner Miene wahrnimmt. Inzwischen kenne ich ihn so gut, dass ich ihn wirklich hübsch finde – jedenfalls fast. Was meinst du, Marianne?»
«Jetzt vielleicht noch nicht, aber gewiss bald, Elinor. Wenn du mir befiehlst, ihn wie einen Bruder zu lieben, wird mir sein Gesicht ebenso makellos erscheinen wie sein Herz.»
Bei diesem Versprechen zuckte Elinor zusammen und bereute, dass sie mit so viel Wärme über ihn gesprochen hatte. Sie empfand enorme Hochachtung vor Edward. Sie glaubte auch, dass diese Achtung wechselseitig war, aber sie brauchte noch größere Gewissheit, um wie Marianne von ihrer beider Liebe überzeugt sein zu können. Was Marianne und ihre Mutter im einen Moment vermuteten, das vermochten sie im nächsten bekanntlich schon zu glauben; Wünschen bedeutete für sie Hoffen, und Hoffen bedeutete Erwarten. Sie versuchte ihrer Schwester den wahren Stand der Dinge zu erklären.
«Ich will nicht leugnen», sagte sie, «dass ich viel von ihm halte, dass ich ihn sehr schätze, dass ich ihn gernhabe.»
Empört brach es aus Marianne hervor: «Schätzen, gernhaben! Du bist eiskalt, Elinor! Ach, schlimmer als eiskalt! Du würdest dich schämen, wenn es anders wäre. Noch einmal solche Worte, und ich verlasse augenblicklich den Raum.»
Elinor musste lachen. «Entschuldige, ich wollte dich bestimmt nicht vor den Kopf stoßen, indem ich so gelassen über meine Gefühle spreche. Glaub mir, sie sind stärker, als ich es eingestanden habe; sie sind so stark, wie seine Vorzüge und meine Vermutung, nein, meine Hoffnung, dass er mich liebt, es mir gestatten, ohne dass ich gleich leichtsinnig oder töricht werde. Aber mehr solltest du nicht annehmen. Ich bin mir seiner Zuneigung keineswegs sicher. Es gibt Augenblicke, in denen ich im Unklaren bin, wie weit sie geht, und solange ich seine Gefühle nicht wirklich kenne, darfst du dich nicht wundern, wenn ich jede Ermutigung von mir weise, die mir einzureden versucht, ich empfände mehr. In meinem Innern zweifle ich wenig, ja kaum an seiner Sympathie. Aber neben seiner Neigung gibt es auch andere Dinge zu bedenken. Er ist alles andere als unabhängig. Wir kennen seine Mutter nicht, aber Fannys gelegentliche Bemerkungen über ihr Verhalten und ihre Ansichten lassen nicht gerade auf ein liebenswürdiges Wesen schließen. Und wenn ich mich nicht irre, ist sich Edward sehr wohl bewusst, dass er große Schwierigkeiten bekäme, falls er eine Frau heiraten wollte, die weder ein großes Vermögen besitzt noch von hohem Stand ist.»
Marianne staunte, wie weit sich ihre eigene Einbildungskraft und die ihrer Mutter von der Wahrheit entfernt hatten.
«Du bist also nicht verlobt!», sagte sie. «Aber bestimmt ist es bald so weit. Immerhin hat dieser Aufschub zwei Vorteile: Ich werde dich nicht so schnell verlieren, und Edward hat die Möglichkeit, sein noch ungeschultes Verständnis für deine Lieblingsbeschäftigung weiterzuentwickeln, was für dein künftiges Glück unverzichtbar sein dürfte. Ach, wenn er sich durch dein Talent bewegen ließe, selbst zeichnen zu lernen, das wäre wunderbar!»
Elinor hatte ihrer Schwester die Wahrheit gesagt. Sie versprach sich für ihre Zuneigung zu Edward nicht so viel Erfolg, wie Marianne geglaubt hatte. Manchmal hatte er etwas Mutloses an sich, das nicht gerade auf Gleichgültigkeit hinwies, aber ähnlich wenig verheißungsvoll wirkte. Falls er an ihrer Neigung zweifelte, mochte ihn das vielleicht beunruhigen; doch es war unwahrscheinlich, dass dies solche Niedergeschlagenheit hervorrief, wie sie ihn häufig heimsuchte. Der Grund war wohl eher in seiner finanziellen Abhängigkeit zu suchen, die es ihm verbot, sich zu seiner Liebe zu bekennen. Sie wusste, dass seine Mutter ihm einerseits sein Zuhause verleidete, ihm aber andererseits zu verstehen gab, er dürfe nur dann einen eigenen Hausstand gründen, wenn er sich ihren Vorstellungen von seinem gesellschaftlichen Aufstieg fügte. Angesichts dessen konnte Elinor bei diesem Thema unmöglich ein gutes Gefühl haben. Sie rechnete keineswegs fest damit, dass seine Aufmerksamkeit zu dem Ergebnis führte, das Mutter und Schwester noch immer für ausgemacht hielten. Nein, je länger sie zusammen waren, desto mehr zweifelte sie an seiner Neigung, und in manchen schmerzlichen Minuten sah sie darin einfach nur Freundschaft.
Aber welche Grenzen seine Neigung auch haben mochte, sie war auffallend genug, dass seine Schwester sie bemerkte, sich Sorgen machte und taktlos wurde (was nicht gerade ungewöhnlich war). Sie nutzte die erste Gelegenheit, ihre Schwiegermutter zu brüskieren, und sprach eindringlich von den grandiosen Aussichten ihres Bruders, von Mrs. Ferrars’ entschiedenem Willen, beide Söhne gut zu verheiraten, und von der Gefahr, dass eine junge Frau ihn köderte. Mrs. Dashwood konnte nicht mehr so tun, als merke sie nichts, bemühte sich auch nicht mehr, gelassen zu bleiben. Sie gab ihr eine Antwort, in die sie ihre ganze Verachtung legte, verließ augenblicklich das Zimmer und beschloss, dass ihre geliebte Elinor keine Woche länger solchen Anspielungen ausgesetzt sein dürfe, egal, welche Unannehmlichkeiten und Kosten ein so plötzlicher Auszug mit sich brachte.
In dieser Gemütsverfassung erhielt sie per Post einen Vorschlag, der gerade zur rechten Zeit kam. Ihr wurde zu sehr günstigen Bedingungen ein kleines Haus angeboten, das einem Verwandten gehörte, einem vornehmen, wohlhabenden Gentleman in Devonshire. Der Herr hatte den Brief persönlich und in einem aufrichtigen Ton freundlichen Entgegenkommens geschrieben. Er wisse, dass sie eine Bleibe suche, und obwohl das angebotene Haus nur ein Cottage sei, werde alles, was sie für nötig halte, daran getan werden, falls ihr die Lage zusage. Nachdem er ihr Haus und Garten näher geschildert hatte, bat er sie eindringlich, mit ihren Töchtern seinen Landsitz Barton Park zu besuchen und sich dort selbst ein Urteil zu bilden, ob Barton Cottage (die Häuser lagen im selben Sprengel) so umgestaltet werden könne, dass sie sich darin wohlfühle. Ihm schien wirklich daran zu liegen, ihnen gefällig zu sein, und der ganze Brief war so freundlich geschrieben, dass er seiner Cousine einfach Freude machen musste, ganz besonders in einem Augenblick, in dem sie unter der Kälte und Gefühllosigkeit ihrer näheren Verwandten litt. Sie brauchte nicht lange zu überlegen oder zu fragen. Schon während des Lesens stand ihr Entschluss fest. Die Lage von Barton in der Grafschaft Devonshire, weit weg von Sussex, wäre noch vor wenigen Stunden ein Hinderungsgrund gewesen, der sämtliche möglichen Vorteile des Hauses überwogen hätte, war aber jetzt seine beste Empfehlung. Es war nicht mehr schlimm, die Gegend von Norland zu verlassen, es war wünschenswert, ein Segen, verglichen mit dem Elend, weiterhin Gast ihrer Schwiegertochter zu sein; und für immer aus dem geliebten Haus auszuziehen schmerzte sie weniger, als es zu bewohnen oder zu besuchen, solange eine solche Frau dort Hausherrin war. Sie schrieb Sir John Middleton umgehend, dass sie seine Freundlichkeit zu schätzen wisse und seinen Vorschlag annehme, und dann zeigte sie beide Briefe eilends ihren Töchtern, um deren Einwilligung einzuholen, bevor sie die Antwort abschickte.
Elinor war immer der Ansicht gewesen, es sei vernünftiger, sich in einer gewissen Entfernung von Norland niederzulassen, nicht inmitten ihres jetzigen Bekanntenkreises. Diesbezüglich gab es für sie also keinen Grund, sich der Absicht ihrer Mutter, nach Devonshire zu ziehen, zu widersetzen. Zudem war das Haus, wie es Sir John beschrieb, so schlicht und die Miete so ungewöhnlich niedrig, dass es ihr nicht zustand, Einwände zu erheben. Und wiewohl dieser Plan für sie nichts Reizvolles hatte und sie sich mit diesem Umzug viel weiter als gewünscht von Norland entfernten, versuchte sie nicht, ihrer Mutter die Zusage auszureden.
KAPITEL 5
Kaum war die Antwort abgeschickt, verkündete Mrs. Dashwood ihrem Stiefsohn und seiner Frau genüsslich, dass sie ein Haus gefunden habe und ihnen nur noch so lange zur Last fallen werde, bis alles für ihren Einzug hergerichtet sei. Sie vernahmen es mit Erstaunen. Mrs. John Dashwood sagte nichts, aber ihr Mann verlieh höflich seiner Hoffnung Ausdruck, sie würden sich nicht weit von Norland niederlassen. Mit großer Genugtuung erwiderte sie, sie zögen nach Devonshire. Als Edward das hörte, wandte er sich hastig zu ihr um und wiederholte verblüfft und beunruhigt, was sie nicht weiter verwunderte: «Devonshire! Tatsächlich? So weit von hier! Und in welchen Teil?» Sie beschrieb die Lage des Hauses. Es war etwa vier Meilen von Exeter entfernt.
«Es ist nur ein Cottage», fuhr sie fort, «aber ich hoffe, dass mich dort viele Freunde besuchen kommen. Man kann leicht einen oder zwei Räume anbauen, und wenn meine Freunde die Mühe der weiten Reise zu mir nicht scheuen, werde ich keine Mühe scheuen, sie zu beherbergen.»
Sie schloss mit einer sehr freundlichen Einladung an Mr. und Mrs. John Dashwood, sie in Barton zu besuchen, und mit einer noch liebevolleren an Edward. Obwohl das jüngste Gespräch mit ihrer Schwiegertochter ausschlaggebend für ihren Entschluss gewesen war, nicht länger als unvermeidlich auf Norland zu bleiben, hatte es sie doch in der Frage, um die es eigentlich ging, nicht im Mindesten beeinflusst. Edward und Elinor zu trennen lag ihr so fern wie eh und je, und mit dieser demonstrativen Einladung an Mrs. John Dashwoods Bruder wollte sie dieser zeigen, dass sie deren Missbilligung einer solchen Verbindung nicht die geringste Beachtung schenkte.
Mr. John Dashwood beteuerte wieder und wieder, wie außerordentlich leid es ihm tue, dass seine Mutter ein Haus so weit weg von Norland gemietet habe, hindere ihn dies doch daran, ihr beim Umzug irgendwie dienlich zu sein. Er hatte tatsächlich ein schlechtes Gewissen, denn durch diese Regelung ließ sich nun nicht einmal mehr die Hilfe leisten, auf die er sein dem Vater gegebenes Versprechen reduziert hatte. Die gesamte Einrichtung wurde per Schiff verfrachtet. Sie bestand hauptsächlich aus Bettwäsche, Besteck, Porzellan und Büchern, dazu noch ein schönes Klavier von Marianne. Mrs. John Dashwood sah mit einem Seufzer die Kisten verschwinden; irgendwie fand sie es schwer erträglich, dass Mrs. Dashwood, deren Einkommen im Vergleich zu dem ihren doch recht dürftig war, überhaupt hübsche Einrichtungsgegenstände besaß.
Mrs. Dashwood mietete das Haus für ein Jahr; es war voll möbliert, und sie konnte es sofort in Besitz nehmen. Es gab von beiden Seiten keine Schwierigkeiten, und so wartete sie nur, bis ihre persönliche Habe verschickt und hinsichtlich ihres künftigen Haushalts alles entschieden war, um dann sofort Richtung Westen aufzubrechen. All das war bald erledigt, da sie in Dingen, die ihr am Herzen lagen, rasch zu handeln pflegte. Die Pferde, die ihr Mann hinterlassen hatte, waren kurz nach seinem Tod verkauft worden, und als sich nun eine Gelegenheit bot, ihre Kutsche abzustoßen, willigte sie auf Anraten ihrer ältesten Tochter ein, diese ebenfalls zu veräußern. Wäre es nach ihren eigenen Wünschen gegangen, hätte sie den Wagen um der Bequemlichkeit ihrer Kinder willen behalten, doch Elinors Umsicht siegte. Sie war es auch, die in ihrer Klugheit die Zahl der Dienstboten auf drei begrenzte: zwei Mädchen und ein Diener, die sie unter dem Personal auswählten, das schon auf Norland für sie gearbeitet hatte.
Der Diener und eines der Mädchen wurden sofort nach Devonshire geschickt, um das Haus für die Ankunft ihrer Herrin vorzubereiten. Denn da Mrs. Dashwood Lady Middleton nicht kannte, wollte sie gar nicht erst als Gast auf Barton Park wohnen, sondern lieber gleich in ihr Cottage ziehen. Sie verließ sich so vertrauensvoll auf Sir Johns Beschreibung des Hauses, dass sie kein Verlangen verspürte, es zu besichtigen, bevor sie es als ihr eigenes betrat. Die offenkundige Genugtuung ihrer Schwiegertochter über den bevorstehenden Umzug, eine Genugtuung, die sich hinter der frostigen Aufforderung, ihre Abreise doch noch etwas zu verschieben, nur unzureichend verbarg, trug nicht gerade dazu bei, die Ungeduld zu dämpfen, mit der sie sich aus Norland fortwünschte. Jetzt war der Moment gekommen, da ihr Stiefsohn das dem Vater gegebene Versprechen besonders sinnvoll würde erfüllen können. Da er nichts dergleichen getan hatte, als er auf seinem Besitz eintraf, würde er ihren Abschied aus seinem Haus nun gewiss als den rechten Zeitpunkt betrachten. Doch bald ließ Mrs. Dashwood alle Hoffnung fahren; sie erkannte an seinen Äußerungen, dass seine Hilfe niemals mehr umfassen würde als die sechs Monate Beherbergung auf Norland. Er sprach so oft von den steigenden Kosten der Haushaltsführung und den ständigen, übermäßigen Anforderungen an den Geldbeutel, denen ein vornehmer Mann in dieser Welt ausgesetzt sei, dass der Eindruck entstand, eher brauche er selbst Geld, als dass er welches zu verschenken habe.
Wenige Wochen nachdem Sir John Middletons erster Brief auf Norland eingetroffen war, war in ihrem künftigen Heim alles so weit geregelt, dass Mrs. Dashwood und ihre Töchter sich auf die Reise machen konnten.
Sie vergossen viele Tränen beim Abschied aus ihrem geliebten Heim. «Liebes, liebes Norland!», sagte Marianne, als sie am letzten Abend allein vor dem Haus spazieren ging. «Wann werde ich aufhören, um dich zu trauern, wann werde ich lernen, mich woanders zu Hause zu fühlen? Ach, du glückliches Haus, wenn du wüsstest, wie es mich schmerzt, dich von dieser Stelle aus anzuschauen, von der ich dich vielleicht nie mehr anschauen kann. Und ihr, ihr altbekannten Bäume! – Aber ihr werdet dieselben bleiben. Kein Blatt wird welken, weil wir fortziehen, kein Zweig absterben, weil wir ihn nicht mehr betrachten. Nein, ihr werdet dieselben bleiben, werdet von der Freude oder dem Kummer, die ihr verursacht, nichts ahnen und nicht spüren, dass nun andere in eurem Schatten wandeln. Aber wer wird sich noch an euch freuen?»
KAPITEL 6
Der erste Teil der Reise verlief in tief schwermütiger Stimmung, was zwangsläufig zu Langeweile und Freudlosigkeit führte. Erst als sie sich ihrem Ziel näherten, wich ihre Trübsal der Neugier auf die Landschaft, in der sie künftig leben würden, und bereits ihr erster Blick auf Barton Valley stimmte sie fröhlich. Es war ein freundlicher, fruchtbarer Erdenfleck mit Waldstücken und üppigen Weiden. Mehr als eine Meile schlängelte sich das Tal dahin, dann gelangten sie an ihr Haus. An der Vorderseite gehörte lediglich eine kleine Grünfläche zu ihrem Grund, und diese betraten sie nun durch ein hübsches Gartentörchen.
Als Wohnhaus genommen, war Barton Cottage zwar klein, aber bequem und kompakt, als Cottage hingegen ließ es zu wünschen übrig, denn es war symmetrisch gebaut und mit Ziegeln gedeckt, die Fensterläden waren mitnichten grün gestrichen und die Wände nicht mit Geißblatt bewachsen.3 Ein schmaler Flur führte geradewegs durchs Haus in den Garten dahinter. Zu beiden Seiten des Eingangs lagen die Wohnzimmer, jeweils etwa sechzehn Fuß im Quadrat, dann folgten die Wirtschaftsräume und die Treppe. Außerdem gab es im Haus noch vier Schlafzimmer und zwei Dachstuben. Es war erst vor einigen Jahren erbaut worden und befand sich in gutem Zustand. Verglichen mit Norland war es armselig und klein, und doch trockneten die Tränen rasch, die ihnen die Erinnerung beim Eintreten entlockte. Die Dienstboten freuten sich über ihre Ankunft, das heiterte sie auf, und jede der Frauen beschloss, um der anderen willen so zu tun, als sei sie glücklich. Es war Anfang September, eine schöne Jahreszeit, und da sie den ersten Eindruck vom Haus bei gutem Wetter empfingen, präsentierte es sich vorteilhaft, und das half ihnen bei der Vorstellung, es auch auf Dauer schätzen zu können.
Das Gebäude war gut gelegen. Unmittelbar hinter ihm sowie seitlich in mäßiger Entfernung stieg das Land bergig an, zu teils offenen und grasbewachsenen, teils bewirtschafteten und bewaldeten Hügeln. Auf einem solchen Hügel zog sich auch das Dorf Barton entlang, ein hübscher Anblick, wenn man aus den Cottagefenstern sah. Nach vorn hatte man eine noch bessere Aussicht: über das ganze Tal und auch in das Gebiet jenseits davon. Die Hügel, die das Cottage umgaben, riegelten das Tal in dieser Richtung ab; zwischen den beiden steilsten führte ein Weg weiter, doch hatte dieses Seitental einen anderen Namen.
Mit der Größe und Möblierung des Hauses war Mrs. Dashwood weitgehend zufrieden; ihr früherer Lebensstil machte zwar viele Ergänzungen unumgänglich, aber zu ergänzen und zu verbessern war ihr ein Vergnügen, und sie hatte momentan genug Geld, um hinzuzufügen, was den Zimmern an Eleganz fehlte. «Das Haus ist natürlich zu klein für unsere Familie», sagte sie, «aber fürs Erste werden wir es uns schon einigermaßen bequem machen, jetzt ist es für Veränderungen zu spät im Jahr. Bis zum Frühling habe ich sicher viel Geld gespart, dann können wir vielleicht über einen Umbau nachdenken. Die beiden Wohnstuben sind zu eng für den Freundeskreis, den ich hier häufig zu sehen hoffe. Ich trage mich mit dem Gedanken, die eine um den Flur sowie einen Teil der zweiten zu erweitern und den Rest der zweiten zum Eingangsbereich zu machen. Zusammen mit einem neuen Salon, der sich leicht anbauen lässt, einem Schlafzimmer darüber und einer Dachkammer ergibt das ein sehr gemütliches Landhäuschen. Ich wünschte nur, die Treppen wären bequemer. Aber man kann nicht alles haben – obwohl es vermutlich nicht schwer wäre, sie zu verbreitern. Wir werden sehen, wie viel ich im Frühling beiseitegelegt habe, und unsere Verbesserungen dementsprechend planen.»
Bis dahin, bis sich all diese Änderungen von den Rücklagen aus jährlich fünfhundert Pfund, gespart von einer Frau, die nie im Leben hatte sparen müssen, verwirklichen ließen, waren sie klug genug, sich mit dem Haus zufriedenzugeben, so wie es jetzt war. Jede begann eifrig mit dem Einrichten und bemühte sich, mit Büchern und anderen Habseligkeiten ein Zuhause zu schaffen. Mariannes Klavier wurde ausgepackt und an einen passenden Platz geschoben, und Elinors Zeichnungen kamen an die Wohnzimmerwände.
Tags darauf wurden sie bei diesen Tätigkeiten gleich nach dem Frühstück durch die Ankunft ihres Vermieters unterbrochen; er schaute kurz vorbei, um sie in Barton willkommen zu heißen und ihnen aus seinem eigenen Haus und Garten anzubieten, was in dem ihren zurzeit noch fehlen mochte. Sir John Middleton war ein gut aussehender Mann um die vierzig. Er hatte sie früher einmal in Stanhill besucht, aber das war zu lange her, als dass seine jungen Verwandten sich noch an ihn hätten erinnern können. Er hatte eine heitere Ausstrahlung, und sein Benehmen war so liebenswürdig wie der Stil seiner Briefe. Ihre Ankunft schien ihn wirklich zu erfreuen, ihr Behagen ihm wirklich ein Anliegen zu sein. Er sprach viel darüber, wie aufrichtig er sich einen geselligen Umgang der beiden Familien wünsche, und lud sie derart herzlich ein, so lange jeden Tag bei ihnen auf Barton Park zu speisen, bis sie sich besser eingerichtet hätten, dass sie ihm sein hartnäckiges, fast schon unhöfliches Drängen nicht übelnehmen konnten. Seine Freundlichkeit beschränkte sich nicht auf Worte. Keine Stunde nachdem er sie verlassen hatte, traf ein großer Korb mit Gemüse und Obst aus dem Garten von Barton Park ein, noch vor Tagesabschluss gefolgt von einer Wildbretspende. Zudem bestand er darauf, all ihre Briefe von der Post abzuholen und dort hinzubringen, und ließ es sich nicht nehmen, ihnen täglich seine Zeitung zu schicken.
Lady Middleton hatte ihm ein überaus höfliches Billett mitgegeben, des Inhalts, sie gedenke Mrs. Dashwood ihre Aufwartung zu machen, sobald sie sicher sein könne, dass ihr Besuch keine Störung darstelle, und da die Dashwoods diese Nachricht mit einer ebenso höflichen Einladung beantworteten, machten sie am nächsten Tag Bekanntschaft mit Lady Middleton.
Sie waren natürlich sehr neugierig auf diesen Menschen, von dem ihr Wohlergehen in Barton in hohem Maße abhing, und Lady Middletons elegante Erscheinung entsprach ganz dem, was sie sich versprochen hatten. Sie war nicht älter als sechs- oder siebenundzwanzig, ihr Gesicht war hübsch, ihre Gestalt hochgewachsen und beeindruckend und ihr Benehmen würdevoll. Ihre Manieren zeugten von all der Vornehmheit, die ihrem Mann fehlte. Allerdings hätte ihr ein wenig von seiner Offenheit und Warmherzigkeit gutgetan, und der Besuch dauerte lang genug, um die anfängliche Bewunderung ein wenig zu dämpfen, denn es zeigte sich, dass sie zwar wohlerzogen war, aber zurückhaltend und kühl und außer platten Fragen oder Bemerkungen von sich aus nichts zu sagen wusste.
Die Unterhaltung kam dennoch nie zum Erliegen, denn Sir John war äußerst gesprächig, und Lady Middleton hatte in weiser Voraussicht ihr ältestes Kind mitgebracht, einen hübschen kleinen Jungen von etwa sechs Jahren, wodurch sich ein Thema ergab, auf das man im Notfall immer wieder zurückgreifen konnte, schließlich mussten sich die Damen nach seinem Namen und Alter erkundigen, seine Schönheit bewundern und ihm Fragen stellen, die seine Mutter für ihn beantwortete, während er mit gesenktem Kopf neben ihr stand, natürlich zum großen Erstaunen der Lady, die sich über seine Schüchternheit in Gesellschaft wunderte, da er zu Hause ordentlich lärmen konnte. Überhaupt sollte bei jedem Höflichkeitsbesuch ein Kind mit von der Partie sein, denn es versorgt die Anwesenden mit Gesprächsstoff. Im vorliegenden Fall brauchte man allein zehn Minuten, um herauszufinden, ob der Junge mehr seinem Vater oder seiner Mutter glich und worin im Besonderen er jeweils dem einen oder der anderen glich, denn natürlich war jeder anderer Ansicht und jeder wunderte sich über die Meinung der Übrigen.
Bald sollte sich für die Dashwoods auch die Gelegenheit bieten, über alle weiteren Kinder zu diskutieren, denn Sir John wollte das Haus nicht verlassen, ohne die Zusage erhalten zu haben, dass sie morgen nach Barton Park zum Dinner kommen würden.
KAPITEL 7
Barton Park lag etwa eine halbe Meile vom Cottage entfernt. Die Damen waren auf ihrer Fahrt durch das Tal in der Nähe vorbeigekommen, aber vom Cottage aus war es ihren Blicken durch einen Hügelvorsprung verborgen. Das Haus war groß und schön, und die Middletons führten ein ebenso gastfreies wie vornehmes Leben. Ersteres diente der Befriedigung von Sir John, Letzteres der Befriedigung seiner Gattin. Fast immer beherbergten sie Gäste, und sie verkehrten mit mehr Leuten als jede andere Familie in der Nachbarschaft. Dies war nötig für ihrer beider Glück, denn wie unterschiedlich sie in Naturell und Auftreten auch sein mochten, so glichen sie einander doch sehr in ihrem vollständigen Mangel an Talent und künstlerischem Geschmack, wodurch sich ihre Tätigkeiten, sofern sie nicht gesellschaftlich bedingt waren, auf einen sehr engen Bereich beschränkten. Sir John war Jäger, Lady Middleton Mutter. Er schoss das Wild, sie hätschelte die Kinder, darin bestand ihre ganze Unterhaltung. Lady Middleton war insofern im Vorteil, als sie ihre Kinder das ganze Jahr über verwöhnen konnte, während Sir Johns Liebhaberei ihm nur die Hälfte dieser Zeit zur Verfügung stand. Ständige Einladungen bei ihnen zu Hause und anderswo entschädigten jedoch für alle Unzulänglichkeiten hinsichtlich Gemütsart und Benehmen, retteten die gute Laune von Sir John und verschafften der guten Erziehung seiner Frau ein Betätigungsfeld.
Lady Middleton bildete sich auf ihre kultivierte Tafel und die Einrichtung ihres Hauses einiges ein, und ihre diesbezügliche Eitelkeit war der Hauptgrund für ihre große Freude an Empfängen. Sir Johns Vergnügen an Gesellschaft ging tiefer, er genoss es, mehr junge Leute um sich zu versammeln, als das Haus fasste, und je lauter sie waren, desto besser gefiel es ihm. Er war ein Segen für die Jugend in der Nachbarschaft, denn im Sommer veranstaltete er ständig Picknicks mit kaltem Schinken und Hähnchen, und im Winter gab er so viele Privatbälle, dass selbst die jungen Damen genug bekamen, sofern sie nicht unter dem unersättlichen Appetit von Fünfzehnjährigen litten.
Die Ankunft einer neuen Familie in der Gegend fand er immer erfreulich, und von den Mietern, die er nun für sein Cottage in Barton aufgetrieben hatte, war er in jeder Hinsicht entzückt. Die Misses Dashwood waren jung, hübsch und natürlich. Das genügte, um ihnen seine Wertschätzung zu sichern, denn alles, was ein hübsches Mädchen brauchte, um andere geistig ebenso zu entzücken wie körperlich, war Natürlichkeit. Galant, wie er war, machte es ihn glücklich, wenn er Menschen gefällig sein konnte, deren Lage sich im Vergleich zu früher verschlechtert hatte. Seine Liebenswürdigkeit gegenüber den Verwandten befriedigte den herzensguten Menschen in ihm, und dass er in seinem Cottage eine Familie angesiedelt hatte, die nur aus Frauen bestand, befriedigte den Jäger in ihm, denn dieser schätzt zwar nur solche Geschlechtsgenossen, die ebenfalls Jäger sind, will sie aber nicht innerhalb seines eigenen Reviers wohnen lassen, weil es ihre Jagdlust wecken könnte.
Sir John kam Mrs. Dashwood und ihren Töchtern schon an der Haustür entgegen und hieß sie mit ungekünstelter Herzlichkeit auf Barton Park willkommen. Während er sie in den Salon geleitete, äußerte er den jungen Damen gegenüber dieselbe Sorge, die ihn schon tags zuvor umgetrieben hatte, dass es nämlich bei ihm keine eleganten jungen Männer gebe, mit denen er sie bekannt machen könne. Außer ihm träfen sie hier nur einen einzigen Herrn an, einen engen Freund, der als Gast auf Barton Park weile, aber weder sehr jung noch sehr lebenslustig sei. Sie würden hoffentlich den kleinen Kreis entschuldigen, und er verspreche, so etwas werde nicht wieder vorkommen. Er habe am Vormittag mehrere Familien aufgesucht, in der Hoffnung, die Runde noch erweitern zu können, aber der Mond scheine,4 und alle Welt habe bereits Verabredungen getroffen. Zum Glück sei vor einer Stunde Lady Middletons Mutter auf Barton eingetroffen, und da sie eine sehr heitere, liebenswürdige Frau sei, würden es die jungen Damen am Ende nicht so langweilig finden, wie sie vielleicht befürchteten.
Den jungen Damen wie auch ihrer Mutter genügte es freilich, zusammen mit zwei gänzlich fremden Menschen eingeladen zu sein, sie hatten kein Verlangen nach mehr.
Mrs. Jennings, Lady Middletons Mutter, war eine gut gelaunte, fröhliche, beleibte ältere Frau, die viel redete, völlig unbeschwert und ziemlich gewöhnlich wirkte. Sie hatte jede Menge Scherze parat und lachte viel, und das Dinner war noch nicht vorüber, da witzelte sie schon ausgiebig über Verehrer und Ehemänner. Sie verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, die jungen Damen hätten ihr Herz nicht in Sussex zurückgelassen, und behauptete, sie wären errötet, ob das nun zutraf oder nicht. Marianne ärgerte sich um ihrer Schwester willen und warf Elinor einen Blick zu, um zu sehen, wie sie diese Angriffe aufnahm, doch Mariannes ernste Miene machte Elinor viel mehr zu schaffen als solch platte Scherze wie die von Mrs. Jennings.
Colonel Brandon, Sir Johns Freund, schien, was die Wesensgleichheit anging, ein ebenso wenig passender Freund zu sein wie Lady Middleton eine passende Ehefrau und Mrs. Jennings eine passende Mutter für Lady Middleton. Er war schweigsam und gesetzt. Seine äußere Erscheinung war nicht unangenehm, obwohl er in den Augen von Marianne und Margaret ein typischer Hagestolz war, gewiss schon jenseits der fünfunddreißig. Er sah nicht eigentlich gut aus, aber sein Gesicht verriet Empfindsamkeit, und er benahm sich wie ein vollendeter Gentleman.
Keiner in der Runde hatte etwas an sich, was ihn den Dashwoods als Gefährten empfohlen hätte, aber die kalte Fadheit von Lady Middleton war besonders abstoßend; im Vergleich dazu wirkten der Ernst von Colonel Brandon und sogar die stürmische Heiterkeit Sir Johns und seiner Schwiegermutter noch anziehend. Lady Middleton ließ sich erst zu freudigen Gefühlen hinreißen, als nach dem Dinner ihre vier lärmenden Kinder hereinkamen, sie herumzogen, an ihrer Kleidung zerrten und jedem Gespräch, das sich nicht um sie drehte, ein Ende bereiteten.
Als man am Abend entdeckte, dass Marianne gern musizierte, wurde sie gebeten zu spielen. Das Instrument wurde aufgesperrt, alle waren willens, sich bezaubern zu lassen, und Marianne, die sehr gut sang, arbeitete sich auf Bitten der Zuhörer durch fast alle Notenblätter, die Lady Middleton bei ihrer Eheschließung mit in die Familie gebracht hatte und die seither vermutlich unverrückt auf dem Klavier lagen, denn ihre Ladyschaft hatte dieses Ereignis dadurch gefeiert, dass sie das Musizieren aufgab, obwohl sie nach Aussage ihrer Mutter ungewöhnlich gut und nach ihrer eigenen sehr gern gespielt hatte.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)