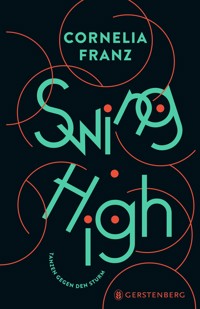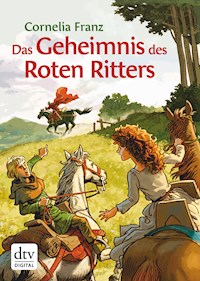6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Jan versucht vor einem Familiengeheimnis aus der Nazi-Zeit wegzulaufen. Doch das gelingt nur bedingt ... Jan, 17, entdeckt auf einer Auktion Gemälde, die früher einmal im Besitz seiner Eltern waren. Wieso hat seine Mutter vor Jahren behauptet, die Bilder seien verbrannt? Und warum wehrt sein Vater alle Fragen ab? Jan beginnt selbst nachzuforschen – und kommt einem Familiengeheimnis auf die Spur, das mit der NS-Zeit zu tun hat. Völlig verstört haut er von zu Hause ab – und trifft unterwegs Sunny, in die er sich verliebt. Aber sein schlechtes Gewissen lässt ihn nicht los. Mehr als nach irgendwas anderem sehnt sich Jan nach einer Welt ohne Lügen und ohne Verrat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Cornelia Franz
Verrat
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2011© 2000Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, StuttgarteBook ISBN 978-3-423-41227-8 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-78153-4Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
[Informationen zum Buch]
[Informationen zur Autorin]
1
Lieber Judas,
es war gar nicht so einfach, deine Adresse herauszufinden. Aber ich hab’s geschafft! Siehst du, manchmal krieg ich auch was Vernünftiges auf die Reihe . . .
Was machst du gerade? Ich sitze im Moment in einem Straßencafé. Es nieselt und das Meer ist ganz grau. Aber es ist trotzdem genauso schön, wie ich’s mir vorgestellt habe. Der kleine Seeräuber, den du mir geschenkt hast, der sitzt vor mir auf dem Tisch. Wir zwei würden dich schrecklich gerne wieder sehen. Aber wahrscheinlich hast du vor uns beiden Reißaus genommen, oder?
Mach’s gut, Judas, vergiss mich nicht.
Deine Sunny
»Sunny, liebe Sunny.« Ich halte die Ansichtskarte mit dem knallroten Sonnenuntergang in den Händen und starre auf die krakeligen runden Buchstaben, bis sie mir vor den Augen verschwimmen. Ach Sunny, keine einzige Minute werde ich vergessen, keinen winzigen kleinen Augenblick. Du bist das Beste, was mir im Leben bisher passiert ist– auch, wenn ich vor dir davongelaufen bin. Aber das liegt an mir, nicht an dir. Ich laufe immer davon, wenn es brenzlig wird. Ich bin eben Judas, der Verräter. Doch das durchschaue ich erst jetzt, wo ich wieder zu Hause bin und Zeit habe, über alles nachzudenken.
Es gibt Erlebnisse, die haben so viel aufgewirbelt, dass sich die Erinnerung erst langsam absetzen muss, bevor man klar sieht. Körnchen für Körnchen sinken die einzelnen Teile tiefer ins Bewusstsein und es dauert eine ganze Weile, bis man begreift, was eigentlich passiert ist.
Sunny und Judas vor dem Eiffelturm. Sunny, mit einem Lederband um die Stirn, damit ihr die langen blonden Haare nicht ins Gesicht fallen, lacht in die Kamera. Judas, mit Bartstoppeln und Sonnenbrand, zieht abweisend die Augenbrauen zusammen, weil er sich nicht von einem dieser herumlungernden Profifotografen knipsen lassen will. Das ist das einzige Bild, das ich von unserer Fahrt mitgebracht habe. Der Fotograf hat es aufgenommen, als wir zu Füßen des Eiffelturms in der Sonne saßen, und Sunny hat ihm dafür unsere letzten zwanzig Francs gegeben. Am Abend haben wir dann im Supermarkt Schokolade, Cola und Hering in Dosen geklaut. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas gestohlen habe– abgesehen von den Kaugummikugeln, die ich als kleiner Junge aus dem Automaten neben dem Bahnhof gerüttelt hab.
Nein, Judas ist kein Dieb. Später, als Sunny anfing den Touristen in der U-Bahn das Portemonnaie aus der Hosentasche zu ziehen, stand er mit klopfendem Herzen abseits und studierte den Pariser Metroplan über den Köpfen der Leute. Judas ist kein Dieb, das Stehlen liegt ihm nicht. Nein, Judas ist ein Verräter.
2
Ich weiß nicht, warum ich »Judas« sagte, als Sunny mich nach meinem Namen fragte. Wir saßen am Rand der Autobahnraststätte nebeneinander und warteten darauf, dass jemand anhielt.
»Stell dich gefälligst ein paar Meter weiter weg, du versaust mir die Tour mit deiner muffeligen Miene und der speckigen Lederjacke«, hatte Sunny mich angemacht. Doch nach einer Viertelstunde kam sie von selbst an, um mich nach einer Zigarette zu fragen.
»Ich bin Sunny«, sagte sie und trollte sich auch dann nicht davon, als ich ihr nichts zu rauchen geben konnte. »Eigentlich heiße ich Sonya-Evelyna. Mit Bindestrich. Das erste und letzte Mal, dass meine Mutter versucht hat originell zu sein.« Sie hockte sich auf ihre bunte Stofftasche und zupfte mich an der Jeans. »Und du?«
Ich sah von oben auf sie hinunter. »Ich? Ich versuche meistens originell zu sein.«
»Scheint ja prima zu klappen.« Sunny lächelte mich an. »Soll ich dich Kaspar nennen?«
Ich setzte mich im Schneidersitz neben sie auf den Asphalt. »Nenn mich Judas«, antwortete ich. »Eigentlich heiße ich Jan-Niklas, mit Bindestrich«, wollte ich hinzufügen. Aber ich ließ es. Vielleicht, weil ich nicht schon wieder originell klingen wollte in den Ohren dieses Mädchens, das es fertig brachte, reichlich cool und gleichzeitig freundlich zu sein. Aber vielleicht auch, weil mir der Name, den mir mein Vater hinterhergeschleudert hatte, als ich das Haus verließ, noch immer in den Ohren klang. Weil ich ihn aussprechen wollte, um ihn noch einmal zu hören. Um zu hören, ob er zu mir passte, ob er richtig war. Richtiger als Jan-Niklas, wie mich meine Eltern nannten, oder Niklas, wie meine Großmutter sagte, oder Jan, wie ich in der Schule hieß.
»Du Judas!« Auch so ein Teilchen, das herumwirbelte, sich noch nicht abgesetzt hatte, langsam, langsam zu Boden taumelte und dabei für trübes Wasser sorgte. Ein Teilchen aus einer anderen Geschichte. Einer Geschichte, die vor über sechzig Jahren angefangen hatte und mit der ich nichts, absolut nichts mehr zu tun haben wollte.
Deshalb stand ich hier an der Autobahnraststätte und wartete auf irgendeinen Wagen, der mich mitnehmen würde.
Das heißt, ich stand nicht, ich saß. Ich saß neben dem Mädchen Sunny.
»Und wo willst du hin, Judas?« Sunny musterte mich, als könnte sie an meiner schwarzen Jeans und meinem kleinen Lederrucksack erkennen, was ich vorhatte. Ihr Blick war ein wenig spöttisch, aber den Namen »Judas« hatte sie ohne Ironie ausgesprochen. Eigentlich klang er ganz akzeptabel, aus ihrem Mund.
Ich zuckte mit den Schultern. »Richtung Süden. Und du?«
»Ich will nach Frankreich.«
»Nach Frankreich? Wohin denn genau?«
Jetzt zuckte Sunny mit den Schultern.
»Weiß nicht. Paris . . .«
»Und warum?«
»Weil ich da noch nicht gewesen bin.« Sunny strich sich eine ihrer langen Haarsträhnen aus dem Gesicht. Eine Weile schwiegen wir und sahen den Autos zu, die an uns vorbeirollten. Kurz bevor sie auf unserer Höhe waren, schienen die meisten Fahrer noch einmal extra Gas zu geben, so dass uns ab und zu ein wegspritzendes Kiesstückchen traf. Sunny hatte den ausgestreckten Arm auf den Knien abgestützt und ließ ihren Daumen unaufhörlich von links nach rechts pendeln.
»So wird das nie was.« Ich stand auf. Der nächste Wagen, der vom Parkplatz kam, sah ganz viel versprechend aus. Ein VW-Bus mit fünf, sechs Leuten, die meisten in meinem Alter. Ich wedelte mit den Armen und lächelte dem Typen am Steuer auffordernd zu.
Er kurbelte das Fenster herunter und lehnte sich hinaus. »Verpiss dich und geh arbeiten!«, brüllte er mich an. Der Bus machte einen Schlenker auf mich zu, so dass der Hinterreifen knapp an meinen Turnschuhen vorbeischrammte.
Ich blieb stehen ohne zu reagieren. Langsam ließ ich die Arme sinken und sah dem schlingernden Bus nach. Sunny war aufgesprungen und schleuderte einen Kieselstein in die Richtung, in die der Bus davonknatterte. »Du Wichser!«, schrie sie und rannte ein paar Schritte hinter dem Wagen her. Dann kehrte sie um und sah mich an, wie ich die Arme vor der Brust verschränkte.
»Bleibst du immer so cool, wenn dir einer auf die Füße tritt?«, fragte sie und dabei klang sie so verärgert, als hätte ich sie beleidigt.
Ich presste die Lippen zusammen und antwortete nicht. Mit großen Schritten stakste ich zu den Toiletten hinüber. Im Waschraum ließ ich mir kaltes Wasser in die Hände laufen und tauchte mein Gesicht hinein. Ich fühlte mich klebrig und verschwitzt.
Was geht dich das an?, dachte ich. Was geht das irgendeinen Menschen an? Lass mich bloß in Ruhe, Sunny.
Als ich aus dem Waschraum kam, sah ich das Mädchen nicht mehr. »Umso besser«, murmelte ich. »Allein kommt man eh schneller weg.«
Den mausgrauen Mercedes mit getönten Scheiben, der ein paar Meter entfernt mit laufendem Motor dastand, beachtete ich nicht weiter. Solche Typen nehmen einen sowieso nicht mit. Doch dann wurde auf der Beifahrerseite das Fenster runtergelassen und ein magerer braun gebrannter Arm herausgestreckt.
»Na komm schon, Judas«, hörte ich Sunnys Stimme. »Oder willst du hier Wurzeln schlagen?«
Ich lief auf den Wagen zu, setzte mich zu dem fremden Mädchen auf die Rückbank und wir fuhren davon.
3
National Gallery, Tate Gallery und zum Schluss auch noch dieses verstaubte Auktionshaus in Soho. Und natürlich hatte es in London seit Tagen von morgens bis abends geregnet. Die ganze Klasse hockte mit feuchten Jacken und ausdruckslosen Gesichtern auf den Holzstühlen des Auktionshauses und ließ das Geschehen an sich vorbeiziehen. Der Auktionator verbreitete mit seinem vornehm näselnden Oxford-Englisch die reinste Beerdigungsatmosphäre. Jan warf einen Blick auf die Liste der zu versteigernden Objekte und seufzte. Noch vier Bilder, aus der Reinfeld-Sammlung, wie es in der Ankündigung hieß. Das würde bestimmt eine Ewigkeit dauern.
Klar, er mochte Bilder, vor allem die expressionistischen mit den knallbunten Farben. Aber sie wurden nun schon seit Tagen von Museum zu Museum, von Galerie zu Galerie gescheucht. Da wurde auch der Gutmütigste langsam müde. Jan drehte sich zu Oliver um, der zwei Reihen hinter ihm saß, und machte ihm ein Zeichen. Es musste doch möglich sein, sich zwischendurch mal für eine Kaffeepause zu verdrücken.
»Pass bloß auf, Jan. Eine falsche Bewegung und du verlässt den Laden mit einem von diesen Schinken unter dem Arm. Und zwar um fünfzigtausend Mark ärmer.« Charlotte, die neben ihm saß, hielt seinen Arm fest.
»Kann er sich doch leisten, unser Krösus. Zahlt er doch von seinem Taschengeld.« Das war Sebastian. Natürlich konnte der sich die Anspielung auf Jans wohlhabendes Elternhaus mal wieder nicht verkneifen.
Jan tat so, als hätte er nichts gehört und sah nach vorne, wo gerade eines der Gemälde gezeigt wurde. Das Ringen hieß es, Mindestgebot vierzigtausend Mark. Charlotte hatte gar nicht so daneben gelegen. Das Ringen in Blutrot, ein Pferd, strauchelnd, vielleicht auf dem Schlachtfeld. Jan schaute nicht so genau hin. Es waren einfach zu viele Bilder gewesen in den letzten Tagen, zu viele Eindrücke. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, streckte die Beine aus und schloss die Augen. Drei, vier Atemzüge, und die Stimme des Auktionators rutschte in weite Ferne. Für welche Summe das blutrote Ringen schließlich verkauft wurde, hörte Jan schon nicht mehr. Das Nächste, was er von der Versteigerung und dem gedämpften Gemurmel ringsherum mitbekam, war die Ankündigung der Aquarelle Existenz eins, zwei und drei.
Existenz, das erinnerte ihn an irgendwas. Vielleicht waren die Worte des Auktionators deshalb zu ihm durchgedrungen. Der Existenz-Zyklus. In Jans Bewusstsein schoben sich verworrene Bilder von Großstadtszenen in verwaschenem Grau, blassen Rottönen und Schwefelgelb. Menschen auf der Straße, ein Verkehrsunfall, zwei Huren auf einem schmutzigen Laken. Szenen, die er als Kind immer wieder zu Hause im Esszimmer studiert hatte. Existenz stand unter jedem dieser Werke und eine Jahreszahl, an die er sich nicht mehr erinnern konnte. Jan mochte die Bilder, aber eines Tages hing stattdessen eine abstrakte Geige in Öl an der Wand, die er langweilig fand. »Der Existenz-Zyklus«, hatte seine Mutter gemeint, »das waren doch nur billige Reproduktionen«, und er hatte sich das Wort von ihr erklären lassen.
»Nicht schlecht, die beiden Mädels, aber das Bettzeug könnten sie mal wieder waschen.« Sebastians Bemerkung löste allgemeines Gekicher aus.
Jan öffnete die Augen. Sein Blick fiel auf die Staffelei, neben der der Auktionator stand. Und plötzlich war er hellwach. Natürlich, das waren sie, die beiden Frauen, die jahrelang seine Fantasie auf eine Weise beflügelt hatten, die seinen Eltern bestimmt nicht recht gewesen war. Er war sich sicher gewesen, dass seine Mutter nicht ohne Hintergedanken auf die harmlosen braun-grünen Quadrate und Kreise verfallen war.
Jan setzte sich auf. Ja, das war die Szene im Bordell und daneben der Verkehrsunfall, die Menschen auf der Straße. Die Gesichter eindringlicher, die Farben kräftiger, als er sie in Erinnerung hatte.
»Billige Reproduktionen«, hörte er seine Mutter sagen. »Die Originale waren viel, viel schöner. Die Farben haben richtig geleuchtet.«
»Hast du sie mal im Museum gesehen?«, hatte Jan gefragt. Er wusste, dass sich seine Mutter für moderne Malerei begeisterte. Zumindest solange man noch in etwa erkennen konnte, um was es ging. In jedem Urlaub schleppte sie die Familie in mindestens drei Kunstmuseen und manchmal schaffte sie es sogar, Jan mit ihrer Begeisterung anzustecken.
Seine Mutter hatte plötzlich richtig wehmütig ausgesehen. »Sie haben bei deinen Großeltern im Wohnzimmer gehangen. Als dein Vater mich das erste Mal zum Abendessen zu sich nach Hause einlud, hat mich das sehr beeindruckt.«
»Und wo sind sie jetzt, die Originale?«, hatte er gefragt.
»Die gibt es nicht mehr.«
»Warum nicht?«
»Sie sind verbrannt.«
Ja, das war die Antwort seiner Mutter gewesen. Jan versuchte das Gespräch zu rekonstruieren. Er hatte doch bestimmt nachgehakt. Wann waren die Bilder verbrannt und warum? Doch er erinnerte sich nicht mehr. Vielleicht hatte seine Mutter das Thema gewechselt. Das tat sie oft, wenn ihr Jan und seine Fragen zu viel wurden. Irgendwann hatte er die Bilder vergessen. Das heißt, er hatte sie nicht vergessen. Die Erinnerung an sie war hinabgesunken in die Tiefen seines Bewusstseins, war überlagert worden von anderen Bildern, Eindrücken, Erlebnissen.
Als Kind hatte er sich nicht für den Namen des Malers interessiert, aber jetzt schaute er sich noch einmal die Liste an, die auf seinem Schoß lag. »Werner Behrmann, 1901–1947«, murmelte er vor sich hin.
»Hey, scheint ja fast, als wärst du scharf auf das Bild mit den Weibern. Willst du’s dir übers Bett hängen oder soll es ’ne reine Kapitalanlage sein?« Sebastian hatte gemerkt, dass Jan seine Schläfrigkeit schlagartig überwunden hatte.
»Pfff.« Jan ersparte sich die Antwort. Von Sebastian kam selten etwas anderes als zweideutige Bemerkungen oder dumme Sprüche über die Höhe von Jans Taschengeld.
Aber für einen Moment juckte es ihn tatsächlich in den Fingern, dem Auktionator ein Zeichen zu geben. Wie seine Eltern wohl schauen würden, wenn er mit den Aquarellen im Koffer von der Klassenreise zurückkehren würde? Wenn er die Bilder, von denen sie glaubten, sie wären verbrannt, plötzlich hervorzaubern könnte? Schade, dass er nicht der Krösus war, für den Sebastian ihn hielt– aber er freute sich schon auf ihre Gesichter, wenn er ihnen von der Auktion erzählen würde.
4
»Deine Freundin ist müde«, sagte der Mann am Steuer. Seit einer halben Stunde sah ich von ihm nichts anderes als den ausrasierten Nacken und den kurz geschorenen Haarkranz um die Halbglatze herum. Er war Handlungsreisender in Sachen Herrenmodenaccessoires, wie er mir erzählt hatte. Der Passat Kombi, in den wir kurz hinter Kassel eingestiegen waren, war voll gestopft mit Schlipsen und Ledergürteln und solchen Sachen.
»Ja, scheint so«, antwortete ich.
»Ihr seid wohl schon lange unterwegs?«
»Noch nicht so lang.« Wieder brachte ich keinen anständigen Satz heraus, obwohl ich wusste, dass die meisten Menschen Tramper mitnehmen, um Unterhaltung zu haben. Aber ich fühlte mich leer und erschöpft und hätte am liebsten geschlafen, so wie Sunny.
Sunny lag in ihrer Ecke auf der Rückbank zwischen Plastiktüten und Reisetaschen und hatte den Kopf an die Scheibe gelehnt. Sie schlief, aber sie sah nicht friedlich und entspannt aus. Ab und zu zuckte es in ihrem Gesicht und ihre Lippen bewegten sich.
»Von wo kommt ihr denn? Seid ihr aus Hamburg? Und wo soll’s hingehen? Sind denn schon Ferien?« Der Mann ließ nicht locker und so riss ich mich zusammen und tischte ihm eine Geschichte von der Verlobung meines besten Freundes in Paris auf, zu der wir eingeladen waren.
». . . und Zugfahren ist ja so teuer und man lernt beim Trampen immer interessante Menschen kennen . . .« Ich plapperte so vor mich hin und hörte mir selbst kaum zu. Schließlich habe ich es gelernt, höflich zu sein. In unserer Familie lernt man Konversation zu machen, bevor man das Wort überhaupt aussprechen kann. (»Jan-Niklas, sitz doch nicht so stumm da, erzähl unserem Gast von deinem Hockeyturnier, erzähl von dem Sommercamp in der Provence, erzähl von deiner Arbeit bei der Schülerzeitung und deinen Plänen nach dem Abi . . .« Ja, Jan-Niklas, zeig ihm, was für ein toller Typ du bist und wie wahnsinnig sympathisch wir alle sind.)
Ab und zu ging mein Blick vom Nacken des Handlungsreisenden hinüber zu Sunny. Jetzt, wo sie schlief, sah ich sie zum ersten Mal richtig an. Ihre langen Wimpern und ihre Augenbrauen waren genau so hellblond wie ihre Haare. Die Nase war übersät mit feinen Sommersprossen, die man nur erkennen konnte, wenn man genau hinschaute. Aber ich scheute mich davor, sie allzu sehr anzustarren. Sie wirkte so schutzlos und gleichzeitig unantastbar.
Merkwürdig, ich glaube, ich hatte bis dahin außer meinen Eltern noch niemanden schlafen gesehen. Auf Klassenreisen oder wenn ich mal bei Oliver geschlafen habe, war ich immer der Letzte, der wach wurde. Aber früher, als ich klein war, bin ich manchmal morgens sehr früh aufgewacht. Ich bin dann ins Schlafzimmer meiner Eltern gegangen und habe sie mir angeschaut. Auch damals schien es mir nicht richtig, was ich tat. Wenn ich merkte, dass sie aufwachten, schlich ich mich schnell wieder hinaus, um kurz darauf noch mal ins Zimmer zu kommen. Diesmal laut und lärmend, so dass sie mich ermahnten nicht so einen Krach zu machen. Ich stand dann wartend vor dem Bett und tippte vorsichtig gegen die Federdecke, die sich weiß und frisch gebügelt vor mir auftürmte. Und manchmal durfte ich zu Mutter unter die Bettdecke kriechen.
Sunny schlief, bis wir in Frankfurt ankamen. Als der Wagen hielt, war sie sofort wach und schaute aus dem Fenster.
»Was soll das denn?« Sie griff nach ihrer Stofftasche, als wollte sie sofort aus dem Auto springen. »Wo sind wir denn jetzt gelandet?«
»In Frankfurt«, antwortete ich. »In der Nähe vom Bahnhof.«
»Spinnst du? Er hätte uns auf der Autobahn rauslassen müssen. Wie sollen wir denn hier wieder wegkommen?«
Der Mann mit der Halbglatze drehte sich um. »Tut mir Leid, das hättet ihr euch eher überlegen müssen. Hier ist Endstation, meine Herrschaften. Oder wollt ihr mit ins Parkhaus?«
»Nein, nein, vielen Dank fürs Mitnehmen«, murmelte ich und wenig später standen Sunny und ich auf dem Bahnhofsvorplatz.
»Zum Trampen zu dämlich«, meinte Sunny. Aber ihr Ärger schien schon verraucht zu sein. »Und was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag?«
Ich zeigte auf eine Pizzeria. »Ich lade dich zum Essen ein, als Wiedergutmachung.«
»Essen gehen?« Sunny runzelte die Stirn. »Du schmeißt das Geld ja zum Fenster raus, du Krösus. Wir können uns doch auch was vom Imbiss holen. Oder hat dir Papi so viel zugesteckt?«
Ich nahm meinen Rucksack vom Boden und warf ihn mir über die Schulter. »Okay, vergiss das mit der Pizzeria. Ich hab sowieso keinen Hunger.«
Sunny baute sich vor mir auf und stemmte die Arme in die Seite. »Was ist los, Mimose? Hab ich was Falsches gesagt?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Du hast doch irgendwas?«
»Ich hab überhaupt nichts. Aber du kannst mir einen Gefallen tun. Sag gefälligst nicht mehr Krösus zu mir, ja? Ich hasse diesen Ausdruck, kapiert?«
»Kapiert, kapiert.« Sunny nahm ebenfalls ihre Tasche vom Boden und steuerte auf die Pizzeria zu. »Na, komm schon, Judas«, sagte sie– zum zweiten Mal, seitdem ich sie kannte.
Als ich sie eingeholt hatte, griff sie meinen Arm und hängte sich bei mir ein. Auf den Stufen, die zu der Glastür der Pizzeria führten, senkte sie ein wenig den Kopf, so dass ihr die langen Haare ins Gesicht fielen. »Krösus«, hörte ich sie murmeln, ganz leise, wie ein trotziges Kind, und ich musste grinsen.
5
Jan und Oliver saßen oben in der letzten Reihe des roten Doppeldeckerbusses und ließen sich durch das Londoner Straßengewirr schaukeln. Oliver hatte die langen Beine so gut es ging ausgestreckt und versuchte an Jan vorbei aus dem Fenster zu kucken. »Hier ist jedes zweite Auto ein Taxi«, meinte er. »Die Leute scheinen ja Geld zu haben.«
»Glaub ich nicht«, antwortete Jan. »Die fahren eben Taxi statt sich ein eigenes Auto anzuschaffen. Das ist unterm Strich sicher noch billiger.«
»Stimmt, du kennst dich ja aus bei dem Thema.« Oliver stieß Jan leicht mit dem Ellenbogen in die Seite.
Jan boxte freundschaftlich zurück. Er wusste natürlich, worauf Oliver anspielte. Manchmal, wenn er den Schulbus verpasst hatte und es zu spät war, um noch mit dem Rad zu fahren, kam er mit dem Taxi zur Schule, worauf es jedes Mal großes Gejohle in der Klasse gab. Jan bemühte sich den Spott der anderen an sich abprallen zu lassen. Aber er ärgerte sich trotzdem darüber, wenn die anderen lästerten. Nur von Oliver ließ er sich solche Sprüche gefallen.
»Lass sie doch stänkern, Jan. Wenn ich von meinen Eltern so viel Schotter kriegen würde wie du, käme ich auch nicht auf die Idee, bei Wind und Wetter zehn Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren«, hatte Oliver mal gesagt.
»Kuck mal, Janni, dieses Gewühl da unten. Unglaublich, wie viele Menschen es hier gibt.« Oliver sah begeistert zum Fenster hinaus.
»Fast so wie auf dem Bild vorhin, diese Straßenszene. Hast du zufällig mitbekommen, wer die ersteigert hat?« Jan war in Gedanken immer noch bei der Auktion.
»Nee. Ist mir auch ziemlich egal.«
»Mir nicht, komischerweise«, meinte Jan. Und dann erzählte er Oliver die Geschichte von den Reproduktionen und den angeblich verbrannten Originalen.
»Vielleicht hat deine Mutter sich damals geirrt«, überlegte Oliver.
Jan nickte. »Ja, vielleicht . . . Aber eigentlich irrt sich meine Mutter nie. Denkt sie zumindest.«
»Mütter irren sich nie und Väter haben immer Recht. Das ist nun mal der Lauf der Dinge«, meinte Oliver. »Was glaubst du, warum die Leute Kinder kriegen? Damit sie endlich Chef sind. Mein Vater spielt sich manchmal auf, als wäre er der Papst. Und alles nur, weil er immer noch nicht Abteilungsleiter ist, sondern ein popeliger Angestellter. Und wenn die Leute keine Kinder haben, dann legen sie sich einen Dackel zu. An dem können sie dann rummeckern.«
»Mein Vater ist doch sowieso Chef. Von daher wäre ich ja der reine Luxus. Obwohl . . . als ich geboren wurde, gehörte die Druckerei noch meinem Großvater. Und wahrscheinlich hatte mein Vater da nicht allzu viel zu sagen.«
»Wollen deine Eltern eigentlich immer noch, dass du die Druckerei übernimmst?«
»Klar.«
»Und du?«
»Ich? Ich weiß nicht.« Jan sah zum Fenster, an dem jetzt die Regentropfen hinunterliefen. Als kleine Rinnsale begannen sie oben an der Scheibe ihren Weg, zuerst zögerlich, dann zielstrebiger. Auf halber Strecke vereinigten sie sich mit anderen, wurden breiter, mächtiger, aber ließen sich dennoch durch die Geschwindigkeit des Busses an den hinteren Rand der Scheibe drängen. Jan beobachtete einen der Tropfen, der es fast bis unten geschafft hatte, seine Bahn allein zu ziehen. Erst kurz vor dem Ende wurde er von einem dickeren, schwereren Tropfen eingeholt und geschluckt.