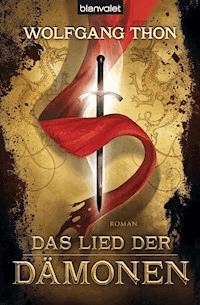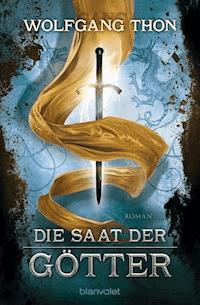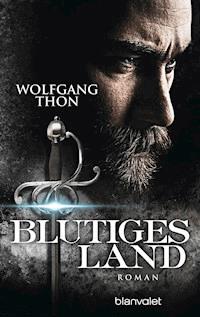5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie wurden als Brüder geboren, doch der Krieg macht sie zu Feinden ...
Eik und Valerian sind Halbbrüder, doch in den Wirren des 30-jährigen Krieges stehen sie auf unterschiedlichen Seiten. Nur in ihrer Liebe zu Augusta – des einen Schwester, des anderen Geliebte – haben sie noch eine Gemeinsamkeit. Aber als Wallenstein erneut den Befehl über ein Heer übernimmt, finden sie in ihm einen Mann, dem sie beide dienen können. Da wird Wallenstein im Moment seines größten Triumphs des Verrats am Kaiser bezichtigt, und jeder der beiden Brüder muss für sich entscheiden, wem seine Treue gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Eik und Valerian sind Halbbrüder, doch in den Wirren des 30-jährigen Krieges stehen sie auf unterschiedlichen Seiten. In der Schlacht von Magdeburg hatten sie sich beinahe gegenseitig umgebracht. Nur in ihrer Liebe zu Augusta – des einen Schwester, des anderen Geliebte – haben sie noch eine Gemeinsamkeit. Doch jetzt ist Augusta von Eik schwanger, und der verwundete Valerian gerät schier außer sich. Aber bevor er irgendetwas Unbedachtes tun kann, befiehlt ihm der Kaiser, nach Prag zu reisen. Dort soll er Wallenstein überzeugen, erneut den Befehl über ein Heer zu übernehmen. Der Feldmarschall ist ein Mann, dem beide Brüder dienen können. Bis zu jenem schicksalshaften Tag, an dem Wallenstein im Moment seines größten Triumphs des Verrats am Kaiser bezichtigt wird. Nun muss jeder der beiden Brüder für sich entscheiden, wem seine Treue gilt …
Autor
Wolfgang Thon wurde am 17. 07. 1954 in Mönchengladbach geboren. Nach dem Abitur studierte er Sprachwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Berlin und Hamburg. Heute ist er als Übersetzer und Autor für verschiedene Verlage tätig. Er ist Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kindern und lebt, schreibt, übersetzt, reitet und tanzt (Argentinischen Tango) in Hamburg.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Wolfgang Thon
Verratene Ehre
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
© Johannes Frick unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (© Improvisor, © n_astya, © Maryna Stamatova, © prapann, © 13Imagery, © Eky Studio)
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-21254-4V001
www.blanvalet.de
Für Margarethe.
TEIL EINS
Der Löwe aus Mitternacht
1. KAPITEL
Wiener Hofburg
Die Absätze von auf Hochglanz polierten Reitstiefeln knallten laut auf dem Marmor der langen Korridore in der prachtvollen Residenz des Kaisers. Das schnelle Stakkato verriet, dass es der Träger dieser Stiefel eilig hatte.
Graf Tuchy näherte sich den hohen Flügeltüren der Ratskammer, vor denen zwei Gardisten der Trabantenleibgarde mit ihren Hellebarden Wache hielten. Er verlangsamte seine Schritte und versuchte, seine Atmung zu kontrollieren. Aber es gelang ihm nicht, sein Keuchen zu unterdrücken.
Die beiden Wachen kannten den Grafen, und als der mit dem zusammengerollten Pergament in seiner linken Hand winkte, trat eine der Wachen vor und öffnete die äußere Flügeltür. Sodann wollte der Soldat in den kleinen Raum treten, um die innere Tür zur Ratskammer für den Grafen aufzumachen, aber der scheuchte den Mann beiseite.
»Schon gut, bleib er auf seinem Posten, Kerl.«
Der Gardist zögerte, zog dann jedoch die Hand zurück, salutierte und trat wieder hinaus.
Tuchy legte seine behandschuhte Rechte auf die vergoldete Klinke, atmete tief durch und warf einen kurzen Blick auf das Pergament in seiner anderen Hand. Der Inhalt dieser Botschaft würde weder seinem Herrn gefallen, dem Kurfürsten Maximilian von Bayern, noch dem Kaiser, aber sie war so brisant, dass er sie ihnen augenblicklich überbringen musste, selbst auf die Gefahr hin, dass er sich wegen dieser Störung den Unmut des Kaisers zuzog.
Tuchy straffte sich und drückte die Klinke nach unten. Die Tür schwang auf, und ihm schlug erregtes Stimmengewirr entgegen.
»… selbst gesagt, Euer Majestät. Niemand konnte damit rechnen, dass …«
»Wir wissen sehr wohl, was wir gesagt haben, verehrter Kurfürst!«, schnitt ihm der Kaiser scharf das Wort ab. »Aus dem einen Feinderl mehr ist Uns ein ernst zu nehmender Gegner erwachsen! Was Wir von Euch wissen wollen, ist, wie Ihr gedenkt, den Schweden aufzuhalten! Wie ich höre, zieht er völlig ungehindert durch den Norden des Reiches, und seine Armee wächst dabei von Tag zu Tag!«
Tuchy blieb in der geöffneten Tür stehen und wartete darauf, dass ihn der Kaiser oder einer der anderen hohen Herrn wahrnahm und hereinbat. Aber weder Maximilian von Bayern noch einer der Kriegsräte, die an dem langen schweren Tisch in der Mitte des Saales saßen, hatten das Öffnen der Tür bemerkt. Alle hatten nur Augen für den Kaiser, der es vor lauter Erregung nicht mehr auf seinem thronartigen Stuhl ausgehalten hatte.
Ferdinand II. stand mit vor dem Bauch verschränkten Händen an dem hohen Fenster des Saales und starrte hinaus auf den Ballhausplatz. Dabei wandte er den Männern am Tisch den Rücken zu.
»Ich bin mir sicher, Euer Majestät, dass ihm unser verehrter Tilly Einhalt gebieten wird, sobald er die Truppen Eurer Majestät und der Liga um sich gesammelt hat …«
»Und wann wird das sein?« Der Kaiser fuhr herum. »Wenn der Schwede in Prag steht?« Er richtete seinen Blick auf Maximilian von Bayern, der mit finsterem Gesicht am Tisch saß und den Kopf gesenkt hatte. »Oder in München? Oder Uns gar hier in Wien einen unerwünschten Besuch abstattet?« Er schüttelte den Kopf. »Und das Letzte, was Wir von Eurem Tilly gehört haben, war seine Bitte um Geld, um zu verhindern, dass ihm seine Söldner weglaufen. Das entspricht wahrhaftig nicht Unserer Vorstellung von einem erfolgreichen Feldherrn!«
Endlich blickte Herzog Maximilian auf. »Euer Majestät, falls Ihr auf diesen Friedländer anspielen solltet, bitte ich Euch, nicht zu vergessen, aus welchem Grund Ihr ihn vom Generalat entbunden habt! Er hat …«
»Ihr habt!«, zischte der Kaiser ergrimmt, »Ihr habt Uns nachdrücklich daran erinnert, dass Wir Eure Stimme brauchten, um Unseren Sohn Erzherzog Ferdinand zum römischen König krönen zu lassen. Und der Preis für Eure Stimme war die Entlassung Wallensteins! Nun, das haben Wir getan!« Ferdinand II. schlug mit der Faust auf den Tisch. »Und wozu hat es geführt? Wozu, frage ich Euch!«
Tuchy hielt unwillkürlich die Luft an. Er hatte noch nie erlebt, dass sich Ferdinand II. so offen gegen Maximilian stellte.
»Majestät«, mischte sich der Beichtvater von Ferdinand ein, der Jesuit Wilhelm Lamormaini. »Es war richtig, Wallenstein abzusetzen. Er hat mit den Protestanten konspiriert und hätte Magdeburg kampflos aufgegeben! Generallieutenant Tilly hat …«
»Erinnert mich nicht an Magdeburg, Pater!« Der Kaiser richtete sich auf, sah seinen Beichtvater an und schüttelte den Kopf. »Der Sieg, den Tilly dort errungen hat, ist Uns weit teurer zu stehen gekommen als Wallensteins unverfrorene Kritik an Unserem Restitutionsedikt! Wallenstein hatte recht, die Protestanten lagen schon am Boden. Nach der Auslöschung von Magdeburg haben sie sich wieder erhoben, und jetzt schließen sie sich in Scharen dem Schweden an! Er hat es sogar gewagt, in Mecklenburg die protestantischen Herzöge wieder einzusetzen, und sogar der Kurfürst von Sachsen hat sich mit Gustav Adolf verbündet!« Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Wir hatten Unsere Dispute mit Wallenstein, aber zumindest hat er die Protestanten und auch die Dänen geschlagen.« Er sah Maximilian an. »Glaubt Ihr wirklich, Kurfürst, dass es Tilly gelingt, den Schweden aufzuhalten?«
Maximilian antwortete nicht sofort, sondern wich dem Blick des Kaisers aus. Dabei bemerkte er Tuchy, der immer noch neben der geöffneten Tür wartete. Seine Miene verfinsterte sich, aber als er das Gesicht des Grafen und das zusammengerollte Pergament in seiner Hand sah, winkte er seinen Berater zu sich.
»Mit Verlaub, Majestät«, sagte er dabei zu Ferdinand. »Vielleicht machen wir uns umsonst Sorgen. Ich glaube, Graf Tuchy hat dringende Nachrichten für uns. Wenn Ihr gestattet, würde ich ihn gern an unseren Tisch bitten, um sie uns mitzuteilen.«
Tuchy verneigte sich tief, als Ferdinand ihn ansah und nickte. »Majestät, Euer Gnaden«, er streifte Maximilian mit einem kurzen Blick, »Edle Herren.« Er ballte die Hände, damit die Anwesenden nicht sahen, wie ihm die Hände zitterten. Dabei zerdrückte er die Pergamentrolle. Als er das bemerkte, erbleichte er.
Ferdinand musterte ihn kühl. Tuchy wusste, dass der Kaiser ihn nicht sonderlich mochte, weil er als Sonderbeauftragter Maximilians von Bayern häufig mit Aufträgen betraut wurde, die Ferdinand suspekt waren. Und meist zu Recht. Aber falls der Kaiser glaubte, dass Tuchy seinetwegen blass geworden war, irrte er.
Maximilian dagegen kannte seinen Vertrauten gut genug, um zu ahnen, dass die Nachricht, die er brachte, alles andere als erfreulich war. Und das war noch gelinde ausgedrückt.
»Ich habe Nachricht von Generallieutenant Tilly. Er hat sich Gustav Adolfs Heer in Werben bei Havelberg entgegengestellt.« Tuchy zögerte einen Herzschlag lang.
»Nun rede Er schon!«, fuhr ihn Ferdinand an. »Hat er den Schweden zurückgeschlagen?« Er trat an den Tisch neben seinen Stuhl und stützte sich mit beiden Händen auf der Platte ab. »Hat er ihn besiegt?«
Tuchy spürte die scharfen Blicke der Anwesenden auf sich ruhen und merkte, wie ihm der Schweiß auf die Stirn trat. »Leider nicht, Majestät. Seinem Schreiben zufolge«, er hob das Pergament und legte es dann auf den Tisch, »musste er sich der Übermacht aus Schweden, Protestanten und Sachsen geschlagen geben.«
Sein Blick zuckte zu Maximilian, dessen Miene sich verfinstert hatte und bei den letzten Worten Anzeichen von Panik hatte erkennen lassen.
Ferdinand stöhnte auf und ließ sich auf seinen Stuhl sinken. »Wir haben schon vor Wochen gesagt, dass es ein Fehler war, Wallenstein zu entlassen!« Sein Blick zuckte zu seinem Beichtvater. »Er hat Uns vor dem Schweden gewarnt. Und wie sich gezeigt hat, war diese Warnung mehr als nur begründet!«
»Majestät, es mag sein, dass der Friedländer recht hatte, aber er hat Euer Restitutionsedikt in aller Öffentlichkeit kritisiert …«, begann Pater Lamormaini, aber Ferdinand hob die Hand und unterbrach ihn.
»Gewiss, das war unerhört und musste bestraft werden. Aber es ändert nichts daran, dass Wir Wallenstein und seine Fähigkeiten als Feldherr benötigen, wenn Wir in diesem Krieg bestehen wollen!« Er biss sich auf die Lippe und sah Maximilian an. »Wir haben ihm bereits vor etlichen Wochen einen Brief geschrieben, in dem Wir ihn ersucht haben, erneut den Oberbefehl über Unsere Truppen zu übernehmen. Ich nehme an, verehrter Kurfürst, Ihr seht mittlerweile ebenfalls die Notwendigkeit eines solchen Vorgehens ein?«
Maximilian warf Tuchy einen fast schon vorwurfsvollen Blick zu, so als wäre er verantwortlich für den Inhalt der Nachricht, die er überbracht hatte. Dann wandte er sich an den Kaiser.
»Darf ich fragen, Majestät, was Wallenstein auf Euer … Ersuchen geantwortet hat?« Die kurze Pause, die der Kurfürst machte, war fast beleidigend, und allen Anwesenden war klar, dass er eigentlich etwas anderes, weniger Schmeichelhaftes hatte sagen wollen.
»Er hat gar nicht geantwortet!«, erwiderte Ferdinand. »Und Wir können nicht umhin festzustellen, dass Wir es ihm auch nicht verdenken können! So, wie die Versammlung der Kurfürsten gegen ihn intrigiert hat, ist es kaum verwunderlich, dass der Herzog zögert.«
Maximilian presste die Lippen aufeinander. »Meine Bedenken gegen Wallenstein haben nach wie vor Bestand, Euer Majestät.« Der Kurfürst und Herzog von Bayern verbeugte sich in Richtung des Kaisers. »Aber ich bin bereit, diese hintanzustellen und mich Eurer Bitte … Eurem Ersuchen«, verbesserte er sich rasch, als er Ferdinands Blick bemerkte, »anzuschließen.« Das letzte Wort presste er förmlich zwischen den Zähnen hervor. Keinem der Anwesenden konnte verborgen geblieben sein, wie viel Überwindung ihn dieses Zugeständnis gekostet hatte. »Allerdings bezweifle ich, dass dies unserer Sache bei einem überheblichen Menschen wie Wallenstein dienlich sein dürfte.«
»Auf jeden Fall müssen Wir es versuchen, wenn Wir nicht wollen, dass sich der Schwede des ganzen Reiches bemächtigt! Nachdem er Tilly geschlagen hat, sehen Wir niemanden sonst, der sich Gustav Adolf entgegenstellen könnte.« Ferdinand nickte. »Ich denke, damit ist alles gesagt. Wir werden sofort eine Nachricht an Wallenstein verfassen und ihn darüber in Kenntnis setzen, dass er sich Unserer Unterstützung und auch der des Geheimen Rates sicher sein kann, sollte er sich bereit erklären, den Oberbefehl wieder zu übernehmen.« Er wartete einen Moment, ob einer der Anwesenden einen Einwand erheben wollte, und nickte erneut, als allgemeines Schweigen antwortete. Dann nahm er die Nachricht von Tilly an sich und schob sie in sein Wams.
»Pater«, wandte er sich an den Jesuiten, »Ihr begleitet mich. Ich will Gottes Beistand für dieses Unterfangen erflehen.« Ohne abzuwarten, bis sich die Kriegsräte und Maximilian von ihren Stühlen erhoben hatten, um ihm ihren Respekt zu erweisen, drehte Ferdinand sich um und verließ mit langen Schritten den Raum.
Tuchy verbeugte sich tief, als Ferdinand an ihm vorbeiging, aber der Kaiser schenkte ihm keinerlei Beachtung. Als er sich wieder aufrichtete, begegnete er dem Blick von Maximilian von Bayern.
In den dunklen Augen des Kurfürsten loderte blanke Wut. Dennoch schwieg er, bis die Kriegsräte und Fürsten das Ratszimmer verlassen hatten und er mit Tuchy allein war.
»Großartig, Graf!«, zischte Maximilian, als sich die Flügeltür hinter Hofkriegsrat von Questenberg schloss, einem glühenden Fürsprecher Wallensteins. »Nicht nur, dass der Kaiser die Macht der Reichsstände immer mehr beschränkt, jetzt muss ich auch noch vor meinem ärgsten Widersacher zu Kreuze kriechen!« Sein Gesicht verzog sich vor Grimm. »Ich will verflucht sein, wenn ich diesen Parvenü anflehe, uns zu helfen! Diesen Triumph gönne ich ihm nicht!« Er schüttelte den Kopf. »Aber wenn Tilly es nicht schafft, den Schweden aufzuhalten, wird mir am Ende nichts anderes übrig bleiben, fürchte ich.« Er sah den Grafen an. »Diese Niederlage hätte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen können!«
Tuchy nickte. »Aber noch ist nicht alles verloren, Euer Gnaden. In seiner Nachricht schreibt Tilly, dass er mit seinen restlichen Truppen gegen Leipzig marschieren und die Pleißenburg einnehmen will. Dann will er dort sein Lager beziehen und weitere Truppen der Liga und der Kaiserlichen an sich ziehen.« Er zuckte mit den Schultern. »Jedenfalls kann Gustav Adolf ihn nicht einfach ignorieren und zulassen, dass Tilly ihm im Rücken steht, während er selbst nach Süden marschiert.«
Maximilian nickte. »Ihr meint, Tilly kann Gustav Adolf zu einer weiteren Schlacht zwingen?«
»Jedenfalls hat er das vor, wie er schreibt.«
»Und wenn er diese Schlacht ebenfalls verliert?« Maximilians Miene verriet auf einmal Furcht. »Der Kaiser hat recht. Wer soll sich ihm dann noch entgegenstellen? Falls Tilly ein weiteres Mal geschlagen wird, liegt Deutschland für den Schweden völlig offen da, schutzlos.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich fürchte, wir können uns der Schmach nicht entziehen, als Bittsteller vor der Schwelle des Friedländers aufzutauchen.«
»Vielleicht doch, Euer Gnaden.«
Maximilian hob ruckartig den Kopf und sah Tuchy scharf an. »Wie meint Ihr das, Graf? Heraus damit!«
»Die Worte Seiner Majestät haben mich auf eine Idee gebracht, Euer Gnaden«, erwiderte der Graf gedehnt. »Ich meine, was er über Mecklenburg gesagt hat.«
Maximilian runzelte die Stirn. »Mecklenburg? Ihr meint, dass Gustav Adolf die beiden Herzöge wieder in ihre angestammten Positionen eingesetzt hat?« Er schnaubte. »Jedenfalls hat er damit weit mehr Fingerspitzengefühl bewiesen als Seine Majestät, als sie diesem Parvenü einfach dieses Herzogtum …« Er unterbrach sich, und seine Augen verengten sich zu Schlitzen. »Ah! Ihr meint …«
Tuchy lächelte. »Ich meine, dass es vielleicht gar nicht nötig ist, den Friedländer anzuflehen, sich an die Spitze unserer Armee gegen Gustav Adolf zu stellen. Ihr könntet ihm stattdessen unsere Armee anbieten, damit er sich dagegen wehren kann, dass ihm der Schwede auch noch seine anderen Besitztümer abnimmt, Friedland zum Beispiel.«
»Ihr seid wahrlich ein gerissener Ratgeber, mein lieber Graf«, erwiderte Maximilian. »Trotzdem, wenn ich ihm einen Brief schreibe, in dem ich ihn bitte zurückzukehren, wäre das nicht unglaubwürdig?« Er lachte bitter. »Schließlich wurde Wallenstein auf mein Betreiben hin seines Amtes enthoben, und er weiß ganz genau, dass ich seinem Machtstreben zutiefst misstraue.«
»Natürlich müssten wir diesen Vorschlag in ein demütiges Ersuchen und vielleicht so etwas wie eine Entschuldigung kleiden, damit er sein Gesicht wahren kann. Immerhin hat er ja offenbar die Unverfrorenheit gehabt, die Bitte Seiner Majestät des Kaisers schlichtweg zu ignorieren.«
»Solange Ihr nicht von mir verlangt, selbst nach Canossa zu reiten und mich vor diesem Emporkömmling zu demütigen, soll mir das recht sein.«
»Nein, Euer Gnaden, selbstverständlich verlange ich das nicht. Wir sollten Euer Ersuchen sowie den Bettelbrief des Kaisers von jemandem überbringen lassen, dem Wallenstein vertraut, damit es ihm schwerfällt, rundheraus abzulehnen.« Tuchy klopfte mit einem Finger gegen sein Kinn und lächelte dann plötzlich. »Und ich weiß auch genau die richtige Person für diese Aufgabe.«
Maximilian hob eine Braue. »Tatsächlich? Kenne ich ihn?«
Tuchy nickte. »Allerdings, Euer Gnaden. Und Ihr werdet mit mir übereinstimmen, dass er für diese Aufgabe geradezu ideal ist.«
2. KAPITEL
Sachsen, Nähe Torgau
»Dort drüben, Herr Rittmeister!«
Valerian hob müde den Kopf und wischte sich mit dem Ärmel seiner Uniform den Schweiß von der Stirn. Dann beugte er sich vor und kniff die Augen zusammen.
Der Kornett seiner kleinen Abteilung Kürassiere deutete mit ausgestrecktem Arm auf eine bewaldete Hügelkuppe, hinter der eine Rauchsäule in den blauen Septemberhimmel emporstieg. »Sieht fast so aus, als würden dort Bauern ihre Stoppeläcker abbrennen.«
Valerian runzelte die Stirn. »Das sind keine Herbstfeuer, nicht so früh im Jahr.« Wenn doch, würde das bedeuten, dass diese Bauern ihre Ernte bereits eingefahren haben. Auf so viel Glück wage ich gar nicht zu hoffen. »Außerdem wäre es dumm von ihnen, ihre Felder abzubrennen. Das würde jeden Plünderer im Umkreis von fünfzig Meilen anziehen.«
Er sah seinen Unteroffizier an. Dessen Miene verriet, dass er ebenfalls nicht so recht an das, was der Kornett vermutet hatte, glauben mochte. Sie waren bereits seit sechs Tagen unterwegs und saßen wie an allen Tagen zuvor seit den frühen Morgenstunden im Sattel. Die Männer waren müde, hungrig und gereizt. Und sind sicherlich auch ziemlich wundgeritten, wenn ich an meinen eigenen Hintern denke, dachte Valerian. Außerdem waren sie sichtlich frustriert, weil ihre Strapazen bislang umsonst gewesen waren. Und es wäre unglaubliches Glück gewesen, wenn ihre Suche nach Nahrungsmitteln für das Regiment ausgerechnet jetzt, auf dem Rückweg zum Lager, Erfolg haben sollte.
Andererseits, etwas Glück käme vielleicht ganz recht. Seit sie in Sachsen lagen, war es immer schwieriger geworden, Proviant für Tillys Heer zu organisieren. Das Land war vollkommen ausgeplündert, zunächst durch die Protestanten, dann durch die Liga und die Kaiserlichen, und jetzt standen auch noch die Schweden im Land. Ich frage mich wirklich, wie lange Tilly die Leute noch bei der Stange halten kann.
Dass der Generallieutenant des Kaisers seine erste größere Schlacht bei Werben am Havelberg gegen Gustav Adolf verloren hatte, trug auch nicht gerade zur Moral der Söldner bei. Tilly und seine Stabsoffiziere wussten natürlich, wie launisch das Kriegsglück war und dass die Söldner je nach Lage der Dinge nicht zögerten, die Seiten zu wechseln, sowohl hüben wie drüben. Wurde der Proviant nun noch knapper und blieb dann auch noch der Sold aus, konnte es schnell zu einer Massenflucht von den Fahnen kommen. Dann hat unser Oberkommandierender ein noch größeres Problem.
Valerian schüttelte den Kopf. Eins nach dem anderen, dachte er. Jetzt geht es erst einmal darum, etwas Essbares aufzutreiben. Und zwar schnell.
Ihre mitgenommenen Vorräte hatten sie bereits vor zwei Tagen aufgebraucht und ernährten sich vorwiegend von Waldfrüchten und dem ein oder anderen Kaninchen. Valerian war klar, dass sich seine Leute zusammenrissen, weil ihr Rittmeister und Kommandierender Offizier mit ihnen ritt. Dennoch, die Stimmung war auf dem Tiefpunkt, und es brauchte nicht viel, um das Pulverfass zur Explosion zu bringen. Glücklicherweise hatten sie bisher keine Gelegenheit gehabt, ihrem Frust und ihrer Wut freien Lauf zu lassen, aber Valerian wusste, dass das nicht so bleiben würde, sollten sie unverrichteter Dinge ins Lager zurückkehren.
»Die Leute und das Land hier haben einfach nichts mehr zu geben, Herr Rittmeister«, hatte sein Fourier Istvan Strellitz erst gestern festgestellt, als sie in eine kleine Siedlung etliche Meilen südlich von Torgau geritten waren. Es war bereits die dritte Siedlung gewesen, auf die sie an diesem Tag gestoßen waren und wo es nichts Lebendes gab außer Ratten und Krähen, die sich an den Leichen gütlich taten. »Außerdem sind die Protestanten offensichtlich mal wieder vor uns da gewesen.« Der Mann hatte angewidert den Kopf geschüttelt und sich ein schmutzig graues Taschentuch vor Nase und Mund gebunden, um den Leichengeruch zumindest ein bisschen erträglicher zu machen.
Die Protestanten oder die Schweden, dachte Valerian jetzt, oder, Gott behüte, unsere eigenen Leute.
Letztere waren ein Grund dafür gewesen, dass sich Valerian kurzerhand und sehr zum Erstaunen seiner Offizierskameraden an die Spitze der Männer gesetzt hatte, die von dem Befehlshaber ihres Kürassierregiments zum Fouragieren ausgeschickt worden waren.
Wenn du ehrlich bist, sagte sich Valerian jetzt, während er den Hut abnahm und sich das feuchte Haar aus der Stirn schob, ist eben dieser Vorgesetzte ein weiterer Grund für deine Entscheidung gewesen. Doch es war nicht der rechte Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Außerdem würde alles Nachdenken nichts an der gegenwärtigen Situation ändern.
Seufzend setzte Valerian den Hut wieder auf, erhob sich in den Steigbügeln seines Pferdes und verzog kurz die Lippen, als seine Gesäß- und Schenkelmuskeln schmerzhaft protestierten. Dann drehte er sich langsam um und musterte die Gesichter seiner Männer. Sie hatten den Rauch ebenfalls gesehen, und die unverhoffte Aussicht auf Beute, Nahrung oder Frauen hatte ihre Lethargie schlagartig vertrieben. Aber der plötzliche Eifer und die Gier auf den Gesichtern der Männer wirkten ebenso nachvollziehbar wie abstoßend auf Valerian.
»Also gut, Kornett«, wies er den Mann an. »Wir sammeln uns und reiten in geschlossener Kolonne, und zwar leise, ohne Gebrüll oder Säbelrasseln! Und ohne Hornsignale!«
Er sah Bogdanow in die Augen, und der Kornett nickte verstehend. Das war eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass diese Feuer keine Herbstfeuer waren und die Leute, die sie entzündet hatten, keine Bauern.
Der Mann wendete sein Pferd, ritt zu den drei Korporalen ihrer Abteilung zurück und gab den Befehl des Rittmeisters weiter.
Valerian sah zu, wie sich die Männer formierten, und als alle bereit waren, gab er das Zeichen zum Vorrücken.
Nach ihrer ersten Begegnung mit Marodeuren oder vielmehr dem, was diese Bestien zurückgelassen hatten, war er froh gewesen, dass er sich entschieden hatte, mit seiner Abteilung zu reiten.
Es war entsetzlich gewesen, und die Bilder davon hatten ihn noch lange verfolgt. All die zerstörten Hütten, die aufgedunsenen Leichen von Frauen und Kindern, Alten und Gebrechlichen, die vor den niedergebrannten Häusern auf den Straßen lagen, da, wo sie auch gestorben waren … Offenbar hatte es niemanden gegeben, der ihnen ein christliches Begräbnis hätte geben oder sie wenigstens hatte verscharren können oder wollen. Ein Blick auf die Leichen hatte genügt, um sich vorzustellen, was die Söldner mit ihren wehrlosen Opfern angestellt hatten. Solche Gräueltaten würde er bei seinen Männern auf keinen Fall dulden. Jedenfalls nicht, wenn er es verhindern konnte.
Sie ritten über eine freie Weide auf ein Waldstück zu; es säumte den Fuß des sanft ansteigenden Hügels, hinter dem der Rauch aufstieg. Die Fichten und Tannen des Nadelgehölzes standen weit genug auseinander, dass sie mit ihren Pferden mühelos hindurchreiten konnten. Der von Nadeln übersäte Waldboden dämpfte zudem die Schläge der Hufe. Daher würde, wer auch immer auf der anderen Seite der Kuppe warten mochte, sie erst hören, wenn es zu spät war.
Plötzlich verhielt der Kornett sein Pferd und hob die Hand. Valerian tat es ihm gleich, und binnen Kurzem kam die gesamte Abteilung, etwa vierzig Mann, zum Stehen. Einige Pferde schnaubten leise, aber die Geräusche, die über den Hügelkamm zu ihnen herunterdrangen, waren trotzdem nicht zu überhören.
Valerian und Bogdanow warfen sich einen kurzen Blick zu. Worte waren überflüssig.
Es waren Schreie, schrille, spitze Schreie, und dazwischen Gebrüll und Gelächter aus männlichen Kehlen.
Plünderer. Und ihre Opfer. Valerian drehte sich zu seinen Männern herum, die ihn ohne Ausnahme ansahen.
»Arkebusen und Partisanen fertig machen! Wir teilen uns auf! Der Kornett übernimmt eine Gruppe und reitet von rechts heran, die anderen folgen mir. Auf der Kuppe verhaltet ihr und wartet auf meinen ausdrücklichen Befehl zum Angriff, verstanden?«
Einige Söldner nickten kurz, während sie ihre Waffen bereit machten. Die Gier auf den Gesichtern der Männer war der Erregung vor einem bevorstehenden Kampf gewichen, und bei einigen zeichnete sich auch Furcht ab.
Er wartete, bis alle bereit zu sein schienen, dann ließ er sich wieder in den Sattel sinken, blickte nach vorn und trieb sein Pferd an.
»Halt!« Valerian hob die Hand, als er die Hügelkuppe erreicht hatte, und seine Abteilung kam in einer lang gezogenen Reihe hinter ihm zum Stehen. Er machte sich nicht die Mühe, seine Stimme zu dämpfen, denn dazu gab es keinen Grund. Außerdem hätten seine Männer ihn ansonsten bei dem Gebrüll der Söldner und den Schreien der Gequälten oder Sterbenden nicht gehört.
Ebenso wenig schien es nötig zu sein, sich zu verstecken oder heimlich zu nähern. Denn dort unten in dem Dorf hatte keiner einen Blick für irgendwelche Reiter, die aus dem Wald kamen. Selbst wenn jemand die Reiter durch den Rauch, der aus den brennenden Hütten quoll, hätte sehen können. Die Menschen, die sich dort unten anbrüllten, anflehten oder miteinander kämpften, waren vollkommen damit beschäftigt, entweder ihr eigenes Leben zu retten oder es jemand anders zu nehmen, je nachdem.
Und wie es aussieht, gewinnen Letztere gerade die Oberhand!
Valerian konnte vom Hügel aus nicht erkennen, um was für Söldner es sich handelte, aber das spielte auch keine Rolle. Denn er sah sehr genau, was dieses menschliche Vieh dort unten veranstaltete. Wahrscheinlich wäre sein Entsetzen noch größer gewesen, hätte er solche Bilder in den letzten sechs Tagen nicht schon mehrfach zu Gesicht bekommen. Möglicherweise handelt es sich sogar um dieselben Plünderer, dachte Valerian und biss die Zähne zusammen. Aber wenigstens damit ist jetzt Schluss.
Er drehte sich zu Korporal Strellitz um. »Istvan, wir reiten in einer lang gezogenen Reihe hinunter, Arkebusen feuerbereit und Partisanen im Anschlag. Angegriffen wird erst auf mein Kommando hin, verstanden? Denkt daran, wir wollen fouragieren, nicht morden und brandschatzen.«
»Verstanden, Herr Rittmeister.« Istvan Strellitz musterte Valerian, den er das erste Mal auf Schloss Villesen getroffen hatte, vor einer Ewigkeit, wie es Valerian schien, und der ihm seitdem zuverlässig diente. Dann warf er einen kurzen Blick auf das Dorf. »Mit Verlaub, Herr, es sieht aus, als kämen wir für Letzteres ohnehin zu spät.«
Valerian fletschte die Zähne. »Führ einfach meinen Befehl aus, Istvan!«, schnauzte er seinen Unteroffizier an, schärfer, als er eigentlich beabsichtigt hatte.
Der Mann zuckte kurz zusammen, und seine Miene verfinsterte sich. Aber er hütete sich, noch etwas zu sagen, sondern salutierte und gab den Befehl an die Leute weiter.
Was ist mit dir los?, dachte Valerian. Du hast doch schon so viele Gräueltaten erlebt, wieso also bist du so gereizt? Dein Korporal hat nur gesagt, was alle denken, einschließlich deiner selbst.
Sein Blick glitt wieder zu dem Dorf hinab, und er verzog das Gesicht, als er beobachtete, wie zwei Männer eine Frau ergriffen und ihr die Kleider vom Leib rissen. Sie war bereits blutüberströmt und schrie wie ein gequältes Tier, als sie unter den beiden Männern verschwand.
Wenn du dich nicht an den Anblick brutaler Gewalt gegen Wehrlose gewöhnen kannst, solltest du nicht länger in diesem Krieg kämpfen!, dachte er. Doch für den Moment schob er dieses Problem beiseite, sondern blickte nach rechts, wo im selben Moment, wie angeordnet, Kornett Bogdanow mit den restlichen Männern auftauchte.
Vielleicht gelingt es uns ja jetzt zur Abwechslung mal, etwas Nützliches zu tun und ein paar verdammte Seelen zu retten! Er zog seinen Säbel aus der Scheide und schwang ihn einmal im Kreis über seinen Kopf. Wofür auch immer das gut sein mag.
Dann verstummte sein innerer Monolog, und der Soldat in ihm übernahm das Kommando. Er ließ ein letztes Mal den Blick durch das Dorf streifen, keine Pferde zu sehen, gut, und spürte, wie er innerlich kalt und ruhig wurde. Den Blick seiner blauen Augen richtete er fest auf das Ziel unterhalb von sich, eine kleine Gruppe von Plünderern, denen offenbar aufgefallen war, dass sie ungebetenen Besuch bekommen hatten. Es waren vielleicht zehn Männer, die gegen seine Abteilung gepanzerter Kürassiere niemals bestehen konnten. Offenbar sahen sie das genauso, denn als Valerian seinen Säbel ein zweites Mal schwang, rannten die Marodeure schon zu einem kleinen Brunnen etwa in der Mitte der Häuser, wo zwei weitere Söldner auf sie warteten. Hastig hoben sie Beutel und Tücher vom Boden auf und wandten sich zur Flucht, weg von den Kürassieren.
»Angriff!«, schrie Valerian und trieb sein Pferd an. »Wehe, wenn einer entkommt! Aber ich will sie möglichst lebend!«
Die letzten Worte gingen im lauten Gebrüll seiner Männer unter, als sie ihren Pferden die Sporen gaben und den Hang hinuntergaloppierten.
Die Plünderer waren offenbar zu Fuß unterwegs gewesen, denn sie machten keine Anstalten, ihre Beute fallen zu lassen, um vielleicht schneller ihre Pferde zu erreichen. Aber selbst wenn sie welche im Wald versteckt hätten, wäre ihr Versuch zum Scheitern verurteilt gewesen, da ihnen sämtliche Fluchtwege abgeschnitten waren.
Valerian und seine Abteilung hatten bereits den Rand der Siedlung erreicht und zogen ihre Linie in die Länge, um möglichen Pistolenschützen einen Treffer zu erschweren, und sei es auch nur ein Zufallstreffer. Durch den Rauch, der sich durch die Siedlung wälzte, sah er auf der anderen Seite Bogdanow mit seinen Männern in einer weit auseinandergezogenen Reihe heranreiten.
Gut, dachte er. Falls sich nicht noch einer dieser Hundesöhne in einem Haus versteckt hat, dürften wir sie jetzt alle zwischen uns haben.
Die Plünderer drängten sich zusammen und sahen sich hastig um, als sie das Trommeln der Hufe hörten. Die Männer, etwa ein Dutzend, hatten ausnahmslos ihre Waffen gezogen, und Valerian sah etliche Pistolen und sogar zwei Arkebusen.
Er kniff die Augen zusammen und wünschte sich fast, einer der Plünderer hätte seine Waffe angelegt und ihm so einen Vorwand geliefert, selbst den Befehl zum Feuern zu geben.
Warum gibst du ihn nicht trotzdem?, meldete sich eine wütende Stimme in seinem Kopf, als sein Blick auf eine kleine Gruppe von blutbefleckten Frauen in zerrissenen Kleidern fiel, die ihre Kinder an sich zerrten und die Neuankömmlinge mit furchtsam aufgerissenen Augen anstarrten. Aber Valerian kannte die Antwort. Weil du nicht so sein willst wie sie. Wie dieses Vieh.
Dann sah er, wie einer der Plünderer einem Mann mit einer Arkebuse die Hand auf die Schulter legte, etwas zu ihm sagte und in seine, Valerians, Richtung deutete. Der Arkebusier zögerte kurz, zuckte dann mit den Schultern und ließ seine Waffe sinken.
Etwas in Valerians Hinterkopf regte sich, als er dies beobachtete, aber er verfolgte den Gedanken nicht weiter. Seine Gruppe hatte sich mittlerweile bis auf zwanzig Schritt den Plünderern genähert, und er hob die Hand zum Zeichen für seine Leute anzuhalten.
Die Kürassiere kamen in einer gewaltigen Staubwolke zum Stehen, und in dem ganzen Rauch und Staub waren die Gestalten vor dem Brunnen für einen Moment nur noch schemenhaft zu erkennen.
»Kornett!«, schrie Valerian.
»In Position, Rittmeister!«, ertönte Bogdanows tiefe Stimme von der anderen Seite des Brunnens her, und im nächsten Moment tauchte seine Abteilung im langsamen Schritt aus dem Nebel auf. Valerian sah, dass alle ihre Arkebusen angelegt hatten. Die Waffen waren mit Radschlössern ausgestattet, sodass man nicht erst umständlich Lunten entzünden musste, um sie abzufeuern.
»Waffen runter!«, blaffte Valerian die Plünderer an. »Sofort! Seid ihr vollzählig, oder haben sich noch ein paar von euch Hundsfotten hier irgendwo verkrochen?«
»Villesen?«
»Ich rate euch, meine Geduld nicht allzu sehr auf die Probe zu stellen, Gesindel!« Valerian spürte Wut in sich aufsteigen, als er sah, dass einer der Plünderer krampfhaft ein dürres, vor Angst zitterndes Mädchen vor sich hielt, dessen schmutziges Gesicht tränen- und blutverschmiert war. Offenbar hatte der Mann das Mädchen gerade vergewaltigt und war noch nicht dazu gekommen, seine Hose ordentlich hochzuziehen. Er benutzte das Mädchen, um seine Blöße zu bedecken.
»Ich verlange auf der Stelle eine Antwort! Und du da …!« Er deutete auf den Plünderer mit dem Mädchen. »Lass das Kind los, und zwar sofort!«
»Von Villesen? Seid Ihr das?«
Valerian fixierte den Mann mit dem Mädchen mit zornigem Blick, hatte seine Pistole gezogen und den Hahn gespannt. Er war bereit, dem Mann eine Kugel in den Schädel zu jagen, wenn er nicht sofort gehorchte; der Söldner war groß und fett und bot hinter dem dürren Mädchen ein ausreichend gutes Ziel.
Als Valerian das erste Mal seinen Namen gehört hatte, war er nicht darauf eingegangen, und auch jetzt glaubte er fast, seine Einbildung hätte ihm einen Streich gespielt.
Als der fette Söldner das Mädchen losließ, das ein paar Schritte von ihm wegtaumelte und dann zu Boden stürzte, sah Valerian aus den Augenwinkeln, dass seine Vermutung richtig gewesen war. Der Mann nestelte hastig an seiner Hose herum.
Aber Valerians Blick hatte sich bereits auf den Mann gerichtet, der ihn mit Namen angesprochen hatte.
»Du kennst mich, Kerl?« Mit einem leichten Schenkeldruck trieb er sein Schlachtross auf den Plünderer zu und sah befriedigt, dass der unwillkürlich einen Schritt zurückwich. Aber sein schmutziges, bärtiges Gesicht zeigte weniger Angst als vielmehr Selbstgefälligkeit.
»So wie Ihr mich, Herr von Villesen!« Der Mann schob seine Pistole in den Gürtel und verbeugte sich mit spöttischer Ehrerbietung. In Anbetracht seiner Lage eine sehr kühne Reaktion.
Valerian runzelte die Stirn. Er hatte nicht die geringste Lust, Ratespiele mit einem Plünderer und Marodeur zu spielen, aber irgendetwas an dem Mann kam ihm tatsächlich bekannt vor. Und plötzlich wusste er, um wen es sich handelte, noch bevor der Mann sich wieder aufgerichtet und seinen arg mitgenommenen, von Dreck starrenden Hut gelüftet hatte, dessen Federn nicht erahnen ließen, von welcher Art Federvieh sie stammten.
»Hufner, Freiherr von Villesen.« Der Mann nickte, als er das Erkennen in Valerians Gesicht bemerkte. »Eberhard Hufner, der Schmied aus Bruchhausen, zu Euren Diensten.«
Valerian starrte den Mann einen Moment wortlos an. Warst du nicht bei den Ligistischen, Kerl?Hast wohl wieder die Seiten gewechselt, weil du dir beim Schweden mehr Fortune erhoffst? Offenbar bereiteten sein Schweigen und sein scharfer Blick dem Schmied Unbehagen, denn er straffte sich und redete hastig weiter.
»Kein Grund für Feindseligkeiten, Herr.« Er deutete auf die kleine Gruppe von Plünderern, die den Wortwechsel aufmerksam verfolgten und offenbar Hoffnung schöpften, als sie begriffen, dass Eberhard, der wohl so etwas wie der Anführer der Gruppe war, und der Befehlshaber der Kürassiere sich kannten. Jedenfalls schienen sie sich zu entspannen, ließen die Waffen sinken, auch wenn sie sie nicht wegsteckten, und traten langsam näher.
»Noch einen Schritt, ihr Halunken, dann schießen meine Leute euch die Beine weg und lassen euch hier im Dreck liegen!«, tönte Bogdanows tiefe Stimme von hinten. »Ich kann mir gut vorstellen, was die Bewohner dieser Siedlung dann mit euch machen. Jedenfalls die, die ihr am Leben gelassen habt!«
Hufner wurde blass und hob hastig die Hände zum Zeichen, dass er unbewaffnet war und keine feindlichen Absichten hegte. »Wie gesagt, Herr …«
»Es heißt Rittmeister, Kerl!«, mischte sich Korporal Strellitz ein, der sein Pferd neben Valerians Ross getrieben hatte. Dann sah er Valerian kurz an. »Sieht aus, als wären das alle, Herr Rittmeister.«
Valerian nickte kurz, ohne den Blick von Hufner zu nehmen.
»Wie gesagt, Herr Rittmeister«, der Schmied hütete sich, den militärischen Rang spöttisch zu betonen, aber trotzdem spürte Valerian die Verachtung in der Stimme des Mannes, »es gibt keinen Grund für Feindseligkeiten. Wir haben genug erbeutet, um zu teilen, und was die Frauen angeht … Tut Euch gern gütlich an ihnen.« Er grinste spöttisch. »Wir hatten in den letzten Tagen mehr als genug von ihnen und geben gern etwas ab. Und was die Lebensmittel betrifft – unsere Pferdewagen stehen nicht weit von hier im Wald. Mein Bruder bewacht sie, den kennt Ihr ja auch, hab ich recht, Herr? Gerulf.« Er straffte sich, als Valerian weiterhin schwieg, und missverstand offenbar dieses Schweigen als Aufforderung zum Weitersprechen. »Seit unserer letzten Begegnung hat sich unser Schicksal gewendet, Herr.« Er deutete mit einem seiner dicken Daumen auf sich. »Ich bin jetzt kein Schmied mehr, sondern Korporal in der Kompanie von Hauptmann Machinskij im ligistischen Regiment von Obrist von Grimberg.« Seine Stimme klang stolz, als er mit einem Nicken auf die Fahne deutete, die der Fähnrich der kleinen Abteilung hielt. »Mein Lieutenant hat mich zum Fouragieren geschickt, und wir waren recht erfolgreich. Wir sind auf derselben Seite, Herr Rittmeister, deshalb biete ich Euch gern einen Teil unserer Beute an, denn offensichtlich hattet Ihr nicht so viel Erfolg …« Jetzt klang seine Stimme unverhohlen selbstgefällig.
Valerians Blick streifte kurz die Fahne, dann blickte er wieder auf den Schmied oder vielmehr den frischgebackenen Korporal. Es macht keinen Unterschied, dachte er. Er ist ein Plünderer und Mordbrenner, so oder so.
»O Hufner, das würde ich nicht sagen.« Er blickte kurz zu Bogdanow hinüber, dessen Leute ihre Arkebusen hatten sinken lassen, und gab ihm ein kurzes Handzeichen. Der Kornett verstand und wies seine Männer mit einem leisen Befehl an, die Waffen weiter im Anschlag zu halten. »Denn der Auftrag meines Obristlieutenants lautete, zu fouragieren und den Plünderern und Mordbrennern Einhalt zu gebieten, die hier herumstreifen und Gehöfte, Siedlungen und Felder niederbrennen.« Er schüttelte den Kopf. »Ich frage mich, ob diese Mordbrenner wohl begreifen, dass irgendwann niemand mehr da sein wird, der die Äcker bestellt und das Getreide und Gemüse erntet, wenn alle Bewohner der Siedlungen und Dörfer niedergemetzelt sind.« Er legte den Kopf auf die Seite und sah Hufner an. »Was meinst du, Hufner, kannst du mir da vielleicht zu einer Antwort verhelfen?«
Der Korporal blinzelte verwirrt, weil er offenbar die Ironie dieser Worte nicht begriff. Aber das musste er auch nicht. Valerians feindseliger Ton war ihm keineswegs entgangen.
»Was wollt Ihr tun, Rittmeister? Uns unsere mühsam gesammelte Beute wegnehmen? Ich werde bei Hauptmann Machinskij Meldung machen, falls Ihr auf diese Idee kommt, und außerdem wird Euch das auch nur über meine Leiche gelingen!« Die Vorstellung, diese »Beute« zu verlieren, schien Hufner so wütend zu machen, dass er sowohl jede Vorsicht beiseiteschob als auch seine Angst vergaß und einen Schritt auf Valerian zu machte. »Ihr könnt Euch sicher sein, dass sich Obrist von Grimberg bei Eurem Regimentskommandeur …«
»Mühsam gesammelte Beute?« Valerians Stimme klang so schneidend, dass Hufner unvermittelt den Mund zuklappte. »Du meinst wohl, brandschatzend und mordend zusammengeraffte Beute, du Hund von einem Plünderer?« Das Blut rauschte in Valerians Ohren, und rote Punkte tanzten vor seinen Augen. Er musste sich zusammenreißen, um den Mann nicht einfach niederzureiten.
Aber Hufner ließ sich von seinem Zorn mitreißen. »Und Ihr? Edler Freiherr und Rittmeister?« Er deutete mit der Hand auf die Siedlung, die Frauen, die sich immer noch zitternd aneinanderdrängten, dann auf das Mädchen, das im Dreck lag und dessen Schultern beim Weinen zuckten, und auf den fetten Söldner, der endlich seine Hose zugeknöpft hatte. »Ihr wollt mir sagen, Ihr seid nur hier, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun? Um diese arme Bevölkerung zu retten und höflich zu fragen, ob sie vielleicht so nett wären, Euch ein Fässchen Bier oder einen Scheffel Getreide zu geben?« Er lachte verächtlich und spuckte aus. »Wären wir es nicht gewesen, wären die Protestanten gekommen und hätten die Dörfer hier geplündert. Und wir sind uns doch wohl einig, dass es besser ist, wenn die kaiserlichen Söldner zu fressen kriegen als die Union oder der Schwede? Ihr seid doch nur wütend, weil Ihr zu spät gekommen seid und jetzt mit leeren Händen zu Eurer Kompanie zurückkehren müsst!«
Valerian blähte die Nasenflügel, als er tief einatmete, um sich zu beruhigen. Trotz seiner Wut konnte er nicht leugnen, dass in den Worten des Mannes eine gewisse Logik lag. »Mit leeren Händen? Wohl kaum!« Er presste die Worte zwischen den Zähnen hervor, und um dem anderen Mann klarzumachen, wie ernst es ihm war, legte er seine Hand auf den Knauf seiner Reiterpistole.
»Ganz gewiss mit leeren Händen!«, zischte Hufner. »Ich nehme mein Angebot, mit Euch zu teilen, zurück, Freiherr Rittmeister von Villesen!« Der Schmied packte den Griff seines Säbels. »Ihr bekommt gar nichts von uns, und vergesst ja nicht, dass wir unter dem gleichen Herrn dienen. Wenn Ihr uns …!«
»Wir haben nichts mit Mordbrennern gemein!«, rief Korporal Strellitz und zog seine Reiterpistole, spannte den Hahn und richtete sie auf Hufner.
»Istvan, nicht!«, rief Valerian, als auch schon ein Schuss fiel.
»Verflucht, was …!«, schrie Hufner gleichzeitig und riss seinen Säbel aus der Scheide. »Nein!«, brüllte er. »Gerulf, nein!«
»Feuer!«, ertönte auf der anderen Seite des Brunnens die Stimme von Kornett Bogdanow.
Während die Arkebusen-Salve knallte, die verwundeten Plünderer aufschrien und die verängstigten Frauen zu kreischen begannen, blickte Valerian verblüfft auf seinen Korporal. Es dauerte einen Moment, bis er begriff, dass es nicht sein Untergebener gewesen war, der den Schuss abgegeben hatte. Im Gegenteil, ganz offenbar hatte Korporal Istvan Strellitz eine Kugel abbekommen, die sonst möglicherweise ihn, Valerian, getroffen hätte.
Valerian starrte immer noch wie gebannt seinen Korporal an, als dieser seitlich aus dem Sattel kippte. Kopf und Oberkörper trafen auf den Boden, während ein Stiefel im Steigbügel hängen blieb. Valerian konnte einen kurzen Blick auf die Seite seines Schädels werfen, die nur noch eine blutige Masse war, offenbar zerschmettert von einer Musketenkugel. Dann scheute das reiterlose Pferd vor dem Lärm und dem Gewicht im Steigbügel und brach aus.
Valerian blickte in die Richtung, aus der der Schuss gekommen sein musste, und sah, dass drei Männer am Rand des Dorfes standen, die ihre Musketen auf die Gabeln gelegt hatten und zielten. »Musketenfeuer!«, schrie Valerian und deutete mit dem Degen. »Achtung!«
Seine Leute waren gut ausgebildet. Die lang gezogene Reihe aus Reitern schwenkte sofort um und galoppierte auf die drei Schützen zu. Zwei der Reiter hatten ihre Arkebusen bereits in Anschlag gebracht und schossen, drei andere waren noch damit beschäftigt, die Radschlösser zu spannen, und zwei weitere legten ihre Partisanen an, die kurzen, knapp zwei Schritt langen Reiterspieße, während sie die Schützen angriffen.
Das muss Gerulf sein, dachte Valerian, als sein Blick auf den Söldner fiel, der den Schuss abgefeuert hatte. Offenbar hatte er seinen Bruder in Gefahr gewähnt und versucht, ihm das Leben zu retten. Sein Schuss hatte jedoch eine Kette von Gewalt ausgelöst, die auch Valerian nicht mehr aufhalten konnte.
Er sah zu, wie seine Reiter auf die Schützen zustürmten, die vor Nervosität nicht mehr rechtzeitig anlegen konnten. Die Reiter feuerten ihre Arkebusen ab, und einer der Schützen stürzte zu Boden. Sekunden später hatten die anderen Reiter den zweiten erreicht und ihn mit ihren Partisanen durchbohrt. Gerulf hatte gar nicht erst versucht, seine Muskete weiterzuladen, sondern hatte sich umgedreht und war davongelaufen. Zwei Reiter verfolgten ihn.
Valerian drehte sich wieder zu der Gruppe von Plünderern herum, die zusammengedrängt am Brunnen standen. Zwei seiner Männer waren bei ihm als Leibgarde geblieben, aber er sah sofort, dass er keines Schutzes mehr bedurfte.
Kornett Bogdanows Leute hatten ganze Arbeit geleistet. Die meisten Plünderer lagen am Boden, wälzten sich blutend im Dreck oder rührten sich nicht mehr. Zwei standen noch auf den Beinen, von denen einer sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Arm hielt. Keiner von ihnen dachte daran, von seiner Waffe Gebrauch zu machen.
Hufner lag mit ausgebreiteten Armen und Beinen vor ihm auf dem Rücken im Dreck. Einer von Valerians Reitern hatte ihm eine Kugel ins Auge geschossen, und ein anderer hatte ihn offenbar in die Brust getroffen, denn auf dem schmutzigen Wams breitete sich rasch ein dunkler Fleck aus. Es bestand kein Zweifel, dass der ehemalige Schmied tot war.
Es sind Plünderer, gewiss, aber es sind auch Kameraden! Du kannst sie doch nicht einfach so abschlachten! Noch während er überlegte, was er mit den restlichen Männern tun sollte, ritten Bogdanow und seine Leute an dem Brunnen vorbei und erreichten die Plünderer.
Wie erstarrt sah Valerian zu, wie sein Kornett mit einem mächtigen Schlag seines Säbels einem der Plünderer fast den Schädel vom Kopf trennte. Der Mann fiel zu Boden, und der Schädel, nur noch an Haut und Sehnen mit der Leiche verbunden, rollte hin und her wie ein Pendel.
Dann beobachtete Valerian, ohne sich zu rühren, wie einer von Bogdanows Männern dem letzten Plünderer, der die Hände hob, um sich zu ergeben, seine Partisane durch den Rücken rammte. Die Spitze kam am Brustbein wieder heraus, und ein Sprühnebel aus Blut spritzte aus der Wunde. Der Mann taumelte ein paar Schritte vorwärts und fiel auf die Knie, während dunkles Blut aus seinem Mund quoll. Dann sackte er tot zur Seite.
»Das wäre das, Herr Rittmeister«, sagte Bogdanow und zügelte sein Pferd neben Valerian. »Aber was ist mit unserem Freund Istvan?«
Der Kornett deutete grimmig auf den Korporal, den sein Pferd zwanzig Schritt weit mitgeschleift hatte, bevor sein Fuß schließlich aus dem Stiefel gerutscht und er im Dreck liegen geblieben war.
»Er ist tot«, sagte Valerian tonlos. »Ich wüsste nicht, dass ich befohlen hätte …«
»Nein, Herr Rittmeister«, fiel ihm Bogdanow ins Wort und wischte sich mit seiner behandschuhten Rechten den Schweiß aus dem Gesicht. Der Kornett musterte Valerian aufmerksam. »Für solche wenig ruhmreichen Taten habt Ihr Eure treuen Untergebenen, Herr.« Sein Blick glitt noch einmal zu dem Korporal, und er bedeutete einem seiner Leute mit einer Handbewegung, den Toten zu holen. »Die nicht davor zurückscheuen, ihr Leben für Euch zu opfern.«
Er wartete, aber Valerian sah ihn nur schweigend an.
Bogdanow nickte. »Ganz recht. Und jetzt sollten wir uns ansehen, welche Beute der da«, er deutete verächtlich auf Eberhard Hufner, »so ungern mit uns teilen wollte, dass er sie uns nur über seine Leiche überlassen hat.« Er wendete sein Pferd und sah dann zu Valerian zurück. »Einverstanden, Herr Rittmeister?«
»Sicher, Kornett. Tut …«, Valerian räusperte sich, »tut alles, was nötig ist.«
Er fühlte sich wie betäubt, als der größte Teil seiner Abteilung den beiden Reitern folgte, die sich an die Verfolgung des flüchtigen Schmiedes gemacht hatten, und im Wald hinter dem Dorf verschwanden.
Sein Blick streifte die toten Plünderer und dann die anderen Leichen, die vor den Häusern oder auf der Straße lagen. Wie in allen anderen von Plünderern heimgesuchten Dörfern befanden sich auch hier so gut wie keine Männer unter den Opfern. Wenn doch, waren es zumeist Alte und Gebrechliche, die nicht mehr in der Lage gewesen waren, eine Pike zu halten oder eine Muskete abzufeuern.
Dann fiel sein Blick auf die drei Frauen und die Kinder, die sich zitternd am Brunnen zusammendrängten. Eine der Frauen hatte während der Kämpfe das schluchzende Mädchen von der Stelle weggeholt, wo es zuvor gelegen hatte, und presste es jetzt fest an sich, während sie Valerian mit einem Blick betrachtete, der ihm das Blut in den Adern erstarren ließ.
Es war ein Blick von abgrundtiefer Verzweiflung und blankem, glühendem Hass.
Ich bin nicht wie die anderen!, hätte er ihr gern zugerufen, hätte sie gern beruhigt, hätte alles getan, um so etwas wie Erleichterung oder Dankbarkeit in ihrem Gesicht zu sehen.
Aber das konnte er nicht. Es wäre gelogen. Plötzlich hatte er einen bitteren Geschmack im Mund, als er sein Pferd wendete, um seinen Männern zu folgen. Dann überlegte er es sich noch einmal anders. Er zog am Zügel und trieb sein Pferd langsam auf die Frauen am Brunnen zu.
Die wichen weiter vor ihm zurück, bis sie sich mit dem Rücken an die Steinfassung des Brunnens pressten, und eine der Frauen wimmerte leise, während die Kinder, alles Mädchen, wie Valerian sah, ihn mit bebenden Lippen und riesigen Augen anstarrten.
Er griff an seinen Gürtel, und die Frau, die das Mädchen umklammert hielt, zuckte zusammen.
»Keine Angst«, murmelte er. Er wusste nicht, ob sie ihn gehört hatte, aber das spielte auch keine Rolle. Bloße Worte würden ihr Entsetzen sicherlich nicht lindern. Er zog zwei Silbergulden aus der Tasche in seinem Gürtel und hielt sie hoch, damit die Frauen sie sehen konnten. Dann warf er sie in den Staub zu ihren Füßen.
»Herr Rittmeister, wir haben gefunden, was wir suchten!«, ertönte Bogdanows Stimme vom Rand des Dorfs. »Kommt und seht selbst! Ein schöner Fang, das muss ich schon sagen!«
Valerian blickte zu seinem Kornett hinüber und nickte. Aber er zögerte noch einen Moment und sah die Frauen am Brunnen an.
»Für euch!«, rief er und deutete auf die Münzen, die schwach im Staub funkelten.
Er hatte keine Dankbarkeit oder gar Freude erwartet, aber immerhin hatte er versucht, das Leid dieser Frauen ein wenig zu mindern.
Doch als die Frau, die das Mädchen von der Straße gezogen hatte, aufstand und sich aufrichtete, ohne darauf zu achten, dass ihre schlaffen Brüste aus dem zerrissenen Kleid heraushingen, wurde Valerian klar, dass er nicht den Frauen hatte helfen wollen.
Er sah unbeweglich zu, wie die Frau zu den Münzen ging, ohne ihn dabei aus den Augen zu lassen. Ihr Blick schien sich in seinen zu brennen, und ihre dunklen Augen waren hasserfüllt, als sie sich bückte, und … auf die Münzen spuckte. Dann erst hob sie sie vom Boden auf, drehte sich um, ohne Valerian eines weiteren Blickes zu würdigen, und ging zu den anderen Frauen am Brunnen zurück.
Dir selber hast du helfen wollen, dachte er. Dein Gewissen wolltest du erleichtern! Mit zwei Silberstücken. Er riss seinen Blick von der kleinen Gruppe am Brunnen los und wendete sein Pferd. Und jetzt fühlst du dich, als wären es nicht zwei, sondern dreißig Silberlinge gewesen.
3. KAPITEL
Zu den Waffen!
»Hab ich mir doch gedacht, dass ich dich hier finde, Kerl!«
Eik blickte von dem Teller mit Lamm und Gemüse hoch, der dampfend vor ihm stand. Er hatte den Mund voller Fleisch, das gar nicht übel schmeckte, und deutete mit dem Messer in der Hand auf einen Hocker an seinem Tisch.
»Hätte ich mir ja denken können, dass du genau rechtzeitig kommst, um mir in die Suppe zu spucken, Obristlieutenant«, nuschelte Eik und grinste den hochgewachsenen Mann spöttisch an, der sich vor ihm aufgebaut hatte. »Aber setz dich wenigstens hin, so viel Zeit wirst du ja wohl haben.«
Hans De Vries zögerte einen kurzen Moment, dann nahm er seinen breitkrempigen schwarzen Hut ab und drehte sich zum dicht umlagerten Tresen um. »Heda, Wirt!« Seine tiefe Stimme übertönte mühelos den Lärm in der Gaststube. »Ein Krug von dieser Brühe, die du Bier nennst, aber pronto!«
Er wartete, bis der Schankwirt seinen Blick erwiderte und nickte, dann zog er mit dem Fuß den Schemel unter dem Tisch heraus und setzte sich. »Und, wie schmeckt das Lamm?«
»Nach uraltem Hammel«, erwiderte Eik und lachte, weil er gewusst hatte, dass De Vries sich auch von dieser Bemerkung nicht abhalten lassen würde, seinen Dolch zu ziehen und sich ein Stück von der Keule abzuschneiden. Er spießte es auf und schob es sich in den Mund. Dann verdrehte er genüsslich die Augen.
»Das ist der zarteste alte Hammel, den ich je zwischen die Zähne bekommen habe«, brummte er. Er drehte sich wieder zum Tresen herum und hob gebieterisch die Hand. Der Wirt sah zu ihm hinüber. »Und die gleiche Portion wie mein Lieutenant hier!«, rief er. Diesmal wartete er nicht ab, bis der Wirt die Bestellung bestätigt hatte, sondern drehte sich wieder zu Eik herum. »Lieber alten Hammel als alten Gaul«, sagte er. »Wer weiß, wann wir wieder so etwas Köstliches vorgesetzt bekommen.«
Eik hörte auf zu kauen und sah seinen Vorgesetzten und Kameraden scharf an. Nicht nur Kamerad, sondern Freund, dachte er, während er das tiefgebräunte und vom Feuer gezeichnete Gesicht des anderen Mannes musterte. »Das heißt, du bist nicht zufällig hier oder weil dein Magen dich hierhergeführt hat.«
Das war keine Frage, sondern eine Feststellung. Vor knapp einem Monat hatten sie mit ihrem protestantischen Kontingent und den Schweden unter dem Befehl von Gustav Adolf die Kaiserlichen unter Tilly vor der Stadt Werben geschlagen, dann hatte sich die Leibkompanie ihres Obristen Hans Caspar von Klitzing nach Leipzig zurückgezogen, um die Festung Pleißenburg in Leipzig zu verteidigen. Die Gerüchte wollten wissen, dass Tilly vorhatte, die Festung zu erstürmen, um damit Leipzig in die Hand zu bekommen, wo die protestantischen Reichsstände erst vor wenigen Monaten ihren Bund gegen die Reichsgewalt geschlossen hatten.
Bis jetzt jedoch war von Tilly nichts zu sehen, und so logierten sie seit einer guten Woche hier. Außerdem hatte Eik es sich zur Gewohnheit gemacht, im Goldenen Lamm zu essen. Das war einer der Vorteile, die seine neue Position als Lieutenant im kursächsischen Dragonerregiment mit sich brachte. Regelmäßige und nicht zu knappe Soldzahlung, für die vor allem die Kasse Gustav Adolfs von Schweden sorgte. Er konnte sich ordentliches Essen leisten, genauso wie die bescheidene Unterkunft unter dem Dachboden ebendieser Herberge.
Und seit den letzten Briefen von Augusta zog es ihn abends auch nicht mehr in die Vergnügungsviertel oder zu den Dirnen. De Vries hatte ihn deswegen schon aufgezogen, doch Eik hatte freundlich, aber entschieden jede Einladung abgelehnt.
»Als Familienvater trage ich Verantwortung, nicht nur für meine Frau und das Kind, sondern auch für meine leibliche Gesundheit«, hatte er De Vries am ersten Abend nach zwei Krügen Bier hier in der Schänke gestanden. »Schließlich will ich die Mutter meiner Kinder nicht mit der Soldatenseuche infizieren.«
De Vries hatte genickt und dann breit gegrinst. »Nun, umso mehr Dirnen bleiben für mich übrig«, hatte er gemeint, aber Eik wusste, dass er das nur im Scherz sagte. Seit einer Weile gab es eine junge Frau im Tross der Schweden, die De Vries offenbar so sehr erfüllte, dass er gar nicht mehr auf den Gedanken kam, seine Lust woanders zu befriedigen.
Jedenfalls wusste De Vries, wo er Eik finden konnte, aber dass er um diese Stunde hier auftauchte, sagte Eik, dass er einen ganz besonderen Grund haben musste.
Und Eik konnte sich nur einen einzigen Grund für einen Soldaten vorstellen, auf die zärtlichen Umarmungen seiner Geliebten zu verzichten. De Vries’ nächste Worte bestätigten seine Vermutung.
»Wir reiten übermorgen früh. Der Kurfürst hat unser Regiment Gustav Adolf unterstellt«, erklärte De Vries. »Johan Banér hat den Befehl über einen Teil der Reiterei bekommen. Und damit auch über uns arme Dragoner. Der größte Teil des Regiments ist bereits abgerückt, und unsere Leibkompanie reitet morgen mit dem Obristen hinterher.« Er lehnte sich zurück, als das Schankmädchen kam und den Bierhumpen vor ihm auf den Tisch stellte. Die dralle Magd warf dem Obristen, der trotz seiner Entstellung recht eindrucksvoll war, einen anzüglichen Blick zu, aber der Offizier achtete nicht auf sie.
Was Eik ein knappes Lächeln entlockte. Diese Schwedin muss wirklich etwas an sich haben, dachte er, wenn er so gar nicht mehr auf weibliche Reize anderer Frauen reagiert. Sein Blick streifte die prallen Brüste des Schankmädchens, aber dann schob sich das Gesicht einer dunkelhaarigen Frau vor seine Augen, und sein Lächeln verstärkte sich. Aber geht es mir anders?
Er griff nach seinem Bier und prostete De Vries zu. »Ich habe mich schon gefragt, wie lange der Löwe warten will, um Tilly den Rest zu geben.«
Sie tranken, dann setzte De Vries den Humpen wieder auf den Tisch und wischte sich den Schaum vom Mund. »Das würde Gustav Adolf sicher lieber heute als morgen tun, aber ich glaube, dass der alte Haudegen T’Serclaes da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat.« Er strich sich über den Knorpelrest, der einmal sein rechtes Ohr gewesen war, eine unbewusste Geste, die Eik schon an seinem Vorgesetzten und Freund kannte. Das machte De Vries immer, wenn er ins Grübeln geriet. »Wenn die Gerüchte stimmen, hat er vor, die Pleißenburg zu stürmen.« Er grinste. »Ein kühnes Unterfangen, vor allem nach seiner Niederlage gegen Gustav Adolf vor einem Monat.«
Eik zuckte mit den Schultern. »Ich vermute, Tilly hat genug damit zu tun, seine Wunden zu lecken«, sagte er nicht ohne Stolz. »Wir haben ihm in Werben ganz schön zugesetzt. Ich glaube nicht, dass er es wirklich wagen würde, gegen Leipzig zu marschieren, und wenn doch, was interessiert es uns? Wir sind spätestens morgen Abend weg!«
»Ein Glück, sage ich!«
Eik hatte sich nicht die Mühe gemacht, seine Stimme zu senken, in der Gewissheit, dass er hier in Leipzig in einer der protestantischen Hochburgen war. Immerhin hatten die Protestanten in dieser Stadt vor nicht einmal einem halben Jahr ihren Bund gegen die Reichsgewalt geschlossen. Aber ganz offensichtlich gab es auch hier Menschen, die nicht gut auf Söldner und Soldaten zu sprechen waren, seien es nun protestantische, schwedische oder kaiserliche.
Eik drehte sich in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war, und starrte finster in die dämmerige Schänke.
»Lass gut sein«, brummte De Vries, nachdem er einen tiefen Zug aus seinem Humpen genommen hatte. »Das Bier ist gut, und es wäre schade, es wegen so eines Schwachkopfs schal werden zu lassen.«
»Wer hat das gesagt?«, fragte Eik und schüttelte die Hand von De Vries ab, die der beruhigend auf seinen Arm gelegt hatte.
»Das war ich.« Ein vierschrötiger Mann stieß sich vom Schanktisch ab und drehte sich zu Eik herum. Zwei andere, ebenfalls kräftige Männer folgten ihm, dann noch drei weitere. Sie traten in die Mitte des Schankraums, zwischen Eik und De Vries auf der einen und die Tür auf der anderen Seite, kamen aber nicht näher. »Und ich sage, ein Glück, dass ihr Gesindel aus der Stadt verschwindet. Hat euch ein Magdeburg noch nicht gereicht? Wollt ihr Tilly dazu bringen, Leipzig auch noch zu magdeburgisieren?«
»Wir werden …!«, begann Eik und wollte aufstehen.
»… nichts dergleichen tun!«, mischte sich De Vries ein. Seine Hand auf Eiks Arm wirkte plötzlich wie eine stählerne Klammer, aus der sich der junge Lieutenant nicht befreien konnte. »Und damit ist die Diskussion auch beendet, Kerl!«
De Vries stand auf, nahm den Hut ab und warf ihn auf den Tisch. Eik sah, dass der Sprecher unwillkürlich die Luft zwischen den Zähnen einsog, als er das entstellte Gesicht des Obristlieutenants sah.
Aber der Mann hatte offenbar keine Lust, vor seinen Gefährten klein beizugeben. »Das hier ist zu Ende, wenn ich es …«
De Vries schüttelte den Kopf und legte mit aufreizender Lässigkeit seinen Unterarm auf den Korbgriff seines Säbels. »Falsch. Es ist jetzt zu Ende, oder aber mit dir ist es zu Ende. Falls du nicht verstehst, Kerl, was ich meine, will ich es dir gern erklären. Ich bin Obristlieutenant, und draußen wartet meine Leibgarde aus kampferprobten, wilden und mordgierigen Dragonern, die schon viel zu lange kein Blut mehr gesehen haben und sich teuflisch darüber freuen würden, ihre Säbel und Dolche an dir und deinen Spießgesellen blank zu wetzen.«
Eiks Zorn war ebenso schnell verraucht, wie er aufgeflammt war, und er verkniff sich ein Grinsen, als er das Gesicht des Sprechers sah. Der Mann war plötzlich blass geworden. Die ganze Sache war noch amüsanter, weil er genau wusste, dass De Vries allein unterwegs war, denn es war nicht seine Art, die eigenen Leute vor einer Schänke warten zu lassen, während er sich drinnen ein Bier genehmigte.
Der Sprecher zögerte und sah sich zu seinen Gefährten um, die ebenfalls unschlüssig zu sein schienen. Schließlich wandte sich einer davon zum Tresen um und murmelte »Verfluchtes Söldnerpack!«, aber so leise, dass De Vries die Möglichkeit hatte, so zu tun, als hätte er die Worte nicht gehört. Zwei weitere folgten ihm, sodass schließlich nur noch der Sprecher und die beiden Männer in der Mitte des Raumes standen, die ihm als Erste gefolgt waren.
»Hast du nichts Sinnvolleres zu tun, Kerl, als dich mit den Leuten anzulegen, die deine Stadt und deine Familie verteidigen?«, fragte De Vries jetzt in freundlicherem Ton.
»Schöne Verteidiger!«, stieß der Mann hervor. »Ihr habt doch selbst gerade gesagt, dass Ihr morgen abrückt! Und was machen wir, wenn Tilly kommt?«
Jetzt heißt es schon wieder »Ihr«, dachte Eik, der neugierig war, was De Vries auf diese nicht ganz unberechtigte Frage antworten würde.
»Wir haben Tilly erst vor einem Monat geschlagen«, erwiderte De Vries gelassen. »Wenn ihr ihm genauso entschlossen gegenübertretet wie mir, dann braucht euch nicht bange zu sein.« Er machte eine verächtliche Handbewegung. »Aber ich verwette mein gesundes Ohr, dass es dazu gar nicht erst kommen wird. Tilly wird sich hüten …«
Die Tür flog auf, und zwei Soldaten betraten hastig den Schankraum.
Eik sah De Vries an, der seine Aufmerksamkeit augenblicklich auf die beiden Männer richtete, die, wie Eik bemerkte, Unteroffiziere ihrer Kompanie waren.
»Fähnrich Schmachfeld, Herr Obristlieutenant! Obrist von Klitzing befiehlt alle Stabsoffiziere und Offiziere in sein Quartier! Befehlsausgabe!«
De Vries stieß einen Fluch aus, als er sah, dass sich das Schankmädchen ihm mit dem bestellten Lammbraten näherte. Dann sah er Eik an, bevor er den Blick wieder auf die beiden Unteroffiziere richtete. »Ich nehme an, die Sache kann nicht so lange warten, bis ich meinen Lammbraten verzehrt habe?«
Der Fähnrich sah seinen Kameraden an, ließ dann den Blick kurz durch die Schänke schweifen und zuckte mit den Schultern. »Der Herr Obrist hat gesagt, unverzüglich, Herr Obristlieutenant«, erwiderte er. »Der Stab rückt noch heute Abend ab.«
Daraufhin war De Vries tatsächlich überrascht. »Was? Heute Abend? Warum die Eile?«
Bevor der Fähnrich antworten konnte, flog die Tür erneut auf, und ein Mann stürmte herein. Er trug ein Wams mit einem Bandelier quer über der Brust, einen weichen Hut und einen Stoßdegen an seinem breiten Gürtel; er war ein Angehöriger der Stadtwache. »Tilly …!«, keuchte der Mann und hielt sich dann mit schmerzverzerrtem Gesicht die Seite, als wäre er eine weite Strecke gelaufen. »Tilly steht vor Leipzig! Alle Mann zu den Waffen!«
4. KAPITEL
Feldlager Tillys vor Leipzig
»Wir werden blutige Vergeltung üben! Die Männer dürsten nach Rache, das darf ich dem Herrn Generallieutenant versichern.«