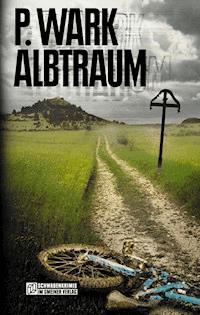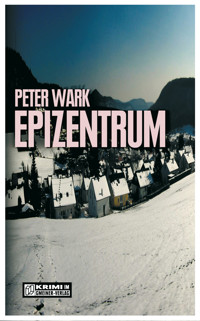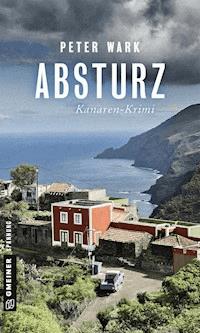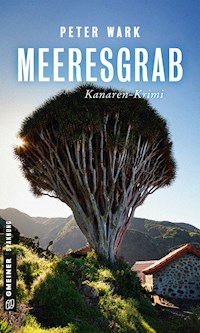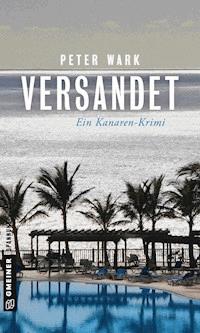
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Aussteiger Martin Ebel
- Sprache: Deutsch
Martin Ebel macht das, was er am liebsten mag: Der ehemalige Rechtsanwalt sitzt in seiner Wahlheimat La Palma am Strand, baut eine seiner Sandburgen und philosophiert über das Leben im Allgemeinen und sein Leben im Speziellen. Als ihm plötzlich eine leichenstarre Hand entgegenragt, ahnt er noch nicht, dass der Tote am Strand ein Teil seines früheren Lebens in Deutschland war. Als er auch noch zum Hauptverdächtigen in dem Mordfall wird, muss Ebel etwas unternehmen, um nicht unter die Räder zu kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Wark
Versandet
Ein Kanaren-Krimi
Zum Buch
Mord im Ferienparadies Ein Leichenfund an »seinem« Strand. Das ist so ziemlich das Letzte, womit Martin Ebel beim Bau einer Sandburg am Strand von Puerto de Tazacorte gerechnet hätte und es ist definitiv das Letzte, was er in seinem Leben gerade gebrauchen kann. Es läuft nicht besonders geschmeidig für den ehemaligen Rechtsanwalt, und das, obwohl er auf La Palma sein Paradies gefunden zu haben glaubt. Ebel lebt von der Hand in den Mund, verdient als Mountainbike-Guide und Wanderführer seine Brötchen, die Beziehung zu seiner einheimischen Freundin Carmen befindet sich in Schieflage. Dass die Polizei sich mangels Alternativen ausgerechnet an den Deutschen als Haupttatverdächtigen hält, stellt sein beschauliches Leben auf den Kopf. Gut, dass er einen funktionierenden Freundeskreis aus Einheimischen und anderen deutschen Aussteigern hat, der ihn immer wieder auffängt. Immer tiefer wird Ebel in den Mordfall um den Toten vom Strand verwickelt. Wird ihn sein altes Leben einholen?
Heimatverbunden und weltoffen: so sieht sich Autor Peter Wark. Seine Reiseleidenschaft schlägt sich auch in seinen Büchern nieder, die in Baden-Württemberg und Australien, in Stuttgart sowie auf den kanarischen Inseln spielen. Geboren wurde Wark auf der Schwäbischen Alb, was seiner geistigen und kulturellen Entwicklung – nach eigener Aussage – nicht geschadet hat. Über 30 Jahre war er als Redakteur für verschiedene Tageszeitungen tätig.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Albtraum (2012)
Epizentrum (2006)
Ballonglühen (2003)
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © embeki/fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5698-5
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Erstes Kapitel
1
Leere Versprechungen.
Nichts als leere Versprechungen.
Meine Hände steckten fast bis zu den Ellbogen in dem kleinen Sandhaufen, den ich vor mir aufgehäuft hatte. Die Brise vom Meer sorgte dafür, dass es an diesem Dienstagnachmittag am schwarzen Sandstrand von Puerto de Tazacorte trotz Temperaturen von 30 Grad einigermaßen angenehm war. Eine feine Sandschicht überzog meinen Körper, und das kräftige Dunkelblau meiner Badehose versuchte vergebens, gegen den sandfarbenen Überzug anzuleuchten. Der Strand erstreckte sich direkt vor der zehn Meter hohen Betonkaimauer, die das Hafenbecken von Puerto de Tazacorte vor den manchmal ungestümen Brechern des Atlantiks schützte. Die Sandburg, an deren Entstehung ich seit zwei Stunden arbeitete, war weit von der Vollendung entfernt. Sie würde wohl eine Ruine bleiben, bis sie mit Einsetzen der Flut von den unersättlichen Wellen verschluckt würde, wie einst unzählige Piratenschiffe.
Eine Sandburg zu errichten, ist eine diffizile Angelegenheit, der nicht viele Menschen tatsächlich gewachsen sind.
Außer mir war nur eine einheimische Familie mit einem auffallend dürren, aber gut gelaunten Opa am Strand, die mein Treiben nicht weiter verfolgte.
Ich war an diesem Nachmittag nicht recht bei der Sache.
Leere Versprechungen.
Geiger hatte mir einen Job versprochen. Na ja, genau genommen nicht Geiger selbst. Leute wie er versprechen Leuten wie mir nichts; sie haben ihre Untergebenen. Leute, die Leuten wie mir Versprechungen machen. Oder sie bedrohen. Vielleicht auch Unangenehmeres. Je nachdem. Dieser Mitarbeiter von Geiger war schon auf den ersten Blick einer von der unangenehmen Sorte. Einer, wie ich sie früher verteidigt hatte, in einem anderen Leben, als ich noch aufstrebender junger Rechtsanwalt in Stuttgart war. Die Sozietät Weißböck, Weißböck & Partner hatte sich auf die sehr einträgliche Verteidigung von Wirtschaftsstraftätern und Unterwelt-Größen spezialisiert, was moralisch betrachtet keinen Unterschied machte, und dabei bemerkenswerte, wirklich bemerkenswerte Erfolge erzielt. Für mich lag diese Zeit schon vier lange Jahre zurück, nachdem ich den Job nicht mehr wollte. Besser gesagt: Der Job wollte mich nicht mehr, aber das ist eine andere Geschichte.
Es war zwei Wochen her, dass ich in Geigers Büro in Los Llanos war, um mich nach irgendeiner Tätigkeit zu erkundigen, mit der Geld zu verdienen war. Wenn ich eine adrette Empfangsdame erwartet hatte, wurde ich zutiefst enttäuscht. Stattdessen fertigte mich dieser Typ ab: Geigers Lakai trug eine textile Beleidigung in Form eines zu keiner Dekade in Mode gewesenen Leopardenmuster-T-Shirts, das den Joops und Konsorten vermutlich einen Schreikrampf entlockt hätte. Ich sah mich vor die Wahl gestellt, zu erblinden oder zu kotzen, konnte durch eine geradezu übermenschliche Anstrengung aber beides vermeiden. Nein, es gebe im Moment keine Arbeit, hatte mir Leopardenfell mitgeteilt. Man wolle aber gerne meinen Namen und meine Adresse notieren, um zu gegebener Zeit wieder auf mich zukommen zu können. Mit anderen Worten: Ich würde nie wieder von Geigers Firmen hören. Geiger hatte, nach allem, was so erzählt wurde, eine ganze Menge Firmen.
Geiger selbst war so etwas wie ein Phantom. Jeder kannte jemanden, der ihn kannte. Kaum jemand konnte Genaues über ihn sagen, er wurde aber allgemein als grandioses Arschloch eingeschätzt. In der Hitparade der Skrupellosigkeit belegte er dem Hörensagen nach einen Spitzenplatz. Geiger hatte Geld, Macht und Einfluss wie kein Zweiter hier auf der Insel. Er war, wie man sich erzählte, vor etwa 20 Jahren aus Deutschland nach La Palma gekommen, also viele, viele Jahre vor mir. Geiger machte Geschäfte mit Immobilien, besaß eine Baufirma und war Herrscher über eine Reifenfabrik, die für das Festland produzierte und die man als die einzig nennenswerte Industrieansiedlung im Westen der Insel bezeichnen konnte. Wer nicht in der Landwirtschaft oder im Tourismus tätig war, arbeitete mit großer Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Weise für Geiger. So, wie die Dinge lagen, würde ich mich eines überhaupt nicht fernen Tages auch in die lange Reihe seiner Sklaven einordnen müssen. Wobei Ein- und Unterordnen nicht zu meinen Stärken zählte. Deshalb war ich auch nicht mehr Anwalt.
Wenn ich nur einen Job bei einem von Geigers Unternehmen bekommen könnte, der regelmäßig Geld abwarf. Nicht, dass ich diese Perspektive wirklich attraktiv fand, regelmäßige Arbeit an sich hatte für mich schon lange nichts Reizvolles mehr. Aber ein leeres Konto konnte einen auf Dauer in ziemliche Schwierigkeiten bringen. Selbst hier, auf der paradiesischsten aller Kanareninseln.
In den letzten Wochen waren Ebbe und Flut so ziemlich das Einzige, auf das ich mich verlassen konnte. Apropos Verlassen: Mit Carmen lief es in letzter Zeit auch nicht besonders großartig. Sie drohte mir gelegentlich damit, sich endgültig zu trennen. Das hätte natürlich bedeuten können, dass sie mich auch aus ihrer Wohnung in der Avenida Venezuela in Los Llanos schmeißen würde, was meine Situation zusätzlich erschweren dürfte. Carmen war manchmal ein wenig impulsiv. Seit dieser an sich unbedeutenden Sache mit der Urlauberin aus Düsseldorf hegte Carmen einen gewissen Groll gegen mich und war schon mal probeweise aus ihrer – unserer – Wohnung im ersten Stock direkt über ihrem Modeladen ausgezogen.
Sie habe mich oft genug gewarnt. So sprach sie zu mir und musste den Zeigefinger dabei gar nicht erst erheben. Es hatte etwas Melodramatisches. Wehe, wenn Carmen melodramatisch wurde!
Man muss einiges einstecken im Leben. Darin hatte ich Übung. Auch wenn die meisten Leute das einem Spross aus einer Diplomatenfamilie nicht unbedingt zutrauen. Meinem Vater bin ich heute dankbar dafür, dass ich einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend in Barcelona verbringen durfte, wo ich perfektes Spanisch ebenso lernte wie die Zuneigung zur mediterranen Lebensart. Mein Vater war im diplomatischen Dienst, ansonsten war er aber in Ordnung. Heute gingen meine Eltern stramm auf die Siebzig zu und lebten längst wieder in Deutschland am Bodensee. Manchmal besuchte ich sie, nur um festzustellen, dass wir es nicht lange miteinander aushielten. Nach einer Woche Zoff flog ich dann für gewöhnlich wieder zurück nach La Palma, das ich heute am ehesten von allen Plätzen unter der Sonne als meine Heimat bezeichnen würde. Heimat ist ein Begriff, über den sich am besten unter dem Einfluss geistiger Getränke philosophieren lässt. Für mich war Heimat keine Frage des Längen- und Breitengrades. Heimat ist dort, wo man sich aufhängt, wie ein bekannter Dramatiker einmal gesagt hatte. Der Satz gefiel mir.
Passte gut zu meiner Situation.
Zurzeit stand kein Flug nach Deutschland in Aussicht. Pekuniäre und andere Gründe sprachen dagegen. Ich war – wie gesagt – nicht ganz bei der Sache. Ein nicht näher zu fassendes Gefühl von Beunruhigung ließ sich nicht einfach mit einer Handbewegung wegwischen, so wie die Fliegen, die an diesem Strand herumschwirrten. Ich sah in die Ferne, auf das Meer hinaus und empfand dabei eine unerklärliche Leere. Während ich mir zum wiederholten Male meine Situation durch den Kopf gehen ließ, wühlte ich mit beiden Händen im Sand. Gesprächsfetzen von der vergnügten Familie mit dem gut gelaunten, klapperdürren Opa schwappten herüber.
Nicht viele Menschen haben ein Gespür für Sand. Ich schon. Auf einem Regal in meiner, besser in Carmens Wohnung, staubte eine relativ lange Reihe akkurat ausgerichteter kleiner Filmdosen wie Zinnsoldaten vor sich hin. Die Dosen enthielten Sand in allen Farbschattierungen von Stränden überall auf dieser Welt. Es war eine Marotte von mir, damals – lange vor La Palma – von meinen Reisen Sand mitzubringen. Jede Dose war fein säuberlich beschriftet und sagte mir, wo und wann ich sie befüllt hatte: 1986 Death Valley/USA, ebenfalls 1986 Volcanoes National Park/Hawaii, 1987 Nai Harn/Thailand, Vieux Fort/Guadeloupe, 1989 Saint James/Südafrika, 1991 Cape Howe/Australien und so weiter und so weiter.
Sand war etwas Faszinierendes für mich; nur wer das richtige Gefühl dafür hat, wird je eine außergewöhnliche Sandburg oder Sandskulptur zustande bringen. Dieses Gefühl für Sand – ich habe es tatsächlich. Und ich beschäftigte mich intensiv mit dem Bau von Sandburgen. Ohne übertreiben zu wollen, möchte ich sagen, dass ich einer der begabtesten Sandburgen-Erbauer bin, die ich kenne. Seit meine vergänglichen Kreationen meinem Freund Pepe, dem Herausgeber und Chefredakteur der Inselzeitung Correo del Valle, vor einigen Monaten eine Doppelseite mit Fotos wert waren, galten meine Sandgebilde als eine Art lokale Attraktion hier auf der Westseite der Insel. Fast immer, wenn ich an einer neuen Anlage arbeitete, kamen Touristen und einige Einheimische vorbei, um dem verrückten Deutschen beim Buddeln und Gestalten zuzuschauen. Hin und wieder konnte es vorkommen, dass plötzlich eine Handvoll Kinder mit Schaufeln und anderem Gerät vor mir stand und mir half. Durch meine Sandburgen war ich – so steht zu befürchten – in vielen holländischen, englischen und deutschen Fotoalben verewigt.
Mehr Fliegen, als mir lieb war, schwirrten durch die Luft. Schlimmer noch waren die ekligen kleinen Stechmücken, die es an diesem Tag darauf angelegt zu haben schienen, mir das Blut tröpfchenweise auszusaugen, so wie es im fernen Deutschland der Fiskus mit den Werktätigen tat. Eine von mir entwickelte Theorie besagt, dass Stechmücken im Lauf der Evolution einiges durchgemacht haben müssen, so wie sie ihren Hass auf alle anderen Lebewesen hemmungslos ausleben.
Ich blickte in die Ferne, dorthin wo Horizont und Ozean eins werden. Weit draußen waren zwei dunkle Punkte auszumachen, Fischerboote wahrscheinlich. Fischfang war immer noch eine der Haupteinnahmequellen und Tazacorte galt als das Zentrum des Fischfangs auf La Palma.
Die Luft roch nach Meer, Schweiß und Ungemach. Mit der Hand unternahm ich zum wiederholten Mal einen unsinnigen Versuch, eine dieser verdammten Stechmücken zu erwischen. Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte das Gefühl, dass sie mir den Mittelfinger zeigte und sich köstlich amüsierte.
Seufzend wandte ich mich wieder dem Sand zu. Im engen Umkreis um meinen Sitzplatz hatte ich schon ziemlich tief gegraben. Um Nachschub an Baumaterial zu bekommen, musste ich den Radius ausweiten. Beherzt griff ich zu einer meiner beiden Sandschaufeln und grub mich tief in den Untergrund ein. Dabei förderte ich neben den üblichen Treibholzresten mehrere benutzte Kondome, eine Tüte vom Spar-Supermarkt, ein nasses und schmutziges Bikini-Oberteil und eine vom Rost zerfressene Armbanduhr zutage. Eine tolle Ausbeute! Ich häufte Schaufel um Schaufel Sand neben die Mauern meiner Festung, bis ich auf Widerstand stieß.
Manchmal lagen große Steine oder Reste von Flutholz über einen Meter tief im Sand vergraben. An stürmischen Wintertagen verwandelten die heranrasenden Wellen den Strand in eine unwirklich scheinende Wüste aus Steinen und Treibholz.
Das verdammte Ding, was immer es auch sein mochte, machte mir erhebliche Schwierigkeiten. Zugleich stachelte es aber auch meinen Ehrgeiz an. Wo ich im Sand herumgrabe, bleibt kein Stein auf dem anderen, wie Pepe seinerzeit in seinem etwas übertrieben bildhaft ausgefallenen Artikel malerisch formuliert hatte. Ich legte um das hartnäckige Hindernis ein tiefes Loch frei. Mit der Schaufel fuhr ich immer wieder in den Sand hinein. Hart wie Stein schien das störende Objekt nicht unbedingt zu sein.
Ich grub und grub. Ein Stück Stoff kam zum Vorschein. Ich legte die Schaufel beiseite und zerrte mit der Hand daran. Es war ein komisches Gefühl. Gerade so als ob …
Mein Herzschlag legte an Tempo zu.
Ich buddelte weiter.
Bis sich mir aus dem Sand mehrere menschliche Finger entgegenstreckten.
2
Es war ein bizarres Bild: fünf Finger. An den Fingern war eine Hand. An der Hand war ein Arm. Was am Arm war, sollte ich erst später erfahren, nachdem ich dem frisch gebuddelten Loch meinen Mageninhalt anvertraut hatte. Es ließ sich nicht vermeiden, dass die Hand auch etwas abbekam. Ihrem Besitzer war es vermutlich egal.
Die Panikattacke kam schlagartig. Mein Kreislauf ging auf Achterbahnfahrt und schuld daran war nicht die Hitze. Mein Herz raste, der Schweiß brach mir aus. Kalte Angst kroch an mir hoch wie zuvor die Stechmücken. Seit diesem Moment weiß ich, was die Leute meinen, wenn sie davon reden, dass ihnen die Haare zu Berge stehen. Das Luftholen fiel mir schwer, schwerer noch fiel mir, den Blick von der Hand in der vollgekotzten Sandkuhle abzuwenden.
Mein Verhalten hatte die Neugier der palmerischen Familie neben mir erweckt. Ihre Gespräche waren plötzlich verstummt. Verstohlen blickten Vater, Mutter, drei Kinder und der Opa zu mir herüber. Er war tatsächlich unfassbar dünn, aber das war im Moment für mich von eher untergeordneter Bedeutung.
Mit einer fahrigen Bewegung wischte ich mir den Mund ab, glotzte dabei immer wieder auf die Finger. Es war eine linke Hand, wie ich erst jetzt bemerkte. Die Finger stachen aus dem Sand wie die Tuffkalksteingebilde im Mono Lake. Der Mono Lake ist extrem salzhaltig, wie mir ausgerechnet und unpassenderweise in genau diesem Augenblick einfiel, da ich einen unangenehmen Salzgeschmack im Mund spürte. Die Szenerie wirkte irreal und gleichzeitig gespenstisch realistisch. Weiß der Teufel, warum ich mich an die surrealistischen Skulpturen von Giacometti erinnert fühlte.
3
Sie hatten alle in Marsch gesetzt, die aufzutreiben waren.
Erst kam die Policia. Es waren die beiden örtlichen Polizisten, die ich vom Sehen her kannte. La Palma war eine kleine Insel. Die beiden blickten so hilflos drein, wie ich mich fühlte. Den beiden Ordnungshütern war klar, dass sie hier offensichtlich nicht ausreichend Ordnung gehütet hatten, sonst hätte nicht passieren können, was passiert war.
Kurz nach ihnen traf die Guardia Civilaus dem fünf Kilometer entfernten Los Llanos ein, das viele Einheimische – und ich übrigens auch – als heimliche Hauptstadt der Insel betrachteten. Die Bullen hatten alle acht Fahrzeuge und alle 20 Mann geschickt. Es kam nicht oft vor, dass sie mit Sirene und Karacho zu einem Einsatz fahren mussten. Sie genossen es. Zumindest genossen sie Sirene und Karacho, beim Einsatz war ich mir nicht so sicher. Bis eine ganze Anzahl uniformierter und ziviler Bullen von der Ostseite der Insel aus der offiziellen Hauptstadt Santa Cruz de La Palma eintrafen, waren fast zwei Stunden vergangen. Knappe zwei Stunden, in denen keiner so recht zu wissen schien, was zu tun war und in denen die Einwohnerschaft aus der weiten Umgebung angereist war. Die Buschtrommeln hatten funktioniert. Etwas Unerhörtes hatte sich ereignet und das sprach sich erstaunlich schnell herum.
Wie gesagt: La Palma ist eine kleine Insel.
Jeder wollte einen Blick auf die starr aus dem Boden ragende wachsfarbene Hand erhaschen und jeder wollte sich an der allgemeinen Aufregung beteiligen. Obwohl auf La Palma nur knapp über 100 Einwohner pro Quadratkilometer leben, schienen die meisten sich an dem sonst so malerischen Strand eingefunden zu haben. Es wurde lebhaft diskutiert. So, wie es aussah, nahm man das Schlimmste an und ich, der leicht verrückte, Sandburgen bauende aleman, hatte mich durch meine pure Anwesenheit höchst verdächtig gemacht. Den Opa verdächtigte jedenfalls niemand irgendeiner Unregelmäßigkeit, wie ich den Gesprächsfetzen entnehmen konnte. Mittlerweile hatte ich mir Shorts und ein T-Shirt übergezogen, die ich in meinem kleinen Seesack dabei hatte, in dem ich immer meine Schaufeln und Spaten an den Strand trug. Die Schaufel, die ich heute Nachmittag bei mir hatte, war zu groß für den Seesack, sodass der Stiel oben herauslugte, bevor ich die Schaufel aus dem Sack befreit hatte.
Der Stiel hatte aus dem Seesack herausgeragt wie die fünf Finger vor mir aus dem Sand.
Ich war von den Männern der Guardia Civil befragt worden. Befragt, wohlgemerkt, nicht verhört.
Der Hauch der Ratlosigkeit lag ebenso in der Luft wie der des Todes und mischte sich mit der Seeluft, die ich an anderen Tagen als würzig bezeichnet hätte. Jetzt schien sie eher modrig zu riechen.
Ein etwa 50-jähriger Uniformierter von der Truppe aus Santa Cruz nahm die Sache schließlich in die Hand. Er strahlte eine Art natürlicher Autorität aus, derer er sich sehr bewusst war. Er ordnete an, dass das vermaledeite Sandloch abzusperren sei. Die beiden örtlichen Polizisten schienen froh ob dieser Aufgabe, doch wurde ihr Eifer schnell gebremst, indem der Uniformierte mehrere seiner Männer aus der Hauptstadt damit betraute. Er befehligte in einem Ton, der Widerspruch kategorisch ausschloss. Die Männer beeilten sich, seine in knappen Sätzen vorgetragenen Befehle auszuführen.
»Verzeihen Sie.« Ein zivil gekleideter Mann, der mir vorhin als stiller Beobachter aufgefallen war, sprach mich an. Bisher hatte er sich im Hintergrund gehalten, als gehöre er nicht zu der Szenerie.
Klar verzieh ich. Im Verzeihen bin ich ein echtes As.
Er war etwas kleiner als ich, trug eine dunkle Hose und ein kurzärmeliges Hemd, dessen blütenweiße Farbe Meister Propers Selbstbewusstsein ordentlich anheben würde. Sein glattes, aber volles und pechschwarzes Haar wurde von einem Seitenscheitel in Zaum gehalten und stand in auffallendem Kontrast zur Farbe seines Hemdes. Tiefschwarz auch der mächtige, ausgesprochen gepflegt wirkende Schnurrbart. Das Einzige an dem Mann, das nicht wirkte wie aus dem Ei gepellt, waren die feinen Halbschuhe, die nicht an diesen Strand gehörten und über und über mit Sand bedeckt waren. Auch das Schuhwerk war vor einer halben Stunde bestimmt noch makellos gewesen, da war ich mir sicher.
Er stellte sich als Kommissar Esquivel von der Kriminalpolizei in Santa Cruz vor und wedelte mit einem Ausweis vor meinem Gesicht herum. Damit war nun wirklich nicht zu spaßen. Wer auf den Kanaren ein derart offizielles Papier besaß, hatte in aller Regel tatsächlich etwas zu melden und vermittelte das seiner Umgebung für gewöhnlich durch ein Benehmen, das sich in etwa im Gleichgewicht zwischen Belehrung und Herablassung bewegte. Je nach individuellem Charakter des Ausweisinhabers schlug es mehr auf die eine oder andere Seite aus.
Weder die Temperaturen noch das Außergewöhnliche der Situation schienen Señor Esquivel etwas anhaben zu können. Er wirkte souverän, so als ruhe er in sich selbst. Was das für mich bedeutete, würde sich noch herausstellen müssen. Wie schon früher fragte ich mich, was einen halbwegs gebildeten, intelligenten und nicht gänzlich verzweifelten jungen Menschen dazu bringen konnte, sich dem Berufsstand der Bullen anzuschließen. Wie schon früher blieb ich mir die Antwort schuldig.
»Darf ich fragen, wer Sie sind?«
Ich sagte es ihm.
Er blickte mich mit einem Ausdruck aus seinen dunklen Augen an, den ich nicht zu deuten wusste. »Sie wirken nicht wie ein gewöhnlicher Tourist«, sagte er. Genau betrachtet war der Bursche möglicherweise gar nicht so übel. Aber wahrscheinlicher war, dass ihm die beiden örtlichen Polizisten schon alles über mich erzählt hatten, was sie wussten. Und dass er schon längst wusste, dass ich Martin Ebel aus Stuttgart war, der seit vier Jahren in Los Llanos lebte.
Bitte, ich spielte das Spiel mit. »Ich lebe seit einigen Jahren in Los Llanos.« In Deutschland hätte ich in einer Situation wie dieser, ohne zu überlegen, die Art meines Broterwerbs hinzugefügt. Abgesehen davon, dass ich keinem regelmäßigen Broterwerb nachging, schien es mir hier nicht so wichtig. Die Spanier hatten eine andere Einstellung zur Bedeutung der Arbeit; eine die mir sympathischer war als die, die ich in Deutschland kennengelernt hatte.
»Sie haben den oder die Tote gefunden?«, fragte er. Dabei wussten doch schon ungefähr ein paar Tausend Leute auf Palma, dass ich den oder die Tote gefunden hatte. Falls an der Hand noch ein Toter oder eine Tote dran hing. Man hört heutzutage ja so einiges …
»Ja«, sagte ich.
»Als Sie im Sand gegraben haben.« Eine Feststellung, keine Frage.
»Ja.« Meine Güte, war ich einsilbig. Ob das angesichts der Umstände zu meiner Entlastung beitragen würde?
»Sie graben regelmäßig am Strand, haben mir die Kollegen gesagt.« Mag sein, dass ich mich täuschte, aber ich hatte das Gefühl, unter dem buschigen Schnauzer ein Zucken bemerkt zu haben.
»Ja, ich baue ganz gerne Sandburgen oder Sandfiguren. Das entspannt mich.«
»Und dabei sind Sie auf diese menschliche Hand gestoßen, vor …«, er blickte kurz auf seine goldene Armbanduhr, »… etwa zweieinhalb Stunden?« Das wusste er doch längst.
»Ja.« Ich nickte.
Noch immer hatte Esquivel seine harten Augen auf mich geheftet, als wolle er mich mit Blicken an die Betonkaimauer nageln, damit ich ihm nicht davonlief.
»Wovon leben Sie?« Also doch. Die Sache mit der spanischen Einstellung zur Arbeit musste ich bei Gelegenheit noch einmal überdenken.
Wovon lebte ich? Eine gute Frage. Einem traditionsbewussten Palmero zu erklären, dass man eine Freundin aus gutem Haus hat, die einen, nennen wir es der Einfachheit halber unterstützt, ist glatt ein Ding der Unmöglichkeit.
Also versuchte ich es anders. »Sie wissen sicher, dass man hier viel billiger leben kann als in Deutschland. Ich habe Ersparnisse. Außerdem habe ich regelmäßig Gelegenheitsjobs.«
Das war nicht gelogen. Gelegentlich half ich in Carmens Laden aus. Ich hatte zwar von der Mode, die sie verkaufte keine Ahnung, aber die Kundinnen schien das nicht zu stören. Sie wussten eigentlich immer ganz genau, was sie wollten, und nahmen dann noch ein zweites oder drittes Teil mit. Auch auf La Palma gab es Leute, die den Euro nicht zweimal umdrehen mussten. In den Laden kamen fast ausschließlich Frauen, die Männer kamen eher wegen Carmen als wegen der Klamotten.
»Können Sie diese Jobs etwas genauer definieren?« Esquivels Fragen ließen mir wenig Spielraum.
»Meine Lebensgefährtin führt ein Modegeschäft in Los Llanos, in dem ich mitarbeite.«
»Und weiter?«
»Weiter was?«
»Sie sprachen von mehreren Jobs.«
»Ja, ja.« Er verursachte mir Unbehagen. »Regelmäßig arbeite ich als Tourenführer für die Wander- und Bikestation.« Auch das war nicht gelogen. Dank meiner Begeisterung für das Mountainbiken hatte ich bald nach meiner Ankunft auf der Insel Siggi kennengelernt, der schon lange auf La Palma lebte und mit seiner Frau Claudia die Bikestation in Los Llanos führte. Seit immer mehr deutsche Touristen Fahrrad-Urlaub machten, konnte er sich vor Arbeit kaum retten. Schon seit Jahren arbeitete ich für Siggi und führte Wandergruppen und Biker über die Insel – für mich eine der wenigen denkbaren Möglichkeiten, Geld zu verdienen und dabei sogar Spaß zu haben. Manchmal wenigstens.
»Sie werden verstehen, dass wir das alles nachprüfen müssen. Ich schicke Ihnen gleich einen Kollegen vorbei, der Ihre Adresse aufnimmt. Wenn Sie hier weiter zuschauen wollen, habe ich nichts dagegen. Schließlich trampeln genügend Leute herum.«
Mein Unbehagen wuchs. Esquivel drehte sich halb von mir ab, um plötzlich innezuhalten und mit dem Finger auf mich zu zeigen. »Eine Frage hätte ich noch.« Das musste er sich beim guten alten Columbo im Fernsehen abgeschaut haben. »Sie haben nicht zufällig eine Ahnung, wer da im Sand begraben liegt?«
Ich schüttelte den Kopf. Einen Kopf, um den ich mich zu fürchten begann.
Esquivel war hier der Häuptling.
Das wurde mir klar, als ich sah, wie der Uniformierte, der vorhin das Kommando geführt hatte, fast schon sehnsüchtig auf eine Anweisung wartete. Und Esquivel vermittelte den Eindruck, als wisse er, was zu tun sei. Er ließ vorsichtig den Sand um die Hand herum abtragen. So verschwand wenigstens meine Kotze. Esquivel nahm einen Kollegen zur Seite, der ein Köfferchen bei sich trug, und auf den er leise einredete. Der Typ war wohl die Spurensicherung.
Von einem Mord hatte ich auf La Palma noch nie gehört. Ein Einbruch, aufgebrochene Autos, und hin und wieder auch Drogenkriminalität in Santa Cruz und Los Llanos, davon las man zunehmend im Correo del Valle. Aber Mord und Totschlag war etwas, das ich glaubte, in meiner alten Welt zurückgelassen zu haben. Wie sehr ich mich täuschte, sollte mir noch schmerzhaft klar werden.
Wo sie so schnell die Schaufeln und anderes Gerät zum Graben aufgetrieben hatten, wusste ich nicht. Konzentriert gruben mehrere Männer den Sand rund um die Leiche ab. Sie arbeiteten schnell, aber doch vorsichtig. Esquivel gab hin und wieder knappe Anweisungen. Auch seinen Kollegen gegenüber benahm er sich in der gleichen sachlichen Art und Weise wie vorhin bei mir. Schwer vorzustellen, dass er abends mit ihnen ein Bier trinken ging.
Die Schaulustigen drängten sich näher an die Absperrung. Mütter versuchten, ihre Kinder aus den ersten Reihen zu zerren und dabei selbst noch einen ausgiebigen Blick auf das Zentrum des Geschehens zu werfen. Ganz vorne in der Menge sah ich Pepe mit seinem Notizblock. Er schaute mich fragend an. Ich zuckte die Achseln.
Pepe war nicht alleine gekommen, er hatte seinen Fotografen Jorge dabei, den alle wegen seiner Vorliebe für den legendären brasilianischen Fußballer nur Zico nannten. Esquivel und einige der anderen Polizisten hatten sich Zigaretten angezündet. Es dauerte nicht lange, bis zur Gewissheit wurde, was eigentlich allen schon längst klar war. Im Sand, ein gutes Stück unter der Oberfläche, lag eine Leiche.
Nicht, dass mir das viel ausgemacht hätte, wäre ich nur einer der zahlreichen Zuschauer gewesen. Es war auch nicht die erste Leiche, die ich sah. Wer als Anwalt mit den ganz harten Jungs aus dem Milieu verkehrt, wird früher oder später mit dem einen oder anderen Todesfall zu tun haben. Einer meiner Mandanten, der als Mann fürs Grobe bei einem Szene-König galt, hatte einmal zu mir gesagt: »Solange du nicht mindestens zwei Typen auf einmal kalt machst, interessiert sich kein Schwein für dich.« Ich wusste bis heute nicht, ob er die beiden Morde begangen hatte, für die sie ihn eingebuchtet hatten. Erst hatte er es mir nicht sagen wollen, dann konnte er nicht mehr. Bei einem Sturz im Gefängnishof, dessen Umstände nie geklärt wurden, hatte er sein verkorkstes Leben ausgehaucht. Musste sich verdammt tapsig angestellt haben. Dafür, dass der Boden vollkommen ebenerdig war, stürzte er ausgesprochen unglücklich. Zu diesem Ergebnis waren jedenfalls die Ermittlungsbehörden gekommen, als sie die Aktendeckel zuklappten. Dem Vorwurf, zu intensiv zu ermitteln, hatten sie sich damals nicht gerade ausgesetzt.
Esquivels Kollege, der meine Personalien aufnahm, war ebenfalls in Zivil. Wie sein Vorgesetzter behandelte auch er mich distanziert-höflich.
»Ihren Namen und Ihre Adresse bitte.«
»Martin Ebel, deutscher Staatsbürger, wohnhaft in der Avenida Venezuela in Los Llanos.«
»Ihr Beruf?«
»Ich war Anwalt.«
»Und was sind Sie jetzt?«
»Urlauber, Lebenskünstler, Aussteiger, Gelegenheitsjobber. Suchen Sie sich etwas aus.«
Er hob die Augenbraue leicht und sah mich missbilligend an, sagte aber nichts weiter.
»Einen Ausweis tragen Sie nicht zufällig bei sich?«
»Nein.«
»Dann werden wir Sie später nach Hause begleiten, wo Sie uns Ihren Ausweis zeigen können.«
Na prima. Bullen in der Wohnung. Das würde Carmen freuen, falls sie es denn überhaupt mitbekommen sollte.
Die Polizei schien ausschließlich in Frageform zu reden. »Wann sind Sie heute an den Strand gekommen und was haben Sie gemacht, bevor Sie das da …«, er deutete mit der Hand über seine Schulter, »… gefunden haben?«
Und so weiter, und so weiter.
Er fragte mir starke zehn Minuten Löcher in den Bauch, bevor er sich knapp für meine Kooperationsbereitschaft bedankte und sich wieder dem Gewusel um die Sandkuhle zuwandte. Nicht, ohne mich vorher freundlich darauf aufmerksam zu machen, ich möge doch bitteschön wie alle anderen auch hinter die Absperrung verschwinden.
Das tat ich auch, doch ich wurde nicht von der glotzenden Menge verschluckt. Man ließ mir Platz. Genauer gesagt, wich man vor mir zurück. Schließlich hatte ich eine Leiche ausgebuddelt, und sie in den Augen der meisten vielleicht vorher auch eingegraben. Ich hatte ganz entschieden ein Problem mit meiner Aura.
Sie hatten den starren Körper freigelegt. Der Geräuschpegel rund um das Sandloch stieg. Es war die Leiche eines Mannes. Auch ohne den stützenden Sand ragte die steife Hand noch immer steil nach oben und zeigte dorthin, wo sich die Seele des unglückseligen Opfers jetzt vielleicht befand.
Das auffallend hellblonde Haar des Mannes war trotz des Sandes, der immer wieder in die Grube rieselte, deutlich zu erkennen. Um einen Spanier handelte es sich bei diesem bedauernswerten Menschen mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht. Andererseits würde sich wohl auch nicht die Hoffnung erfüllen, dass es Donald Trump war. In meinen Eingeweiden rumorte es. Mit einer Hand wischte einer von Esquivels Männern der Leiche den Sand aus dem Gesicht.
Das Rumoren steigerte sich zu einem mittleren Beben. Ich kannte den Mann, der da so was von tot in einem gottverdammten Sandloch am Strand von Puerto de Tazacorte lag.
4
Sie bewegten die Leiche nicht.
Der Mann mit dem Köfferchen machte sich an ihr zu schaffen. Irgendwer fotografierte das Ganze. Wie im Fernsehkrimi, nur dass das hier die verfluchte Realität war. Vorsichtig umrundete Esquivel den Toten, einen auffallend muskulösen Mann, der viel Zeit im Fitnessstudio verbracht zu haben schien. Angesichts der aktuellen Umstände war es wohl verlorene Zeit.
Der Kommissar sah die Leiche gründlich von allen Seiten an, vermied aber, sie zu berühren. Er bückte sich, neigte den Kopf, schaute sich das Gesicht des Toten genau an und scannte ihn mit seinem Blick schließlich von oben nach unten, dann wieder von unten nach oben. Ich musste es zugeben, der Bulle aus Santa Cruz strahlte Kompetenz aus. Der Tote war mit einer blauen Jeans und einem bunten Allerweltshemd bekleidet, Schuhe hatte er keine an. Um den Hals hing eine dünne Goldkette. Von meinem Standpunkt aus konnte ich keine äußerliche Verletzung erkennen, aber das wollte nichts heißen. Mir war längst klar, dass die Sache für mich mit vielen Scherereien verbunden sein würde.
Schererei war früher einmal mein zweiter Vorname, doch das hatte sich längst geändert. Inzwischen genoss ich die ruhig und gleichsam dahingleitenden Tage. Die schienen vorerst vorbei zu sein.
Es dauerte noch ein paar Minuten, bis ich dem Gesicht des Toten einen Namen und eine Geschichte zuordnen konnte. Gerade, als sich die gedanklichen Nebel lichteten und das Kramen im Kleinhirn Erfolg zeigen wollte, hatte sich Pepe zu mir durchgekämpft. Seine Stimme klang für den Anlass eine Spur zu fröhlich.
»Würdest du widersprechen, wenn ich vermuten würde, dass du in Schwierigkeiten steckst?« Pepe konnte einen echt aufbauen.
»In relativ großen Schwierigkeiten, wenn ich die Lage richtig deute.«
»Habe ich ein Glück«, jubilierte Pepe, »Exklusivinterview mit dem Mann, der Sandburgen baut und Leichen ausgräbt.«
»Ich gebe keine Interviews. Außerdem bin ich zu der Leiche gekommen wie die Jungfrau zum Kind.«
»Jungfrauen sind auch nicht mehr das, was sie früher einmal waren, compadre.« Er lachte aus ganzem Herzen. Seine Fröhlichkeit nervte mich.
Ich sagte es ihm.
Pepe war nicht beeindruckt. »Du scheinst dazu zu neigen, in Stresssituationen dein inneres Gleichgewicht zu verlieren. Kopf hoch, Anwalt.«
»Du weißt, ich bin kein Anwalt mehr und es nervt mich, Anwalt genannt zu werden.«