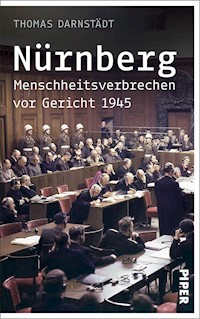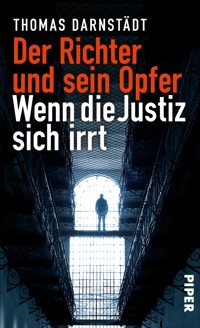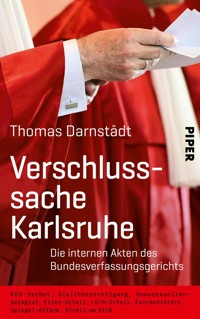
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Archive des Bundesverfassungsgerichts waren so verschlossen wie die des Vatikans. Nun endlich sind die alten Akten der großen Prozesse um die junge Demokratie des Grundgesetzes zugänglich. Die Karlsruher Papiere illustrieren, wie hinter den Kulissen um die Grundwerte der neuen Verfassung gerungen wurde - und wie auf den Trümmern eines Staates, der von Rassenhass und Kriegsgeschrei geprägt war, eine freiheitliche Gesellschaft entstehen konnte, die sich der Menschenwürde und dem Frieden verschrieben hat. Nach Sichtung hunderter Akten zeigt Thomas Darnstädt anhand der Debatten um Parteiverbote, Schwangerschaftsabbruch oder Gleichberechtigung und um Polit-Intrigen wie der Spiegel-Affäre oder dem Adenauer-Fernsehen, wie die Richter in Karlsruhe die Weichen in die Zukunft Deutschlands stellten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Meinen Eltern –
die mich von Beginn an lehrten, welch Glück es ist,
in der Demokratie des Grundgesetzes zu leben
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Uli Deck/dpa
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Übersichtstafel
Einleitung
Die Karlsruhe-Papiere. Wie 24 Richter die Demokratie in Deutschland neu erfanden
1 KPD-Verbot
Der Krieg der Welten. Parteienstaat oder liberale Demokratie?
2 Gleichberechtigung
Fünf Wörter. Ist das Patriarchat gottgegeben?
3 Elfes-Urteil
Die Erfindung der Freiheit. Soll alles erlaubt sein, was nicht verboten ist?
4 Homosexuellen-Verfolgung
Schande. Wie das Sittengesetz nach Karlsruhe kam
5 Lüth-Urteil
Wir sind die Guten. Welchen Wert hat die Freiheit?
6 Fernseh-Streit
Der Fall Adenauer. Souverän ist, wer über die öffentliche Meinungsbildung verfügt
7 »Spiegel«-Affäre
Der Abgrund. Was dürfen Bürger wissen?
8 § 218-Streit
Die Gretchenfrage. Ein Fall, für den es keine Lösung gibt
Verzeichnis wichtiger im Text verwendeter Monografien und Urteilssammlungen
Abbildungsnachweis
Anmerkungen
Fall Nummer eins – Die älteste Akte des Bundesverfassungsgerichts über einen Streit zwischen der Badischen Landesregierung und der Bundesregierung um die geplante Volksabstimmung über einen »Südweststaat«. [4]
Einleitung
Die Karlsruhe-Papiere. Wie 24 Richter die Demokratie in Deutschland neu erfanden
Kleine graue Kästen
Mit der Geschichte der deutschen Demokratie muss man sehr sorgfältig umgehen. 18 Grad Celsius, 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, das ist das Schonklima in jenem neonbeleuchteten Bunker, wo sie untergebracht ist. Kein Staub kann sich hier über die Vergangenheit legen. Da ruhen sie, in den deckenhohen Rollregalen des Koblenzer Bundesarchivs, sortiert in gestapelten kleinen grauen Kästen: die Karlsruhe-Papiere.
Die Kästen haben an der Seite eine schwarze Schlaufe. Zieht man daran, öffnet sich die Klappe aus grauer Pappe und gibt den Inhalt frei: flaschengrüne Aktenordner, abgegriffen, eingerissen, voller Stempel und amtlicher Vermerke. »Bundesverfassungsgericht« steht vorn drauf, drunter »Verfahren«. Die älteste Akte, knapp zusammengehalten mit schwarzem Klebeband, trägt das in Schönschrift hingemalte Aktenzeichen 2 BvG 1/51. Das sind die Dokumente eines Prozesses zwischen der Badischen Landesregierung und der Bundesregierung um die geplante Volksabstimmung über einen »Südweststaat«.
So beginnt die Geschichte der Demokratie des Grundgesetzes. Wie sich aus den Trümmern einer historischen Katastrophe, am Tatort eines Jahrtausendverbrechens, im Zentrum eines soeben untergegangenen Terrorregimes, in Deutschland also, ein blühendes, freiheitliches Gemeinwesen entwickeln konnte, das sich einer Politik des Friedens und der Menschenrechte verschrieb: Das findet sich in den kleinen grauen Kästen. Dass das Grundgesetz, jenes als Provisorium einer Verfassung gedachte schmale Bändchen, siebzig Jahre nach seinem Inkrafttreten von Politikern überall auf der Welt als Glücksfall der deutschen Geschichte betrachtet wird, als Garantie für gute Nachbarschaft mit dieser unheimlichen Großmacht in Europas Mitte, dass die Deutschen im zweiten Anlauf eine Demokratie zum Funktionieren brachten, die sich auch in Krisenzeiten als sturmfest und vertrauenswürdig erweisen würde – das alles ist ohne das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nicht denkbar.
Die Männer und Frauen in ihren roten Roben haben – Fall für Fall – das Grundgesetz zum Betriebssystem eines freiheitlichen Staates gemacht, das mittlerweile in viele Länder der Welt exportiert wurde. Und die Einsicht, dass die beste Verfassung nichts taugt, wenn nicht ein mächtiges Verfassungsgericht sie durchsetzt und mit Leben erfüllt, hat sich von Deutschland aus in nahezu alle jungen Demokratien verbreitet. So zwingend erscheint andererseits der in Deutschland demonstrierte Zusammenhang zwischen Bürgerfreiheit und Verfassungsgerichtsbarkeit, dass Regenten mit autoritären Ambitionen – etwa in Polen oder der Türkei – als Erstes beginnen, ihr Verfassungsgericht zu demontieren. »Karlsruhe« ist in siebzig Jahren Grundgesetz zur Formel für das Gelingen von Demokratie geworden. »Die Erfolgsgeschichte des Grundgesetzes lässt sich nicht von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts trennen«, bilanziert der ehemalige Verfassungsrichter und Staatsrechtsprofessor Dieter Grimm. Und wenn es einmal klemmte mit der bundesdeutschen Demokratie, bewährte sich das Karlsruher Gericht als schnelle Eingreiftruppe: »Die Defizite des parteienstaatlichen Parlamentarismus mit seinen Repräsentationslücken und strukturellen Entscheidungsschwächen« seien von den Karlsruhern immer wieder durch »kompensatorische Handlungsanteile« am politischen Prozess ausgeglichen worden, schreibt Horst Dreier, der Herausgeber des führenden deutschen Grundgesetz-Kommentars.[1]
Das Geheimnis von Karlsruhe: Wie haben die das gemacht? Was ist das Rezept für die Alchemie, mit der in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts aus dem braunen Sumpf Deutschlands das Gold der Freiheit, der Gleichheit, der Menschenwürde gewonnen wurde? Wie sind die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zustande gekommen, die heute das Verfassungsleben der Bundesrepublik prägen?[2]
Die Schöpfungsgeschichte der deutschen Demokratie trägt die Archivnummer B 237. Historiker, Verfassungsrechtler, Politikwissenschaftler graben unter dieser Nummer nach Antworten in den Rollregalen des Bundesarchivs. B 237 ist der Code, unter dem die Karlsruher Akten verwaltet werden. Eine vierköpfige Projektgruppe sitzt auch 2019, am 70. Geburtstag des Grundgesetzes, am hundertsten Gründungstag der verunglückten ersten, der Weimarer Demokratie, im Achtzigerjahre-Zweckbau auf der Koblenzer Kartause, klebt und pflegt und restauriert die flaschengrünen Mappen aus Karlsruhe. Gut drei Kilometer Karlsruhe-Papiere haben sie mittlerweile zusammen: Getipptes auf dünnem Durchschlagpapier, Hektografiertes von Wachsmatrizen, handschriftliche Notizen der Richter, geschmückt mit gemalten Mustern als Produkt langweiliger Sitzungen. Bissige Randbemerkungen an den Ausarbeitungen der Kollegen. Böse Briefe aus dem Bundeskanzleramt. Einladungen zur Weihnachtsfeier mit Julklapp. Aus dem Nähkästchen der Demokratie. Alles muss in die kleinen grauen Kästchen mit der schwarzen Lasche. Alles für immer. Bei 18 Grad und 50 Prozent Luftfeuchte.
Das Orakel im Rechtsstaat
Kaum dämpft der graue Teppich das Volksgemurmel im Saal. Doch dann wird es ganz still. Ein Herold in der blauen Kluft der Justizbediensteten tritt neben den Ständer mit der deutschen Fahne und verkündet: »Das Bundesverfassungsgericht!« Alles erhebt sich, die Tür in der hellen Holzwand hinter dem Richtertisch geht auf. Feierlich betreten die Richter in ihren roten Roben mit den weißen Beffchen in genau festgelegter Reihenfolge den Sitzungssaal, nehmen ihre runden Hüte ab und legen sie neben sich. Keine Orgelmusik, kein Weihrauch. Das braucht es auch nicht. Das Kollegium, das hier »im Namen des Volkes« auftritt, bezieht seine Erhabenheit aus seiner Autorität – und seine Autorität aus dem Recht des letzten Wortes. Niemand darf dem Bundesverfassungsgericht widersprechen – weil das so in der Verfassung steht. Und kaum jemand will ihm widersprechen – weil das Gericht im Volke, in dessen Namen es urteilt, nahezu unbegrenztes Vertrauen genießt.
So nehmen die Karlsruher Richter an jenem Nimbus teil, auf dem schon die Seher der Antike ihre Macht gründeten: dem Nimbus der Unfehlbarkeit. Das Gremium, das inmitten des idyllischen Karlsruher Schlossparks in einem zugleich schicken und schlichten Neubau residiert, ist ein Orakel im Rechtsstaat. Jeder Bürger, jeder Politiker, jedes Verfassungsorgan kann sich mit seinem Anliegen an die Männer und Frauen in ihren roten Roben wenden. Und niemand, ob Kanzler, Abgeordneter oder Bürger, kann sicher sein, was er zur Antwort bekommt.
Was Wunder, dass sich die Leute im Schlosspark nicht in ihre Karten schauen lassen wollen. Und jahrzehntelang ist es dem Gericht auch gelungen, sein Geheimnis zu bewahren. Das Geheimnis der Herstellung von Verfassungsgerichtsentscheidungen offenbart sich nicht in den mittlerweile mehr als 140 Bänden der amtlichen Urteilssammlung des Gerichts. Darin finden sich die Ergebnisse der Arbeit am Grundgesetz, die Begründungen der Urteile und neuerdings manchmal auch »abweichende Meinungen« der Richter, die sich der Mehrheit im Senat nicht anschließen wollten. Das ist die Darstellung von Verfassungsrecht, das Schaufenster der Demokratie. Doch wie es entstanden ist, woher die Richter ihre Erkenntnisse und Einsichten über das Richtige und das Falsche wirklich bezogen, das ist in den Akten verborgen. Und da sollte es bleiben. Die Geschichte der Karlsruhe-Akten ist geprägt von zähem Ringen der Aktensammler des Bundesarchivs mit dem Gericht. Seit den Sechzigerjahren reisten die Koblenzer Archivare immer wieder in die Residenz des Rechts, um die Papiere zu verlangen – mit mäßigem Erfolg. Zwar lieferten die Karlsruher bereitwillig tonnenweise Alt-Akten in Koblenz ab, doch das war nur der Platznot im Gericht geschuldet. Die Archivare durften die Prozessakten stapeln, aber nicht zu »Archivgut« machen – das heißt, registrieren und für die Allgemeinheit öffnen. Die interessanten Sachen blieben ohnehin unter Karlsruher Kontrolle: Akten mit den unterschiedlichen Urteilsentwürfen, die oft einander widersprechenden Voten der Richter, die mit einem Fall befasst waren.
Doch gerade diese Präliminarien, so war den Koblenzer Archivaren klar, sind von unschätzbarem zeitgeschichtlichem Wert. »In den Nebenakten und Handakten muss ein erheblicher Teil gerade dessen stecken, worauf es dem Bundesarchiv unter historisch-wissenschaftlichen Gesichtspunkten ankommt«, heißt es in einem Vermerk des Archivs aus dem Jahr 1965. »Da die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik erst seit Entstehen des Karlsruher Gerichts ihre Ausbildung gefunden hat, muss erwartet werden, dass in den dissentierenden Voten und Stellungnahmen vor der Urteilsfindung, die eben nicht mehr in die Hauptakte eingehen, das Werden der Verfassungsgerichtsbarkeit und die Herausarbeitung der verfassungsrechtlich wesentlichen Gesichtspunkte zu erkennen sein müsste«, schrieben die Archivare schon damals. Aber alle drängenden Briefe aus Koblenz wurden in Karlsruhe stets freundlich hinhaltend beschieden: »Wir kommen darauf zurück.«
»Akten raus!« Die Forderung von Bürgerinitiativen und seit den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts zunehmend auch von Vertretern der großen Parteien in Deutschland an die Staatsgewalten, ihre Arbeit transparenter zu machen, stieß in Karlsruhe auf taube Ohren. Wie sich damals der Gerichtspräsident Ernst Benda querlegte, haben die Koblenzer nicht vergessen. Der habe, so notierte man verärgert beim Bundesarchiv im Januar 1979, bezweifelt, »ob die Archivare genügend Kenntnisse und Fingerspitzengefühl hätten, um das rechte Maß an Aufhebenswertem zu finden«. Benda fürchtete wohl um die Unbefangenheit unter den Richter-Kollegen, wenn alles, was sie notierten, eines Tages ans Licht käme: Die »bisher geübte Flüchtigkeit« in den Voten, so äußerte der Präsident laut Vermerk der Bundesarchivare, drohe dann »langatmigen Selbstreflexionen« für die Geschichtsbücher zu weichen.
Dass die Hochburg des Grundgesetzes eine Blackbox sein soll, deren geheimnisvolle innere Funktionalitäten Geheimnisse bleiben müssen, war von Anfang an ausgemachte Sache. Als es 1950 darum ging, für das neu erfundene Gericht eine gesetzliche Grundlage zu schaffen – das Bundesverfassungsgerichtsgesetz –, war es den Parlamentariern der Unionsmehrheit wichtig, rechtzeitig einen Vorhang vor der Arbeit des Gerichts herunterzulassen: Die in einem Entwurf schon damals vorgesehene Veröffentlichung von Sondervoten einzelner Richter wurde vom zuständigen Unterausschuss wieder gestrichen. Begründung: »Mangelnde Reife des deutschen Volkes«.[3] Wenn deutlich werde, dass auch das letzte Wort im neuen Staate Menschenwerk sei, Ansichtssache, diskutiert, strittig gar, sei das »Ansehen des Gerichtes« und »die Autorität der Entscheidung« in Gefahr – so begründete die Regierung damals ihre Haltung.[4] (Erst 1970 wurde die Veröffentlichung von abweichenden Voten zugelassen.) Vergeblich hielt damals der Abgeordnete und spätere »Kronjurist« der SPD-Fraktion Adolf Arndt dagegen: Man solle »nicht immer so viel Angst haben. Das ganze Grundgesetz besteht ja überwiegend aus Angst vor der Demokratie«.[5] Hinter dieser historischen Kontroverse um eine scheinbare Nebensächlichkeit – sollen Sondervoten veröffentlicht werden? – verbirgt sich ein tief greifender Dissens über die Aufgabe, die das Bundesverfassungsgericht unter dem Grundgesetz haben sollte. Würde das neue Institut ein Instrument der Demokratie sein – oder eine Kontrollinstanz? Ein Bürgergericht oder eine Staatsgewalt? Was ist wichtiger: die Entstehung einer Entscheidung – oder das Urteil? Der politische Diskussionsprozess – oder sein Ergebnis?
Auf der einen Seite stand das Vorbild des US-amerikanischen Supreme Court, in dem schon stets die Kultur des offenen Ringens um ein Urteil die politische Debatte geprägt hat. Dort ist jeder Richter politisch festgelegt, seine Ansichten sind bekannt, sein Beitrag zur Entscheidung ist in jeder Zeitung nachzulesen. Und in Deutschland war es zum Beispiel einer der einflussreichsten Verfassungsrichter späterer Jahre, Ernst-Wolfgang Böckenförde, der die Ansicht vertrat, amerikanische Offenheit in eigenen Dingen könnte »das Verständnis und die Akzeptanz« der Karlsruher Sprüche erhöhen.[6] Das Monitum des Konservativen Böckenförde traf sich mit den Ideen des erzliberalen österreichischen Staatsrechtlers Hans Kelsen, der schon eine Generation zuvor in den Zwanzigerjahren die Idee eines Verfassungsgerichts in Deutschland populär gemacht hatte.[7] Auf Kelsens Konzept über das Verfassungsgericht als Garanten der offenen, pluralistischen Struktur der Gesellschaft und des politischen Prozesses setzten die Gründerväter des Grundgesetzes bei ihren ersten Entwürfen 1948 auf Herrenchiemsee.[8] Nach Kelsen war das Verfassungsgericht eine politische Instanz wie das Parlament, und nicht weniger legitimiert, politisch zu handeln – wenn auch durch Recht. Wie jeder andere politische Prozess musste darum auch der von Karlsruhe für die Bürger kontrollierbar und nachvollziehbar sein. Also: Akten raus!
Schnell wichen solche radikal-liberalen Konzepte der alten deutschen Angst: Im Parlamentarischen Rat des Jahres 1948/49 sah man die Rolle des Gerichts weit zurückhaltender. Dieser Kelsen, das war unter den konservativen Staatsrechtlern nahezu Common Sense, hatte mit seinen Ideen, die vom Positivismus geleitet waren, schon die Weimarer Republik zugrunde gerichtet, nun musste es gut sein. Das Verfassungsgericht sollte die neue Ordnung stabilisieren – als Instanz der Wahrheit und des Rechts. Was heißt hier Bürgergericht? Nicht einmal die Verfassungsbeschwerde – heute täglich Brot der Karlsruher – mochte der Parlamentarische Rat ins Grundgesetz schreiben. So etwas gefährde die »Souveränität des Staates«, hieß es auch noch aus der konservativen Regierungsmehrheit im Bundestag.[9] Dass die wichtigste Rechtsschutzmöglichkeit der Bürger gegen die Verletzung ihrer Grundrechte dann später doch eingeführt wurde, geschah gegen massive Widerstände der Gründergeneration. Und noch 1952 pestete der Vizepräsident des Gerichts Rudolf Katz öffentlich: Vier Fünftel der bis dato eingegangenen 1500 Verfassungsbeschwerden seien Anträge »notorischer Querulanten und Geisteskranker«.[10]
So, schon ist es passiert. Ein bisschen Gerangel um alte Akten, schon stecken wir in den großen Schicksalsfragen der Demokratie des Grundgesetzes: Haben es die Verfassungsrichter jemals geschafft, sich vom paternalistischen Gehabe ihrer Gründer zu befreien? Wollten sie Ordnungshüter oder Demokratiebeschleuniger sein? Oder waren sie so erfolgreich, weil sie sich auch darüber nie festgelegt haben? Der amerikanische Weg der Offenheit jedenfalls war in Karlsruhe nie eine Option. Es sollte sechzig weitere Jahre dauern, bis 2010 die auch vom Bundesverfassungsgericht wiederholt statuierte Bedeutung der »Informationsfreiheit« für den demokratischen Diskurs der Bürger Konsequenzen im eigenen Haus zu zeitigen schien: Im Gericht, so wurde bekannt, plane man mit einer Änderung der Geschäftsordnung nun auch die internen Voten und Entwürfe der Richter zugänglich zu machen. Nach einer Sperrfrist von 90 Jahren.
Die Empörung, die daraufhin vor allem von Zeitgeschichtlern ausging,[11] führte schließlich zu einer Gesetzesinitiative im Bundestag. Ins Bundesverfassungsgerichtsgesetz wurde eine Bestimmung aufgenommen, die den Umgang mit den Karlsruher Akten verbindlich vorschrieb. Ein Kompromiss: Alle Akten müssen nach Koblenz, Sperrfrist für Prozessakten: dreißig Jahre, Sperrfrist für die Handakten der Richter mit Voten und Entwürfen: sechzig Jahre. So machten sich die Koblenzer bereit für die Mammutaufgabe, die Entstehungsgeschichte der Demokratie des Grundgesetzes in kleine graue Kästen zu sortieren. Kein einfaches Unternehmen: Schnell stellte sich heraus, dass in den frühen Akten des hohen Hauses großes Chaos herrschte. Die besonders spannenden Teile fehlten. Vermutlich waren die Unterlagen und Entwürfe irgendwann bei den Richtern verschwunden – jedenfalls in den Fünfzigerjahren war es ganz normal, dass die Juristen, die damals im engen Prinz-Max-Palais residierten, die Arbeit mit nach Hause nahmen. Manche Voten tauchten schließlich in privaten Nachlässen wieder auf, die ebenfalls ans Bundesarchiv gelangt waren. Offenheit war für das Karlsruher Verfassungsorgan nach wie vor ein quälender Prozess. Da waren diese rätselhaften Aktenkartons der Firma Kracher&Wiendl, verschlossen und zugeklebt mit braunem Paketband, drüber das Siegel des Bundesverfassungsgerichts. Was sollten die Koblenzer damit machen?
Winter 2016:
Koblenz an Karlsruhe: Was ist da drin?
Sagen wir nicht.
Darf man’s denn wenigstens aufmachen?
Auf keinen Fall!
Steckte es da drin, das Geheimnis von Karlsruhe? Der Stein der Weisen? Die braunen Kartons wurden zur Chefsache. Michael Hollmann, der Präsident des Bundesarchivs, hat die Befugnis, notfalls Regierungsakten mit Staatsgeheimnissen einzusehen. Doch Hände weg von Karlsruhe: »Ich werde mich hüten, diese Siegel aufzubrechen«, erklärte er.
Herbst 2017:
Karlsruhe an Koblenz: Ihr dürft die Kartons jetzt öffnen.
»Pharaonengrab« nennen die Historiker so etwas: Lang gesuchte Richter-Handakten zu den wichtigsten Urteilen der Fünfzigerjahre kamen zum Vorschein. Was für eine Entdeckung. Der Inhalt der Kartons wurde zur wichtigsten Grundlage der folgenden Kapitel: Acht Geschichten über die allmähliche Entstehung der Demokratie des Grundgesetzes.
Die Chance des Anfangs
Was erwartet ein Verfassungsrichter von einer guten Verfassung? »Sie muss kurz und dunkel sein«, sagte einmal in Anlehnung an einen berühmten Bismarck-Spruch Winfried Hassemer, der Karlsruher Vizepräsident in den Jahren der Jahrtausendwende. Kurz und dunkel: Ein Blick in die Akten zeigt schnell, warum das Grundgesetz, jenes im Nachkriegschaos eilig zusammengehauene Provisorium, so ein Welterfolg werden konnte. Vom ersten Tag der neuen Demokratie an diente es den Juristen in ihrem Karlsruher Gehäuse als Rechtfertigung, das zu tun, was sie, nach bestem Wissen und Gewissen, für das Richtige hielten.
Wie sollte es weitergehen, nachdem alle Werte und Gewissheiten zusammengebrochen waren, keinem Wegweiser mehr zu trauen war? So viel Anfang war nie in Deutschland. Niemand, auch nicht die Autoren des Grundgesetzes, konnte sagen, zu welchem Ende das große kühne Experiment einer auf Trümmern gebauten Demokratie führen würde. Vorsichtig tastend haben sich die Richter zu Beginn in der neuen Freiheit des Grundgesetzes bewegt, wie Scouts, die unbekanntes, vermintes Gelände erschließen müssen. Da konnte man nicht an Landkarten kleben, selbst gut gemeinte Gesetze brachten keine Sicherheit. Welches ist der nächste richtige Schritt? In den Karlsruher Aktenkartons finden sich die Notizen und Dossiers, oft nur handschriftlich hingeschmierte Stichworte der ersten Verständigung jener Pioniere der neuen Freiheit. Wo geht es lang? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt gehen?
Das Verfassungsgericht war so erfolgreich, gerade weil es keine Agenda hatte, die es abzuarbeiten galt. Der Freiburger Historiker Ulrich Herbert war einer der Ersten, die in der Frühgeschichte des Karlsruher Gerichts geforscht haben. Sein Befund: »Die hatten keinen Plan, in Karlsruhe.« Die haben rumprobiert, wie alle anderen Institutionen des neuen Staates auch: »Statt einer Agenda für den neuen Staat war da nur ein weißes Blatt Papier.« Da gab es keinen organisierten Aufbau der deutschen Nachkriegsdemokratie: Es habe sich, sagt der Fünfzigerjahre-Forscher, »etwas zurechtgeruckelt« in der vom Krieg »vollständig durchgerüttelten Gesellschaftsstruktur«.
Die Karlsruher nutzten die Chance des Anfangs: »Es konnte sich vorerst niemand vorstellen, wie das in der Praxis funktionieren würde, was der Parlamentarische Rat da beschlossen hatte«, sagt Herbert. Und gerade das Vorläufige dieser neuen Republik und ihrer vorläufigen Verfassung war das Geheimnis ihres Erfolges. Herbert: »Die Bundesrepublik war ja nur als fragiles Zwischengebilde gedacht, nichts für die Ewigkeit, nur bis zur schon bald vermuteten Wiedervereinigung.« Das Provisorium schützte vor voreiligen Festlegungen. Kein Plan, Planlosigkeit war das Geheimnis. Die Autoritäten des alten Denkens, die nach wie vor den Staat als letzte Instanz aller Politik betrachteten, wurden von so viel Chaosmanagement geradezu überrollt. »Niemand, der bei der Gründung des Verfassungsgerichts dabei war, konnte sich damals vorstellen, was kommen würde«, konstatiert Justin Collings, der US-Verfassungsrechtler, der die Geschichte des von den Amerikanern einst initiierten »German Federal Constitutional Court« in allen Details erforscht und beschrieben hat.[12] »Als Konrad Adenauer feststellen musste, wie schnell das Bundesverfassungsgericht Macht und Autorität gewonnen hatte, war es schon zu spät«, konstatiert Herbert. Der Alte hatte sich die Karlsruher als Justiziare eines starken Staates gedacht, eigentlich wäre ihm ein Staatspräsident namens Adenauer mit machtvollen Letztentscheidungsbefugnissen lieber gewesen. Nun waren es auf einmal die Richter, an denen man nicht mehr vorbeikam. Sie beanspruchten das letzte Wort im Staate. Die berühmte Reaktion des Kanzlers: »Dat ham wir uns so nich vorjestellt.«
Die Berufung auf das Grundgesetz diente den Richtern als Schutz. Denn von Beginn an mussten sie sich gegen Bedrohungen von allen Seiten wehren. Da waren die Geister von gestern, die im Staat des Grundgesetzes spukten und versuchten, eine Nische für ihre totalitären Ideen zu finden. Da waren die Kollegen, die furchtbaren Juristen der NS-Zeit, die nun versuchten, ihre Karriere möglichst bruchlos gleich nebenan, beim Bundesgerichtshof, fortzusetzen. Und da waren die neuen Paternalisten der Adenauer-CDU, die versuchten, den politischen Katholizismus zum Geist des Grundgesetzes zu erklären.
Die Karlsruher wurden so ganz schnell zu den Hoffnungsträgern der neuen, fragilen Demokratie. Denn ihre Autorität war über jeden Verdacht erhaben: »Es war die Instanz der sauberen Hände«, sagt der Frankfurter Verfassungshistoriker Michael Stolleis. Die Neuen in Karlsruhe konnten von vornherein die Legitimation überzeugter Demokraten für sich in Anspruch nehmen. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – einige kommen in Kapitel 1 in Zusammenhang mit dem Verbotsverfahren gegen die KPD zur Sprache – waren die Verfassungsrichter von der dunklen Vergangenheit unbelastet. Einige von ihnen hatten die NS-Zeit im Exil verbringen müssen, die meisten hatten mindestens einen Karriereknick unter den Nazis erlebt – wenn sie nicht sogar aus ihren Ämtern vertrieben worden waren. Dass sie saubere Hände hatten, dadurch unterschieden sich die Richter des Bundesverfassungsgerichts vertrauenerweckend von der großen Mehrheit an den anderen Gerichten: Die Mehrzahl der Juristen in der deutschen Justiz hatte ihre Arbeit nach der Zeitenwende 1945 unbeirrt fortgesetzt. Vor allem die SPD hatte darauf bestanden, dass das neue Gericht mit Autoritäten besetzt werde, die mit der vom NS-Regime verdorbenen Richterschaft nichts zu tun hatten.[13] Nur sechs der 24 Verfassungsrichter der ersten Generation kamen von anderen Gerichten. Wir sind die Guten: Dies war die Fahne, die bald weithin sichtbar über dem Prinz-Max-Palais, dem ersten Amtssitz des Gerichts, wehte. Die Juristen nutzten das Auslegungsmonopol für das Grundgesetz, die junge Republik in eine konsensfähige, wärmende »Werteordnung« zu hüllen. Es ging um den Weg, auf dem die verstörte Gesellschaft des westlichen Deutschland ohne allzu große Zerwürfnisse und Kosten in die bürgerlich liberale Welt des Westens gelotst werden konnte. »Wie bringt man die Leute aus der Volksgemeinschaft der NS-Ära in die Demokratie des Grundgesetzes?« – Dies, so sieht es der Freiburger Historiker Ulrich Herbert, war die große Aufgabe des neuen Anfangs.
Das Zauberwort
»Subsumtion« nennen die Richter ihre Methode, das Leben nach dem Wortlaut des Gesetzes zu beurteilen. Die Methode der Verfassungsrichter war – zumindest in der Gründerzeit der deutschen Demokratie – nicht Subsumtion, sondern Integration. »Integration« war das Zauberwort, das die Karlsruher Rechtsprechung in den Zeiten des Aufbaus der deutschen Demokratie prägte. Es taucht fast nie in den Akten auf. Aber Rechtstheoretiker bezeichneten schon damals mit dem Begriff den Geist, der über dem Gericht schwebte. Der Begriff stammt von Rudolf Smend, dem bürgerlich-liberalen Staatsdenker der Weimarer Republik, der nach dem Krieg in Göttingen wirkte und an der dortigen Universität um sich all jene jungen Talente scharte, denen wir später beim Bundesverfassungsgericht wieder begegnen werden. Von Smend kam Gerhard Leibholz, ein Verfassungsrichter der ersten Stunde, der mit seinen Methoden der Rechtsanwendung das Gericht stark geprägt hat. Das Bundesverfassungsgericht sei ein »Integrationsfaktor«, lehrte der Professor vom Zweiten Senat, die »Integrationsfunktion« seines Hauses gehe über dessen »richterliche Funktion« weit hinaus.[14]
»Integration« als ideale Methode, mit einer ideal dunklen und ideal kurzen Verfassung eine neue Gesellschaft zu formen: Dies könnte die Arbeit des Gerichts zu Leibholz’ Zeiten gut erklären – wenn wir wüssten, was mit »Integration« genau gemeint ist. Eine »schwebende Ausdrucksweise« bescheinigt der Rechtshistoriker Michael Stolleis in seinem Standardwerk über die Geschichte des öffentlichen Rechts[15] dem berühmten Ideengeber Smend. So ganz haben selbst die Experten nie verstanden, was der Denker eigentlich gemeint hat. Nach Smend ist die Verfassung »die Lebensform einer Gesellschaft«[16], sie diene dazu, »Gegensätze in rechtsförmiger Weise zu überwinden«. Das Ziel der Integration ist es, eine »Einheit von Volk und Staat« herzustellen, ein Ganzes, das mehr ist als seine Teile. Kritiker sehen heute in solchem Denken eine »mythische Verklärung«, ein »antipluralistisches, obrigkeitsstaatliches Verständnis« von Politik – ja, eine Art »politischer Theologie«.[17]
»Integration« in diesem Sinne war also etwa das Gegenteil dessen, wozu das Bundesverfassungsgericht einst erfunden wurde. Die Gründerväter des Grundgesetzes hatten 1948 bei ihrer ersten Versammlung auf der Chiemseeinsel ja noch den Smend-Gegenspieler Kelsen im Sinn, der seiner Erfindung der Verfassungsgerichte ausschließlich die Aufgabe einräumen wollte, die Fairness und Offenheit der politischen Auseinandersetzungen in der Gesellschaft zu garantieren, sodass am Ende im freien Kräftespiel der Meinungen als Resultante des demokratischen Prozesses so etwas wie das Gemeinwohl herauskommt.[18]
Doch Smends »Integrationslehre« passte gut zur selbst gewählten Rolle des Gerichts als politischer Friedensstifter. Dieses Selbstverständnis des Gerichts hatte etwas Vertrauenerweckendes. Schnell nahm das Volk des Grundgesetzes die Autorität an, die doch offenbar abseits politischen Parteiengezänks Harmonie stiftete.[19] So erreichte das Verfassungsgericht im Rating des Volksvertrauens alsbald Werte, die gleich hinter denen des ADAC lagen. Die »auf Konsens angelegte Grundstimmung der frühen und mittleren Bundesrepublik« ebenso wie der »subkutane Einfluss kirchlicher Denktraditionen«[20] prägten die Arbeit im Prinz-Max-Palais im Sinne Smends. Da habe sich schon früh in Karlsruhe eine »Zivilreligion« breitgemacht, urteilt der Rechtshistoriker Stolleis. Wie sich die fromme Denkart der Integration auf die Anwendung des Grundgesetzes auswirkte, lässt sich besonders deutlich in den Akten zum berühmten »Lüth-Urteil« (Kapitel 5) von 1958 zeigen, in dem es darum ging, wie ein kritischer Bürger sein Grundrecht der Meinungsfreiheit auch gegen die zivilrechtlich geschützten Gewinninteressen eines Filmunternehmens durchsetzen kann. Die »Werteordnung« des Grundgesetzes zwinge dazu, so entschied das Gericht ganz im Sinne Smends, der Meinungsäußerung den Vorrang zu geben, jedenfalls, wenn diese im Interesse der Allgemeinheit liege.
Kurz und dunkel sind die Bestimmungen des Grundgesetzes zur Meinungs- und Pressefreiheit. Und doch ist es immer wieder dieses Grundrecht, an dem sich das Gericht in seinen großen Entscheidungen abarbeitete: Ob im Falle Lüth, ob im Prozess um die »Spiegel«-Affäre (Kapitel 7) oder um Konrad Adenauers Privatfernsehen (Kapitel 6) – von Fall zu Fall entwickelten die Verfassungsrichter aus dem Freiheitsrecht der Bürger ein vielseitiges Instrument zur Herstellung und Wahrung von Konsens und Frieden in der offenen Gesellschaft, die »schlechthin konstituierenden« Grundlage der repräsentativen Demokratie des Grundgesetzes. Wie macht man Verfassungsrecht? Die Akten erlauben erstmals, einen Blick in die Karlsruher Werkstatt zu werfen. Der Verfassungsrichter Theodor Ritterspach, Autor und Ideengeber nicht nur des Lüth-Urteils, sondern auch anderer epochaler Sprüche des Gerichts, notierte für die Kollegen:
Es ist nicht genug, dass ein Gericht Tatsachen des Lebens unter „bereits vorgebildete, nicht am empirischen Rechtsmaterial gewonnene“ (Kelsen) Begriffe einordnet und sich für die Entscheidung mit der Anwendung der Grundsätze begnügt, ... Aufgabe des Gerichts ist es vielmehr, die im Einzelfall richtige Entscheidung zu finden ... aus einer unmittelbaren Fallanschauung, aus genauer Betrachtung und Bewertung der konkreten Lebensvorgänge fließende, den Anforderungen der Logik gerecht werdende, aber auch das Rechtsgefühl befriedigende Entscheidung.[21]
Eine Delikatesse für Rechtsmethodiker. Es hätte nicht der ausdrücklichen Distanzierung vom damals verhassten Positivisten Kelsen bedurft, um die Ideen des Kelsen-Gegenspielers Smend hinter solchen Anleitungen zu erkennen. Grau ist alles Gesetz, die »Betrachtung und Bewertung« des »konkreten« Lebens weist den Weg in die Harmonie des inneren Friedens und befriedigt das Rechtsgefühl. Rudolf Smend, das große Vorbild aus Göttingen, bescheinigte dann auch öffentlich den Richtern, gute Schüler zu sein: Das Gericht »kämpft um die Herrschaft des Rechten und Guten, indem es diese höchsten irdischen Werte ausdrücklich zur Grundlage seiner Entscheidungen macht«, verkündete er in einem Festvortrag zum zehnten Jubiläum des hohen Hauses.[22]
Die Mitte …
Die Abschaffung der Dunkelheit durch 24 Lichtgestalten im Prinz-Max-Palais mit den Methoden Rudolf Smends: Haben wir’s endlich gefunden, das Geheimnis von Karlsruhe? Manchem ist nicht ganz wohl bei solchen Aktenfunden: Die Relativierung der ganzen Rechtsordnung durch ein Ensemble »objektiver« Werte, die Lossagung der Richter vom toten Wortlaut des Gesetzes, die Hinwendung zum »konkreten Leben«, aus dem sich die richtige Entscheidung schon anbietet: Hatten wir das nicht gerade erst überwunden? »In frappanter Weise«, sieht sich der Rechtshistoriker und Verfassungsrechtler Stolleis an die »Wertdurchdringung der Rechtsordnung durch die Nazis« erinnert. Unter dem Vorzeichen der »Integration« finde sich in den alten Akten, so Stolleis, eine »methodische Reprise der Umwertungen von 1933«[23], jener rechtlichen Gehirnwäsche, mit der die Weimarer Demokratie in eine Diktatur verwandelt wurde. Ist das der zynische Clou, der uns aus den Papieren über die Gründerzeit der deutschen Demokratie anspringt? Wurde die Karlsruher Republik deshalb so erfolgreich, weil sie die allgemeine Orientierungslosigkeit nutzte, die alten Irrlehren in neuer Form zu präsentieren, mit denen die deutschen Staatsrechtler die unglückselige Weimarer Republik »retteten«, indem sie wie der Staatsrechtslehrer Carl Schmitt den »Werten« der völkischen Diktatur das Wort redeten? Haben die Richter von Karlsruhe, als sie sich von ihrem Erfinder Hans Kelsen abwandten und dem Werte-Theoretiker Rudolf Smend folgten, den Auftrag veruntreut, der ihnen vom Herrenchiemsee mit auf den Weg gegeben war?
Die Sicht von außen auf die Blackbox Karlsruhe relativiert den Eindruck, der aus den Akten entsteht. Die historische Funktion des Bundesverfassungsgerichts in den Fünfzigerjahren, so sieht es der Geschichtsprofessor Herbert, sei es keineswegs gewesen, der Gesellschaft ein neues Wertekorsett überzuziehen. Die Rolle, die das Gericht tatsächlich spielte, sei auch mit dem Begriff »Integration« ganz schlecht beschrieben: »Es ging ja nicht darum, irgendetwas Neues in einen bestehenden Rahmen zu integrieren – es ging um die Unterstützung des mühsamen und schmerzhaften Prozesses der Formation eines neuen Rahmens, der Konsensbildung in der verstörten Nachkriegsgesellschaft.« Die Leute, sagt Herbert, hätten etwas gebraucht, worauf man sich verlassen könne. Und das sei das Wort aus Karlsruhe gewesen.
Aus der Sicht des Historikers ging es darum, aus dem Prinz-Max-Palais heraus die Mitte zu markieren, eine neue Mitte, um die sich die widerstreitenden Interessen, Bedürfnisse und Glaubensrichtungen in der neuen Demokratie scharen konnten. Die Mitte in der Demokratie sollte nicht einfach der Mainstream der Mehrheit sein, sondern nach Herbert eine »normative Mitte«: Die Gebote des Grundgesetzes dienten als Korrektur für Übertreibungen im Volke. Nicht als Hohepriester einer Zivilreligion, als Moderatoren bei der allmählichen Verfestigung einer politischen Kultur im Lande haben nach dieser Deutung die 24 von Karlsruhe gewirkt. Wenn im 21. Jahrhundert der Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle das Grundgesetz als »Verfassung der Mitte«[24] charakterisiert und die Aufgabe seines Gerichts darin sieht, die »Balance« in der politischen Auseinandersetzung zu bewahren, so lässt sich das als Versuch deuten, die Erfolgsgeschichte der frühen Jahre in postmodernen Zeiten zu wiederholen.
Wer die alten Akten studiert, merkt schnell: Die Balance zu wahren, allzu heftige Bewegungen im Volke mit dem Gegengewicht der Maßgaben des Grundgesetzes zu dämpfen, war offenbar schon damals die Maxime, die einzelne Richter bei der täglichen Arbeit am Fall leitete. Was da in Karlsruhe agierte, war kein Sturmgeschütz der Demokratie, das war eine wohlmeinende Gouvernante, die mit dem Beharren aufs letzte Wort zugleich stets auch um ihre eigene Stellung kämpfte. Noch so ein Hinweis aus Richter Ritterspachs Notizen:
Eine elastische, das Bedürfnis nach Realisierung der Grundrechte wie auch das Ansehen der Gerichte und ihrer Urteile gleichermaßen berücksichtigende Handhabung ... wird das Richtige treffen. Nach dieser „Faustregel“ ist wohl bisher auch verfahren worden.[25]
So viel Rücksicht hätte die zarte Pflanze des Aufbruchs in eine neue Freiheit schnell verkümmern lassen können. Wenn die Karlsruher Gouvernante damals auf die bewährten Werte der Volkserziehung zurückgegriffen hätte, auf die »höheren« Werte des Naturrechts etwa, die altbekannten Ideen von der »Homogenität« des Volkes, das »dem Staat« Gehorsam schulde: Dann wäre es – wieder – nichts geworden mit der deutschen Demokratie. Es war der Glücksfall der Geschichte, dass das Grundgesetz in die Hände von Juristen geriet, die von Beginn an in den 146 Artikeln der neuen Verfassung die Werte der Aufklärung entdeckten, wie sie sich über die Französische Revolution von 1789 schließlich in ganz Europa ausgebreitet hatten. Die Hinweise auf jene Revolution, den Urfunken der demokratischen Freiheit in Europa, finden sich in den Voten der Richter immer wieder. Es ist die alte Geschichte von 1789, mit der Richter im Streit über die Reisefreiheit des aufmüpfigen CDU-Politikers Wilhelm Elfes (Kapitel 3) argumentieren, um dem Staat einen neuen, bislang unbekannten Freiheitsbegriff der Bürger entgegenzusetzen. Es ist der Geist der Aufklärung, der aus den alten Akten spricht. Die Werte, die maßgeblich für die deutsche Demokratie sein sollten, sind menschengemacht. Im Staat des Grundgesetzes ist nicht Gott, sondern der Mensch das Maß aller Dinge. Seiner Vernunft ist zu trauen, seine Würde ist zu beschützen, seine Freiheit ist der Ausfluss seiner Würde und liegt im Gebrauch seiner Vernunft.
… und ihre Abgründe
Schluss mit den großen Worten. Es gibt genügend Beispiele in diesem Buch, die der Idee der Aufklärung offenkundig ins Gesicht schlagen. Das KPD-Verbot von 1956 (Kapitel 1): ein dumpfer Ausbruch von Kommunistenfurcht, von dem sich das Gericht später distanzieren musste. Das Homosexuellen-Urteil von 1957 (Kapitel 4): eine schwerwiegende Verletzung der Menschenwürde, die wiedergutzumachen sich Politiker heute noch immer mühen. Das Abtreibungs-Urteil von 1975 (Kapitel 8): die Wiederkehr der katholischen Naturrechtslehre. Wie konnte es dazu kommen?
An solchen Entscheidungen zeigt sich, dass jeder Versuch, jenseits normativer Bindungen die »Mitte« zwischen dem als gut Erkannten und dem im Volk Konsensfähigen zu finden, auf Abwege, an Abgründe führen kann. Die Akten zum KPD-Prozess dokumentieren eindrucksvoll, ja mitleiderregend das jahrelange zähe Ringen von freiem Geist und panischer Kommunistenfurcht – auch unter den Richtern. Das Grundgesetz war da ohnehin keine Hilfe: Allzu widersprüchlich, kurz und dunkel waren die Vorgaben für die Richter. Wer sich die Entwürfe und Gegenentwürfe und argumentativen Verirrungen in der internen Diskussion um die Verfassungsmäßigkeit des Homosexuellen-Paragrafen 175 anschaut, verliert jeden Glauben daran, dass sich die Entscheidungen des Gerichts planvoll aus einem allgemeinen Prinzip ableiten. Hier regierte die Resignation vor der übereinstimmend im Volke und im eigenen Kopf dominierenden Gewissheit, dass Männerliebe Schweinkram sei. »Das Pfui-Gefühl der Gesellschaft«, so drückt es Rolf Lamprecht, der langjährige Karlsruhe-Korrespondent des »Spiegel«, aus, habe durch die Richter verfassungsrechtliche Beglaubigung gefunden.[26]
Ein Kapitel für sich ist schließlich das berühmte Urteil zum Strafgesetzbuch-Paragrafen 218, mit dem das Gericht die Liberalisierung des Abtreibungsrechts verbot. Aus den Akten lässt sich die Reaktion der 1975 bereits alt gewordenen Gouvernante lesen, die einen Schreck bekommen hat, was die Kinder des Grundgesetzes mit der ihnen so mühsam beigebrachten Freiheit alles anstellen. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment: Solche Libertinage und ihre Folgen musste, von der Position der gutbürgerlichen liberalen Mitte aus betrachtet, als Übertreibung erscheinen, wie so vieles in den sozialliberalen Siebzigern, in denen das Gericht als Bremser der Liberalisierung auftrat. Und da die Kraft der Werte der Aufklärung sich als ungeeignet erwies, den Prozess der Befreiung zu kanalisieren, griffen die Bewahrer der guten Ordnung zu stärkeren Drogen: dem Gift des Naturrechts, den »höheren, vorgegebenen Werten«, mit denen sich jede rationale Diskussion sofort besiegen ließ. Ein »volkserzieherisches Element« registriert der Historiker Herbert in der Karlsruher Ära der Siebziger. Mit dem Grundgesetz konnte man es ja machen. Die Verfassung, die kurz und dunkel war, machte es den Richtern möglich, im Wechsel der Zeiten stets die Mitte zu halten – und verbindlich festzulegen, wo die Mitte war.
Nur einmal, ziemlich am Anfang, geschah es, dass das Gericht gegen die alles beherrschende Meinung im Volk, gegen den Rat der meisten Juristen, Politiker und aller Kirchenleute eine Position durchsetzte, die damals als reichlich übertrieben galt: »Frauen und Männer sind gleichberechtigt.« Das Urteil von 1953 und seine Ergänzung von 1959 (Kapitel 2), formuliert von der einzigen Frau im Gericht gegen den Widerstand der eigenen Kollegen, kann bis heute als der wichtigste Beitrag des Gerichts zur Demokratisierung der Gesellschaft des Grundgesetzes gelten. Was sagen die Akten? Wie hat die Frau das geschafft? Warum sind Frauen und Männer gleichberechtigt? Ganz einfach: Weil es so, hell und präzise, im Grundgesetz steht.
Quellen
Was sagen die Akten? Diese Frage hat mich beschäftigt, seit ich mich als Student zum ersten Mal mit den großen Urteilen der Fünfzigerjahre befasste. Die Chance, zum siebzigsten Geburtstag des Grundgesetzes an die Quellen der Entstehung jener Demokratie vorzustoßen, in der ich aufgewachsen bin und über die ich dreißig Jahre lang für den »Spiegel« geschrieben habe, verdanke ich der Hartnäckigkeit meiner Freunde, der Rechtshistoriker und der Verantwortlichen des Bundesarchivs, die sich jahrelang um die Öffnung der alten flaschengrünen Bände aus dem verschlossenen Keller des Bundesverfassungsgerichts bemüht haben. Rechtshistoriker waren es dann auch, die mich ermutigt haben, in den Aktenstapeln zu graben und mich in die Ideen und Wirrnisse, die darin dokumentiert sind, einzulesen.
Professor Michael Stolleis, dem ehemaligen Direktor des Max-Planck-Institutes für europäische Rechtsgeschichte, verdanke ich Rat und Wegweisung, ebenso dem Freiburger Professor für Zeitgeschichte Ulrich Herbert. Die Staatsrechtsprofessoren Hans-Joachim Koch, Hamburg, Rüdiger Rubel, Gießen, und Florian Meinel, Würzburg, haben mir mit Hinweisen bei einzelnen Kapiteln des Buches geholfen. Mein Dank gilt auch jenen ehemaligen Verfassungsrichtern, die mir als Gesprächspartner zur Verfügung standen, ohne dass ich ihren Namen nennen darf. Der Historiker und »Spiegel«-Dokumentar Heiko Buschke hat die in diesem Buch erwähnten zeithistorischen Bezüge und Fakten gecheckt. Die »Spiegel«-Kollegen Rolf Lamprecht und Dietmar Hipp haben mir mit Informationen und Einschätzungen aus ihrer journalistischen Arbeit in Karlsruhe geholfen. In den Archiven des »Spiegel« durfte ich bislang unbekannte Akten zu jener Affäre lesen, die »meinem« Blatt einen Platz in der Verfassungsgeschichte beschert hat (Kapitel 7).
Die Akten aus dem Bundesarchiv waren die wichtigsten Quellen für dieses Buch. Die Fundstellen im Koblenzer Bestand B 237 sind in Fußnoten ausgewiesen, ebenso die Literatur, die ich über die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts verwendet habe. Zu manchen Quellen allerdings fehlt die Fußnote: Ich darf ihre Herkunft nicht offenlegen, um Informanten zu schützen. So habe ich es als Journalist immer gemacht – und mich darauf verlassen, dass meine Leser sich auf mich verlassen. Zu vielen Zitaten fehlt zudem einfach deshalb der Beleg, weil sie Frucht persönlicher Gespräche mit dem namentlich Zitierten sind oder weil ihre Herkunft zum Allgemeinwissen des informierten Lesers gehören wird.
Die Auswertung der Akten wäre nicht möglich gewesen ohne die Archivare des Bundesarchivs in Koblenz, die mit Sachkunde und nie endender Geduld meine unendliche Neugier auf immer mehr und immer entlegenere Unterlagen befriedigt haben. Auch das wegen seiner Geheimniskrämerei so oft kritisierte Bundesverfassungsgericht hat sich offen gezeigt und mich in alten Personalakten der Richter lesen lassen.
Die Lawine alter, schwerer Papiere, die ich losgetreten habe, hätte mich mit ihrer ganzen verfassungsrechtlichen Stoff-Fülle verschüttet, wäre ich allein unterwegs gewesen. Doch im Detail, bei der Entzifferung der Alt-Männer-Handschriften in den Handakten, der in Sütterlin bekritzelten Notizzettel, der eilig in Kurzschrift hingeknallten Verhandlungs-Mitschriften, hatte ich die Hilfe meiner ehemaligen Sekretärin Margareta Hüttenberger. Und im ganz Großen hatte ich den Beistand von Rechtsanwältin Susanne Kuhn, die sich um die Aufarbeitung und Analyse des außerordentlich umfangreichen Materials zum KPD-Urteil und der Akten zum epochalen Thema Gleichberechtigung gekümmert hat.
So ist es der freundschaftlichen Zusammenarbeit einer großen Zahl von Kundigen zu danken, dass dieses Buch zustande kam. Alle Fehler habe ich natürlich allein gemacht.
Kommunistenjagd – Polizisten vertreiben KPD-Mitglieder im September 1950 aus dem Versammlungsraum der beschlagnahmten Düsseldorfer Parteizentrale. [9]
1 KPD-Verbot
Der Krieg der Welten. Parteienstaat oder liberale Demokratie?
Kein schöner Anfang
Keine Freiheit den Feinden der Freiheit: Dieser Satz ist mit Blut geschrieben. Er stammt von Louis-Antoine-Léon de Saint-Just, auch genannt der »Erzengel des Todes«. Der Jakobiner Saint-Just war einer der Anführer der Französischen Revolution von 1789, und er war es, der ihren Ruf als europäische Wiege der Menschenrechte und der Demokratie ruiniert hat. Als Wortführer im gefürchteten Wohlfahrtsausschuss ließ er Zigtausende umbringen, die sich nicht willig dem Diktat der Revolutionäre unterwarfen. Sein Motto: »Die Grundlage der Republik ist die vollständige Vernichtung dessen, was gegen sie ist.«
Keine Freiheit den Feinden der Freiheit: Im dritten Jahr der jungen, aus Trümmern erstandenen deutschen Demokratie stand dieser Satz wieder auf der Tagesordnung.
Verfassungsschutz, Abtl. I Tab. Nr. 1190/52,
Köln, den 8. Februar 1952 –
An den Herrn Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes
in Karlsruhe
Betr.: Aktion gegen KPD und SRP
Das bei der Durchsuchung beschlagnahmte Material ist nunmehr ... beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln abgeliefert worden und steht zur Verfügung des Bundesverfassungsgerichtes. Der Umfang des Materials ist bedeutend, schätzungsweise 25 Ctr. Über den Inhalt und die Eignung zur weiteren Begründung der Klage kann nichts gesagt werden, da das Material verpackt und verschnürt eingegangen ist.[1]
Kein schöner Anfang. Kaum dass die Trümmer weggeräumt sind, die ein blutiges Terrorregime in Deutschland hinterlassen hat, kassiert der Staat fünfundzwanzig Zentner Druckschriften der Opposition ein. Eine Geheimdienstaktion im vierten Jahr des Grundgesetzes, der Magna Charta von Menschenrechten und Demokratie. Zwischen den flaschengrünen Aktendeckeln des Bundesverfassungsgerichts die erste Erfolgsmeldung über den ersten Versuch des neuen Staates, einen politischen Gegner zu vernichten – vollständig.
Keine Freiheit den Feinden der Freiheit: Der erste große Fall des ersten deutschen Verfassungsgerichts, der Streit um das Verbot der Kommunistischen Partei, wurde zum schlimmsten in der Geschichte der bundesdeutschen Demokratie. Nie wieder sollte ein Verfahren so lange dauern, nie wieder sollten die Richter sich so quälen mit einer Entscheidung, nie wieder würde ein so langes, ein so wirres Urteil geschrieben werden – über das bis heute gestritten wird. Keine Freiheit den Feinden der Freiheit: Was hat der blutige alte Satz in der deutschen Demokratie zu suchen? Bis ins siebzigste Jahr des Grundgesetzes spukt der Spruch, der da gar nicht drinsteht, durch die deutsche Politik. Keine Freiheit den Feinden der Freiheit: Was bedeutet das für die Rechtsradikalen von der NPD, ihre biederen Gesinnungsgenossen von der AfD? Dürfen Radikale Beamten werden? Wie links dürfen die Linken sein, ehe der Satz sie vors Bundesverfassungsgericht bringt? Und was ist mit den bärtigen Feinden der Freiheit, den Gotteskriegern des Islam? Sollen für sie die Garantien des deutschen Rechtsstaates noch gelten? Vor allem aber: Soll die alte, blutige Parole in einer freiheitlichen Demokratie überhaupt Gültigkeit haben? Ist nicht der wahre Feind der Freiheit, der so redet? Kann man Freiheit schützen, indem man sie begrenzt?
Manche beim Bundesverfassungsgericht haben sich diese Frage schon 1951 gestellt, als nach langen politischen Diskussionen in Bonn der Antrag der Bundesregierung im Karlsruher Prinz-Max-Palais eintraf, wo 23 Männer und eine Frau gerade erst ihre Büros eingerichtet hatten. Zwei radikale Parteien, die rechtsextreme »Sozialistische Reichspartei« (SRP) und die »Kommunistische Partei Deutschlands« (KPD), wollte die Bundesregierung damals durch das Gericht verbieten lassen. Die klaren Sachen zuerst: Mit den Hitler-Verehrern von der SRP wurden die Karlsruher Richter schnell fertig. Doch als man im soeben gegründeten Bundesverfassungsgericht die Kisten mit dem beschlagnahmten Material der KPD öffnete, war auf einmal nichts mehr klar. Ist das eigentlich in Ordnung, wenn Verfassungsrichter, als wären sie Büttel des Geheimdienstes, Kisten voller Pamphlete, Kassenbücher, Geheimprotokolle, Flugblätter, Telefonverzeichnisse, Pläne für den Sturz der Regierung, Abrechnungen von Mitgliedsbeiträgen filzen? Kann man so etwas machen – in einem Rechtsstaat?
Morgens um sechs war die Staatsmacht auf Beschluss des Gerichts angerückt, hatte Funktionäre aus dem Bett geklingelt, »Aufmachen, Polizei«, um auch noch die Keller und die Dachböden der Privatwohnungen zu inspizieren. Wochenlang hatten die Vollzugskräfte sich im Geheimen auf ihren Einsatz vorbereitet, bis der Befehl aus Karlsruhe zum Zugriff kam: Das war der D-Day für die Invasion ins Herz der Finsternis, in die Schreibtischschubladen und die Panzerschränke des Feindes überall im Lande, des »Verfassungsfeindes«.
»Verfassungsfeinde«. Schon das Wort passte nicht zu dem Auftrag, der den Richtern im Prinz-Max-Palais mit auf den Weg gegeben war. »Verfassungsfeinde« – daran haftete noch der Brandgeruch des Krieges. Auf Feinde schießt man, das sind nicht Mitbürger, mit denen man vor Gericht streitet. Die Richter hier waren doch erst vor wenigen Wochen vom Bundespräsidenten Theodor Heuss vereidigt worden, der Freiheit des deutschen Volkes zu dienen. Da waren genug dabei, die Opfer des soeben erst besiegten Unrechtsregimes geworden waren. Die wussten zu genau, was es bedeuten kann, wenn morgens um sechs jemand an die Tür pocht. Ihr Gericht, das Verfassungsgericht, war eine Weltneuheit, erstmals in der Geschichte war in einem Staat dauerhaft eine Gegenmacht der Bürger errichtet worden, die Institution, die alle anderen Gewalten, die Regierung, die Justiz, sogar das Parlament stoppen konnte, sollte, musste, wenn Übergriffe auf die Freiheit der Bürger drohten; ein Gericht, dessen Präsident Ernst Benda Jahrzehnte später einmal das Bild vom »Rettungsfloß« prägte, auf dem die Bürger sich in Zeiten autoritärer Sturmgewalten in Sicherheit bringen können. Und gleich der erste große Fall war einer, wo die Richter als Büttel der Staatsgewalt, im Auftrag der Bundesregierung der frisch errungenen Freiheit autoritär Grenzen zu setzen hatten. – Kann eine Geschichte hässlicher beginnen?
Das antikommunistische Manifest
Ein Gericht kann sich seine Fälle nicht aussuchen. In Artikel 21 des 1949 verabschiedeten Grundgesetzes war von Anfang an klargestellt, dass das Bundesverfassungsgericht, und nur das Bundesverfassungsgericht, darüber entscheiden muss, ob eine Partei zu verbieten ist, weil sie »darauf ausgeht«, die »freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen«. Weil der Bann gegen die weitere Teilnahme am demokratischen Prozess eben nicht von irgendeiner Obrigkeit, nicht mal vom Parlament, sondern nur von den Juristen im Prinz-Max-Palais ausgesprochen werden kann, heißt die Bestimmung unter Staatsrechtlern auch »Parteienprivileg«, als ob es eine besondere Vergünstigung wäre, ein Todesurteil nur von höchster Stelle empfangen zu dürfen. Jedenfalls war auch das eine Weltneuheit. Parteien von Verfassung wegen verbieten zu lassen, war in den demokratischen Staaten des Westens bislang nicht vorgesehen. Die vom Souverän, dem Volk gewählten Abgeordneten einer Partei als Verfassungsfeinde aus dem Parlament zu kippen, wer sollte so etwas wagen? Ausgerechnet die Deutschen, gerade eben aus einer Diktatur erlöst, beschäftigten ihre besten Juristen mit der Frage, wie man der Demokratie von hoher Hand Grenzen setzen konnte. Freiheit ist gut, aber Ordnung muss sein: Aus dieser sehr deutschen Tradition war im jungen Artikel 21 die Formulierung von der »freiheitlichen demokratischen Grundordnung« geronnen. Das war die Formel, die nun erstmals zur Diskussion stand, und die dann später, in den Siebzigerjahren, als Kampfbegriff auf die Formel FDGO verkürzt zum Lieblingsinstrument der Innenminister im Kampf gegen Radikale werden sollte.
Würde es mit der heiklen Bestimmung gelingen, die KPD zu verbieten und ihre Abgeordneten aus den Parlamenten von Bund und Ländern zu vertreiben? Das Bundesverfassungsgericht, von der Bundesregierung zur Entscheidung aufgerufen, hatte keine andere Wahl, als das Verfahren ins Rollen zu bringen.
Also gut. Zuständig war nach einer ersten Verständigung der frisch ernannten Richter der erste der zwei Senate, die jeweils mit zwölf Richtern besetzt waren. Beim ersten also waren die Kisten aus Köln gelandet. Und per Beschluss war schnell entschieden, wer von den Kollegen sich nun mit dem Inhalt zu beschäftigen hatte:
Bundesverfassungsgericht
Erster Senat
24. Januar 1952
Der Richter am BVerfG Dr. Stein wird mit der Durchsicht der beschlagnahmten Gegenstände beauftragt. Er kann sich der Hilfe Sachverständiger und sonstiger Hilfspersonen bedienen.[2]
Erwin Stein hatte nichts von einem Jakobiner. Wie politischer Hass Menschen zerstören kann, hatte der einstige Staatsanwalt und Richter aus Hessen am eigenen Leibe erleben müssen. Als Adolf Hitler 1933 die Macht übernahm, wurde er »aus dem Dienst entfernt«, wie es unter Beamten heißt. Seine Karriere war zu Ende, nicht etwa, weil er gegen das Naziregime opponiert hatte, sondern weil seine Ehefrau Jüdin war und er sich gezwungen sah, seine Entlassung zu beantragen. Um der Deportation ins Konzentrationslager zu entgehen, nahm Steins Ehefrau sich 1943 das Leben. Nach dem Krieg schlug sich der Jurist als Rechtsanwalt durch, suchte Anschluss an die CDU, brachte es bis zum hessischen Kultusminister, verfasste zusammen mit dem langjährigen hessischen Ministerpräsidenten Georg-August Zinn den Rechtskommentar zur neuen hessischen Landesverfassung, unter Staatsrechtlern alsbald berühmt als »der Zinn-Stein«.[3]
So war es ja vielen gegangen, die nun in engen Doppelbüros des Prinz-Max-Palais untergekommen waren (nur der Kollege Franz Wessel saß, weil Kettenraucher, allein in einer kleinen Kammer unterm Dach). Für die meisten von ihnen hatte Deutschlands jüngste Vergangenheit einen Bruch im Leben bedeutet. Wenn nichts Schlimmeres, so doch zumindest einen Karriereknick: Das prägte die Menschen und das Denken an der Karlsruher Karlstraße. Und das unterschied sie ganz grundsätzlich von den Kollegen des Bundesgerichtshofs, die nicht weit von hier in einem Schloss dick wie ein Schlachtschiff im Park an der Herrenstraße residierten. Dort, bei der obersten Instanz der ordentlichen Justiz, hatte die Mehrheit der Richter ihre Karrieren aus der NS-Diktatur nahezu unbeschädigt in den neuen Staat gerettet. Es war ja, auf dem Standpunkt stand man im Schloss, schließlich noch immer dasselbe Strafgesetzbuch, dasselbe Bürgerliche Recht, mit dem man schon im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik wie in der Nazizeit gerichtet hatte. Also, was soll sein?
Erwin Stein beschloss, die Sache ganz grundsätzlich anzugehen. Wer, wenn nicht das Verfassungsgericht, sollte denn die großen Fragen der Nachkriegszeit beantworten? Der Kollege Martin Drath, auch er mit dem KPD-Verfahren befasst, hat sogar einmal geäußert, als Verfassungsrichter wachse man gelegentlich »in die Stellung eines verantwortungsvollen Staatsmannes hinein«[4] – und Drath war es auch, der Stein mit aufregenden Gedankenspielen provozierte: »Wir brauchen uns nur vorzustellen«, warf er einmal in die Debatte, »dass das Parteiverbot nach Artikel 21 GG schon vor 1933 möglich gewesen wäre und dass etwa im Jahre 1932 von einer Landesregierung der Antrag auf Verbot der NSDAP gestellt worden wäre.«[5] Hätte man Hitler so wirklich stoppen können? Kann ein Gericht in die Geschichte eingreifen? Vielleicht ja doch. Erwin Stein zog sich monatelang zurück, wühlte sich immer tiefer in das Material aus den KPD-Kisten hinein. Sein Ergebnis legte er in Form eines internen »Gutachtens« im September den Kollegen vor. Die Verfassungsrichter, so sein Befund, hatten eine historische Mission: den Kommunismus zu stoppen.
Bundesverfassungsgericht
Der Berichterstatter
BVerfRichter Dr. Stein
15. September 1952
An alle Mitglieder des Ersten Senats
Mein Gutachten stellt den I. Teil meiner Stellungnahme dar. Es ist deshalb so umfangreich, weil das Wesen der KPD nur durch eine gleichzeitige Darstellung der geschichtlichen und politischen Entwicklung der SED und der KPdSU verstanden werden kann. Auch ist die Kenntnis der Theorie des Marxismus-Leninismus eine unerlässliche Voraussetzung für die Beurteilung der Praxis des deutschen Kommunismus und der kommunistischen Weltbewegung.
Ich lege den I. Teil nebst Anlagen schon jetzt vor, damit die Mitglieder rechtzeitig vor dem Verhandlungstermin mit dem Studium der Grundlagen des Marxismus-Leninismus beginnen können. Da die Schlussfolgerungen im I. Teil schon angelegt sind, rechtfertigt sich auch aus diesem Grunde die gesonderte Vorlage ...
Dr. Erwin Stein[6]
Der erste Teil, der dann folgt, ist eine 349 Seiten lange Ausarbeitung von geschichtswissenschaftlichem Rang: Fast alles, was wir schon immer über den »Marxismus-Leninismus«, die »Sowjet-Demokratie«, über »Strategie und Taktik des Bolschewismus« wissen wollten. Rechtliche Ausführungen fehlen völlig, und es muss offenbleiben, ob Stein sie in dem angekündigten »II. Teil« nachgeliefert hat – in den Akten findet sich nichts. Aus Steins Sicht brauchte es auch nicht viel Juristerei, die für ihn einzig mögliche »Schlussfolgerung« zu ziehen, dass der Kommunismus als solcher bereits eine tödliche Gefahr nicht nur für den Staat des Grundgesetzes, sondern für die ganze Welt ist. Schon auf Seite 117 lodert die Argumentation des Richters in einem antikommunistischen Manifest:
Die Wirksamkeit des Marxismus-Leninismus beruht nicht auf seiner Theorie. Die Selbsttäuschung des dialektischen Materialismus, die Widersprüche in der Entwicklungslehre und die falschen Erwartungen vom vergesellschafteten Eigentum können durch die jahrzehntelange wissenschaftliche Kritik als widerlegt gelten. Aber der Marxismus-Leninismus lebt trotzdem weiter in den Herzen und im Geist von Millionen von Menschen. Daher hat sein Auftreten nicht allein negative Bedeutung. Der Marxismus-Leninismus ist das notwendige Ergebnis einer Welt, die sich weitgehend säkularisiert hat und dem Nihilismus verfallen ist. Er ist die quälende Frage an Europa, die Vermassung und den Kulturverfall aufzuhalten, den Menschen neu zu ordnen und die soziale Frage in einer eigenen europäischen Gestalt der freiheitlichen und sozialen Demokratie zu lösen.
Solange Europa keine positive Antwort auf die Pläne des europäischen Widersachers in der Gestalt des Marxismus-Leninismus entgegenzusetzen hat, wird es den zielbewussten und zentralgesteuerten Kommunismus nicht überwinden können. Negative Kräfte fürchtet er nicht. Nur vor positiven Erkenntnissen und Handlungen schreckt er zurück.
Droht das Wort des irischen Dichters W. B. Yeats Wirklichkeit zu werden? „Die Dinge fallen auseinander, die Mitte kann sie nicht zusammenhalten. Den Besten mangelt es an Überzeugung, während die Schlimmsten voll Leidenschaft und Feuer sind.“[7]
Die Schlimmsten: Das sind die von der KPD. Todesreiter einer extrakulturellen Macht? Manches in dem Aufruf des Richters zur Rettung des Abendlandes erinnert an die Appelle, die 60 Jahre später zur Rettung der freien Welt vor dem Islam verbreitet werden sollten. Das Gutachten des Richters Stein brachte das Verfahren mit dem Aktenzeichen 1BvB 2/51 auf eine ganz neue Ebene: Das war kein Rechtsfall mehr, hier ging es um einen Krieg der Welten.
Voller Fleiß hat der einstige Wiesbadener Kultusminister dann vollständig zusammengetragen, was draußen in der Welt in diesem Krieg gegen die kommunistische Gefahr bereits alles unternommen wird:
XVI. Die Abwehr des Kommunismus
Die Abwehr mit geistigen und geistlichen MittelnDie Abwehr mit polizeilichen und gesetzgeberischen MittelnUnd so weiter. Es war ja nicht so, dass hier ein Kulturpolitiker aus der hessischen Provinz plötzlich ausgerastet wäre – Stein lag mit seinem Appell voll auf der Höhe des Zeitgeistes im aufblühenden Deutschland der Adenauer-Ära. Die Frühlingsblüte der jungen Freiheit hatte in den frühen Fünfzigern das vom letzten großen Krieg zermürbte Volk des Grundgesetzes kaum erfrischt, da lag schon wieder Gewitterstimmung über dem Land. Schwül drückte das Unbehagen der neuen Zeit auf das Gemüt selbst gutwilliger Demokraten. Die alten Werte galten nicht mehr – und neue? Neue waren noch nicht gefunden. Was war denn das für eine Grundordnung, von der da im Grundgesetz die Rede war? In der neuen Unübersichtlichkeit galt es vom Alten, Bewährten, zu retten, was nicht in Trümmern lag.
Zeitgeschichtler haben in den letzten Jahren viel geforscht[8] über dieses Fünfzigerjahre-Gemisch aus Angst vor dem Neuen und hoffnungsvoller Hinwendung an die guten alten Zeiten, als es Hitler noch nicht gab – dem allerdings auch 1959 noch immer 41 Prozent der Westdeutschen zubilligten, vom Krieg mal abgesehen »einer der größten Staatsmänner« gewesen zu sein.[9] Der Freiburger Historiker Ulrich Herbert beschreibt die große Orientierungslosigkeit, die im jungen Staat des Grundgesetzes herrschte: Die Menschen erlebten den »Verlust von Familie, Vaterland, Nation, Abendland, Autorität sowie sozialer und geschlechtlicher Hierarchie«, panikhaft nahmen sie die neue Zeit als »entfesselte Durchsetzung der modernen Massengesellschaft« wahr.[10] Die Angst vor »Vermassung« schreckte die Überlebenden der bürgerlichen Kuschelkultur des alten Deutschland nachhaltig auf, selbst Intellektuelle wie den Richter Erwin Stein. Der Marxismus-Leninismus wurde da zur quälenden »Frage an Europa, die Vermassung und den Kulturverfall aufzuhalten, den Menschen neu zu ordnen«.[11] Im Weltbild des aufkommenden deutschen Bürgertums war Ordnung ein Wert an sich gewesen – der Zeitgeschichtler Herbert registriert »Beschwörungen traditioneller Bürgerlichkeit, die mit autoritären Staatsvorstellungen und Visionen der Bändigung und Organisation der Massen einhergingen«. Die Ideen vom guten alten Deutschland richteten sich, so Herbert, »gegen Versuche der Ausweitung der institutionalisierten Demokratie zu einer breiteren gesellschaftlichen Partizipation«.[12] Es war das gute alte Deutschland, das sich vom Kaiserreich nicht trennen konnte und schon die Weimarer Republik so lange sabotierte, bis sie endlich kaputt war. Es war das Bürgertum der Weimarer Republik, das der Publizist und Literat Kurt Tucholsky in seinen »Glaubenssätzen der Bourgeoisie« schon 1928 karikierte:
»Wenn man Rhabarber nachzuckert, wird er sauer.«»Bei Gewitter muss man den Gashahn zudrehn.«»Kommunismus ist, wenn alles kurz und klein geschlagen wird.«